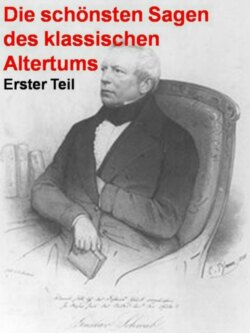Читать книгу Die schönsten Sagen des klassischen Altertums - Erster Teil - Gustav Schwab - Страница 3
Erstes Buch
ОглавлениеErster Teil
Erstes Buch
Prometheus
Himmel und Erde waren geschaffen: das Meer wogte in seinen Ufern, und die Fische spielten darin;
in den Lüften sangen beflügelt die Vögel; der Erdboden wimmelte von Tieren. Aber noch fehlte es an
dem Geschöpfe, dessen Leib so beschaffen war, daß der Geist in ihm Wohnung machen und von ihm
aus die Erdenwelt beherrschen konnte. Da betrat Prometheus die Erde, ein Sprößling des alten
Göttergeschlechtes, das Zeus entthront hatte, ein Sohn des erdgebornen Uranossohnes Iapetos,
kluger Erfindung voll. Dieser wußte wohl, daß im Erdboden der Same des Himmels schlummre;
darum nahm er vom Tone, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und
formte daraus ein Gebilde nach dem Ebenbilde der Götter, der Herren der Welt. Diesen seinen
Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften
und schloß sie in die Brust des Menschen ein. Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin,
Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohnes und blies dem
halbbeseelten Bilde den Geist, den göttlichen Atem ein.
So entstanden die ersten Menschen und füllten bald vervielfältigt die Erde. Lange aber wußten diese
nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend
sahen sie umsonst, hörten hörend nicht; wie Traumgestalten liefen sie umher und wußten sich der
Schöpfung nicht zu bedienen. Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu behauen,
aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem gefällten Holze des Waldes zu zimmern und mit allem
diesem sich Häuser zu erbauen. Unter der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen, wie
von beweglichen Ameisen; nicht den Winter, nicht den blütenvollen Frühling, nicht den
früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren Zeichen; planlos war alles, was sie verrichteten. Da
nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an; er lehrte sie den Auf‐ und Niedergang der Gestirne
beobachten, erfand ihnen die Kunst zu zählen, die Buchstabenschrift; lehrte sie Tiere ans Joch
spannen und zu Genossen ihrer Arbeit brauchen, gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen; erfand
Nachen und Segel für die Schiffahrt. Auch fürs übrige Leben sorgte er den Menschen. Früher, wenn
einer krank wurde, wußte er kein Mittel, nicht was von Speise und Trank ihm zuträglich sei, kannte
kein Salböl zur Linderung seiner Schäden; sondern aus Mangel an Arzneien starben sie elendiglich
dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu
vertreiben. Dann lehrte er sie die Wahrsagerkunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug
und Opferschau. Ferner führte er ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das
Silber und das Gold entdecken; kurz, in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens leitete er sie
ein.
Im Himmel herrschte mit seinen Kindern seit kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront und
das alte Göttergeschlecht, von welchem auch Prometheus abstammte gestürzt hatte.
Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten
Verehrung von ihm für den Schutz, welchen sie demselben angedeihen zu lassen bereitwillig waren.
Zu Mekone in Griechenland ward ein Tag gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen, und
Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als
Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, daß die Götter für die übernommenen Schutzämter den
Sterblichen nicht allzu lästige Gebühren auferlegen möchten. Da verführte den Titanensohn seine
Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier,
davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich davon verlangten. Er hatte aber nach
Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht; auf die eine Seite legte er das Fleisch, das
Eingeweide und den Speck, in die Haut des Stieres zusammengefaßt, und den Magen oben darauf,
auf die andere die kahlen Knochen, künstlich in das Unschlitt des Schlachtopfers eingehüllt. Und
dieser Haufen war der größere. Zeus, der Göttervater, der allwissende, durchschaute seinen Betrug
und sprach: »Sohn des Iapetos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du die Teile
geteilt!« Prometheus glaubte jetzt erst recht, daß er ihn betrogen, lächelte bei sich selbst und sprach:
»Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz im Busen anrät zu
wählen.« Zeus ergrimmte im Herzen, aber geflissentlich faßte er mit beiden Händen das weiße
Unschlitt. Als er es nun auseinandergedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich an, als
entdeckte er jetzt eben erst den Betrug, und zornig sprach er: »Ich sehe wohl, Freund Iapetionide,
daß du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!«
Zeus beschloß, sich an Prometheus für seinen Betrug zu rächen, und versagte den Sterblichen die
letzte Gabe, die sie zur vollendeteren Gesittung bedurften, das Feuer. Doch auch dafür wußte der
schlaue Sohn des Iapetos Rat. Er nahm den langen Stengel des markigen Riesenfenchels, näherte sich
mit ihm dem vorüberfahrenden Sonnenwagen und setzte so den Stengel in glostenden Brand. Mit
diesem Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde, und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel.
In innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhinleuchtenden Glanz des Feuers unter
den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, da des Feuers Gebrauch den Sterblichen nicht
mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott
Hephaistos mußte ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen; Athene selbst, die, auf
Prometheus eifersüchtig, ihm abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes
Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen
geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde,
die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zulieb kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten
herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, mußte dem holden Gebilde Sprache verleihen und
Aphrodite allen Liebreiz. Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel
geschaffen; er nannte das Mägdlein Pandora, das heißt die Allbeschenkte, denn jeder der
Unsterblichen hatte ihr irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben. Darauf
führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern
lustwandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu
Epimetheus, dem argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen.
Vergebens hatte diesen der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Herrscher
anzunehmen, damit dem Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort
zurückzusenden. Epimetheus, dieses Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden
auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen,
von seinem Bruder beraten, frei vom Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit. Das
Weib aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei
Epimetheus angekommen, schlug sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar
von Übeln und verbreitete sich mit Blitzesschnelle über die Erde. Ein einziges Gut war zuunterst in
dem Fasse verborgen, die Hoffnung; aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel
wieder zu, ehe sie herausflattern konnte, und verschloß sie für immer in dem Gefäß. Das Elend füllte
inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter
den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben; eine
Schar von Fiebern hielt die Erde belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen
beschleichend, beflügelte seinen Schritt.
Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem
Hephaistos und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia (dem Zwang und der Gewalt). Diese mußten
ihn in die skythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine
Felswand des Berges Kaukasus mit unauflöslichen Ketten schmieden. Ungerne vollzog Hephaistos
den Auftrag seines Vaters, er liebte in dem Titanensohne den verwandten Abkömmling seines
Urgroßvaters Uranos, den ebenbürtigen Göttersprößling. Unter mitleidsvollen Worten und von den
roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen. So mußte nun
Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie
zu beugen. »Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden«, sagte Hephaistos zu ihm,
»denn des Zeus Sinn ist unerbittlich, und alle, die erst seit kurzem die Herrschergewalt an sich
gerissen [Zeus hatte den Kronos (Saturn), seinen Vater, und mit ihm die alten Götterdynastie gestürzt
und sich des Olymps mit Gewalt bemächtigt. Iapetos und Kronos waren Brüder, Prometheus und
Zeus Geschwisterkinder]. , sind hartherzig.« Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder
doch dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und
Meereswellen, die Allmutter Erde und den allschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein
aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes. »Was das Schicksal beschlossen hat«, sprach er, »muß
derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat.« Auch ließ
er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, daß dem Götterherrscher
durch einen neuen Ehebund [Mit der Thetis] Verderben und Untergang bevorstehe, näher
auszudeuten. Zeus hielt Wort; er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner
Leber zehren durfte, die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Diese Qual sollte nicht eher
aufhören, bis ein Ersatzmann erscheinen würde, der durch freiwillige Übernahme des Todes
gewissermaßen sein Stellvertreter zu werden sich erböte.
Jener Zeitpunkt erschien früher, als der Verurteilte nach dem Spruch des Göttervaters erwarten
durfte. Als er viele Jahre an dem Felsen gehangen, kam Herakles des Weges, auf der Fahrt nach den
Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen. Wie er den Götterenkel am Kaukasus hängen sah und sich
seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, denn er sah zu, wie der Adler, auf
den Knien des Prometheus sitzend, an der Leber des Unglücklichen fraß. Da legte er Keule und
Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den Pfeil und schoß den grausamen Vogel von
der Leber des Gequälten hinweg. Hierauf löste er seine Fesseln und führte den Befreiten mit sich
davon. Damit aber Zeus' Bedingung erfüllt würde, stellte er ihm als Ersatzmann den Zentauren
Chiron, der erbötig war, an jenes Statt zu sterben; denn vorher war er unsterblich. Auf daß jedoch
des Kroniden Urteil, der den Prometheus auf weit längere Zeit an den Felsen gesprochen hatte, auch
so nicht unvollzogen bliebe, so mußte Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an
welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasusfelsen befand. So konnte sich Zeus rühmen, daß sein
Feind noch immer an den Kaukasus angeschmiedet lebe.
Die Menschenalter
Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten,
solange Kronos (Saturnus) dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbst ähnlich, von
Arbeit und Kummer entfernt. Auch die Leiden des Alters waren ihnen unbekannt; an Händen, Füßen
und allen Gliedern immer rüstig, freuten sie sich, von jeglichem Übel frei, heiterer Gelage. Die seligen
Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herden. Wenn sie
verscheiden sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. Solange sie aber lebten, hatten sie alle
möglichen Güter; das Erdreich gewährte ihnen alle Früchte von selbst und im Überflusse, und ruhig,
mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagewerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschlusse
des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern,
welche, dicht in Nebel gehüllt, die Erde rings durchwandelten, als Geber alles Guten, Behüter des
Rechts und Rächer aller Vergehungen.
Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das silberne; dieses war schon
weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestaltung noch an Gesinnung. Sondern
ganze hundert Jahre wuchs der verzärtelte Knabe noch unmündig an Geist unter der mütterlichen
Pflege im Elternhause auf, und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm
nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neuen Menschen in
Jammer; denn sie konnten schon ihre Leidenschaften nicht mehr mäßigen und frevelten im
Übermute gegeneinander. Auch die Altäre der Götter wollten sie nicht mehr mit den gebührenden
Opfern ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg; denn ihm gefiel
nicht, daß sie der Ehrfurcht gegen die Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht
so entblößt von Vorzügen, daß ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum
Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln.
Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen; das hieß das eherne. Das war auch
dem silbernen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben,
immer einer auf des andern Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es, von den Früchten des Feldes
zu essen, und nährten sich vom Tierfleische; ihr Starrsinn war hart wie Diamant, ihr Leib von
ungeheurem Gliederbau; Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahekommen
durfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz, mit Erz bestellten sie das Feld; denn Eisen war damals
noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigenen Hände gegeneinander; aber so groß und entsetzlich
sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den schwarzen Tod und stiegen, vom hellen
Sonnenlichte scheidend, in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder.
Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn des Kronos, ein viertes
Geschlecht hervor, das auf der nährenden Erde wohnen sollte. Dies war wieder edler und gerechter
als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorwelt auch Halbgötter
genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie Zwietracht und Krieg, die einen vor den sieben Toren
Thebens, wo sie um das Reich des Königes Ödipus kämpften, die andern auf dem Gefilde Trojas,
wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr
Erdenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande
des Weltalls an, im Ozean, auf den Inseln der Seligen. Dort führen sie nach dem Tode ein glückliches
und sorgenfreies Leben, wo ihnen der fruchtbare Boden dreimal im Jahr honigsüße Früchte zum
Labsal emporsendet.
»Ach wäre ich«, so seufzet der alte Dichter Hesiod, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt,
»wäre ich doch nicht ein Genosse des fünften Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist; wäre
ich früher gestorben oder später geboren! denn dieses Menschengeschlecht ist ein eisernes!
Gänzlich verderbt, ruhen diese Menschen weder bei Tage noch bei Nacht von Kümmernis und
Beschwerden; immer neue nagende Sorgen schicken ihnen die Götter. Sie selbst aber sind die größte
Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht hold; der Gast haßt den ihn bewirtenden
Freund, der Genosse den Genossen; auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie
vorzeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt, Schmachreden werden
gegen sie ausgestoßen, Mißhandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denket ihr
denn gar nicht an das Göttergericht, daß ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht
erstatten wollet? Überall gilt nur das Faustrecht; auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander.
Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist, nein, nur den
Übeltäter, den schnöden Frevler ehren sie; Recht und Mäßigung gilt nichts mehr, der Böse darf den
Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, Falsches beschwören. Deswegen sind diese
Menschen auch so unglücklich. Schadenfrohe, mißlaunige Scheelsucht verfolgt sie und grollt ihnen
mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen der Scham und der heiligen Scheu, welche sich
bisher doch noch auf der Erde hatten blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönen Leib in das
weiße Gewand und verlassen die Menschen, um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter
zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen blieb nichts als das traurige Elend zurück, und
keine Rettung von diesem Unheil ist zu erwarten.«
Deukalion und Pyrrha
Als das eherne Menschengeschlecht auf Erden hauste und Zeus, dem Weltbeherrscher, schlimme
Sage von seinen Freveln zu Ohren gekommen, beschloß er, selbst in menschlicher Bildung die Erde zu
durchstreifen. Aber allenthalben fand er das Gerücht noch geringer als die Wahrheit. Eines Abends in
später Dämmerung trat er unter das ungastliche Obdach des Arkadierkönigs Lykaon, welcher durch
Wildheit berüchtigt war. Er ließ durch einige Wunderzeichen merken, daß ein Gott gekommen sei;
und die Menge hatte sich auf die Knie geworfen. Lykaon jedoch spottete über diese frommen
Gebete. »Laßt uns sehen«, sprach er, »ob es ein Sterblicher oder ein Gott sei!« Damit beschloß er im
Herzen, den Gast um Mitternacht, wenn der Schlummer auf ihm lastete, mit ungeahntem Tode zu
verderben. Noch vorher aber schlachtete er einen armen Geisel, den ihm das Volk der Molosser
gesandt hatte, kochte die halb lebendigen Glieder in siedendem Wasser oder briet sie am Feuer und
setzte sie dem Fremdling zum Nachtmahle auf den Tisch. Zeus, der alles durchschaut hatte, fuhr vom
Mahle empor und sandte die rächende Flamme über die Burg des Gottlosen. Bestürzt entfloh der
König ins freie Feld. Der erste Wehlaut, den er ausstieß, war ein Geheul, sein Gewand wurde zu
Zotteln, seine Arme wurden zu Beinen: er war in einen blutdürstigen Wolf verwandelt.
Zeus kehrte in den Olymp zurück, hielt mit den Göttern Rat und gedachte das ruchlose
Menschengeschlecht zu vertilgen. Schon wollte er auf alle Länder die Blitze verstreuen; aber die
Furcht, der Äther möchte in Flammen geraten und die Achse des Weltalls verlodern, hielt ihn ab. Er
legte die Donnerkeile, welche ihm die Zyklopen geschmiedet, wieder beiseite und beschloß, über die
ganze Erde Platzregen vom Himmel zu senden und so unter Wolkengüssen die Sterblichen
aufzureiben. Auf der Stelle ward der Nordwind samt allen andren die Wolken verscheuchenden
Winden in die Höhlen des Äolos verschlossen und nur der Südwind von ihm ausgesendet. Dieser flog
mit triefenden Schwingen zur Erde hinab, sein entsetzliches Antlitz bedeckte pechschwarzes Dunkel,
sein Bart war schwer von Gewölk, von seinem weißen Haupthaare rann die Flut, Nebel lagerten auf
der Stirne, aus dem Busen troff ihm das Wasser. Der Südwind griff an den Himmel, faßte mit der
Hand die weit umherhangenden Wolken und fing an, sie auszupressen. Der Donner rollte, gedrängte
Regenflut stürzte vom Himmel; die Saat beugte sich unter dem wogenden Sturm, darnieder lag die
Hoffnung des Landmanns, verdorben war die langwierige Arbeit des ganzen Jahres. Auch Poseidon,
des Zeus Bruder, kam ihm bei dem Zerstörungswerke zu Hilfe, berief alle Flüsse zusammen und
sprach: »Laßt euren Strömungen alle Zügel schießen, fallt in die Häuser, durchbrechet die Dämme!«
Sie vollführten seinen Befehl, und Poseidon selbst durchstach mit seinem Dreizack das Erdreich und
schaffte durch Erschütterung den Fluten Eingang. So strömten die Flüsse über die offene Flur hin,
bedeckten die Felder, rissen Baumpflanzungen, Tempel und Häuser fort. Blieb auch wo ein Palast
stehen, so deckte doch bald das Wasser seinen Giebel, und die höchsten Türme verbargen sich im
Strudel. Meer und Erde waren bald nicht mehr unterschieden; alles war See, gestadelose See. Die
Menschen suchten sich zu retten, so gut sie konnten; der eine erkletterte den höchsten Berg, der
andere bestieg einen Kahn und ruderte nun über das Dach seines versunkenen Landhauses oder über
die Hügel seiner Weinpflanzungen hin, daß der Kiel an ihnen streifte. In den Ästen der Wälder
arbeiteten sich die Fische ab; den Eber, den eilenden Hirsch erjagte die Flut; ganze Völker wurden
vom Wasser hinweggerafft, und was die Welt verschonte, starb den Hungertod auf den unbebauten
Heidegipfeln.
Ein solcher hoher Berg ragte noch mit zwei Spitzen im Lande Phokis über die alles bedeckende
Meerflut hervor. Es war der Parnassos. An ihm schwamm Deukalion, des Prometheus Sohn, den
dieser gewarnt und ihm ein Schiff erbaut hatte, mit seiner Gattin Pyrrha im Nachen heran. Kein
Mann, kein Weib war je erfunden worden, die an Rechtschaffenheit und Götterscheu diese beiden
übertroffen hätten. Als nun Zeus, vom Himmel herabschauend, die Welt von stehenden Sümpfen
überschwemmt und von den vielen tausendmal Tausenden nur ein einziges Menschenpaar übrig sah,
beide unsträflich, beide andächtige Verehrer der Gottheit, da sandte er den Nordwind aus, sprengte
die schwarzen Wolken und hieß ihn die Nebel entführen; er zeigte den Himmel der Erde und die Erde
dem Himmel wieder. Auch Poseidon, der Meeresfürst, legte den Dreizack nieder und besänftigte die
Flut. Das Meer erhielt wieder Ufer, die Flüsse kehrten in ihr Bett zurück; Wälder streckten ihre mit
Schlamm bedeckten Baumwipfel aus der Tiefe hervor, Hügel folgten, endlich breitete sich auch
wieder ebenes Land aus, und zuletzt war die Erde wieder da.
Deukalion blickte um sich. Das Land war verwüstet und in Grabesstille versenkt. Tränen rollten bei
diesem Anblick über seine Wangen, und er sprach zu seinem Weibe Pyrrha: »Geliebte, einzige
Lebensgenossin! Soweit ich in die Länder schaue, nach allen Weltgegenden hin, kann ich keine
lebende Seele entdecken. Wir zwei bilden miteinander das Volk der Erde, alle andren sind in der
Wasserflut untergegangen. Aber auch wir sind unsres Lebens noch nicht mit Gewißheit sicher. Jede
Wolke, die ich sehe, erschreckt meine Seele noch. Und wenn auch alle Gefahr vorüber ist, was fangen
wir Einsamen auf der verlassenen Erde an? Ach, daß mich mein Vater Prometheus die Kunst gelehrt
hätte, Menschen zu erschaffen und geformtem Tone Geist einzugießen!« So sprach er, und das
verlassene Paar fing an zu weinen; dann warfen sie vor einem halb zerstörten Altar der Göttin Themis
sich auf die Knie nieder und begannen zu der Himmlischen zu flehen: »Sag uns an, o Göttin, durch
welche Kunst stellen wir unser untergegangenes Menschengeschlecht wieder her? O hilf der
versunkenen Welt wieder zum Leben!«
»Verlasset meinen Altar«, tönte die Stimme der Göttin, »umschleiert euer Haupt, löset eure
gegürteten Glieder und werfet die Gebeine eurer Mutter hinter den Rücken.«
Lange verwunderten sich beide über diesen rätselhaften Götterspruch. Pyrrha brach zuerst das
Schweigen. »Verzeih mir, hohe Göttin«, sprach sie, »wenn ich zusammenschaudre, wenn ich dir nicht
gehorsame und meiner Mutter Schatten nicht durch Zerstreuung ihrer Gebeine kränken will!« Aber
dem Deukalion fuhr es durch den Geist wie ein Lichtstrahl. Er beruhigte seine Gattin mit dem
freundlichen Worte: »Entweder trügt mich mein Scharfsinn, oder die Worte der Götter sind fromm
und verbergen keinen Frevel! Unsere große Mutter, das ist die Erde, ihre Knochen sind die Steine;
und diese, Pyrrha, sollen wir hinter uns werfen!«
Beide mißtrauten indessen dieser Deutung noch lange. Jedoch, was schadet die Probe, dachten sie.
So gingen sie denn seitwärts, verhüllten ihr Haupt, entgürteten ihre Kleider und warfen, wie ihnen
befohlen war, die Steine hinter sich. Da ereignete sich ein großes Wunder: das Gestein begann seine
Härtigkeit und Spröde abzulegen, wurde geschmeidig, wuchs, gewann eine Gestalt; menschliche
Formen traten an ihm hervor, doch noch nicht deutlich, sondern rohen Gebilden oder einer in
Marmor vom Künstler erst aus dem Groben herausgemeißelten Figur ähnlich. Was jedoch an den
Steinen Feuchtes oder Erdichtes war, das wurde zu Fleisch an dem Körper; das Unbeugsame, Feste
ward in Knochen verwandelt; das Geäder in den Steinen blieb Geäder. So gewannen mit Hilfe der
Götter in kurzer Frist die vom Manne geworfenen Steine männliche Bildung, die vom Weibe
geworfenen weibliche.
Diesen seinen Ursprung verleugnet das menschliche Geschlecht nicht, es ist ein hartes Geschlecht
und tauglich zur Arbeit. Jeden Augenblick erinnert es daran, aus welchem Stamm es erwachsen ist.
Io
Inachos, der uralte Stammfürst und König der Pelasger, hatte eine bildschöne Tochter mit Namen Io.
Auf sie war der Blick des Zeus, des olympischen Herrschers, gefallen, als sie auf der Wiese von Lerna
der Herden ihres Vaters pflegte. Der Gott ward von Liebe zu ihr entzündet, trat zu ihr in
Menschengestalt und fing an, sie mit verführerischen Schmeichelworten zu versuchen: »O Jungfrau,
glücklich ist, der dich besitzen wird; doch ist kein Sterblicher deiner wert, und du verdientest des
höchsten Gottes Braut zu sein! Wisse denn, ich bin Zeus. Fliehe nicht vor mir. Die Hitze des Mittags
brennt heiß. Tritt mit mir in den Schatten des erhabenen Haines, der uns dort zur Linken in seine
Kühle einlädt; was machst du dir in der Glut des Tages zu schaffen? Fürchte dich doch nicht, den
dunklen Wald und die Schluchten, in welchen das Wild hauset, zu betreten. Bin doch ich da, dich zu
schirmen, der Gott, der den Zepter des Himmels führt und die zackigen Blitze über den Erdboden
versendet.« Aber die Jungfrau floh vor dem Versucher mit eiligen Schritten, und sie wäre ihm auf den
Flügeln der Angst entkommen, wenn der verfolgende Gott seine Macht nicht mißbraucht und das
ganze Land in Finsternis gehüllt hätte. Rings umqualmte die Fliehende der Nebel, und bald waren
ihre Schritte gehemmt durch die Furcht, an einen Felsen zu rennen oder in einen Fluß zu stürzen. So
kam die unglückliche Io in die Gewalt des Gottes.
Hera, die Göttermutter, war längst an die Treulosigkeit ihres Gatten gewöhnt, der sich von ihrer
Liebe ab‐ und den Töchtern der Halbgötter und der Sterblichen zuwandte; aber sie vermochte ihren
Zorn und ihre Eifersucht nicht zu bändigen, und mit immer wachem Mißtrauen beobachtete sie alle
Schritte des Gottes auf der Erde. So schaute sie auch jetzt gerade auf die Gegenden hernieder, wo ihr
Gemahl ohne ihr Wissen wandelte. Zu ihrem großen Erstaunen bemerkte sie plötzlich, wie der
heitere Tag auf einer Stelle durch nächtlichen Nebel getrübt wurde und wie dieser weder einem
Strome noch dem dunstigen Boden entsteige, noch sonst von einer natürlichen Ursache herrühre. Da
kam ihr schnell ein Gedanke an die Untreue ihres Gatten; sie spähte rings durch den Olymp und sah
ihn nicht. »Entweder ich täusche mich«, sprach sie ergrimmt zu sich selbst, »oder ich werde von
meinem Gatten schnöde gekränkt!« Und nun fuhr sie auf einer Wolke vom hohen Äther zur Erde
hernieder und gebot dem Nebel, der den Entführer mit seiner Beute umschlossen hielt, zu weichen.
Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen,
verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh. Aber
auch so war die Holdselige noch schön geblieben. Hera, welche die List ihres Gemahls alsbald
durchschaut hatte, pries das stattliche Tier und fragte, als wüßte sie nichts von der Wahrheit, wem
die Kuh gehöre, von wannen und welcherlei Zucht sie sei. Zeus, in der Not und um sie von weiterer
Nachfrage abzuschrecken, nahm seine Zuflucht zu einer Lüge und gab vor, die Kuh entstamme der
Erde. Hera gab sich damit zufrieden, aber sie bat sich das schöne Tier von ihrem Gemahl zum
Geschenke aus. Was sollte der betrogene Betrüger machen? Gibt er die Kuh her, so wird er seiner
Geliebten verlustig; verweigert er sie, so erregt er erst recht den Verdacht seiner Gemahlin, welche
der Unglücklichen dann rasches Verderben senden wird! So entschloß er sich denn, für den
Augenblick auf die Jungfrau zu verzichten, und schenkte die schimmernde Kuh, die er noch immer für
unentdeckt hielt, seiner Gemahlin. Hera knüpfte, scheinbar beglückt durch die Gabe, dem schönen
Tier ein Band um den Hals und führte die Unselige, der ein verzweifelndes Menschenherz unter der
Tiergestalt schlug, im Triumphe davon. Doch machte der Göttin dieser Diebstahl selbst Angst, und sie
ruhte nicht, bis sie ihre Nebenbuhlerin der sichersten Hut überantwortet hatte. Daher suchte sie den
Argos, den Sohn des Arestor, auf, ein Ungetüm, das ihr zu diesem Dienste besonders geeignet schien.
Denn Argos hatte hundert Augen im Kopfe, von denen nur ein Paar abwechslungsweise sich schloß
und der Ruhe ergab, während die übrigen alle, über Vorder‐ und Hinterhaupt wie funkelnde Sterne
zerstreut, auf ihrem Posten ausharrten. Diesen gab Hera der armen Io zum Wächter, damit ihr
Gemahl Zeus die entrissene Geliebte nicht entführen könne. Unter seinen hundert Augen durfte Io,
die Kuh, des Tags über auf einer fetten Trift weiden; Argos aber stand in der Nähe, und wo er sich
immer hinstellen mochte, erblickte er die ihm Anvertraute; auch wenn er sich abwandte und ihr das
Hinterhaupt zukehrte, hatte er Io vor Augen. Wenn aber die Sonne untergegangen war, schloß er sie
ein und belastete den Hals der Unglückseligen mit Ketten; bittre Kräuter und Baumlaub waren ihre
Speise, ihr Bett der harte, nicht einmal immer mit Gras bedeckte Boden, ihr Trank schlammige
Pfützen. Io vergaß oft, daß sie kein Mensch mehr war; sie wollte, Mitleiden erflehend, ihre Arme zu
Argos erheben, da ward sie erst daran erinnert, daß sie keine Arme mehr hatte. Sie wollte ihm in
Worten rührende Bitten vortragen, dann entfuhr ihrem Munde ein Brüllen, daß sie vor ihrer eigenen
Stimme erschrak, welche sie daran mahnte, wie sie durch ihres Räubers Selbstsucht in ein Tier
verwandelt worden sei. Doch blieb Argos mit ihr nicht an einer Stelle, denn so hatte es ihn Hera
geheißen, die durch Veränderung ihres Aufenthalts sie dem Gemahl um so gewisser zu entziehen
hoffte. Daher zog ihr Wächter mit ihr im Lande herum, und so kam sie auch mit ihm in ihre alte
Heimat, an das Gestade des Flusses, wo sie so oft als Kind zu spielen gepflegt hatte. Da sah sie zum
ersten Mal ihr Bild in der Flut; als das Tierhaupt mit Hörnern ihr aus dem Wasser entgegenblickte,
schauderte sie zurück und floh bestürzt vor sich selbst. Ein sehnsüchtiger Trieb führte sie in die Nähe
ihrer Schwestern, in die Nähe ihres Vaters Inachos; aber diese erkannten sie nicht; Inachos
streichelte wohl das schöne Tier und reichte ihm Blätter, die er von dem nächsten Strauche pflückte;
Io beleckte dankbar seine Hand und benetzte sie mit Küssen und heimlichen menschlichen Tränen.
Aber wen er liebkoste und von wem er geliebkost wurde, das ahnete der Greis nicht. Endlich kam der
Armen, deren Geist unter der Verwandlung nicht gelitten hatte, ein glücklicher Gedanke. Sie fing an,
Schriftzeichen mit dem Fuße zu ziehen, und erregte durch diese Bewegung die Aufmerksamkeit des
Vaters, der bald im Staube die Kunde las, daß er sein eigenes Kind vor sich habe. »Ich
Unglückseliger«, rief der Greis bei dieser Entdeckung aus, indem er sich an Horn und Nacken der
stöhnenden Tochter hing, »so muß ich dich wiederfinden, die ich durch alle Länder gesucht habe!
Wehe mir, du hast mir weniger Kummer gemacht, solange ich dich suchte, als jetzt, wo ich dich
gefunden habe! Du schweigst? Du kannst mir kein tröstendes Wort sagen, mir nur mit einem Gebrüll
antworten! Ich Tor, einst sann ich darauf, wie ich dir einen würdigen Eidam zuführen könnte, und
dachte nur an Brautfackel und Vermählung. Nun bist du ein Kind der Herde...« Argos, der grausame
Wächter, ließ den jammernden Vater nicht vollenden, er riß Io von dem Vater hinweg und schleppte
sie fort auf einsame Weiden. Dann klomm er selbst einen Berggipfel empor und versah sein Amt,
indem er mit seinen hundert Augen wachsam nach allen vier Winden hinauslugte.
Zeus konnte das Leid der Inachostochter nicht länger ertragen. Er rief seinem geliebten Sohne
Hermes und befahl ihm, seine List zu brauchen und dem verhaßten Wächter das Augenlicht
auszulöschen. Dieser beflügelte seine Füße, ergriff mit der mächtigen Hand seine einschläfernde Rute
und setzte seinen Reisehut auf. So fuhr er von dem Palaste seines Vaters zur Erde nieder. Dort legte
er Hut und Schwingen ab und behielt nur den Stab; so stellte er einen Hirten vor, lockte Ziegen an
sich und trieb sie auf die abgelegenen Fluren, wo Io weidete und Argos die Wache hielt. Dort
angekommen, zog er ein Hirtenrohr, das man Syrinx nennt, hervor und fing an, so anmutig und voll
zu blasen, wie man von irdischen Hirten zu vernehmen nicht gewohnt ist. Der Diener Heras freute
sich dieses ungewohnten Schalles, erhob sich von seinem Felsensitze und rief hernieder: »Wer du
auch sein magst, willkommener Rohrbläser, du könntest wohl bei mir auf diesem Felsen hier
ausruhen. Nirgends ist der Graswuchs üppiger für das Vieh als hier, und du siehst, wie behaglich der
Schatten dieser dicht gepflanzten Bäume für den Hirten ist!« Hermes dankte dem Rufenden, stieg
hinauf und setzte sich zu dem Wächter, mit welchem er eifrig zu plaudern anfing und sich so ernstlich
ins Gespräch vertiefte, daß der Tag herumging, ehe Argos sich dessen versah. Diesem begannen die
Augen zu schläfern, und nun griff Hermes wieder zu seinem Rohre und versuchte sein Spiel, um ihn
vollends in Schlummer zu wiegen. Aber Argos, der an den Zorn seiner Herrin dachte, wenn er seine
Gefangene ohne Fesseln und Obhut ließe, kämpfte mit dem Schlaf, und wenn sich auch der
Schlummer in einen Teil seiner Augen einschlich, so wachte er doch fortdauernd mit dem andern
Teile, nahm sich zusammen, und da die Rohrpfeife erst kürzlich erfunden worden war, so fragte er
seinen Gesellen nach dem Ursprunge dieser Erfindung. »Das will ich dir gerne erzählen«, sagte
Hermes, »wenn du in dieser späten Abendstunde Geduld und Aufmerksamkeit genug hast, mich
anzuhören. In den Schneegebirgen Arkadiens wohnte eine berühmte Hamadryade (Baumnymphe),
mit Namen Syrinx. Die Waldgötter und Satyrn, von ihrer Schönheit bezaubert, verfolgten sie schon
lange mit ihrer Werbung, aber immer wußte sie ihnen zu entschlüpfen. Denn sie scheute das Joch der
Vermählung und wollte, umgürtet und jagdliebend wie Artemis, gleich dieser in jungfräulichem
Stande verharren. Endlich wurde auf seinen Streifereien durch jene Wälder auch der mächtige Gott
Pan der Nymphe ansichtig, näherte sich ihr und warb um ihre Hand, dringend und im stolzen
Bewußtsein seiner Hoheit. Aber die Nymphe verschmähte sein Flehen und flüchtete vor ihm durch
unwegsam Steppen, bis sie zuletzt an das Wasser des versandeten Flusses Ladon kam, dessen Wellen
doch noch tief genug waren, der Jungfrau den Übergang zu wehren. Hier beschwor sie ihre
Schwestern, die Nymphen, ehe sie in die Hand des Gottes fiele, ihrer sich zu erbarmen und sie zu
verwandeln. Indem kam der Gott herangeflogen und umfaßte die am Ufer Zögernde; aber wie
staunte er, als er, statt eine Nymphe zu umarmen, nur ein Schilfrohr umfaßt hielt; seine lauten
Seufzer zogen vervielfältigt durch das Rohr und wiederholten sich mit tiefem, klagendem Gesäusel.
Der Zauber dieses Wohllautes tröstete den getäuschten Gott. »Wohl denn, verwandelte Nymphe«,
rief er mit schmerzlicher Freude, »auch so soll unsre Verbindung unauflöslich sein!« Und nun schnitt
er sich von dem geliebten Schilfe ungleichförmige Röhren, verknüpfte sie mit Wachs untereinander
und nannte die lieblich tönende Flöte nach dem Namen der holden Hamadryade; und seitdem heißt
dieses Hirtenrohr Syrinx...«
So lautete die Erzählung des Götterboten, bei welcher er den hundertäugigen Wächter unausgesetzt
im Auge behielt. Die Märe war noch nicht zu Ende, als er sah, wie ein Auge um das andere sich unter
der Decke geborgen hatte und endlich alle die hundert Leuchten in dichtem Schlaf erloschen waren.
Nun hemmte der Götterbote seine Stimme, berührte mit seinem Zauberstabe nacheinander die
hundert eingeschläferten Augenlider und verstärkte ihre Betäubung. Während nun der
hundertäugige Argos in tiefem Schlafe nickte, griff Hermes schnell zu dem Sichelschwerte, das er
unter seinem Hirtenrocke verborgen trug, und hieb ihm den gesenkten Nacken, da wo der Hals
zunächst an den Kopf grenzt, durch und durch. Kopf und Rumpf stürzten nacheinander vom Felsen
herab und färbten das Gestein mit einem Strome von Blut.
Nun war Io befreit, und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber den
durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine
ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf
durch ihren Stich zum Wahnsinn trieb. Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel
landflüchtig über den ganzen Erdkreis, zu den Skythen, an den Kaukasus, zum Amazonenvolke, zum
Kimmerischen Isthmos und an die Mäotische See; dann hinüber nach Asien, und endlich nach
langem, verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten. Hier am Strande des Nilufers angelangt, sank Io
auf ihre Vorderfüße nieder und hob, den Hals rücklings gebogen, ihre stummen Augen zum Olymp
empor, mit einem Blicke voll Haders gegen Zeus. Den jammerte dieses Anblickes; er eilte zu seiner
Gemahlin Hera, umfing ihren Hals mit den Armen, flehte um Barmherzigkeit für das arme Mädchen,
das schuldlos an seiner Verirrung war, und schwor ihr beim Wasser der Unterwelt, bei dem die
Götter schwören, von seiner Neigung zu ihr hinfort ganz abzulassen. Hera hörte während dieser Bitte
das flehentliche Brüllen der Kuh, das zum Olymp emporstieg. Da ließ sich die Göttermutter
erweichen und gab dem Gemahle Vollmacht, der Mißgestalteten den menschlichen Leib
zurückzugeben. Zeus eilte zur Erde nieder und an den Nil. Hier strich er der Kuh mit der Hand über
den Rücken. Da war es wunderbar anzuschauen: die Zotteln flohen vom Leibe des Tieres, das Gehörn
schrumpfte zusammen, die Scheibe der Augen verengte sich, das Maul zog sich zu Lippen zusammen,
Schultern und Hände kehrten wieder, die Klauen verschwanden, nichts blieb von der Kuh übrig als
die schöne weiße Farbe. In ganz verwandelter Gestalt erhob sich Io vom Boden und stand aufrecht, in
menschlicher Schönheit leuchtend. Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk
die wunderbar Verwandelte und Errettete göttergleich ehrte, so herrschte sie lange mit
Fürstengewalt über jene Lande. Doch blieb sie auch so nicht ganz von Heras Zorne verschont. Diese
stiftete das wilde Volk der Kureten auf, ihren jungen Sohn Epaphos zu entführen, und nun trat sie
aufs neue eine lange vergebliche Wanderung an, den Geraubten aufzusuchen. Endlich, nachdem
Zeus die Kureten mit dem Blitz erschlagen, fand sie den entführten Sohn an der Grenze Äthiopiens
wieder, kehrte mit ihm nach Ägypten zurück und ließ ihn an ihrer Seite herrschen. Er heiratete die
Memphis, und diese gebar ihm Libya, von der das Land Libyen den Namen erhielt. Mutter und Sohn
wurden von dem Nilvolke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten, sie als Isis, er als Apis,
göttliche Verehrung.
Phaëton
Auf herrlichen Säulen erbaut stand die Königsburg des Sonnengottes, von blitzendem Gold und
glühendem Karfunkel schimmernd; den obersten Giebel umschloß blendendes Elfenbein, gedoppelte
Türen strahlten in Silberglanz, darauf in erhabener Arbeit die schönsten Wundergeschichten zu
schauen waren. In diesen Palast trat Phaëthon, der Sohn des Sonnengottes Phöbos, und verlangte
den Vater zu sprechen. Doch stellte er sich nur von ferne hin, denn in der Nähe war das strahlende
Licht nicht zu ertragen. Der Vater Phöbos, von Purpurgewand umhüllt, saß auf seinem fürstlichen
Stuhle, der mit glänzenden Smaragden besetzt war; zu seiner Rechten und seiner Linken stand sein
Gefolge geordnet, der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte und die Horen; der jugendliche
Lenz mit seinem Blütenkranze, der Sommer mit Ährengewinden bekränzt, weinfarben der Herbst,
der eisige Winter mit schneeweißen Haaren. Phöbos, in ihrer Mitte sitzend, wurde mit seinen
allschauenden Augen bald den Jüngling gewahr, der über so viele Wunder staunte. »Was ist der
Grund deiner Wallfahrt«, sprach er, »was führt dich in den Palast deines göttlichen Vaters, mein
Sohn?« Phaëthon antwortete: »Erlauchter Vater, man spottet mein auf Erden und beschimpft meine
Mutter Klymene. Sie sprechen, ich heuchle nur himmlische Abkunft und sei der Sohn eines dunklen
Vaters. Darum komme ich, von dir ein Unterpfand zu erbitten, das mich vor aller Welt als deinen
wirklichen Sprößling darstelle.« So sprach er; da legte Phöbos die Strahlen, die ihm rings das Haupt
umleuchteten, ab und hieß ihn näher herantreten; dann umarmte er ihn und sprach: »Deine Mutter
Klymene hat die Wahrheit gesagt, mein Sohn, und ich werde dich vor der Welt nimmermehr
verleugnen. Damit du aber ja nicht ferner zweifelst, so erbitte dir ein Geschenk! Ich schwöre beim
Styx, dem Flusse der Unterwelt, bei welchem alle Götter schwören, deine Bitte, welche sie auch sei,
soll erfüllt werden!« Phaëthon ließ den Vater kaum ausreden. »So erfülle mir denn«, sprach er,
»meinen glühendsten Wunsch, und vertraue mir nur auf einen Tag die Lenkung deines geflügelten
Sonnenwagens.«
Schrecken und Reue ward sichtbar auf dem Angesichte des Gottes. Drei‐, viermal schüttelte er sein
umleuchtetes Haupt und rief endlich: »O Sohn, du hast mich ein sinnloses Wort sprechen lassen! O
dürfte ich dir doch meine Verheißung nimmermehr gewähren! Du verlangst ein Geschäft, dem deine
Kräfte nicht gewachsen sind; du bist zu jung; du bist sterblich, und was du wünschest, ist ein Werk
der Unsterblichen! Ja, du erstrebest sogar mehr, als den übrigen Göttern zu erlangen vergönnt ist.
Denn außer mir vermag keiner von ihnen auf der glutensprühenden Achse zu stehen. Der Weg, den
mein Wagen zu machen hat, ist gar steil, mit Mühe erklimmt ihn in der Frühe des Morgens mein noch
frisches Rossegespann. Die Mitte der Laufbahn ist zuoberst am Himmel. Glaube mir, wenn ich auf
meinem Wagen in solcher Höhe stehe, da kommt mich oft selbst ein Grausen an, und mein Haupt
droht ein Schwindel zu erfassen, wenn ich so herniederblicke in die Tiefe und Meer und Land weit
unter mir liegt. Zuletzt ist dann die Straße ganz abschüssig, da bedarf es gar sicherer Lenkung. Die
Meeresgöttin Thetis selbst, die mich in ihren Fluten aufzunehmen bereit ist, pflegt alsdann zu
befürchten, ich möchte in die Tiefe geschmettert werden. Dazu bedenke, daß der Himmel sich in
beständigem Umschwunge dreht und ich diesem reißenden Kreislaufe entgegenfahren muß. Wie
vermöchtest du das, wenn ich dir auch meinen Wagen gäbe? Darum, geliebter Sohn, verlange nicht
ein so schlimmes Geschenk und bessere deinen Wunsch, solange es noch Zeit ist. Sieh mein
erschrecktes Gesicht an. O könntest du durch meine Augen in mein sorgenvolles Vaterherz
eindringen! Verlange, was du sonst willst von alle Gütern des Himmels und der Erde! Ich schwöre dir
beim Styx, du sollst es haben! ‐ Was umarmst du mich mit solchem Ungestüm?«
Aber der Jüngling ließ mit Flehen nicht ab, und der Vater hatte den heiligen Schwur geschworen. So
nahm er denn seinen Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen, Hephaistos' herrlicher
Arbeit. Achse, Deichsel und der Kranz der Räder waren von Gold, die Speichen Silber; vom Joche
schimmerten Chrysolithen und Juwelen. Während Phaëthon die herrliche Arbeit beherzt anstaunte,
tat im geröteten Osten die erwachte Morgenröte ihr Purpurtor und ihren Vorsaal, der voll Rosen ist,
auf. Die Sterne verschwanden allmählich, der Morgenstern ist der letzte, der seinen Posten am
Himmel verläßt, und die äußersten Hörner des Mondes verlieren sich am Rande. Jetzt gibt Phöbos
den geflügelten Horen den Befehl, die Rosse zu schirren; und diese führen die glutsprühenden Tiere,
von Ambrosia gesättigt, von den erhabenen Krippen und legen ihnen herrliche Zäume an. Während
dies geschah, bestrich der Vater das Antlitz seines Sohnes mit einer heiligen Salbe und machte es
dadurch geschickt, die glühende Flamme zu ertragen. Um das Haupthaar legte er ihm seine
Strahlensonne, aber er seufzte dazu und sprach warnend: »Kind, schone mir die Stacheln, brauche
wacker die Zügel; denn die Rosse rennen schon von selbst, und es kostet Mühe, sie im Fluge zu
halten; die Straße geht schräg in weit umbiegender Krümmung; den Südpol wie den Nordpol mußt
du meiden. Du erblickst deutlich die Gleise der Räder. Senke dich nicht zu tief, sonst gerät die Erde in
Brand; steige nicht zu hoch, sonst verbrennst du den Himmel. Auf, die Finsternis flieht, nimm die
Zügel zur Hand; oder ‐ noch ist es Zeit; besinne dich, liebes Kind; überlaß den Wagen mir, laß mich
der Welt das Licht schenken, und bleibe du Zuschauer!«
Der Jüngling schien die Worte des Vaters gar nicht zu hören, er schwang sich mit einem Sprung auf
den Wagen, ganz erfreut, die Zügel in den Händen zu haben, und nickte dem unzufriedenen Vater
einen kurzen, freundlichen Dank zu. Mittlerweile füllten die vier Flügelrosse mit glutatmendem
Wiehern die Luft, und ihr Huf stampfte gegen die Barren. Ohne etwas vom Lose ihres Enkels zu
ahnen, öffnete Thetis, die Mutter Klymenes, die Schranken; die Welt lag in unendlichem Raume vor
den Blicken des Knaben, die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor
ihnen lagen.
Inzwischen fühlten die Rosse wohl, daß sie nicht die gewohnte Last trugen und das Joch leichter sei
als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meere schwanken, so
machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch emporgestoßen und rollte dahin, als wäre er leer.
Als das Rossegespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, und lief nicht mehr
in der vorigen Ordnung. Phaëthon fing an zu erbeben, er wußte nicht, wohin die Zügel lenken, wußte
den Weg nicht, wußte nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte. Als nun der Unglückliche hoch
vom Himmel abwärts sah, auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blaß, und
seine Knie zitterten von plötzlichem Schrecken. Er sah rückwärts; schon lag viel Himmel hinter ihm,
aber noch mehr vor seinen Augen. Beides ermaß er in seinem Geiste. Unwissend, was beginnen,
starrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte den Rossen
rufen, aber er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen sah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in
abenteuerlichen Gestalten am Himmel herumhingen. Da ließ er, von kaltem Entsetzen gefaßt, die
Zügel fahren, und wie diese herabschlotternd den Rücken der Pferde berührten, so verließen die
Rosse ihre Spur, schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief
hernieder; jetzt stießen sie an den Fixsternen an, jetzt wurden sie auf abschüssigem Pfade in die
Nachbarschaft der Erde herabgerissen. Schon berührten sie die erste Wolkenschicht, die bald
entzündet aufdampfte. Immer tiefer stürzte der Wagen, und unversehens war er einem Hochgebirge
nahe gekommen. Da lechzte vor Hitze der Boden, spaltete sich, und weil plötzlich alle Säfte
austrockneten, fing er an zu glimmen; das Heidegras wurde weißgelb und welkte hinweg; weiter
unten loderte das Laub der Waldbäume auf, bald war die Glut bei der Ebene angekommen; nun
wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loderten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung
wurden versengt; rings brannten Hügel, Wälder und Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz
geworden sein. Die Ströme versiegten oder flohen erschreckt nach ihrer Quelle zurück, das Meer
selbst wurde zusammengedrängt, und was jüngst noch See war, wurde trockenes Sandfeld.
An allen Seiten sah Phaëthon den Erdkreis entzündet; ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich;
wie tief aus dem Innern einer Feueresse atmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen,
wie der Wagen erglühte. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte
Asche nicht mehr ertragen; Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann riß ihn
nach Willkür fort; endlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend
wurde er durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu
schießen scheint. Ferne von der Heimat nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bespülte ihm
sein schäumendes Angesicht. Phöbos, der Vater, der dies alles mit ansehen mußte, verhüllte sein
Haupt in brütender Trauer. Damals, sagt man, sei ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht
vorübergeflogen. Der ungeheure Brand leuchtete allein.
Europa
Im Lande Tyrus und Sidon erwuchs die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen
Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes. Zu dieser ward nachmitternächtlicherweile, wo
untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es
kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der gegenüberliegende, und
stritten um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden; die andere ‐ und dies
war Asien ‐ glich an Aussehen und Gebärde einer Einheimischen. Diese wehrte sich mit zärtlichem
Eifer für ihr Kind Europa, sprechend, daß sie es sei, welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt
hätte. Das fremde Weib aber umfaßte sie wie einen Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich
fort, ohne daß Europa im Innern zu widerstreben vermochte. »Komm nur mit mir, Liebchen«, sprach
die Fremde, »ich trage dich als Beute dem Ägiserschütterer Zeus entgegen; so ist dir's vom Geschicke
beschieden.« Mit klopfendem Herzen erwachte Europa und richtete sich vom Lager auf, denn das
Nachtgesicht war hell wie ein Anblick des Tages gewesen. Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht im
Bette, vor sich hinstarrend, und vor ihren weit aufgetanen Augensternen standen noch die beiden
Weiber. Erst spät öffneten sich ihre Lippen zum bangen Selbstgespräche: »Welcher Himmlische«,
sprach sie, »hat mir diese Bilder zugeschickt? Was für wunderbare Träume haben mich
aufgeschreckt, die ich im Vaterhause süß und sicher schlummerte? Wer war doch die Fremde, die ich
im Traume gesehen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr regt sich in meinem Herzen? Und
wie ist sie selbst mir so liebreich entgegengekommen, und auch als sie mich gewaltsam entführte,
mit welchem Mutterblicke hat sie mich angelächelt! Mögen die seligen Götter mir den Traum zum
besten kehren!«
Der Morgen war herangekommen; der helle Tagesschein vermischte den nächtlichen Schimmer des
Traumes aus der Seele der Jungfrau, und Europa erhub sich zu den Beschäftigungen und Freuden
ihres jungfräulichen Lebens. Bald sammelten sich um sie ihre Altergenossinnen und Gespielinnen,
Töchter der ersten Häuser, welche sie zu Chortänzen, Opfern und Lustgesängen zu begleiten
pflegten. Auch jetzt kamen sie, ihre Herrin zu einem Gange nach den blumenreichen Wiesen des
Meeres einzuladen, wo sich die Mädchen der Gegend scharenweise zu versammeln und am üppigen
Wuchse der Blumen und am rauschenden Halle des Meeres zu erfreuen pflegten. Alle Mädchen
führten einen Korb zum Blumensammeln in den Händen. Europa selbst trug einen goldenen Korb,
geschmückt mit glänzenden Bildern aus der Göttersage; er war ein Werk des Hephaistos, ein uraltes
Göttergeschenk des Erderschütterers Poseidon, das dieser der Libya geschenkt hatte, als er um sie
warb. Aus ihrem Besitze war es von Hand zu Hand als Erbstück in das Haus des Agenor gekommen.
Mit diesem Brautschmuck angetan, eilte die holdselige Europa an der Spitze ihrer Gespielinnen den
Meereswiesen zu, die voll der buntesten Blumen standen. Jubelnd zerstreute sich die Schar der
Mädchen da‐ und dorthin, jede suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem Sinne war. Die eine
pflückte die glänzende Narzisse, die andere wandte sich der Balsam ausströmenden Hyazinthe zu,
eine dritte erwählte sich das sanfter duftende Veilchen, andern gefiel der gewürzige Quendel, wieder
andere brachen den gelben, lockenden Krokus. So flogen die Gespielinnen hin und her; Europa aber
hatte bald ihr Ziel gefunden, sie stand, wie unter den Grazien die schaumgeborne Liebesgöttin, alle
ihre Genossinnen überragend, und hielt hoch in der Hand einen vollen Strauß von glühenden Rosen.
Als sie genug Blumen gesammelt, lagerten sich die Jungfrauen, ihre Fürstin in der Mitte, harmlos auf
dem Rasen und fingen an, Kränze zu flechten, die sie, den Nymphen der Wiese zum Dank, an
grünenden Bäumen aufhängen wollten. Aber nicht lange sollten sie ihren Sinn an den Blumen
ergötzen, denn in das sorglose Jugendleben Europas griff unversehens das Schicksal ein, das ihr der
Traum der verschwundenen Nacht geweissagt hatte. Zeus, der Kronide, war von den Geschossen der
Liebesgöttin, die allein auch den unbezwungenen Göttervater zu besiegen vermochten, getroffen
und von der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden. Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen
Hera fürchtete, auch nicht hoffen durfte, den unschuldigen Sinn der Jungfrau zu betören, so sann der
verschlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte seine Gestalt und wurde ein Stier. Aber welch
ein Stier! Nicht, wie er auf gemeiner Wiese geht oder unters Joch gebeugt den schwerbeladenen
Wagen zieht; nein, groß, herrlich von Gestalt, mit schwellenden Muskeln am Halse und vollen
Wampen am Bug; seine Hörner waren zierlich und klein, wie von Händen gedrechselt, und
durchsichtiger als reine Juwelen; goldgelb war die Farbe seines Leibes, nur mitten auf der Stirne
schimmerte ein silberweißes Mal, dem gekrümmten Horne des wachsenden Mondes ähnlich;
bläulichte, von Verlangen funkelnde Augen rollten ihm im Kopfe.
Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm, rief er zu sich auf den Olymp den Hermes und sprach,
ohne ihm etwas von seinen Absichten zu enthüllen: »Spute dich, lieber Sohn, getreuer Vollbringer
meiner Befehle! Siehst du dort unten das Land, das links zu uns emporblickt? Es ist Phönizien; dieses
betritt und treibe mir das Vieh des Königes Agenor, das du auf den Bergtriften weidend finden wirst,
gegen das Meeresufer hinab.« In wenigen Augenblicken war der geflügelte Gott, dem Winke seines
Vaters gehorsam, auf der sidonischen Bergweide angekommen und trieb die Herde des Königes,
unter die sich auch, ohne daß Hermes es geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier gemischt hatte,
vom Berge herab nach dem angewiesenen Strande, eben auf jene Wiesen, wo die Tochter Agenors,
von lyrischen Jungfrauen umringt, sorglos mit Blumen tändelte. Die übrige Herde nun zerstreute sich
über die Wiesen ferne von den Mädchen; nur der schöne Stier, in welchem der Gott verborgen war,
näherte sich dem Rasenhügel, auf welchem Europa mit ihren Gespielinnen saß. Schmuck wandelte er
im üppigen Grase einher, über seiner Stirne schwebte kein Drohen, sein funkelndes Auge flößte keine
Furcht ein, sein ganzes Aussehen war voll Sanftmut. Europa und ihre Jungfrauen bewunderten die
edle Gestalt des Tieres und seine friedlichen Gebärden, ja sie bekamen Lust, ihn recht in der Nähe zu
besehen und ihm den schimmernden Rücken zu streicheln. Der Stier schien dies zu merken, denn er
kam immer näher und stellte sich endlich dicht vor Europa hin. Diese sprang auf und wich anfangs
einige Schritte zurück; als aber das Tier sogar zahm stehenblieb, faßte sie sich ein Herz, näherte sich
wieder und hielt ihm ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus dem sie ein ambrosisches
Atem anwehte. Der Stier leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und die zarte
Jungfrauenhand, die ihm den Schaum abwischte und ihn liebreich zu streicheln begann. Immer
reizender kam der herrliche Stier der Jungfrau vor, ja sie wagte es und drückte einen Kuß auf seine
glänzende Stirne. Da ließ das Tier ein freudiges Brüllen hören, nicht wie andere gemeine Stiere
brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydischen Flöte, die ein Bergtal durchhallt. Dann
kauerte es sich zu den Füßen der schönen Fürstin nieder, blickte sie sehnsüchtig an, wandte ihr den
Nacken zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach Europa zu ihren Freundinnen, den
Jungfrauen: »Kommt doch auch näher, liebe Gespielinnen, daß wir uns auf den Rücken dieses
schönen Stieres setzen und unsere Lust haben; ich glaube, er könnte unserer viere aufnehmen und
beherbergen. Er ist so zahm und sanftmütig anzuschauen, so holdselig; er gleicht gar nicht anderen
Stieren; wahrhaftig, er hat Verstand wie ein Mensch, und es fehlt ihm gar nichts als die Rede!« Mit
diesen Worten nahm sie ihren Gespielinnen die Kränze, einen nach dem andern, aus den Händen und
behängte damit die gesenkten Hörner des Stieres, dann schwang sie sich lächelnd auf seinen Rücken,
während ihre Freundinnen zaudernd und unschlüssig zusahen.
Der Stier aber, als er die geraubt, die er gewollt hatte, sprang vom Boden auf. Anfangs ging er ganz
sachte mit der Jungfrau davon, doch so, daß ihre Genossinnen nicht gleichen Schritt mit seinem
Gange halten konnten. Als er die Wiesen im Rücken und den kahlen Strand vor sich hatte,
verdoppelte er seinen Lauf und glich nun nicht mehr einem trabenden Stiere, sondern einem
fliegenden Roß. Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit einem Satz ins Meer gesprungen
und schwamm mit seiner Beute dahin. Die Jungfrau hielt mit der Rechten eins seiner Hörner
umklammert, mit der Linken stützte sie sich auf den Rücken; in ihre Gewänder blies der Wind wie ein
Segel; ängstlich blickte sie nach dem verlassenen Lande zurück und rief umsonst den Gespielinnen;
das Wasser umwallte den segelnden Stier, und seine hüpfenden Wellen scheuend, zog sie furchtsam
die Fersen hinauf Aber das Tier schwamm dahin wie ein Schiff; bald war das Ufer verschwunden, die
Sonne untergegangen, und im Helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jungfrau nichts um sich her
als Wogen und Gestirne. So ging es fort, auch als der Morgen kam; den ganzen Tag schwamm sie auf
dem Tiere durch die unendliche Flut dahin; doch wußte dieses so geschickt die Wellen zu
durchschneiden, daß kein Tropfen seine geliebte Beute benetzte. Endlich gegen Abend erreichten sie
ein fernes Ufer. Der Stier schwang sich ans Land, ließ die Jungfrau unter einem gewölbten Baume
sanft vom Rücken gleiten und verschwand vor ihren Blicken. An seine Stelle trat ein herrlicher,
göttergleicher Mann, der ihr erklärte, daß er der Beherrscher der Insel Kreta sei und sie schützen
werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde. Europa in ihrer trostlosen Verlassenheit reichte
ihm ihre Hand als Zeichen der Einwilligung; und Zeus hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht.
Aus langer Betäubung erwachte Europa, als schon die Morgensonne am Himmel stand. Sie fand sich
einsam, sah mit verirrten Blicken um sich her, als wollte sie die Heimat suchen. »Vater, Vater!« rief
sie mit durchdringendem Wehelaut, besann sich eine Weile und rief wieder: »Ich verworfene
Tochter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen? Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe
vergessen lassen!« Dann sah sie wieder, wie sich besinnend, umher und fragte sich selbst: »Woher,
wohin bin ich gekommen? ‐ Zu leicht ist ein Tod für die Schuld der Jungfrau! Aber wache ich denn
auch und beweine einen wirklichen Schimpf? Nein, ich bin gewiß unschuldig an allem, und es neckt
meinen Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgenschlaf wieder entführen wird! Wie wäre es
auch möglich, daß ich mich hätte entschließen können, lieber auf dem Rücken eines Untieres durch
unendliche Fluten zu schwimmen, als in holder Sicherheit frische Blumen zu pflücken!« ‐ So sprach
sie und fuhr mit der flachen Hand über die Augenlider, als wollte sie den verhaßten Traum
verwischen. Als sie aber um sich blickte, blieben die fremden Gegenstände unverrückt vor ihren
Augen; unbekannte Bäume und Felsen umgaben sie, und eine unheimliche Meeresflut schäumte, an
starren Klippen sich brechend, empor am niegeschauten Gestade. »Ach, wer mir jetzt den Stier
auslieferte«, rief sie verzweifelnd, »wie wollte ich ihn zerfleischen; nicht ruhen wollte ich, bis ich die
Hörner des Ungeheuers zerbrochen, das mir jüngst noch so liebenswürdig erschien! Eitler Wunsch!
Nachdem ich schamlos die Heimat verlassen, was bleibt mir übrig als zu sterben? Wenn mich nicht
alle Götter verlassen haben, so sendet mir, ihr Himmlischen, einen Löwen, einen Tiger! Vielleicht
reizt sie die Fülle meiner Schönheit, und ich muß nicht warten, bis der entsetzliche Hunger an diesen
blühenden Wangen zehrt!« Aber kein wildes Tier erschien; lächelnd und friedlich lag die fremde
Gegend vor ihr, und vom unumwölkten Himmel leuchtete die Sonne. Wie von Furien bestürmt,
sprang die verlassene Jungfrau auf »Elende Europa«, rief sie, »hörst du nicht die Stimme deines
abwesenden Vaters, der dich verflucht, wenn du deinem schimpflichen Leben nicht ein Ende machst!
Zeigt er dir nicht jene Esche, an welche du dich mit deinem Gürtel aufhängen kannst? Deutet er nicht
hin auf jenes spitze Felsgestein, von welchem herab dich ein Sprung in den Sturm der Meeresflut
begraben wird? Oder willst du lieber einem Barbarenfürsten als Nebenweib dienen und als Sklavin
von Tag zu Tag die zugeteilte Wolle abspannen, du, eines hohen Königes Tochter?« So quälte sich das
unglückliche verlassene Mädchen mit Todesgedanken und fühlte doch nicht den Mut in sich, zu
sterben. Da vernahm sie plötzlich ein heimliches spottendes Flüstern hinter sich, glaubte sich
belauscht und blickte erschrocken rückwärts. In überirdischem Glanze sah sie da die Göttin Aphrodite
vor sich stehen, ihren kleinen Sohn, den Liebesgott, mit gesenktem Bogen zur Seite. Noch schwebte
ein Lächeln auf den Lippen der Göttin, dann sprach sie: »Laß deinen Zorn und Hader, schönes
Mädchen! Der verhaßte Stier wird kommen und dir die Hörner zum Zerreißen darreichen; ich bin es,
die dir im väterlichen Hause jenen Traum gesendet. Tröste dich, Europa! Zeus ist es, der dich geraubt
hat; du bist die irdische Gattin des unbesiegten Gottes; unsterblich wird dein Name werden, denn
der fremde Weltteil, der dich aufgenommen hat, heißt hinfort Europa!«
Kadmos
Kadmos war ein Sohn des phönizischen Königes Agenor, ein Bruder der Europa. Als Zeus, in einen
Stier verwandelt, diese entführt hatte, sandte ihr Vater den Kadmos und dessen Brüder aus, sie zu
suchen, und ohne sie erlaubte er ihnen nicht wieder zurückzukommen. Lange hatte Kadmos
vergebens die Welt durchirrt, ohne des Zeus Schliche entdecken zu können. Als er die Hoffnung
verloren hatte, seine Schwester wieder aufzufinden, scheute er seines Vaters Zorn, wandte sich an
das Orakel des Phöbos Apollo und forschte, welches Land er inskünftige bewohnen sollte. Apollo gab
ihm die Weisung: »Du wirst ein Rind auf einsamen Auen treffen, das noch kein Joch geduldet hat.
Von diesem sollst du dich leiten lassen, und an dem Platze, wo es im Grase ruhen wird, erbaue
Mauern und nenne die Stadt Theben.« Kaum hatte Kadmos die Kastalische Höhle verlassen, wo
Apolls Orakel war, als er schon auf der grünen Weide eine Kuh sich bedächtig ergehen sah, die noch
kein Zeichen der Dienstbarkeit um den Nacken trug. Lautlos zu Phöbos betend, folgte er mit
langsamen Schritten den Spuren des Tieres. Schon hatte er die Furt des Kephissos durchwatet und
war über eine gute Strecke Landes gekommen, als auf einmal das Rind stillestand, sein Gehörn gen
Himmel streckte und die Luft mit Brüllen erfüllte; dann schaute es rückwärts nach der Schar der
Männer, die ihm folgte, und kauerte sich endlich im schwellenden Grase nieder.
Voll Dankes warf sich Kadmos auf der fremden Erde nieder und küßte sie. Hierauf wollte er dem Zeus
opfern und hieß die Diener sich aufmachen, um ihm Wasser aus lebendigem Quell zum Trankopfer zu
holen. Dort war ein altes Gehölz, das noch von keinem Beile jemals ausgehauen worden war; mitten
darin bildete durch zusammengefügtes Felsgestein, mit Gestrüppe und Strauchwerk verwachsen,
eine Kluft, reich an Quellwasser, ein niedriges Gewölbe. In dieser Höhle versteckt ruhte ein
grausamer Drache. Weithin sah man seinen roten Kamm schimmern, aus den Augen sprühte Feuer,
sein Leib schwoll von Gift, mit drei Zungen zischte er und mit drei Reihen Zähne war sein Rachen
bewaffnet. Wie nun die Phönizier den Hain betreten hatten und der Krug, niedergelassen, in den
Wellen plätscherte, streckte der bläuliche Drache plötzlich sein Haupt weit aus der Höhle und erhub
ein entsetzliches Zischen. Die Schöpfurnen entglitten der Hand der Diener, und vor Schrecken stockte
ihnen das Blut im Leibe. Der Drache aber verwickelte seine schuppigen Ringe zum schlüpfrigen
Knäuel, dann krümmte er sich im Bogensprunge, und über die Hälfte aufgerichtet schaute er auf den
Wald herab. Darauf reckte er sich gegen die Phönizier aus, tötete die einen durch seinen Biß, die
andern erdrückte er mit seiner Umschlingung, noch andere erstickte sein bloßer Anhauch, und
wieder andere brachte sein giftiger Geifer um.
Kadmos wußte nicht, warum seine Diener solange zauderten. Zuletzt machte er sich auf, selbst nach
ihnen zu schauen. Er deckte sich mit dem Felle, das er einem Löwen abgezogen hatte, nahm Lanze
und Wurfspieß mit sich, dazu ein Herz, das besser war als jede Waffe. Das erste, was ihm beim
Eintritt in den Hain aufstieß, waren die Leichen seiner getöteten Diener, und über ihnen sah er den
Feind mit geschwollenem Leibe triumphieren und mit der blutigen Zunge die Leichname belecken.
»Ihr armen Genossen«, rief Kadmos voll Jammer aus, »entweder bin ich euer Rächer oder der
Gefährte eures Todes!« Mit diesen Worten ergriff er ein Felsstück und sandte es gegen den Drachen.
Mauern und Türme hätte wohl der Stein erschüttert, so groß war er. Aber der Drache blieb
unverwundet, sein harter schwarzer Balg und die Schuppenhaut schirmten ihn wie ein eherner
Panzer. Nun versuchte es der Held mit dem Wurfspieß. Diesem hielt der Leib des Ungeheuers nicht
stand, die stählerne Spitze stieg tief in sein Eingeweide nieder. Wütend vor Schmerz drehte der
Drache den Kopf gegen seinen Rücken und zermalmte dadurch die Stange des Wurfspießes, aber das
Eisen blieb im Leibe stecken. Ein Streich vom Schwerte steigerte noch seine Wut, der Schlund schwoll
ihm auf, und weißer Schaum floß aus dem giftigen Rachen. Aufrechter als ein Baumstamm schoß der
Drache hinaus, dann rannte er mit der Brust wieder gegen die Waldbäume. Agenors Sohn wich dem
Anfalle aus, deckte sich mit der Löwenhaut und ließ die Drachenzähne an der Lanzenspitze sich
abmüden. Endlich fing das Blut an, denn Untier aus dem Halse zu fließen, und rötete die grünen
Kräuter umher; aber die Wunde war nur leicht, denn der Drache wich jedem Stoß und Stiche aus und
verstattete den Streichen nicht, fest zu sitzen. Zuletzt jedoch stieß ihm Kadmos das Schwert in die
Gurgel, so tief, daß es hinterwärts in einen Eichbaum fuhr und mit dem Nacken des Ungeheuers
zugleich der Stamm durchbohrt wurde. Der Baum wurde von dem Gewichte des Drachen
krummgebogen und seufzte, weil er seinen Stamm von der Spitze des Schweifes gepeitscht fühlte.
Nun war der Feind überwältigt.
Kadmos betrachtete den erlegten Drachen lange; als er sich wieder umsah, stand Pallas Athene, die
vom Himmel herniedergefahren war, zu seiner Seite und befahl ihm, sofort die Zähne des Drachens
als Nachwuchs künftigen Volkes in aufgelockertes Erdreich zu säen. Er gehorchte der Göttin, öffnete
mit dem Pflug eine breite Furche auf dem Boden und fing an, die Drachenzähne, wie ihm befohlen
war, die Öffnung entlang auszustreuen. Auf einmal begann die Scholle sich zu rühren, und aus den
Furchen hervor blickte zuerst nur die Spitze einer Lanze, dann kam ein Helm hervor, auf welchem ein
farbiger Busch sich schwenkte, bald ragten Schulter und Brust und bewaffnete Arme aus dem Boden,
und endlich stand ein gerüsteter Krieger da, vom Kopf bis zum Fuße der Erde entwachsen. Dies
geschah an vielen Orten zugleich, und eine ganze Saat bewaffneter Männer wuchs vor den Augen des
Phöniziers empor.
Agenors Sohn erschrak und war gefaßt darauf, einen neuen Feind bekämpfen zu müssen. Aber einer
von dem erdentsprossenen Volke rief ihm zu: »Nimm die Waffen nicht, menge dich nicht in innere
Kriege!« Sofort holte dieser auf einen der ihm zunächst aus der Furche hervorgekommenen Brüder
mit einem Schwertstreich aus; ihn selbst streckte zu gleicher Zeit ein Wurfspieß nieder, der aus der
Ferne geflogen kam. Auch der, welcher ihm den Tod gegeben, verhauchte unter einer Wunde den
kaum empfangenen Lebensatem bald wieder. Der ganze Männerschwarm tobte in fürchterlichem
Wechselkampfe; fast alle lagen mit zuckender Brust auf dem Boden, und die Mutter Erde trank das
Blut ihrer eben erst geborenen Söhne. Nur fünf waren übriggeblieben. Einer davon ‐ er ward später
Echion genannt ‐ warf zuerst auf Athenes Geheiß die Waffen zur Erde und erbot sich zum Frieden;
ihm folgten die anderen.
Mit dieser fünf erdentsprossenen Krieger Hilfe baute der phönizische Fremdling Kadmos die neue
Stadt, dem Orakel des Phöbos gehorsam, und nannte sie, wie ihm befohlen war, Theben.
Pentheus
Zu Theben ward Bakchos oder Dionysos, der Sohn des Zeus und der Semele, der Enkel des Kadmos,
wunderbar geboren, der Gott der Fruchtbarkeit, der Erfinder des Weinstocks. In Indien erzogen,
verließ er bald die Nymphen, seine Pflegerinnen, und durchreiste die Länder, um allenthalben die
Menschen zu bilden, den Bau des herzerfreuenden Weines zu lehren und die Verehrung seiner
Gottheit zu gründen. So gütig er gegen seine Freunde war, so hart bestrafte er diejenigen, die seinen
Gottesdienst nicht anerkennen wollten. Schon war sein Ruhm durch die Städte Griechenlands und bis
zur Stadt seiner Geburt, nach Theben, gedrungen. Dort aber herrschte Pentheus, welchem Kadmos
das Königreich übergeben hatte, der Sohn des erdentsprossenen Echion und der Agave, einer
Mutterschwester des Bakchos. Dieser war ein Verächter der Götter und zumeist seines Verwandten,
des Dionysos. Als nun der Gott mit seinem jauchzenden Gefolge von Bakchanten herannahte, um
sich dem Könige von Theben als Gott zu offenbaren, hörte dieser nicht auf die Warnung des blinden,
greisen Sehers Tiresias, und als ihm die Nachricht zu Ohren kam, daß auch aus Theben Männer,
Frauen und Jungfrauen zur Verehrung des neuen Gottes hinausströmten, fing er an ergrimmt zu
schelten: »Welch ein Wahnsinn hat euch betört, ihr drachenentsprossenen Thebaner, daß euch, die
kein Schlachtschwert, keine Trompete jemals geschreckt hat, jetzt ein weichlicher Zug von
berauschten Toren und Weibern besiegt? Und ihr Phönizier, die ihr weit über Meere hierher
gefahren seid und euren alten Göttern eine Stadt gegründet, habt ihr ganz vergessen, aus welchem
Heldengeschlecht ihr gezeugt seid? Wollt ihr es dulden, daß ein wehrloses Knäblein Theben erobere,
ein Weichling mit balsamtriefendem Haar, auf dem ein Kranz aus Weinlaub sitzt, in Purpur und Gold
anstatt in Stahl gekleidet, der kein Roß tummeln kann, dem keine Wehr, keine Fehde behagt? Wenn
nur ihr wieder zur Besinnung kommet, so will ich ihn bald nötigen, einzugestehen, daß er ein Mensch
ist, wie ich, sein Vetter, daß nicht Zeus sein Vater und alle diese prächtige Gottesverehrung erlogen
ist!« Dann wandte er sich zu seinen Dienern und befahl ihnen, den Anführer dieser neuen Raserei,
wo sie ihn anträfen, zu fassen und in Fesseln herzuschleppen.
Seine Freunde und Verwandte, die um den König waren, erschraken über diesen frechen Befehl; sein
Ahnherr Kadmos, der in hohem Greisenalter noch lebte, schüttelte das Haupt und mißbilligte das Tun
des Enkels; aber durch Ermahnungen wurde seine Wut nur gestachelt, sie schäumte über alle
Hindernisse hin, wie ein rasender Fluß über das Wehr.
Unterdessen kamen die Diener mit blutigen Köpfen zurück. »Wo habt ihr den Bakchos?« rief ihnen
Pentheus zornig entgegen. »Den Bakchos«, antworteten sie, »haben wir nirgends gesehen. Dafür
bringen wir hier einen Mann aus seinem Gefolge. Er scheint noch nicht lange bei ihm zu sein.«
Pentheus starrte den Gefangenen mit grimmigen Augen an und schrie dann: »Mann des Todes! denn
auf der Stelle mußt du, den andern zu einem warnenden Beispiele, sterben! Sag an, wie heißt dein
und deiner Eltern Name, wie dein Land, und, sag auch, warum verehrst du die neuen Gebräuche?«
Frei und ohne Furcht erwiderte jener: »Mein Name ist Akötes, meine Heimat Mäonien, meine Eltern
sind aus dem gemeinen Volke. Keine Fluren, keine Herden ließ mir der Vater zum Erbteil, er lehrte
mich nur die Kunst, mit der Angelrute zu fischen; denn diese Kunst war all sein Reichtum. Bald lernte
ich auch ein Schiff regieren, die leitenden Gestirne, die Winde, die wohlgelegenen Häfen kennen und
fing an, Schiffahrt zu treiben. Einst, auf einer Fahrt nach Delos, geriet ich an eine unbekannte Küste,
wo wir anlegten. Ein Sprung brachte mich auf den feuchten Sand, und ich übernachtete hier noch
ohne die Gefährten am Ufer. Des andern Tages machte ich mich mit der ersten Morgenröte auf und
bestieg einen Hügel, um zu sehen, was der Wind uns verspreche. Inzwischen hatten auch meine
Gefährten gelandet, und auf dem Rückwege nach dem Schiffe begegnete ich ihnen, wie sie gerade
einen Jüngling mit sich schleppten, den sie am verlassenen Gestade geraubt hatten. Der Knabe, von
jungfräulicher Schönheit, schien vom Weine betäubt, taumelnd wie von Schläfrigkeit, und hatte
Mühe, ihnen zu folgen. Als ich Angesicht, Haltung, Bewegung des Jünglings näher ins Auge faßte,
schien sich mir an demselben etwas Überirdisches zu offenbaren. »Was für ein Gott in dem Jüngling
sei«, so sprach ich zu der Mannschaft, »Weiß ich noch nicht recht; aber so viel ist mir gewiß, daß ein
Gott in ihm ist. ‐ Wer du auch seiest«, sprach ich weiter, »sei uns hold und fördere unsre Arbeit!
Verzeih auch diesen, die dich geraubt!« »Was fällt dir ein«, rief ein anderer, »laß du das Beten!«
Auch die übrigen lachten über mich, von Raubgier verblendet, und somit faßten sie den Knaben, um
ihn in das Schiff zu schleppen. Vergebens stellte ich mich entgegen; der Jüngste und Kräftigste unter
der Rotte, aus einer tyrrhenischen Stadt wegen eines Mordes flüchtig, packte mich an der Gurgel und
schleuderte mich hinaus. Ich wäre im Meere ertrunken, wenn mich das Takelwerk nicht aufgefangen
hätte. Inzwischen lag der Knabe wie im tiefen Schlummer auf dem Schiffe, wohin man ihn gebracht
hatte. Plötzlich, wie vom Geschrei erwacht und vom Rausche zurückgekehrt, raffte er sich auf, trat
unter die Schiffer und rief»Welcher Lärm? Sprecht, ihr Männer, durch welches Geschick kam ich
hierher? Wohin wollt ihr mich bringen?« »Fürchte dich nicht, Knabe«, sprach einer der falschen
Schiffer, »nenne uns nur den Hafen, nach welchem du gebracht zu werden wünschest; gewiß, wir
setzen dich ab, wo du es verlangst.« »Nun wohl«, sprach der Knabe, »so richtet den Lauf nach der
Insel Naxos, dort ist meine Heimat!« Die Betrüger versprachen es ihm bei allen Göttern und hießen
mich die Segel richten. Uns zur rechten Seite lag Naxos. Wie ich nun die Segel rechtshin spanne,
winken und murmeln sie mir alle zu: »Unsinniger, was machst du? Was für ein Wahnwitz plagt dich?
Fahr links!« Ich erstaunte darüber und begriff sie nicht. »Nehme sich ein anderer des Schiffes an!«
sprach ich und trat auf die Seite. »Als ob das Heil unserer Fahrt allein auf dir beruhte!« schrie mir ein
roher Geselle zu und verrichtete das Geschäft anstatt meiner. So ließen sie Naxos liegen und
steuerten in der entgegengesetzten Richtung. Hohnlächelnd, als ob er den Trug jetzt erst bemerkte,
schaute der Götterjüngling vom Hinterverdeck in die See, und endlich, mit verstellten Tränen, sprach
er: »Wehe, nicht diese Gestade verhießet ihr mir, Schiffer, dies ist nicht das erbetene Land! Ist es
auch recht, daß ihr alten Männer ein Kind auf diese Weise täuschet?« Aber die gottesvergessene
Rotte spottete seiner und meiner Tränen und ruderte eilig davon. Plötzlich aber, als umschlösse sie
eine trockene Schiffswerft, stand die Barke mitten im Meere still. Vergebens schlagen ihre Ruder die
See, ziehen sie die Segel herab, streben fort mit doppelter Kraft. Efeu fängt an, die Ruder zu
umschlingen, kriecht rückwärts in geschlängelter Windung herauf, streift mit seinen schwellenden
Träubchen schon die Segel; Bakchos selbst ‐ denn er war es ‐ steht herrlich da, die Stirn mit
beerenbelasteten Trauben bekränzt, den mit Weinlaub umschlungenen Thyrsosstab schwingend.
Tiger, Luchse, Panther erschienen um ihn gelagert, ein duftiger Strom von Wein ergoß sich durch das
Schiff. Jetzt sprangen die Männer scheu empor, in Furcht und Wahnsinn. Dem ersten, der
aufschreien wollte, krümmte sich Mund und Nase zum Fischmaul, und ehe die andern sich darüber
entsetzen konnten, war auch ihnen das gleiche geschehen; ihr Leib senkte sich, von blauen Schuppen
umgeben; das Rückgrat wurde hochgewölbt; die Arme schrumpften zu Floßfedern ein; die Füße
vereinigten sich zu einem Schwanze. Sie waren alle zu Fischen geworden, sprangen in das Meer und
tauchten auf und nieder. Ich von zwanzigen war allein übriggeblieben, aber ich zitterte an allen
Gliedern und erwartete jeden Augenblick dieselbe Verwandlung. Bakchos jedoch sprach mir
freundlich zu, weil ich ihm ja nur Gutes erwiesen habe. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »und steure
mich gen Naxos.« Als wir dort gelandet hatten, weihte er mich an seinem Altar zum feierlichen
Dienste seiner Gottheit ein.«
»Schon zu lange horchen wir deinem Geschwätz«, schrie jetzt der König Pentheus, »auf, ergreifet ihn,
ihr Diener, peinigt ihn mit tausend Martern und schickt ihn zur Unterwelt hinab!« Die Knechte
gehorchten und warfen den Schiffer gefesselt in einen tiefen Kerker. Aber eine unsichtbare Hand
befreite ihn.
Nun begann erst die ernstliche Verfolgung der Bakchosfeier. Des Pentheus eigene Mutter, Agave und
ihre Schwestern, hatten teil an dem rauschenden Gottesdienste genommen. Der König sandte nach
ihnen aus und ließ alle Bakchantinnen in den Stadtkerker werfen. Aber ohne Hilfe eines Sterblichen
werden auch sie ihrer Bande ledig; die Pforten ihres Gefängnisses tun sich auf, und sie rennen in
bakchischer Begeisterung frei in den Wäldern umher. Der Diener, der abgesandt worden, mit
bewaffneter Macht den Gott selbst einzufangen, kam ganz bestürzt zurück, denn jener hatte sich
willig und lächelnd den Fesseln dargeboten. So stand er jetzt gefangen vor dem Könige, der selber
nicht umhinkonnte, seine jugendliche göttliche Schönheit zu bewundern. Und doch beharrte er in
seiner Verblendung und behandelte ihn als einen Betrüger, der den Namen Bakchos fälschlich führe.
Er ließ den gefangenen Gott mit Fesseln belasten und im hintersten und tiefsten Teile seines
Palastes, in der Nähe der Pferdekrippen, in einem dunkeln Loche verwahren. Auf des Gottes Geheiß
spaltete jedoch ein Erdbeben das Gemäuer, seine Bande verschwanden. Er trat unversehrt und
herrlicher als zuvor in die Mitte seiner Verehrer.
Ein Bote über den andern kam vor den König Pentheus und meldete ihm, welche Wundertaten die
Chöre begeisterter Frauen, von seiner Mutter und ihren Schwestern angeführt, verrichteten. Ihr Stab
durfte nur an Felsen schlagen, so sprang Wasser oder sprudelnder Wein heraus; die Bäche flossen
unter seinem Zauberschlage mit Milch; aus den hohlen Bäumen träufelte Honig. »Ja«, fügte einer der
Boten hinzu, »wärest du zugegen gewesen, o Herr, und hättest den Gott, den du jetzt schiltst, selbst
gesehen, du würdest dich in Gebeten vor ihm niedergeworfen haben!«
Pentheus, immer entrüsteter, bot auf diese Nachrichten alle schwerbewaffneten Krieger, alle Reiter,
alle Leichtbeschildeten gegen das rasende Weiberheer auf Da erschien Bakchos selbst wieder und
trat als sein eigener Abgeordneter vor den König. Er versprach, ihm die Bakchantinnen entwaffnet
vorzuführen, wenn nur der König selbst die Frauentracht anlegen wolle, damit er nicht als Mann und
Uneingeweihter von ihnen zerrissen werde. Ungerne und mit sehr natürlichem Mißtrauen ging
Pentheus auf den Vorschlag ein; doch folgte er endlich dem Gotte zur Schlachtbank. Aber als er
hinausschritt zur Stadt, war er schon vom Wahnsinne, den ihm der mächtige Gott zugesandt hatte,
besessen. Ihm deuchte es, als schaue er zwei Sonnen, ein gedoppeltes Theben und jedes seiner Tore
zwiefach. Bakchos selbst kam ihm vor wie ein Stier, der mit großen Hörnern an dem Kopfe vor ihm
herschreite. Er selbst wurde wider Willen von bakchischer Begeisterung ergriffen, verlangte und
erhielt einen Thyrsosstab und stürmte in Raserei dahin. So gelangten sie in ein tiefes, quellenreiches,
von Fichten beschattetes Tal, wo die Bakchospriesterinnen ihrem Gotte Hymnen sangen, andere ihre
Thyrsosstäbe mit frischem Efeu bekleideten. Des Pentheus Augen aber waren mit Blindheit
geschlagen, oder sein Führer Bakchos hatte ihn so zu leiten gewußt, daß sie die Versammlung der
begeisterten Frauen nicht gewahr wurden. Der Gott faßte nun mit seiner wunderbar in die Höhe
reichenden Hand den Gipfel eines Tannenbaumes, beugte ihn hernieder, wie man einen
Weidenzweig biegt, setzte den wahnsinnigen Pentheus darauf und ließ den Baum sachte und
vorsichtig allmählich wieder in seine vorige Lage zurückkehren. Wie durch ein Wunder blieb der
König fest sitzen und erschien auf einmal, hoch auf dem Tannenwipfel hingepflanzt, den
Bakchantinnen im Tale, ohne daß er sie erblickte. Dann rief Dionysos mit lauter Stimme ins Tal hinab:
»Ihr Mägde, schauet hier den, der unsere heiligen Feste verspottet; bestrafet ihn!« Der Äther
schwieg, kein Blatt im Walde regte sich, kein Schrei eines Wildes ertönte. Auf richteten sich die
Bakchantinnen, ihre Augen leuchteten in irrem Glanz; so horchten sie auf der Stimme Hall, die zum
zweitenmal ertönte. Als sie in dem Wort ihren Meister erkannt, schossen sie dahin, schneller denn
Tauben; wilder Wahnsinn, vom Gotte gesandt, trieb sie mitten durch die angeschwollenen
Waldbäche. Endlich waren sie nahe genug gekommen, um ihren Herrn und Verfolger auf dem
Tannenwipfel sitzen zu sehen. Schnell flogen Kiesel, abgerissene Tannenäste, Thyrsosstäbe gegen
den Unglücklichen empor, ohne die Höhe zu erreichen, in der er zitternd schwebte. Endlich
durchwühlten sie mit harten Eichenästen den Boden rings um den Tannenbaum, bis die Wurzel bloß
war und Pentheus unter lautem Jammergeschrei mit der stürzenden Tanne aus der Höhe zu Boden
fiel. Seine Mutter Agave, vom Gotte geblendet, daß sie den Sohn nicht wiedererkannte, gab das erste
Zeichen zum Morde. Dem Könige selbst hatte die Angst seine volle Besinnung wiedergegeben.
»Mutter«, rief er, sie umhalsend, »kennst du deinen Sohn nicht mehr, deinen Sohn Pentheus, den du
im Hause Echions geboren? Hab Erbarmen mit mir, sei du es nicht, Mutter, die meine Sünden am
eigenen Kinde straft!« Aber die wahnsinnige Bakchospriesterin, schäumend und mit weit
aufgesperrten Augen, sah nicht ihren Sohn in Pentheus, sondern glaubte einen Berglöwen in ihm zu
erblicken, faßte ihn an der Schulter und riß ihm den rechten Arm vom Leibe; die Schwestern
verstümmelten den linken; die ganze wütende Rotte stürmte auf ihn ein, jede ergriff ein Glied des
Zerrissenen; Agave selbst umklammerte das entrissene Haupt mit blutigen Fingern und trug es als ein
Löwenhaupt auf einen Thyrsosstab gesteckt durch die Wälder des Kithairon.
So rächte der mächtige Gott Bakchos sich an dem Verächter seines Gottesdienstes
Perseus
Perseus, der Sohn des Zeus, wurde mit seiner Mutter Danae von dem Großvater Akrisios, Könige von
Argos, dem ein Orakelspruch gesagt hatte, daß ein Enkel ihm Leben und Thron rauben würde, in
einen Kasten eingeschlossen und ins Meer geworfen; Zeus behütete sie in den Stürmen des Meeres,
und sie schwammen bei der Insel Seriphos ans Land. Dort herrschten zwei Brüder, Diktys und
Polydektes. Diktys fischte eben, als der Kasten angeschwommen kam, und zog ihn ans Land. Beide
Brüder nahmen sich der Verlassenen liebreich an; Polydektes erhob die Mutter zu seiner Gemahlin,
und der Sohn des Zeus, Perseus, wurde von ihm sorgfältig erzogen.
Als Perseus herangewachsen war, überredete ihn sein Stiefvater, auf Taten auszuziehen und etwas
Großes zu unternehmen. Der mutige Jüngling zeigte sich willig, und bald waren sie einig darüber, daß
Perseus der Medusa ihr furchtbares Haupt abschlagen und dem Könige nach Seriphos bringen sollte.
Perseus machte sich auf den Weg und kam unter Leitung der Götter in die ferne Gegend, wo Phorkys,
der Vater vieler entsetzlicher Ungeheuer, hauste. Zuerst traf er auf drei seiner Töchter, die Graien
oder Grauen; diese waren grauhaarig von Geburt an; alle drei miteinander hatten sie nur ein Auge
und einen Zahn, den sie einander gegenseitig abwechslungsweise zum Gebrauche liehen. Perseus
nahm ihnen beides weg, und als sie ihn flehentlich baten, das Unentbehrlichste ihnen doch
wiederzugeben, zeigte er sich zur Zurückerstattung nur unter der Bedingung bereit, daß sie ihm den
Weg zu den Nymphen zeigen sollten. Diese waren andere Wundergeschöpfe, die Flügelschuhe, einen
Schubsack als Tasche und einen Helm von Hundefell besaßen. Wer sich damit bekleidete, konnte
fliegen, wohin er wollte, sah, wen er wollte, und wurde von niemand gesehen. Die Töchter des
Phorkys zeigten dem Perseus den Weg zu den Nymphen und erhielten Zahn und Auge von ihm
zurück. Bei den Nymphen fand und nahm er, was er wollte, warf den Schubsack um, schnallte die
Flügelschuhe an seine Knöchel und setzte den Helm aufs Haupt. Dazu erhielt er von Hermes eine
eherne Sichel, und so ausgerüstet flog er zu dem Ozean, wo die andern drei Töchter des Phorkys, die
Gorgonen, hausten. Die dritte, die Medusa hieß, war allein sterblich; darum war auch Perseus
ausgesandt worden, ihr Haupt zu holen. Er fand die Ungeheuer schlafend, ihre Häupter waren mit
Drachenschuppen übersäet, mit Schlangen statt Haaren bedeckt; große Hauzähne hatten sie, wie
Schweine, eherne Hände und goldene Flügel, mit welchen sie flogen. Jeden, der sie ansah,
verwandelte dieser Anblick in Stein. Das wußte Perseus. Mit abgewandtem Gesicht stellte er sich
deswegen vor die Schlafenden und fing nur in seinem ehernen, glänzenden Schilde ihr dreifaches Bild
auf So erkannte er die Gorgo Medusa heraus, Athene führte ihm die Hand, und schnitt dem
schlafenden Ungeheuer ohne Gefährde das Haupt ab. Kaum war dies vollbracht, so entsprang dem
Rumpfe ein geflügeltes Roß, der Pegasus, und ein Riese, Chrysaor. Beides waren Geschöpfe des
Poseidon oder Neptunus. Perseus schob nun das Haupt der Medusa in den Schubsack und entfernte
sich rücklings, wie er gekommen war. Indessen hatten sich die Schwestern Medusas vom Lager
erhoben. Sie erblickten den Rumpf der getöteten Schwester und erhoben sich auf ihren Fittichen,
den Räuber zu verfolgen. Diesen aber verbarg der Nymphenhelm vor ihren Augen, und sie konnten
ihn nirgends innewerden. In der Luft faßten inzwischen den Perseus die Winde und schleuderten ihn,
wie Regengewölk, bald da‐, bald dorthin. Als er über den Sandwüsten Libyens schwebte, rieselten
blutige Tropfen vom Medusenhaupte auf die Erde nieder, welche sie auffing und zu bunten
Schlangen belebte. Seitdem ist jenes Erdreich an feindseligen Nattern so ergiebig. Perseus flog nun
weiter westwärts und senkte sich endlich im Reiche des Königes Atlas nieder, um ein wenig zu rasten.
Dieser hütete einen Hain voll goldener Früchte mit einem gewaltigen Drachen. Umsonst bat der
Besieger der Gorgone ihn um ein Obdach. Für sein goldenes Besitztum bange, stieß ihn Atlas
unbarmherzig von seinem Palaste fort. Da ergrimmte Perseus und sprach: »Du willst mir nichts
gönnen; empfange du wenigstens ein Geschenk von mir.« Er holte die Gorgo aus seinem Schubsacke
hervor, wandte sich ab und streckte sie dem König Atlas entgegen. Groß wie der König war, wurde er
augenblicklich zu Stein und in einen Berg verwandelt; Bart und Haupthaar dehnten sich zu Wäldern
aus; Schultern, Hände und Gebein wurden Felsrücken; sein Haupt wuchs als hoher Gipfel in die
Wolken. Perseus nahm seine Fittiche wieder und schnallte sie sich an die Sohlen, hängte sich den
Schubsack um, setzte den Helm auf und schwang sich in die Lüfte. Auf seinem Fluge kam er an eine
Küste Äthiopiens, wo der König Kepheus regierte. Hier sah er an eine hervorragende Meeresklippe
eine Jungfrau angebunden. Wenn nicht ihr Haupthaar ein Lüftchen bewegt hätte und in ihren Augen
Tränen gezittert, so würde er sie für ein Marmorbild gehalten haben. Fast hätte er in der Luft die
Flügel zu bewegen vergessen, so bezaubert war er von dem Reize ihrer Schönheit. »Sprich, schöne
Jungfrau«, redete er sie an, »du, die du ganz anderes Geschmeide verdientest, warum bist du hier in
Banden? Nenne mir doch den Namen deines Landes, nenne mir deinen eigenen Namen!« Das
gefesselte Mädchen schwieg verschämt; sie scheute sich, den fremden Mann anzureden, und hätte
gern ihr Angesicht mit den Händen bedeckt, wenn sie sich hätte regen können. So aber konnte sie
nur ihre Augen mit quellenden Tränen füllen. Endlich, damit der Fremdling nicht glauben möchte, sie
habe eine eigene Schuld vor ihm zu verbergen, erwiderte sie: »Ich bin Kepheus', des Königs der
Äthiopier, Tochter und heiße Andromeda. Meine Mutter hatte gegen die Töchter des Nereus, die
Meeresnymphen, geprahlt, schöner zu sein als sie alle. Darüber zürnten die Nereiden, und ihr
Freund, der Meeresgott, ließ eine Überschwemmung und einen alles verschlingenden Haifisch über
das Land kommen. Ein Orakelspruch versprach uns Befreiung von der Plage, wenn ich, die Tochter
der Königin, dem Fische zum Fraße hingeworfen würde. Das Volk drang in meinen Vater, dieses
Rettungsmittel zu ergreifen, und die Verzweiflung zwang ihn, mich an diesen Felsen zu binden.«
Sie hatte die letzten Worte noch nicht ausgesprochen, als die Wogen aufrauschten und aus der Tiefe
des Meeres ein Scheusal auftauchte, das mit seiner breiten Brust die ganze Wasserfläche umher
einnahm. Das Mädchen jammerte laut auf; zugleich sah man Vater und Mutter herbeieilen, beide
trostlos, doch in der Mutter Zügen drückte sich noch dazu das Bewußtsein der Schuld aus. Sie
umarmten die gefesselte Tochter, aber sie brachten ihr nichts mit als Tränen und Wehklagen. Jetzt
begann der Fremdling: »Zum Jammern wird euch noch Zeit genug übrigbleiben; die Stunde der
Rettung ist kurz. Ich bin Perseus, der Sprößling des Zeus und der Danae; ich habe die Gorgone
besiegt; und wunderbare Flügel tragen mich durch die Luft. Selbst wenn die Jungfrau frei wäre und
zu wählen hätte, wäre ich kein verächtlicher Eidam! Jetzt werbe ich um sie mit dem Erbieten, sie zu
retten. Nehmet ihr meine Bedingung an?« Wer hätte in solcher Lage gezaudert? Die erfreuten Eltern
versprachen ihm nicht nur die Tochter, sondern auch ihr eigenes Königreich zur Mitgift.
Während sie dieses verhandelten, war das Untier wie ein schnellruderndes Schiff
herangeschwommen und nur noch einen Schleuderwurf von dem Felsen entfernt. Da plötzlich, das
Land mit dem Fuße abstoßend, schwang sich der Jüngling hoch empor in die Wolken. Das Tier sah
den Schatten des Mannes auf dem Meere. Während es tobend auf diesen losging, als auf einen
Feind, der ihm die Beute zu entreißen drohte, fuhr Perseus aus der Luft wie ein Adler herunter, trat
schwebend auf den Rücken des Tieres und senkte das Schwert, mit dem er die Meduse getötet hatte,
dem Haifisch unter dem Kopf in den Leib, bis an den Knauf. Kaum hatte er es wieder herausgezogen,
so sprang der Fisch bald hoch in die Lüfte, bald tauchte er wieder unter in die Flut, bald tobte er nach
beiden Seiten wie ein von Hunden verfolgter Eber. Perseus brachte ihm Wunde um Wunde bei, bis
ein dunkler Blutstrom sich aus seinem Rachen ergoß. Indessen troffen die Flügel des Halbgotts, und
Perseus wagte nicht länger, sich dem wasserschweren Gefieder anzuvertrauen. Glücklicherweise
erblickte er ein Felsriff, dessen oberste Spitze aus dem Meere hervorragte. Auf diese Felswand
stützte er sich mit der Linken und stieß das Eisen drei‐ bis viermal in das Gekröse des Ungetüms. Das
Meer trieb die ungeheure Leiche fort, und bald war sie in den Fluten verschwunden. Perseus hatte
sich indessen ans Land geschwungen, hatte den Felsen erklommen und die Jungfrau, die ihn mit den
Blicken des Dankes und der Liebe begrüßte, der Fesseln entledigt. Er brachte sie den glücklichen
Eltern, und der goldene Palast empfing ihn als Bräutigam. Noch dampfte das Hochzeitsmahl, und die
Stunden strichen dem Vater und der Mutter, dem Bräutigam und der geretteten Braut in
sorgenfreier Eile dahin, als plötzlich die Vorhöfe der Königsburg mit einem dumpfen, brausenden
Getümmel sich füllten. Phineus, der Bruder des Königs Kepheus, der früher um seine Nichte
Andromeda geworben, aber in der letzten Not sie verlassen hatte, nahte mit einer Schar von Kriegern
und erneuerte seine Ansprüche. Den Speer schwingend, trat er in den Hochzeitssaal und rief dem
erstaunten Perseus zu: »Sieh mich hier, der ich komme, die mir entrissene Gattin zu rächen; weder
deine Flügel noch dein Vater Zeus sollen dich mir entreißen!« So rief er, schon zum Speerwurfe sich
anschickend: da hub sich Kepheus, der König, vom Mahle. »Rasender Bruder«, rief er, »welcher
Gedanke treibt dich zur Untat? Nicht Perseus raubt dir die Geliebte; sie wurde dir schon damals
entrissen, als wir sie dem Tode preisgaben, als du zusahest, wie sie gefesselt wurde, und weder als
Oheim noch als Geliebter ihr deinen Beistand liehest. Warum hast du nicht selbst dir den Preis von
dem Felsen geholt, an den er geschmiedet war? So laß wenigstens den, der ihn sich errungen hat, der
mein Alter durch die Rettung meiner Tochter getröstet, in Ruhe!«
Phineus antwortete ihm nichts, er betrachtete nur abwechselnd mit grimmigen Blicken bald seinen
Bruder, bald seinen Nebenbuhler, als besänne er sich, auf wen er zuerst zielen sollte. Endlich nach
kurzem Verzuge schwang er mit aller Kraft, die der Zorn ihm gab, den Speer gegen Perseus; aber er
tat einen Fehlwurf, und die Waffe blieb im Polster hängen. Jetzt fuhr Perseus vom Lager empor und
schleuderte seinen Spieß nach der Türe, durch welche Phineus eingedrungen war, und er würde die
Brust seines Todfeindes durchbohrt haben, wenn dieser sich nicht mit einem Sprunge hinter den
Hausaltar geflüchtet hätte. Das Geschoß hatte die Stirne eines seiner Begleiter getroffen, und jetzt
kam das Gefolge des Eingedrungenen mit den längst von der Tafel aufgestörten Gästen ins
Handgemenge. Lang und mörderisch war der Kampf; aber der Eingebrochenen war die Mehrzahl.
Zuletzt wurde Perseus, an dessen Seite sich umsonst die Schwiegereltern und die Braut
schutzflehend stellten, von Phineus und seinen Tausenden umringt. Die Pfeile flogen an ihnen von
allen Seiten vorbei wie Hagelkörner im Sturme. Perseus hatte die Schultern an einen Pfeiler gelehnt
und sich so den Rücken gedeckt. Von da zur Heerschar der Feinde gewendet, hielt er den Anlauf der
Feinde ab und streckte einen um den andern nieder. Erst als er sah, daß die Tapferkeit der Menge
erliegen müsse, entschloß er sich, das letzte, aber untrügliche Mittel, das ihm zu Gebote stand, zu
gebrauchen. »Weil ihr mich genötigt«, sprach er, »will ich mir die Hilfe bei meinem alten Feinde
holen! Wende sein Antlitz ab, wer noch mein Freund ist!« Mit diesen Worten zog er aus der Tasche,
die ihm immer an der Seite hing, das Gorgonenhaupt und streckte es dem ersten Gegner zu, der jetzt
eben auf ihn eindrang. »Suche andere«, rief dieser verächtlich beim ersten flüchtigen Blicke, »die du
mit deinen Mirakeln erschüttern kannst.« Aber als seine Hand sich heben wollte, den Wurfspieß
abzusenden, blieb er mitten in dieser Gebärde versteinert wie eine Bildsäule. Und so widerfuhr es
einem nach dem andern. Zuletzt waren nur noch zweihundert übrig. Da hub Perseus das
Gorgonenhaupt hoch in die Luft empor, daß alle es erblicken konnten, und verwandelte die
zweihundert auf einmal in starres Gestein. Jetzt erst bereut Phineus den unrechtmäßigen Krieg.
Rechts und links erblickt er nichts als Steinbilder in der mannigfaltigsten Stellung. Er ruft seine
Freunde mit Namen, er berührt ungläubig die Körper der Zunächststehenden: alles ist Marmor.
Entsetzen faßte ihn, und sein Trotz verwandelte sich in demütiges Flehen. »Laß mir nur das Leben,
dein sei das Reich und die Braut!« rief er und kehrte sein verzagendes Angesicht seitwärts. Aber
Perseus, über den Tod seiner neuen Freunde erbittert, kannte kein Erbarmen. »Verräter«, schrie er
zornig, »ich will dir für alle Ewigkeit ein bleibendes Denkmal in meines Schwähers Hause stiften!«
Und sosehr Phineus bemüht war, dem Anblicke zu entgehen, so traf doch bald das ausgestreckte
Schreckensbild sein Auge: sein Hals erstarrte, sein feuchter Blick erharschte zu Stein. So blieb er
stehen mit furchtsamer Miene, die Hände gesenkt, in knechtischer, demütiger Stellung. Ohne
Hindernis führte jetzt Perseus seine Geliebte, Andromeda, heim. Lange glückliche Tage erwarteten
ihn, und er fand auch seine Mutter Danae wieder. Doch sollte er an seinem Großvater Akrisios das
Verhängnis erfüllen. Dieser war aus Furcht vor dem Orakelspruche zu einem fremden Könige ins
Pelasgerland geflohen. Hier half er Kampfspiele feiern, als eben Perseus ankam, der auf der Fahrt
nach Argos begriffen war, wo er seinen Großvater begrüßen wollte. Ein unglücklicher Wurf mit der
Scheibe traf den Großvater von des Enkels Hand, ohne daß dieser jenen kannte oder treffen wollte.
Nicht lange blieb ihm verborgen, was er getan. In tiefer Trauer begrub er den Akrisios außerhalb der
Stadt und vertauschte das Königreich, das ihm durch des Großvaters Tod zugefallen war. Doch
verfolgte ihn der Neid des Geschickes nicht länger. Andromeda gebar ihm viele herrliche Söhne, und
der Ruhm des Vaters lebte in ihnen fort.
Ion
Der König Erechtheus von Athen erfreute sich einer schönen Tochter, die Krëusa hieß. Mit dieser
hatte sich, ohne Wissen ihres Vaters, Apollo vermählt, und sie hatte ihm einen Sohn geboren,
welchen sie aus Furcht vor dem Zorn ihres Vaters in eine Kiste verschloß und in der Höhle aussetzte,
wo sie ihre heimlichen Zusammenkünfte mit dem Gotte gehalten hatte, in der Hoffnung, daß sich die
Götter des Verlassenen erbarmen würden. Um aber den neugeborenen Knaben nicht ohne
Erkennungszeichen zu lassen, hing sie ihm den Schmuck um, den sie als Jungfrau zu tragen pflegte.
Apollo, dem als einem Gotte die Geburt seines Sohnes nicht verborgen geblieben war und der weder
seine Geliebte verraten noch den Knaben ohne Hilfe lassen wollte, wandte sich an seinen Bruder
Hermes, welcher als Götterbote, ohne Aufsehen zu erregen, zwischen Himmel und Erde zu verkehren
hatte. »Lieber Bruder«, sprach er, »eine Sterbliche hat mir ein Kind geboren, es ist die Tochter des
Königes Erechtheus zu Athen. Aus Furcht vor ihrem Vater hat sie es in einem hohlen Felsen
verborgen; hilf mir es retten, bring es in der Kiste, in der es liegt, und mit den Windeln, in die es
gewickelt ist, nach meinem Orakel zu Delphi und lege es dort auf die Schwelle des Tempels. Das
übrige laß meine Sorge sein, denn es ist mein Kind.« Hermes, der geflügelte Gott, eilte nach Athen,
fand den Knaben an der bezeichneten Stelle und trug ihn in dem geflochtenen Weidenkorbe, in
welchem er verschlossen lag, nach Delphi, wo er ihn vor den Pforten des Tempels niedersetzte und
den Deckel des Korbes öffnete, damit das Kind bemerklich würde. Dies geschah bei Nacht. Am
andern Morgen, als schon die Sonne emporstieg, kam die delphische Priesterin nach dem Tempel
geschritten, und als sie ihn betreten wollte, fiel ihr Auge auf das neugeborne Kind, das in der Kiste
schlummerte. Sie hielt dasselbe für die Frucht irgendeines Verbrechens und war schon geneigt, es
von der heiligen Schwelle fortzustoßen, als das Mitleid doch in ihrer Seele die Oberhand gewann;
denn der Gott wandte ihr Herz und sprach in demselben für seinen Sohn. Die Prophetin nahm also
das Kind aus dem Korbe und zog es auf, ohne seinen Vater und seine Mutter zu kennen. Der Knabe
erwuchs, um den Altar seines Vaters spielend, und wußte nichts von seinen Eltern. Er wurde ein
stattlicher Jüngling. Die Bewohner von Delphi, die ihn schon als kleinen Tempelhüter gewohnt
worden waren, setzten ihn zum Schatzmeister über alle Geschenke, die der Gott erhielt, und so
brachte er fortwährend ein ehrbares und heiliges Leben im Tempel seines Vaters zu.
Inzwischen hatte Krëusa von dem Gotte nichts mehr erfahren und mußte wohl glauben, daß er ihrer
und ihres Sohnes vergessen habe. Um diese Zeit gerieten die Athener in einen Krieg mit den
Bewohnern der Nachbarinsel Euböa, der bis zur Vertilgung geführt wurde und in welchem die
letzteren unterlagen. In diesem Kampfe war den Athenern besonders wirksam ein Fremdling aus
Achaja beigestanden. Es war dies Xuthos, ein Sohn des Äolos, der selbst ein Sohn des Zeus war. Zum
Lohne seiner Hilfe begehrte und erhielt er die Hand der Königstochter Krëusa; aber es war, als ob der
ihr heimlich angetraute Gott die Geliebte seinen Zorn empfinden ließe, daß sie sich einem andern
vermählt hatte; denn ihre Ehe war nicht mit Kindern gesegnet. Nach langer Zeit verfiel Krëusa auf
den Gedanken, sich an das Orakel zu Delphi zu wenden und von ihm Kindersegen zu erflehen. Dies
war es, was Apollo gewollt; denn er hatte seines Sohnes keineswegs vergessen. So brach die Fürstin
mit ihrem Gemahl und einem kleinen Gefolge von Dienerinnen auf und wallfahrtete zu dem Tempel
nach Delphi. Als sie vor dem Gotteshause ankamen, trat gerade der junge Sohn Apollos über die
Schwelle, um gewohnterweise das Tor und den Vorhof mit Lorbeerzweigen zu fegen. Da fiel sein
Auge auf die edle Matrone, welche auf die Tore des Tempels zugewandelt kam und der beim
Anblicke des Heiligtums Tränen über die Wangen rollten. Er wagte es, die Frau, deren würdige
Gestalt ihm auffiel, bescheiden um die Ursache ihres Kummers zu befragen. »Es wundert mich nicht,
o Jüngling«, erwiderte sie seufzend, »daß meine Traurigkeit deinen Blick auf sich zieht; habe ich doch
Geschicke zu beweinen, die man mir wohl ansehen mag. Die Götter verfahren oft hart mit uns
Sterblichen!« »Ich will deinen Kummer nicht weiter stören«, sprach der Jüngling, »aber sage mir,
wenn es zu wissen erlaubt ist, wer du bist und von wannen du kommst.« »Ich bin Krëusa«,
antwortete die Fürstin, »mein Vater heißt Erechtheus, mein Vaterland ist Athen.« Mit unschuldiger
Freude rief der Jüngling: »Ei, aus welchem berühmten Lande, aus welch berühmtem Geschlechte
stammst du! Aber sage mir, ist es wahr, wie man es auf Bildern bei uns sieht, daß deines Vaters
Großvater Erichthonios aus der Erde wie ein anderes Gewächs emporgesprossen ist, daß die Göttin
Athene den erdgeborenen Knaben in eine Kiste eingeschlossen, ihm zwei Drachen als Wächter
beigegeben und das Kistchen den Töchtern des Kekrops zur Bewahrung überlassen habe; daß diese
aus Neugierde dasselbe eröffnet und beim Anblicke des Knaben in Wahnsinn geraten und sich von
dem Felsen der Kekropischen Burg herabgestürzt?« Krëusa bejahte die Frage schweigend, denn das
Schicksal ihres Urahns erinnerte sie an das Geschick ihres verlorenen Sohnes. Dieser aber, der vor ihr
stand, fuhr fort, unbefangen weiter zu fragen: »Sage mir auch, hohe Fürstin, ist es wahr, daß dein
Vater Erechtheus seine Töchter, deine Schwestern, auf den Ausspruch eines Orakels und mit ihrem
freien Willen dem Tode geopfert, um über die Feinde zu siegen? Und wie kam es, daß du allein
gerettet worden bist?« »Ich war«, sprach Krëusa, »ein neugeborenes Kind und lag in den Armen der
Mutter.« »Und ist es auch wahr«, so fragte der Jüngling weiter, »daß dein Vater Erechtheus von
einem Erdspalt verschlungen worden ist, daß der Dreizack Poseidons ihn verderbt hat und daß in der
Nähe seines Erdgrabes eine Grotte ist, die mein Herr, der pythische Apollo, so lieb hat?« »O schweige
mir von jener Grotte, Fremdling«, unterbrach ihn seufzend Krëusa, »in ihr ist eine Treulosigkeit und
ein großer Frevel begangen worden.« Die Fürstin schwieg eine Weile, sammelte sich wieder und
erzählte dem Jüngling, in welchem sie den Tempelhüter des Gottes erkannte, daß sie die Gemahlin
des Fürsten Xuthos und mit diesem nach Delphi gewallfahrtet sei, um für ihre unfruchtbare Ehe den
Segen Gottes zu erflehen. »Phöbos Apollo«, sprach sie mit einem Seufzer, »kennt die Ursache meiner
Kinderlosigkeit; er allein kann mir helfen.« »So bist du kinderlos, Unglückliche?« sagte betrübt der
Jüngling. »Ich bin es längst«, erwiderte Krëusa, »und ich muß deine Mutter beneiden, guter Jüngling,
die sich eines so holdseligen Sohnes erfreut.« »Ich weiß nichts von einer Mutter und von einem
Vater«, gab der junge Mann betrübt zur Antwort, »ich lag nie an eines Weibes Brust; ich weiß auch
nicht, wie ich hierhergekommen bin; nur so viel weiß ich aus dem Munde meiner Pflegemutter, der
Priesterin dieses Tempels, daß sie sich meiner erbarmt und mich großgezogen hat; das Haus des
Gottes ist seitdem meine Wohnung, und ich bin sein Knecht.« Bei diesen Mitteilungen wurde die
Fürstin sehr nachdenklich, doch drängte sie ihre Gedanken in die Brust zurück und sprach die
traurigen Worte: »Mein Sohn, ich kenne eine Frau, der es gegangen ist wie deiner Mutter; um
ihretwillen bin ich hierhergekommen und soll das Orakel befragen. So will ich denn dir, als dem
Diener des Gottes, ihr Geheimnis anvertrauen, bevor ihr jetziger Gatte, der diese Wallfahrt auch
gemacht, aber unterwegs abgelenkt ist, um das Orakel des Trophonios zu hören, den Tempel betritt.
Jene Frau behauptet, vor ihrer jetzigen Ehe mit dem großen Gotte Phöbos Apollo vermählt gewesen
zu sein und ihm ohne Wissen ihres Vaters einen Sohn geboren zu haben. Diesen setzte sie aus und
weiß seitdem nichts mehr von ihm, nicht, ob er das Sonnenlicht schaut oder nicht. Über sein Leben
oder seinen Tod den Gott auszuforschen, bin ich im Namen meiner Freundin hierhergekommen.«
»Wie lang ist es her, daß der Knabe tot ist?« fragte der Jüngling. »Wenn er noch lebte, so hätte er
dein Alter, o Knabe«, sprach Krëusa. »O wie ähnlich ist das Schicksal deiner Freundin und das
meine!«rief mit dem Ausdrucke des Schmerzes der junge Mann; »sie sucht ihren Sohn, und ich suche
meine Mutter. Doch ist, was ihr geschehen ist, fern von diesem Lande geschehen, und leider sind wir
beide einander ganz fremd. Hoffe auch nicht, daß der Gott von seinem Dreifuße dir die gewünschte
Antwort erteilen wird. Bist du doch gekommen, ihn im Namen deiner Freundin einer Treulosigkeit
anzuklagen; er wird nicht über sich selbst Richter sein wollen!« »Halt ein, Jüngling«, rief jetzt Krëusa,
»dort sehe ich den Gatten jener Frau herannahen; laß dir nichts von dem merken, was ich dir,
vielleicht allzu vertraulich, vorgeplaudert habe.«
Xuthos kam fröhlich in den Tempel und auf seine Gemahlin zugeschritten. »Frau«, rief er ihr
entgegen, »Trophonios hat einen glücklichen Ausspruch getan: ich soll nicht ohne Kinder von hinnen
ziehen! Aber sage mir, wer ist dieser junge Prophet des Gottes?« Der Jüngling trat dem Fürsten
bescheiden entgegen und erzählte ihm, wie er nur der Tempeldiener Apollos sei und im innersten
Heiligtume die vornehmsten Delphier selbst, durchs Los ausgewählt, den Dreifuß umlagern, von dem
jetzt eben die Priesterin Orakel zu geben bereit sei. Als der Fürst dieses hörte, befahl er Krëusen, sich
mit den Zweigen zu schmücken, welche Bittflehende zu tragen pflegen, und an dem Altare des
Gottes, der mit Lorbeer umwunden unter freiem Himmel stand, zu Apollo zu beten, daß er ihnen ein
günstiges Orakel senden möge. Er selbst eilte nach dem Heiligtume des Tempels, indes der junge
Schatzmeister des Gottes im Vorhofe seine Wache fortsetzte. Es hatte nicht sehr lange gedauert, so
hörte dieser die Türen des innersten Heiligtums gehen und sich dröhnend wieder schließen, dann sah
er den Xuthos in freudiger Bestürzung herauseilen; dieser warf sich mit Ungestüm dem Jüngling um
den Hals, nannte ihn zu wiederholten Malen seinen Sohn und verlangte seinen Handschlag und
Kindeskuß. Der junge Mann aber, der von alledem nichts begriff, hielt den Alten für wahnsinnig und
stieß ihn mit jugendlicher Kraft von sich. Doch Xuthos ließ sich nicht abweisen. »Der Gott selbst hat
es mir geoffenbart«, sprach er; »sein Spruch lautete: Der erste, der mir draußen begegnen würde,
der sei mein Sohn und ein Göttergeschenk. Wie das möglich ist, weiß ich zwar nicht, denn meine
Gattin hat mir nie zuvor Kinder geboren. Doch trau ich dem Gotte; mag er selbst sein Geheimnis
enthüllen.« Jetzt gab sich auch der Jüngling der Freude hin; doch halb nur, und mitten unter den
Küssen und Umarmungen seines Vaters mußte er seufzen: »O geliebte Mutter, wer bist du, wo bist
du? wann wird es mir vergönnt sein, auch dein teures Antlitz zu schauen?« Dazu kamen ihm große
Zweifel, wie die kinderlose Gemahlin des Xuthos, die er nicht zu kennen glaubte, ihn als
unerwarteten Stiefsohn aufnehmen, wie die Stadt Athen den nicht gesetzlichen Erben ihres Fürsten
empfangen würde. Sein Vater hieß ihn aber guten Mutes sein; er versprach ihm, ihn den Athenern
und seiner Gattin als einen Fremdling und nicht als seinen Sohn vorzustellen, und gab ihm den
Namen Ion, das heißt Gänger, weil er im Tempel den ihm Entgegengehenden als seinen Sohn erkannt
hatte.
Krëusa war indessen von dem Altare Apollos, vor dem sie sich betend niedergeworfen, nicht
gewichen. Sie wurde endlich in ihrem brünstigen Flehen von ihren Dienerinnen unterbrochen,
welche sich ihr unter Wehklagen nahten. »Unglückliche Herrin«, riefen sie ihr entgegen, »dein Gatte
zwar ist in große Freude versetzt, du aber wirst nie ein eigenes Kind in deine Arme nehmen und an
deine Brust legen. Ihm freilich hat Apollo einen Sohn gegeben, einen erwachsenen Sohn, den ihm vor
Zeiten wer weiß welch ein Nebenweib geboren hat; als er aus dem Tempel trat, kam ihm dieser
entgegen. Er wird sich seines wiedergefundenen Kindes freuen, du aber wirst wie zuvor einer Witwe
gleich im öden Hause wohnen.« Die arme Fürstin, deren Geist der Gott selbst mit Blindheit
geschlagen zu haben schien, daß sich ein so naheliegendes Geheimnis ihr nicht enthüllte, brütete
über ihrem traurigen Schicksal eine Weile fort. Endlich fragte sie nach der Person und dem Namen
des Stiefsohnes, den sie so unvermutet erhalten hatte. »Es ist der junge Tempelhüter, den du schon
kennst«, erwiderten die Dienerinnen; »sein Vater hat ihm den Namen Ion gegeben; wer seine Mutter
ist, wissen wir nicht; jetzt ist dein Gatte zu dem Altare des Bakchos gegangen, um heimlich für seinen
Sohn zu opfern und dann mit ihm den Erkennungsschmaus zu feiern. Uns hat er unter Androhung des
Todes verboten, dir, o Herrin, die Geschichte zu entdecken; nur unsre große Liebe zu dir hat uns
vermocht dieses Verbot zu übertreten. Du wirst uns ja nicht bei ihm verraten!« Jetzt trat aus dem
Gefolge ein alter Diener hervor, der dem Stamme der Erechthiden mit blinder Treue anhing und
seiner Gebieterin mit großer Liebe zugetan war. Dieser schalt den Fürsten Xuthos einen treulosen
Ehebrecher und ließ sich von seinem Eifer so weit verleiten, daß er ihr das Anerbieten machte, den
Bastard, der das Erbe der Erechthiden unrechtmäßigerweise an sich bringen würde, aus dem Wege
zu räumen. Krëusa glaubte sich von ihrem Gatten und von ihrem früheren Geliebten, dem Gott
Apollo, verlassen, und betäubt von ihrem Kummer, lieh sie den frevelhaften Anschlägen des Greisen
allmählich ihr Ohr und machte ihn auch zum Vertrauten ihres Verhältnisses zu dem Gott.
Als Xuthos mit Ion, in welchem er unbegreiflicherweise einen Sohn gefunden zu haben meinte, den
Tempel des Gottes verlassen hatte, begab er sich mit ihm nach dem doppelten Gipfel des Berges
Parnassos, wo der Gott Bakchos, nicht weniger heilig als Apollo selbst, von den Delphiern verehrt und
mit seinem wilden Orgiendienste von den Frauen gefeiert wurde. Nachdem er hier ein Trankopfer
ausgegossen, zum Danke für den gefundenen Sohn, errichtete Ion im Freien mit Hilfe der Diener, die
ihn begleitet hatten, ein herrliches und geräumiges Zelt, das er mit schön gewirkten Teppichen
bedeckte, die er aus Apollos Tempel hatte herbeischaffen lassen. In dem Zelte wurden lange Tafeln
aufgestellt und mit silbernen Schüsseln voll köstlicher Speisen und goldenen Bechern voll des
edelsten Weines belastet; dann sandte der Athener Xuthos seinen Herold in die Stadt Delphi und lud
sämtliche Einwohner ein, an seiner Freude teilzunehmen. Bald füllte sich das große Zelt mit
bekränzten Gästen, und sie tafelten in Herrlichkeit und Freude. Beim Nachtische trat ein alter Mann,
dessen sonderbare Gebärden den Gästen zur Belustigung dienten, mitten in den Saal des Zeltes und
maßte sich das Amt des Mundschenken an. Xuthos erkannte in ihm jenen greisen Diener seiner
Gemahlin Krëusa, lobte den Gästen seinen Eifer und seine Treue und ließ ihn arglos schalten. Der Alte
stellte sich an den Schenktisch und fing an, sich der Becher anzunehmen und die Gäste zu bedienen.
Als nun gegen Schluß des Mahles die Flöten ertönten, befahl er den Knechten, die kleinen Becher von
der Tafel wegzunehmen und den Gästen große silberne und goldene Trinkgefäße vorzusetzen. Er
selbst ergriff das herrlichste Gefäß und trat, als wollte er damit seinen neuen jungen Herrn ehren, an
den Schenktisch, füllte es zuoberst mit köstlichem Weine, schüttete aber zugleich unvermerkt ein
tödliches Gift in den Becher. Indem er sich nun damit dem Ion näherte und einige Tropfen des
Weines als Trankopfer auf den Boden goß, entfuhr zufälligerweise einem der nahestehenden
Knechte ein Fluch. Ion, der unter den heiligen Gebräuchen des Tempels aufgewachsen war, erkannte
darin eine böse Vorbedeutung und befahl, indem er den vollen Becher auf den Boden schüttete, daß
ihm ein neuer Becher gereicht würde, aus welchem er selbst feierlich das Trankopfer ausgoß,
während alle Gäste aus ihren Bechern dasselbe taten. Während dies geschah, flatterte eine Schar
heiliger Tauben, die im Tempel des Apollo unter dem Schirme des Gottes aufgefüttert wurden, lustig
in das Zelt herein. Als sie die Ströme Weines sahen, die von allen Seiten ausgegossen wurden, ließen
sie sich, lüstern gemacht, auf den Boden nieder und fingen an, von dem herumschwimmenden
Weine mit ausgereckten Schnäbeln zu nippen. Und allen übrigen schadete das Trankopfer nicht; nur
die eine Taube, die sich an die Stelle gesetzt hatte, wo Ion seinen ersten Becher ausgegossen,
schüttelte, sowie sie den Trank gekostet hatte, krampfhaft ihre Flügel, fing, zum Staunen aller Gäste,
zu ächzen und zu toben an und starb unter Flügelschlag und Zuckungen. Da erhub sich Ion von
seinem Sitze, streifte sein Gewand zürnend von den Armen, ballte die Fäuste und rief. »Wo ist der
Mensch, der mich töten wollte? Rede, Alter! denn du hast deine Hand dazu geliehen, du hast mir den
Trank gemischt!« Damit faßte er den Greis bei der Schulter, um ihn nicht wieder loszulassen. Dieser,
überrascht und erschrocken, gestand die ganze Freveltat als von Krëusen herrührend. Da verließ der
durch Apollos Orakel für des Xuthos Sohn erklärte Ion das Zelt, und alle Gäste folgten ihm in wilder
Aufregung nach. Als er draußen im Freien stand, erhub er die Hände, umringt von den vornehmsten
Delphiern, und sprach: »Heilige Erde, du bist mein Zeuge, daß dieses fremde Erechthidenweib mich
mit Gift aus dem Wege räumen will!« »Steiniget, steiniget sie!« erscholl es von der Versammlung der
Delphier wie aus einem Munde; und die ganze Stadt brach mit Ion auf, die Verbrecherin zu suchen.
Xuthos selbst, dem die schreckliche Entdeckung seine Besinnung geraubt hatte, wurde von dem
Strome mit fortgerissen, ohne zu wissen, was er tat.
Krëusa hatte am Altar Apollos die Früchte ihrer verzweifelten Tat erwartet. Diese aber keimten ganz
anders auf, als sie vermutet hatte. Ein Tosen aus der Ferne schreckte sie aus ihrer Versunkenheit auf,
und noch ehe es ganz nahe kam, war dem heranstürmenden Haufen einer der Knechte ihres
Gemahls, der ihr selbst vor andern getreu war, vorangeeilt und hatte kaum Zeit gehabt, die
Entdeckung ihres Frevels und den Beschluß, den das Volk von Delphi gefaßt hatte, ihr zu melden. Ihre
Dienerinnen scharten sich um sie. »Halte dich fest am Altare, Gebieterin«, riefen sie, »denn sollte
dich auch der heilige Ort nicht vor deinen Mördern schützen, so werden sie doch durch deine
Ermordung eine unsühnbare Blutschuld auf sich laden!« Indessen kam die tobende Schar der
Delphier, von Ion angeführt, dem Altare immer näher. Noch ehe sie bei demselben angelangt waren,
hörte man des Jünglings zürnende Worte, die der Wind durch die Lüfte führte: »Die Götter haben es
gut mit mir gemeint«, rief er in lautem Grimme, »daß dieser Frevel mich von der Stiefmutter befreien
sollte, die mich zu Athen erwartete. Wo ist die Verruchte, die Viper mit der Giftzunge, der Drache mit
dem todspeienden Flammenauge? Auf, daß die Mörderin vom höchsten Felsen in den Abgrund
gestürzt werde!« Das ihn begleitende Volk brüllte Beifall.
Jetzt waren sie am Altare angekommen, und Ion zerrte an der Frau, die seine Mutter war und in der
er nur seine Todfeindin erkannte, um sie von dem Asyl, auf dessen Heiligkeit und Unverletzlichkeit sie
sich berief, hinwegzureißen. Aber Apollo wollte nicht, daß sein eigener Sohn der Mörder seiner
Mutter würde. Auf seinen göttlichen Wink war das Gerücht von dem gedrohten Verbrechen Krëusens
und der Strafe, welche sie dafür erwartete, schnell bis in den Tempel und zu den Ohren der Priesterin
gedrungen, und der Gott hatte ihren Sinn erleuchtet, so daß sie einen raschen Blick in den
Zusammenhang aller Ereignisse warf und ihr plötzlich klar wurde, daß ihr Pflegling Ion nicht des
Xuthos, wie sie selbst nebelhaft prophezeit hatte, sondern Apollos und Krëusas Sohn sei. Sie verließ
den Dreifuß und suchte das Kistchen hervor, in welchem der neugeborene Knabe samt einigen
Erkennungszeichen, die sie gleichfalls sorgsam aufbewahrt hatte, einst zu Delphi vor dem Tempeltor
ausgesetzt worden war. Mit diesem im Arme, eilte sie ins Freie und nach dem Altare, wo Krëusa
gegen den eindringenden Ion um ihr Leben kämpfte. Als Ion die Priesterin herannahen sah, ließ er
sogleich von seiner Beute ab, ging ihr ehrerbietig entgegen und rief. »Sei mir willkommen, liebe
Mutter, denn so muß ich dich nennen, obgleich du mich nicht geboren hast! Hörst du, welchen
Nachstellungen ich entgangen bin? Kaum habe ich einen Vater gefunden, so sinnt auch schon die
böse Stiefmutter auf meinen Tod! Nun sage mir, Mutter, was soll ich tun; denn deiner Mahnung will
ich folgen!« Die Priesterin erhob warnend ihren Finger und sprach: »Ion, geh mit unbefleckter Hand
und unter günstigen Vogelzeichen nach Athen!« Ion besann sich eine Weile, eh er antwortete. »Ist
denn der nicht fleckenlos«, sprach er endlich, »der seine Feinde tötet?« »Tue du nicht also, bist du
mich gehört hast«, sagte die ehrwürdige Frau. »Siehst du dies alte Körbchen, das ich, mit frischen
Kränzen umwunden, in meinen Armen trage? In diesem bist du einst ausgesetzt worden, aus ihm
habe ich dich hervorgezogen.« Ion staunte. »Davon Mutter«, sprach er, »hast du mir nie etwas
gesagt. Warum hast du es so lange vor mir verborgen?« »Weil der Gott«, antwortete die Priesterin,
»dich bis hierher zu seinem Priester haben wollte. Jetzt, wo er dir einen Vater gegeben hat, entläßt er
dich nach Athen.« »Was soll mir aber dieses Kistchen helfen?« fragte Ion weiter. »Es enthält die
Windeln, in welchen du ausgesetzt worden bist, lieber Sohn!« antwortete die Priesterin. »Meine
Windeln?« sprach Ion heftig. »Nun, das ist ja eine Spur, die mich auf meine rechte Mutter führen
kann. O erwünschte Entdeckung!« Die Priesterin hielt ihm nun das offene Kistchen hin, und Ion griff
gierig hinein und zog die reinlich zusammengewickelte Leinwand heraus. Während er seine
betränten Augen auf die kostbaren Überbleibsel heftete, hatte sich Krëusas Angst allmählich verloren
und ein Blick auf das Kistchen ihr die ganze Wahrheit entdeckt. Mit einem Sprunge verließ sie den
Altar, und mit dem Freudenrufe: »Sohn!« hielt sie den staunenden Ion umschlungen. Diesem schlich
sich aufs neue Mißtrauen ins Herz, er fürchtete die Umarmungen der Fremden als eine Hinterlist und
wollte sich unwillig losmachen. Aber Krëusa selbst raffte sich zusammen, trat einige Schritte zurück
und sprach: »Diese Leinwand soll für mich zeugen, Kind! Wickle sie getrost auseinander; du wirst die
Zeichen finden, die ich dir angebe. Die Stickerei, die sie schmückt, ist das Werk meiner
mädchenhaften Nadel. In der Mitte des Gewebes muß sich das Gorgonenhaupt finden, umringt von
Schlangen, wie auf dem Ägisschilde!« Ungläubig entfaltete Ion die Windeln, aber mit einem
plötzlichen Freudenschrei rief er aus: »O großer Zeus, hier ist die Gorgone, hier sind die Schlangen!«
»Noch nicht genug«, sprach Krëusa, »es müssen in dem Kistchen auch kleine goldne Drachen sein,
zur Erinnerung an die Drachen in der Kiste des Erichthonios; ein Halsschmuck für das neugeborene
Knäbchen.« Ion durchforschte den Korb weiter, und mit wonnigem Lächeln zog er bald auch die
Drachenbilder hervor. »Das letzte Zeichen«, rief Krëusa, »muß ein Kranz aus den unverwelklichen
Oliven sein, die vom erstgepflanzten Ölbaume Athenes stammen und den ich meinem neugeborenen
Knaben aufgesetzt.« Ion durchsuchte den Grund des Kistchens, und seine Hand brachte einen
schönen grünen Olivenkranz hervor. »Mutter, Mutter!« rief er mit einer von schluchzenden Tränen
unterbrochenen Stimme, fiel Krëusen um den Hals und bedeckte ihre Wangen mit Küssen. Endlich riß
er sich von ihrem Halse los und verlangte nach seinem Vater Xuthos. Da entdeckte ihm Krëusa das
Geheimnis seiner Geburt und wie er des Gottes Sohn sei, dem er so lang und getreu im Tempel
gedient habe. Auch die früheren Verwicklungen und die letzte Verirrung Krëusens wurden ihm jetzt
klar, und er fand selbst den verzweifelten Anschlag seiner Mutter auf des unerkannten Sohnes Leben
verzeihlich. Xuthos nahm den Ion, obgleich nur als Stiefsohn, doch auch so als ein teures
Göttergeschenk in seine Arme, und alle drei erschienen wieder im Tempel, dem Gotte zu danken. Die
Priesterin aber weissagte von ihrem Dreifuß herab, daß Ion der Vater eines großen Stammes werden
sollte, Ionier nach seinem Namen genannt; auch dem Xuthos weissagte sie Nachkommenschaft von
Krëusen, einen Sohn, der Doros heißen und der weltberühmten Dorier Vater werden sollte. Mit so
freudigen Erfüllungen und Hoffnungen brach das Fürstenpaar von Athen mit dem glücklich
gefundenen Sohn nach der Heimat auf, und alle Einwohner Delphis gaben ihm das Geleite.
Dädalos und Ikaros
Auch Dädalos aus Athen war ein Erechthide, ein Sohn des Metion, ein Urenkel des Erechtheus. Er war
der kunstreichste Mann seiner Zeit, Baumeister, Bildhauer und Arbeiter in Stein. In den
verschiedensten Gegenden der Welt wurden Werke seiner Kunst bewundert, und von seinen
Bildsäulen sagte man, sie leben, gehen und sehen und seien für kein Bild, sondern für ein beseeltes
Geschöpf zu halten. Denn während an den Bildsäulen der früheren Meister die Augen geschlossen
waren und die Hände, von den Seiten des Körpers nicht getrennt, schlaff herunterhingen, war er der
erste, der seinen Bildern offene Augen gab, sie die Hände ausstrecken und auf schreitenden Füßen
stehen ließ. Aber so kunstreich Dädalos war, so eitel und eifersüchtig war er auch auf seine Kunst,
und diese Untugend verführte ihn zum Verbrechen und trieb ihn ins Elend. Er hatte einen
Schwestersohn namens Talos, den er in seinen eigenen Künsten unterrichtete und der noch
herrlichere Anlagen zeigte als sein Oheim und Meister. Noch als Knabe hatte Talos die Töpferscheibe
erfunden; den Kinnbacken einer Schlange, auf den er irgendwo gestoßen, gebrauchte er als Säge und
durchschnitt mit den gezackten Zähnen ein kleines Brettchen; dann ahmte er dieses Werkzeug in
Eisen nach, in dessen Schärfe er eine Reihe fortlaufender Zähne einschnitt, und wurde so der
gepriesene Erfinder der Säge. Ebenso erfand er das Drechseleisen, indem er zuerst zwei eiserne Arme
verband, von welchen der eine stillestand, während der andere sich drehte. Auch andere künstliche
Werkzeuge ersann er, alles ohne die Hilfe seines Lehrers, und erwarb sich damit hohen Ruhm.
Dädalos fing an zu befürchten, der Name des Schülers möchte größer werden als der des Meisters;
der Neid übermannte ihn, und er brachte den Knaben hinterlistig um, indem er ihn von Athenes Burg
herabstürzte. Während Dädalos mit seinem Begräbnisse beschäftigt war, wurde er überrascht; er gab
vor, eine Schlange zu verscharren. Dennoch wurde er vor dem Gerichte des Areopagos wegen eines
Mordes angeklagt und schuldig befunden. Er entwich nun und irrte anfangs flüchtig in Attika umher,
bis er weiter nach der Insel Kreta floh. Hier fand er bei dem Könige Minos eine Freistätte, ward
dessen Freund und als berühmter Künstler hoch angesehen. Er wurde von ihm auserwählt, um dem
Minotauros, einem Ungeheuer von abscheulicher Abkunft, der ein Doppelwesen war, das vom Kopfe
bis an die Schultern die Gestalt eines Stieres hatte, im übrigen aber einem Menschen glich, einen
Aufenthalt zu schaffen, wo das Ungetüm den Augen der Menschen ganz entrückt würde. Der
erfindsame Geist des Dädalos erbaute zu dem Ende das Labyrinth, ein Gebäude voll gewundener
Krümmungen, welche Augen und Füße des Betretenden verwirrten. Die unzähligen Gänge schlangen
sich ineinander wie der verworrene Lauf des geschlängelten phrygischen Flusses Mäander, der in
verzweifelndem Gange bald vorwärts‐, bald zurückfließt und oft seinen eigenen Wellen
entgegenkommt. Als der Bau vollendet war und Dädalos ihn durchmusterte, fand sich der Erfinder
selbst mit Mühe zur Schwelle zurück, ein so trügerisches Irrsal hatte er gegründet. Im innersten
dieses Labyrinthes wurde der Minotauros gehegt, und seine Speisen waren sieben Jünglinge und
sieben Jungfrauen, die, vermöge alter Zinsbarkeit, alle neun Jahre von Athen dem Könige Kretas
zugesandt werden mußten.
Indessen wurde dem Dädalos die lange Verbannung aus der geliebten Heimat doch allmählich zur
Last, und es quälte ihn, bei dem tyrannischen und selbst gegen seinen Freund mißtrauischen Könige
sein ganzes Leben auf einem vom Meere rings umschlossenen Eilande zubringen zu sollen. Sein
erfinderischer Geist sann auf Rettung. Nachdem er lange gebrütet, rief er endlich ganz freudig aus:
»Die Rettung ist gefunden; mag mich Minos immerhin von Land und Wasser aussperren, die Luft
bleibt mir doch offen; soviel Minos besitzt, über sie hat er keine Herrschergewalt. Durch die Luft will
ich davongehen!« Gesagt, getan. Dädalos überwältigte mit seinem Erfindungsgeiste die Natur. Er fing
an, Vogelfedern von verschiedener Größe so in Ordnung zu legen, daß er mit der kleinsten begann
und zu der kürzeren Feder stets eine längere fügte, so daß man glauben konnte, sie seien von selbst
ansteigend gewachsen. Diese Federn verknüpfte er in der Mitte mit Leinfäden, unten mit Wachs. Die
so vereinigten beugte er mit kaum merklicher Krümmung, so daß sie ganz das Ansehen von Flügeln
bekamen. Dädalos hatte einen Knaben namens Ikaros. Dieser stand neben ihm und mischte seine
kindischen Hände neugierig unter die künstliche Arbeit des Vaters; bald griff er nach dem Gefieder,
dessen Flaum von dem Luftzuge bewegt wurde, bald knetete er das gelbe Wachs, dessen der
Künstler sich bediente, mit Daumen und Zeigefinger. Der Vater ließ es sorglos geschehen und
lächelte zu den unbeholfenen Bemühungen seines Kindes. Nachdem er die letzte Hand an seine
Arbeit gelegt hatte, paßte sich Dädalos selbst die Flügel an den Leib, setzte sich mit ihnen ins
Gleichgewicht und schwebte leicht wie ein Vogel empor in die Lüfte. Dann, nachdem er sich wieder
zu Boden gesenkt, belehrte er auch seinen jungen Sohn Ikaros, für den ein kleineres Flügelpaar
gefertigt und bereit lag. »Flieg immer, lieber Sohn«, sprach er, »auf der Mittelstraße, damit nicht,
wenn du den Flug zu sehr nach unten senktest, die Fittiche ans Meerwasser streifen und von
Feuchtigkeit beschwert dich in die Tiefe der Wogen hinabziehen, oder wenn du dich zu hoch in die
Luftregion verstiegest, dein Gefieder den Sonnenstrahlen zu nahe komme und plötzlich Feuer fange.
Zwischen Wasser und Sonne fliege dahin, immer nur meinem Pfade durch die Luft folgend.« Unter
solchen Ermahnungen knüpfte Dädalos auch dem Sohne das Flügelpaar an die Schultern, doch
zitterte die Hand des Greisen, während er es tat, und eine bange Träne tropfte ihm auf die Hand.
Dann umarmte er den Knaben und gab ihm einen Kuß, der auch sein letzter sein sollte.
Jetzt erhoben sich beide mit ihren Flügeln. Der Vater flog voraus, sorgenvoll wie ein Vogel, der eine
zarte Brut zum erstenmal aus dem Neste in die Luft fährt. Doch schwang er besonnen und kunstvoll
das Gefieder, damit der Sohn es ihm nachtun lernte, und blickte von Zeit zu Zeit rückwärts, um zu
sehen, wie es diesem gelänge. Anfangs ging es ganz gut. Bald war ihnen die Insel Samos zur Linken,
bald Delos und Paros, die Eilande, vorüberflogen. Noch mehrere Küsten sahen sie schwinden, als der
Knabe Ikaros, durch den glücklichen Flug zuversichtlich gemacht, seinen väterlichen Führer verließ
und in verwegenem Übermute mit seinem Flügelpaar einer höheren Zone zusteuerte. Aber die
gedrohte Strafe blieb nicht aus. Die Nachbarschaft der Sonne erweichte mit allzukräftigen Strahlen
das Wachs, das die Fittiche zusammenhielt, und ehe es Ikaros nur bemerkte, waren die Flügel
aufgelöst und zu beiden Seiten den Schultern entsunken. Noch ruderte der unglückliche Jüngling und
schwang seine nackten Arme; aber er bekam keine Luft zu fassen, und plötzlich stürzte er in die Tiefe.
Er hatte den Namen seines Vaters als Hilferuf auf den Lippen; doch ehe er ihn aussprechen konnte,
hatte ihn die blaue Meeresflut verschlungen. Das alles war so schnell geschehen, daß Dädalos, hinter
sich nach seinem Sohne, wie er von Zeit zu Zeit zu tun gewohnt war, blickend, nichts mehr von ihm
gewahr wurde. »Ikaros, Ikaros!« rief er trostlos durch den leeren Luftraum: »Wo, in welchem Bezirke
der Luft soll ich dich suchen?« Endlich sandte er die ängstlich forschenden Blicke nach der Tiefe. Da
sah er im Wasser die Federn schwimmen. Nun senkte er seinen Flug und ging, die Flügel abgelegt,
ohne Trost am Ufer hin und her, wo bald die Meereswellen den Leichnam seines unglücklichen
Kindes ans Gestade spülten. Jetzt war der ermordete Talos gerächt. Der verzweifelnde Vater sorgte
für das Begräbnis des Sohnes. Es war eine Insel, wo er sich niedergelassen und wo der Leichnam ans
Ufer geschwemmt worden war. Zum ewigen Gedächtnis an das jammervolle Ereignis erhielt das
Eiland den Namen Ikaria.
Als Dädalos seinen Sohn begraben hatte, fuhr er von dieser Insel weiter nach der großen Insel
Sizilien. Hier herrschte der König Kokalos. Wie einst bei Minos auf Kreta fand er bei ihm gastliche
Aufnahme, und seine Kunst setzte die Einwohner in Erstaunen. Noch lange zeigte man da einen
künstlichen See, den er gegraben und aus dem ein breiter Fluß sich in das benachbarte Meer ergoß;
auf den steilsten Felsen, der nicht zu erstürmen war und wo kaum ein paar Bäume Platz zu haben
schienen, setzte er eine feste Stadt und führte zu ihr einen so engen und künstlich gewundenen Weg
empor, daß drei oder vier Männer hinreichten, die Feste zu verteidigen. Diese unbezwingliche Burg
wählte dann der König Kokalos zur Aufbewahrung seiner Schätze. Das dritte Werk des Dädalos auf
der Insel Sizilien war eine tiefe Höhle. Hier fing der den Dampf unterirdischen Feuers so geschickt
auf, daß der Aufenthalt in einer Grotte, die sonst feucht zu sein pflegte, so angenehm war wie in
einem gelinde geheizten Zimmer und der Körper allmählich in einen wohltätigen Schweiß kam, ohne
dabei von der Hitze belästigt zu werden. Auch den Aphroditentempel auf dem Vorgebirge Eryx
erweiterte er und weihte der Göttin eine goldene Honigzelle, die mit der größten Kunst
ausgearbeitet war und einer wirklichen Honigwabe täuschend ähnlich sah.
Nun erfuhr aber König Minos, dessen Insel der Baumeister heimlich verlassen hatte, daß Dädalos sich
nach Sizilien geflüchtet habe, und faßte den Entschluß, ihn mit einem gewaltigen Kriegsheere zu
verfolgen. Er rüstete eine ansehnliche Flotte aus und fuhr damit von Kreta nach Agrigent. Hier
schiffte er seine Landtruppen aus und schickte Botschaften an den König Kokalos, welche die
Auslieferung des Flüchtlings verlangen sollten. Aber Kokalos war über den Einfall des fremden
Tyrannen entrüstet und sann auf Mittel und Wege, ihn zu verderben. Er stellte sich an, als ginge er
auf die Absichten des Kreters ganz ein, versprach ihm in allem zu willfahren, und lud ihn zu dem Ende
zu einer Zusammenkunft ein. Minos kam und wurde mit großer Gastfreundschaft von Kokalos
aufgenommen. Ein warmes Bad sollte ihn von der Ermüdung des Weges heilen. Als er aber in der
Wanne saß, ließ Kokalos diese so lange heizen, bis Minos in dem siedenden Wasser erstickte. Die
Leiche überließ der König von Sizilien den Kretern, die mit ihm gekommen waren, unter dem
Vorgeben, der König sei im Bade ausgeglitten und in das heiße Wasser gefallen. Hierauf wurde Minos
von seinen Kriegern mit großer Pracht bei Agrigent bestattet und über seinem Grabmal ein offener
Aphroditentempel erbaut. Dädalos blieb bei dem Könige Kokalos in ununterbrochener Gunst; er zog
viele und berühmte Künstler und wurde der Gründer seiner Kunst auf Sizilien. Glücklich aber war er
seit dem Sturze seines Sohnes Ikaros nicht mehr, und während er dem Lande, das ihm Zuflucht
gewährt hatte, ein heiteres und lachendes Ansehen durch die Werke seiner Hand verlieh, durchlebte
er selbst ein kummervolles und trübsinniges Alter. Er starb auf der Insel Sizilien und wurde dort
begraben.