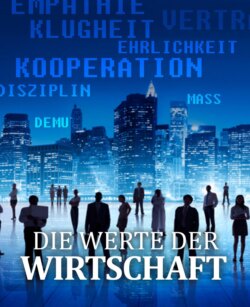Читать книгу Die Werte der Wirtschaft - Handelsblatt GmbH - Страница 2
Vorwort Mehr Wert!
ОглавлениеEs gibt Dinge, die sind nicht teuer, aber dennoch schwer zu kriegen. Wer im Weihnachtstrubel eines Buch-Kaufhauses am Rande der Düsseldorfer Kö zurzeit nach "Werten" fragt, wird von der Verkäuferin angelächelt, als suche er nach Lametta mit Wodka-Geschmack.
Werte? Tja, das ist ja jetzt mal eine ausgefallene Frage. Vielleicht im dritten Stock, rät sie, bei der Esoterik. Wenn man die Bedeutung gesellschaftlicher Großtrends an den Regal-Metern misst, die sie hier einnehmen, scheint "Glück" und die Suche danach das ganz große Ding dieses Advents zu sein. Werte haben es schwerer.
Sind die Deutschen egoistischer geworden? Der jüngste "Werte -Index" legt den Schluss nahe. Rund 1,7 Millionen Beiträge aus Blogs und sozialen Netzwerken haben Infratest und der Trendforscher Peter Wippermann auswerten lassen. Ergebnis: Gesundheit, Freiheit und Erfolg führen die Liste an.
Gesundheit ist für die Deutschen 2013 vor allem ein Gradmesser der persönlichen Optimierung. Freiheit wird als Ausdruck individueller Unabhängigkeit verstanden. Und Erfolg trägt die Fixierung auf Karriere ja schon im Namen. "Die Erwartungen an den Staat sinken. Vielmehr werden Lebensqualität, Gesundheit und Sicherheit zum eigenverantwortlichen Projekt", sagt Wippermann.
Das postmaterialistische Zeitalter, wie es der US-Politologe Ronald Inglehart in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts prophezeit hat, manifestiert sich nun in den Ich-AGs der digitalen Boheme. Aber die "Werte -Index"-Resultate sind nicht Beleg einer Abkehr von alten Idealen, sondern eher Indiz einer großen Enttäuschung.
Wir sind enttäuscht von politischen Lichtgestalten wie Barack Obama, der sich in nicht einmal einer Amtsperiode vom erhofften Messias in ein realpolitisches Rumpelstilzchen verwandelt hat. Wir sind verärgert, wenn wieder ein Multi-Funktions-Vorbild wie Uli Hoeneß beim maßlos-gierigen Zocken und anschließenden Steuerbetrug erwischt wird. Und wir sind empört über all die Schlagzeilen zu Gehaltsexzessen, gierigen Bankern und Betrugsverfahren.
Werte sind vielerorts zu Etiketten der Marketing-Abteilungen verkommen, wo es heute ebenso chronisch wie unreflektiert um Corporate Responsibility und Nachhaltigkeit in allen Lebenslagen geht. Sie sind aber ja eben nicht nur im Zusammenhang mit Cholesterin, Börsenkursen oder Spareinlagen wichtig. Es geht dabei um jene moralisch-ethischen Leitplanken, die unser Leben flankieren.
Es ist eine komische Sache mit diesen Werten, für die es keine Börse gibt, obwohl sie den Unternehmenswerten sprachlich doch so ähneln. Der simple Grund: Diese Werte haben keinen Preis. Oder können wir uns vorstellen, dass die ARD-Börsen-Kassandra Anja Kohl uns mal in der "Börse im Ersten" entgegenschwäbelt: "Mut hat 0,4 Prozent zugelegt, Disziplin 2,1 Prozent nachgegeben. Bergab ging es auch mit der Ehrlichkeit, nachdem die Koalition ..."
Vielleicht unterliegt sogar Moral konjunkturellen Zyklen. Aber es gibt keinen Werte-Dax, denn durch Geld verlieren Werte in der Regel ihren Wert. Das wiederum macht sie für den Markt interessant: Sie sind Indikatoren von großer Authentizität und Unabhängigkeit, denn letztlich wurzeln sie in der härtesten Währung: unserem Gewissen.
Kein Wunder also, dass sich Unternehmen so gern auf sie berufen. Das Problem: Richtig verstandene Werte werden zur Grundbedingung, die erst auffällt, wenn sie ausfällt. Dann aber umso schmerzhafter. Die konsequente Einhaltung (und Verteidigung) von Werten ist in den Kurs eingepreist. Erst ihre Verletzung sorgt für Kursverluste. Und obwohl sie auf keinem Markt gehandelt werden, sind Werte demnach etwas wert. Sie bilden die Grundlage unseres Handelns und Handels. Was wäre zum Beispiel das gesamte Finanzsystem ohne Vertrauen? Was eine Marktwirtschaft ohne Disziplin oder Ehrlichkeit?
Die Liste all der großen und kleinen Skandale und Affären wird dennoch jeden Tag länger. Und die Enttäuschung darüber ist derart breit, dass sie mittlerweile selbst Papst Franziskus erreicht hat. Vergangene Woche hat er sein "Evangelii Gaudium" (Freude des Evangeliums) veröffentlicht. Das Werk will eine Art Wegweiser sein. Beim Thema Wirtschaft gerät es ihm allerdings zur Generalabrechnung: "Ebenso wie das Gebot 'Du sollst nicht töten' eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein 'Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen' sagen. Diese Wirtschaft tötet."
Harte Worte des Stellvertreters Gottes auf Erden, der aus seinem persönlichen Erfahrungsschatz als einstiger Bischof in den Elendsvierteln von Buenos Aires schöpft: "Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichtemacht", schreibt Franziskus. Dieser sonst so milde Papst klagt einen seiner Meinung nach im wahrsten Sinne des Wortes wert-los gewordenen Kapitalismus an: "Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel."
Zwar steht diese Art klerikaler Kapitalismuskritik in einer langen Tradition. Und natürlich kann man gegen den Standpunkt viel einwenden. Zum Beispiel, dass die Globalisierung, der die Wirtschaft ihre Dynamik verdankt, eben nicht nur Opfer schuf, sondern auch Abermillionen Gewinner. Dass nicht überall, wo Elend herrscht, der Markt schuld ist. Oder dass Franziskus mit den dunklen Seiten seiner Vatikanbank oder der Affäre um Bischof Tebartz-van Elst im eigenen Haus einen Teil jenes Problems vorfindet, das er andernorts anprangert.
Aber Franziskus' Empörung zeigt zugleich, wie ambivalent das Thema generell ist. Moralvorstellungen, Werte, Normen müssen von jeder Generation neu verhandelt werden. Für das Frauenbild der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts kann man sich heute nur noch schämen. Und bis Ende der neunziger Jahre haben Konzerne ihre Schmiergelder sogar als "nützliche Aufwendungen" von der Steuer absetzen können. Erst danach änderten sich Gesetze und Wertvorstellungen.
Dieser permanente Veränderungsprozess steckt in jedem von uns. Selbstzweifel inklusive. Wann ist Mut noch Zivilcourage, wann wird er zum Zockertum? Ist Vertrauen immer gut oder Kontrolle manchmal besser? Und wann wird aus respektvoller Demut Kriecherei? Wer Kinder hat, sollte sich selbst fragen, welche Werte er ihnen vermitteln möchte, denn das führt zu den ehrlichsten Antworten überhaupt.
Der stetige Kampf um das Gute muss dabei keine säuerliche Mühsal sein. Selbst von Pippi Langstrumpf kann man mehr ableiten als den Spaß an Anarchie light. Steht Astrid Lindgrens Göre nicht auch für Klugheit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, für Vertrauen oder Kooperation? Das alles sind Werte, über die bekannte Köpfe heute und in den nächsten Tagen im Handelsblatt philosophieren werden. Und auch dabei wird sichtbar: Werte offenbaren uns auch die Widersprüche in uns selbst.
Sie sind zugleich konstitutiv für die Wirtschaft an sich und für das Zusammenleben von Menschen generell. Es liegt also im ureigensten Interesse der Firmen und ihrer Akteure, diese Werte nicht nur zu behaupten, sondern zu leben.
In Deutschland kann man das an vielen Familienunternehmern ablesen. Persönlichkeiten wie Bosch-Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach etwa, der Eliten zum Dienen statt Herrschen aufruft. Oder Claus Hipp, der sein Babynahrungs-Imperium ökologischen Zielen verpflichtet. Oder Götz Werner, der die Mitarbeiter seiner "dm"-Drogerie-Märkte fördert statt knechtet und dennoch - oder deshalb - zum Marktführer avancierte. Hunderte von Stiftungen kanalisieren Vermögen, um damit Gutes zu tun. Gerade in einer Zeit, da andere Vorbilder erodieren - die Kirchen übrigens ja ebenso wie große Teile der Politik - , könnte die Wirtschaft punkten. Mit mehr als nur Geld.
Ihre Alltagsrealität ist jedenfalls weit besser als ihr Ruf. Es besteht Anlass zu Optimismus auf allen Ebenen. Am Montag etwa war "Tag des Ehrenamtes". Der Bundespräsident zeichnete besondere rührige Helfer aus. 23 Millionen Bundesbürger leisten im Schnitt 16 Stunden ehrenamtliche Arbeit jeden Monat. Einfach so.
Wirtschaft ist eben nicht nur zu mindestens 50 Prozent Psychologie, wie Ludwig Erhard angeblich einst sagte: Sie lebt auch von Gefühlen und Überzeugungen. Marktwirtschaft braucht das alles, und sie braucht darüber hinaus breite Akzeptanz. Diese Akzeptanz muss verdient sein.
Ohne Werte keine Wirtschaft. So einfach ist das. Und umgekehrt gilt womöglich auch: Ohne Wirtschaft keine Werte. Das ist keine Bürde, sondern Chance.
Thomas Tuma ist stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts. Den Sinn von Werten versucht er sonst vor allem seinen beiden Töchtern näherzubringen.