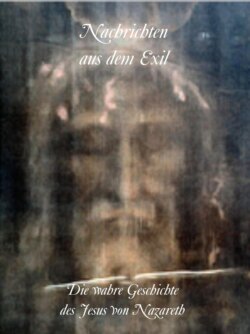Читать книгу Nachrichten aus dem Exil - Hannes Hanses - Страница 5
Die Kindheit
ОглавлениеÜber die Reise nach Ägypten wurde in unserer Familie nicht viel gesprochen.
Meine ersten eigenen Erinnerungen beziehen sich dann auch erst auf unser Leben in Alexandria.
Alexandria war in diesen Jahren eine pulsierende lebendige orientalische Stadt.
Viele verschiedene Kulturen und Rassen lebten hier friedlich nebeneinander, beeinflussten sich gegenseitig und es kam auch zu gewollten und ungewollten Vermischungen.
Unser jüdisches Viertel das sich nahe am Hafen von Alexandria befand, wo mein Vater arbeitete, grenzte an ein von indischen Menschen bewohntes Viertel. Meine Mutter verkehrte viel mit den Frauen der indischen Gemeinde und ließ sich von ihnen in die Kunst der Gewürzverwendung einweisen.
Wann immer es uns möglich war besuchten wir eines der Theater in Alexandria, um dort die Hypokritái14 zu bewundern die griechische Dramen von Aischylos, Sophokles oder Euripides oder auch Komödien von Aristophanes oder Menander aufführten.
Überhaupt entstand ein reger Gedankenaustausch zwischen den benachbarten Gruppen die hier in Alexandria in friedlicher Koexistenz lebten.
So diskutierte mein Vater nächtelang mit seinen arabischen und indischen Freunden über den Sinn der Religionen, über Gott, die Menschen und den Sinn des Lebens überhaupt.
Oft saß ich dabei und hörte mit offenen Ohren zu, schlief aber ebenso oft dabei ein, wenn die Männer kein Ende finden konnten und sich in ihre philosophischen Gedankengebäude verstrickt hatten und endlos debattierten.
Wie oft habe ich meine Mutter Jehosaf ermahnen hören, dass er seiner Gesundheit schade, wenn er sich durch das nächtelange Debattieren um den Schlaf brachte, am nächsten Morgen jedoch selbstverständlich wieder an sein schweres Tageswerk gehen musste. Wie besorgt sah meine Mutter ihrem Mann an manchem Morgen nach, wenn er übernächtigt zur Arbeit schlurfte, kaum in der Lage die Augen offen zu halten.
Häufig aber war es auch meine Mutter selbst, die meinem Vater eine schlaflose Nacht bereitete indem sie sich einander hingaben in zärtlicher Lust und Gemeinsamkeit.
Unser Heim war zu klein, als dass wir Kinder – inzwischen hatte ich einen Bruder mit Namen Jakobus und eine Schwester mit Namen Ester bekommen – das Liebesspiel und die Zärtlichkeit unserer Eltern nicht mitbekommen hätten. Wir lebten sehr frei und ungezwungen miteinander ohne falsche Scham.
In einigen Gesprächen meiner Mutter mit ihren jüdischen, indischen und arabischen Freundinnen hörte ich sie flüsternd und lachend über die Kunst des Liebens sprechen und ich beobachtete, wie diese Gespräche alle Beteiligten erregte und manchmal auch erröten ließ.
Für mich war es normal dies alles aufzunehmen und ich empfinde es rückblickend als großes Geschenk multikulturell und so frei und ungezwungen aufgewachsen zu sein.
*
Da mein Vater – wie schon gesagt – einen wachen Geist besaß der sich neuen Gedanken und Inspirationen nicht verschloss, ergaben sich in unserem Heim, oder wo auch immer sich die Männer trafen, immer rege Gespräche.
Schon früh hielt mich mein Vater dazu an mir meine eigene Meinung zu bilden und die Dinge, die mir widerfuhren, kritisch zu beleuchten.
In seinen Augen gab es kein „Schicksal“ in das man sich zu fügen hatte. Er war fest davon überzeugt, dass jeder sein eigenes so genanntes Schicksal fest in der Hand hält und aktiv an seinem eigenen Weg mitgestalten kann.
Mein Vater war durch und durch in seinem jüdischen Glauben an unseren einen Gott „J.H.V.H.“ verankert. Aber gleichzeitig verhielt er sich auch sehr liberal und so kam es, dass ich schon in jungen Jahren die Vielfalt der Religionen kennen lernte.
Natürlich bildete unser jüdischer Glaube das Fundament meiner religiösen Erziehung, doch mein Vater war weitsichtig und tolerant genug zu erkennen, welche positiven Gedanken und Ideen auch in anderen Religionen enthalten waren.
Oft schimpfte er über die Naturfeindlichkeit und Naturverachtung unserer eigenen Religion.
Dann sagte er: „Sind wir nicht alle Kinder dieser Erde, die uns mit ihrem Reichtum beschenkt? Wo wären wir denn ohne die Pflanzen und Tiere, die uns unter anderem Nahrung bieten, aber ebenso zur Freude unseres Herzens und unserer Seele beitragen.
Stehen wir über ihnen?
Sind wir ihnen etwa überlegen?“
Dann sagte er: „In diesem Punkt stimme ich mit unseren hinduistischen und buddhistischen Freunden überein!
Tiere und Pflanzen haben den gleichen Wert wie wir Menschen und sind ebenso beseelt wie wir.
Schau dir einen Affen an mit welchem Geschick er an einer Palme hinaufklettert um sich eine Banane zu holen. Mach es ihm nach und ich werde über deine Ungeschicklichkeit und dein Unvermögen die Palme zu besteigen schmunzeln.
Wie liebevoll kümmern sie sich um ihren Nachwuchs.
Wie klug und friedfertig regeln sie ihr soziales Zusammenleben.
Haben sie nicht in der Schöpfung genauso ihren Platz wie wir?
Sieh dir diese Pflanze an. Gestern hat der Händler sie mit ihrer Blüte gen Osten vor seinen Laden gestellt. Heute hat sie sich von selbst nach Süden gewandt um ihrer Blüte den hellsten und wärmsten Sonnenstrahl zu schenken. Und wie geschickt lockt sie mit ihrem betörenden Duft die Insekten an die sie zur Bestäubung benötigt.
Alles ist von unserem Schöpfer so wunderbar geregelt.
So etwas Herrliches soll also geringer sein als wir Menschen?
Nein, nein, ich stimme unseren Freunden zu: Alle Lebewesen auf dieser Erde sind Geschöpfe Gottes und haben damit dieselbe Achtung verdient, die wir für uns selbst von anderen verlangen!“
Meist schloss mein Vater solche Gedanken und Worte mit dem Satz: „Das ist meine tiefe innere Überzeugung“. Dann wussten wir, es hat keinen Zweck ihm zu widersprechen.
In unserer jüdischen Gemeinde stieß er mit solchen Gedanken häufig auf Unverständnis, besonders beim Rabbiner.
Aber das kümmerte meinen Vater wenig. Er pflegte dann zu sagen: „Gott ist groß und sein Reich hat viele Zimmer. Soll doch jeder nach seinen eigenen Überzeugungen glücklich werden“.
Dann wandte er sich an uns Kinder und beschwor uns: „Hütet euch vor jenen Menschen die behaupten sie wüssten alles und nur sie hätten recht. Das sind falsche Propheten die nur Unheil, Streit und Unglück bringen.
Kinder, seid tolerant euren Nachbarn gegenüber, verurteilt nicht die, die ihr nicht kennt, nur weil sie euch fremd erscheinen.
Geht mit offenen Ohren, Augen und Herzen durch eure Welt und nehmt erst alles unvoreingenommen auf, wägt es für euch ab, und wenn ihr feststellt dass es für euch gut ist, so eignet es euch an. Stellt ihr aber fest, dass es nicht gut ist, verurteilt es nicht, sondern sagt euch, für mich ist es nicht gut.“
In diesem Geiste wuchsen wir Kinder heran.
*
Sobald ich kräftig genug war half ich meinem Vater bei seiner Arbeit.
Ich erlernte sein Handwerk und war nicht ungeschickt darin.
Bei jeder Gelegenheit begleitete ich meinen Vater voll Freude und war stolz auf ihn und auf mich selbst, dass ich schon so groß war, ihm zur Hand zu gehen.
Mutter ermahnte meinen Vater oft mir doch die Zeit zum Spielen zu lassen.
Dann habe ich meine Mutter gehasst, denn sie verstand gar nichts. Welcher Junge will schon spielen wenn er gemeinsam mit seinem Vater arbeiten kann.
Ich war stolz darauf dass mein Vater mich zu seiner Arbeit mitnahm und mich in meinem Tun bestärkte.
Manchmal aber gab Vater nach, nämlich dann, wenn Mutter zu zänkisch wurde.
Dann musste ich Zuhause bleiben und „durfte“ spielen.
Doch wer wollte das schon.
An solchen Tagen war ich ungehalten und launisch und machte meiner Mutter das Leben schwer, so dass sie am nächsten Tag froh darüber war, wenn ich mit Vater wieder zur Arbeit ging.
Es ging uns ziemlich gut. Vater hatte Arbeit und verdiente Geld.
Unsere Familie wuchs und bald schon mussten wir uns ein neues Zuhause suchen, da unsere alte Mietwohnung zu klein geworden war.
Ganz in der Nähe unserer neuen geräumigen Bleibe lebten buddhistische Mönche, die mit ihrer Kleidung und ihren tägliche Ritualen nicht nur die Aufmerksamkeit meiner Eltern, sondern auch die meine weckten.
Sie waren sehr freundliche und hilfsbereite Menschen, und obwohl ich nicht erkennen konnte womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten, lebten sie sehr zufrieden und entspannt neben uns, und ihre innere Ruhe und Kraft strahlte geradezu aus ihnen.
Sie schienen nie hungrig zu sein, versenkten sich tagtäglich in Gebet und Meditation und lebten ausschließlich für ihren Glauben.
Ich fragte sie eines Tages wie sie das denn machen würden, immer nur beten und dabei gar nichts zu essen. Da lachte einer der Mönche und verriet mir, dass sie von den Spenden gläubiger Menschen leben würden, dass sie aber auch nicht viel zu ihrem Lebensunterhalt benötigten und dass man mittels tiefer Meditation jegliche Bedürfnisse nach Essen und Trinken oder auch andere menschliche Bedürfnisse sehr stark reduzieren könne. Es wäre ihnen ein Anliegen, so fuhr er fort, ihren Körper beherrschen zu lernen, so wie es ihr Gründer und Meister Buddha Siddharta Gautama vermocht hätte.
Ich war fasziniert von diesen bescheidenen, ruhigen und so zufrieden und glücklich wirkenden Mönchen. Immer häufiger saß ich bei ihnen anstatt mit meinem Vater zu gehen. Ich sah ihnen zu, versuchte zu begreifen und war froh, dass meine Eltern mich diese Erfahrungen sammeln ließen.
Es wurde für mich zu einem täglichen Ritual jeden Morgen in der Frühe, kurz nach Tagesanbruch, gemeinsam mit den Mönchen zu beten und zu meditieren. Ich war erstaunt, welche Ruhe und Kraft mir diese Übungen mit der Zeit gaben. Ich fragte die Mönche alles was mir in den Sinn kam und obwohl ich ein Kind war nahmen sie mich ernst.
Eine Frage die mich besonders stark beschäftigte war die nach dem Mitleid, einem sehr zentralen Aspekt der buddhistischen Religion. Die Mönche waren sehr geduldig und antworteten mir auf alle meine Fragen.
Damals habe ich nicht alles verstanden was sie mir erzählten und über ihre Religion erklärten, doch ich spürte dass ihre Religion ein ausgewogenes, auf Toleranz basierendes Miteinander aller Lebewesen auf dieser Erde zu verwirklichen suchte.
Sie betrachteten sich selbst nicht höher oder besser gestellt als Menschen anderer Nationalitäten oder anderen Glaubens. Nein, im Gegenteil. Sie sahen sich auch nicht höher gestellt als jedes beliebige Tier oder jede Pflanze. Sie sahen in jedem Geschöpf auf dieser Erde ein zu achtendes Individuum dem Respekt entgegen zu bringen ist.
Dies stand in starkem Kontrast zu unserer naturfeindlichen Religion.
Uns Juden war die Natur immer als Feind entgegen getreten, die uns Opfer und Mühen abverlangte und uns ihren Widerwillen entgegensetzte.
Bei dem Auszug unseres Volkes aus Ägypten ins gelobte Land hatte man Hunger und Durst gelitten und die Härte und Unbarmherzigkeit der Natur der Wüste erlebt.
Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelte sich allmählich der Blick auf die Natur als unserem Feind, den es zu besiegen galt.
Mosche und die späteren Führer unserer Stämme hatten uns gelehrt zu versuchen die Natur zu besiegen. Doch der Preis war hoch gewesen, und so setzte sich die Erinnerung an den Kampf gegen die Natur in unserem Gedächtnis fest. Er fand schließlich auch Eingang in unsere Rituale und Gebete und irgendwann hatte er Eingang in die Gesetze gefunden. Ein Gesetz unseres Gottes besagte sich die Natur „untertan“ zu machen und sie zu bekämpfen und zu beherrschen.
Meine buddhistischen Freunde lehrten mich jedoch, dass es auch eine andere Sichtweise geben kann. Jene nämlich, die Natur als Begleiter, als Freund und als Leben Spender zu betrachten und zu akzeptieren, nicht gegen die Natur zu leben, sondern im Einklang mit ihr.
Die Mönche lehrten mich die Individualität und den besonderen Wert eines jeden Lebewesens auf dieser Erde zu erfassen und zu schätzen.
Sie machten mich auf die Schönheit und Grazie der Tiere und Pflanzen aufmerksam.
Sie öffneten mir die Augen und das Herz und machten mich sehend für das Wunder der Schöpfung.
Durch sie erfuhr ich welches Geschenk es ist an einer Blume riechen zu dürfen und sich an ihrem süßen Duft zu berauschen.
Sie machten mir bewusst, dass sich die Pflanzen und Tiere opfern um uns als Heilmittel oder Speise zu dienen, und dass deshalb ein wahlloses Töten von Pflanzen und Tieren ein großes Verbrechen darstellt.
Und auf einmal begriff ich das Mosche wohl falsch verstanden worden sein musste als er vom „Opferlamm“ sprach.
Nicht wir opfern das Lamm unserem Gott zur Besänftigung seines Zornes oder um ihn wohl gesonnen zu stimmen, sondern Gott opfert eines seiner Geschöpfe, ein Lamm, um unseren Hunger zu stillen, um unser Überleben zu sichern. Das Lamm gibt sein Leben her, um unseres zu erhalten.
Gibt es einen noch größeren Beweis von Liebe?
Natürlich sind mir diese Einsichten in dieser Klarheit damals nicht gleich so deutlich geworden.
Ich war jung und unerfahren, ein Wanderer zwischen den Welten.
Auf der einen Seite waren da die Traditionalisten und Bewahrer, die in ihrer konservativen und unflexiblen, ja engstirnigen Auslegung der Worte und Gesetze Mosches und der Propheten meinten, unseren Glauben hier im Exil wahren zu müssen.
Auf der anderen Seite stand dem Traditionellen das Lebensgefühl, die Lebensfreude und die multikulturelle Vielfalt unseres Wohnviertels gegenüber.
Hier waren es vor allem die arabischen Händler, die indischen Kaufleute und nicht zuletzt die buddhistischen Mönche, die mit ihrer Lebensfreude und ihrem eigenen Glauben auf mich wirkten und mich zugegeben auch etwas verwirrten. Denn sehr oft standen sie im starken Kontrast zu unserer jüdischen Lebensweise und unseren Glaubensvorschriften.
Warum zum Beispiel sollte ein Schwein nicht „Koscher“ sein? – Etwa weil es im Dreck wühlt?
Auf solche oder ähnliche Fragen gaben mir meine jüdischen Lehrer entweder gar keine Antwort oder sie sagten: „Das Gesetz schreibt es so vor“.
Fragte ich meine buddhistischen Freunde etwas, so öffneten sie mir zuerst die Augen und ermunterten mich dann, selbst nach einer Antwort zu suchen.
Ich will versuchen am Beispiel mit dem Schwein zu erklären was ich damit meine.
Als ich danach fragte, warum sie glauben dass ein Schwein nach Auffassung unserer Religion als nicht koscher zu betrachten sei, weil ich den Grund dafür selbst nicht ergründen konnte, mussten meine buddhistischen Freunde zuerst einmal herzlich lachen, entschuldigten sich dann jedoch sogleich dafür, denn sie wollten mich mit einer Unhöflichkeit nicht verletzen oder sich über unsere Religion lustig machen.
Dann aber versuchten sie mir zu erklären wie sie die Angelegenheit betrachteten.
Vordergründig gesehen, so sagten sie, sei ein Schwein zwar schmutzig, denn es wühle im Dreck, wälze sich in Schlammpfützen und fresse alles was man ihm zuwerfe, beim genaueren Hinsehen jedoch, so fuhren sie fort, und wenn man es mit unserem menschlichen Verhalten vergleiche, so ergebe sich ein differenzierteres Bild des Schweins.
„Das Schwein wühlt im Dreck! Aber warum?“, fragten sie mich.
Ich antwortete: „Es sucht nach Wurzeln und Pilzen“.
„Ganz genau“, war ihre Antwort, „…und diese Wurzeln und Pilze sind für uns Menschen eine Delikatesse, die wir den Schweinen, die sie offensichtlich auch gerne essen, rauben. Wir benutzen die feine Nase der Schweine dazu, Leckerbissen für unseren Gaumen zu finden, verachten aber gleichzeitig ihr Wühlen im Dreck.
Ähnlich verhält es sich mit dem Suhlen des Schweins im Schlamm.
Wenn wir unsere Haut vor der Sonne oder vor lästigen, stechenden Insekten schützen wollen, so ziehen wir uns Kleider an. Wir legen uns sozusagen eine „zweite Haut“ zu.
Genauso verhält es sich bei den Schweinen. Ihre Haut ist sehr empfindlich; und da sie sich keine Kleider anziehen können verschaffen sie sich durch das Bad im Schlamm eine zweite Haut, die sie vor der Sonne und Insekten schützt.
Und was ihre Nahrung betrifft, so sagten wir gerade schon, dass sie Wurzeln und Pilze lieben, die wir ihnen jedoch rauben. Als schlechten Ersatz werfen wir ihnen unsere Essensreste zu.
Wenn ein Schwein also für nicht „koscher“ gehalten wird, weil es alles frisst was man ihm zuwirft, so sind wir Menschen es ebenfalls nicht, denn auch wir sind Allesfresser.
Wenn wir sagen dass sie unsere Abfälle fressen, so sollten wir uns eher dafür schämen, denn schließlich sind wir es die den Schweinen die Wurzeln und Pilze stehlen und ihnen stattdessen unsere Abfälle zuwerfen.
Also was denkst du nun Jeshua, ist ein Schwein koscher?
Schau einem Schwein in die Augen und du wirst erkennen wie intelligent es ist.
Wenn wir es essen, so hat sich das Schwein uns zum Geschenk gegeben und wir sollten dafür dankbar sein dass es sich uns als Nahrung zur Verfügung stellt.
Wir sollten ein Schwein nicht beleidigen, herabwerten und entwürdigen, nur weil es im Dreck wühlt, sich im Schlamm wälzt und unsere Essensreste frisst.
Allerdings“, so räumten sie abschließend ein, „kann es sinnvoll sein auf den Verzehr von Schweinefleisch zu verzichten.
Wenn man längere Wanderungen unternimmt so ist es ratsam, kein Schweinefleisch mitzunehmen denn es verdirbt sehr schnell in der Sonne und kann dann zu unangenehmen Durchfällen oder schlimmeren Erkrankungen führen. Wir glauben dass eure Führer das gemeint haben, als sie auf eurem Auszug aus Ägypten den Menschen rieten kein Schweinefleisch zu essen.
Aber unter normalen Bedingungen hätten sie sicher nichts dagegen gehabt.
Du siehst, Jeshua, man sollte immer alle Seiten einer Sache betrachten und nicht vorschnell urteilen.“
Von diesem Moment an betrachtete ich Schweine mit anderen Augen und ich habe es mir beherzigt nicht vorschnell Schlüsse zu ziehen oder etwas von vornherein zu verurteilen.
Im Unterricht bei den Rabbinern und Schriftgelehrten stieß ich mit meinen Ideen und Gedanken auf taube Ohren oder sogar auf Protest, wobei dies noch die harmloseste Bezeichnung für die mir entgegengebrachten Reaktionen ist.
Einer der Rabbiner, Rabbi Isaak, weigerte sich nach der Geschichte mit dem Schwein die ich ihm erzählte sogar, mich weiter zu unterrichten, bezeichnete mich als Ungläubigen, als Gotteslästerer, besserwisserisch, vorlaut und so weiter… Ich verschloss meine Ohren, wenn er seine Schimpftiraden über mich ergoss.
Meine Eltern waren nicht glücklich mit dieser Entwicklung, jedoch tolerant genug mir weiterhin zu gestatten mich mit meinen buddhistischen Freunden zu treffen, wofür ich ihnen sehr dankbar war.
Diesen offenen Gesprächen mit meinen Freunden verdanke ich viele Einsichten und Gedanken, die mir ohne ihre Offenheit und Toleranz versperrt geblieben wären.
*
Ich bin froh darüber, dass meine Eltern freiwillig nach Alexandria gegangen sind, denn Menschen die gezwungen werden ins Exil zu gehen neigen dazu, ihre ferne Heimat höher zu stilisieren und werden in ihrer verklärten Liebe zu ihrer verlorenen Heimat und zu ihrer Religion häufig fanatischer und extremer als jene, die freiwillig gingen oder dort geblieben sind und sich jeden neuen Tag den Gott werden lässt im Heimatland abmühen müssen im Kampf ums Überleben.
Genauso war es auch in unserer jüdischen Gemeinde.
Die Religiosität unserer Gemeindemitglieder war orthodoxer und gesetzestreuer als ich es je in Judäa oder Galiläa, selbst bei Pharisäern erlebt habe.
Die Sehnsucht und Liebe zu unserer Heimat war verklärt durch die Entfernung.
Alles war in der Heimat schöner, üppiger und saftiger als es der Wirklichkeit, der Realität entsprach.
Das aber war für mich, der ich die Heimat noch nicht kannte nicht erkennbar.
Das gelobte Land der Väter erschien mir aufgrund der Erzählungen wie ein Paradies und meine Sehnsucht nach diesem Zuhause wuchs, je älter ich wurde.
Natürlich störte mich die konservative und starre Haltung unserer Gemeindemitglieder.
Da aber meine Familie und besonders mein Vater eine tolerante Haltung fremden Einflüssen gegenüber einnahm, sah ich in ihm den Prototypen des aufrechten und gottesfürchtigen Juden.
Wenn meine Mutter abends mit uns am Feuer saß und uns Kindern von der Heimat erzählte, träumte ich mich dorthin; und obwohl ich Alexandria und seine multikulturell geprägte Bevölkerung sehr liebte, entwickelte sich in mir dennoch eine schmerzliche Sehnsucht das Land meiner Väter kennen zu lernen.
Aber bis zu dem Tag, an dem wir in unsere Heimat zurückwandern sollten, lebte ich zwischen den frühmorgendlichen Gebets- und Meditationsstunden mit meinen buddhistischen Freunden, der gemeinsamen Arbeit mit meinem Vater, den Religionsunterweisungen der Rabbiner und Schriftgelehrten und unseren abendlichen Freundes- und Familienrunden, wo so manche heitere und auch nachdenkliche Geschichte erzählt wurde.
Ich war ein glücklicher Junge der in einer intakten Familie mit Geschwistern und Haustieren aufwachsen durfte, von den Eltern akzeptiert, zur Übernahme von Verantwortung erzogen, dazu angehalten den Dingen und Menschen unvoreingenommen zu begegnen und frei sich seinen eigenen Interessen widmen zu dürfen.
Kurz gesagt, es ging mir, es ging uns allen richtig gut.
Doch es sollte der Tag kommen, an dem sich unser Leben radikal änderte.
Ich erinnere mich genau, es war an einem Sonntag.
Ich war inzwischen 12 Jahre alt.
An diesem Tag hatte ich in der Früh Bauchweh gehabt und deshalb meinen Vater nicht zur Arbeit begleitet.
Nachmittags um die neunte Stunde brachten sie ihn nach Hause.
Schon frühmorgens war mein Vater auf der Baustelle gewesen, hatte Balken gehobelt und zusammen mit seinen Freunden begonnen ein Dach aufzurichten. Alles lief gut. Die Arbeiter kannten einander, arbeiteten seit langem zusammen und so lief die Arbeit wie aus einer Hand.
Als sie meinen Vater zu uns nach Hause brachten, haben uns seine Freunde dies alles erzählt.
Die Mittagszeit war schon vorbei. Sie hatten sich in den Schatten einiger Bäume gesetzt und wie fast jeden Mittag während ihrer Mahlzeit debattiert. Anschließend waren sie wieder an die Arbeit gegangen. Auf dem Dach wollte mein Vater noch einige Sparren anbringen, die er zum besseren Halt in die Balken einlassen wollte. So hatte er seinen Holzhammer und einige scharfe Stecheisen mit aufs Dach genommen und bearbeitete dort den Balken.
Ob es sein gleichmäßiges Schlagen war oder nur ein großer unglücklicher Zufall? Eine der über dem Kopf meines Vaters bereits fixierten Querstreben des Daches löste sich, glitt an dem Dachbalken entlang und traf meinen Vater, der in seine Arbeit vertieft nichts von diesem Vorgang über ihm mitbekommen hatte am Kopf. Von der Querstrebe getroffen verlor mein Vater den Halt und stürzte vom Dach.
So war es gewesen und nun lag mein Vater, immer noch bewusstlos, vor unserem Heim auf der Trage und Mirjam, die sonst so besonnene Mirjam, stand hilflos dabei, in Tränen aufgelöst, unfähig Entscheidungen zu treffen.
Ich erkannte den Ernst der Situation sofort und gleichzeitig sah ich dass meine Mutter unfähig war zu handeln. Also war es an mir nun die Entscheidungen zu treffen.
„Jakobus, du holst den Arzt. Esther, du läufst schnell los und holst den Rabbi“, ich dachte man kann ja nie wissen, und ich selbst lief zu unseren buddhistischen Freunden um sie um Hilfe zu bitten.
Da sie unserem Zuhause am nächsten wohnten, waren wir auch die ersten, die wieder dort ankamen.
Eine wehklagende Gruppe von Frauen hatte sich mittlerweile um meine Mutter gescharrt und teilte mit ihr die Angst um meinen Vater.
Ich spürte das diese Frauengemeinschaft meiner Mutter gut tat, dass es ihr half gemeinsam zu fühlen, den Schmerz und die Angst zu teilen und ich begriff in diesem Moment wie wichtig es ist, wenn am Schicksal eines Anderen Anteil genommen wird.
So also wurde mir in diesem Moment klar, was meine buddhistischen Freunde unter anderem mit dem Mitleid allen Geschöpfen gegenüber meinten.
Der älteste Mönch Namens Sedûn betastete meinen bewusstlosen Vater vorsichtig und sehr konzentriert. Manchmal murmelte er kopfnickend, dann wieder verstummte er in tiefer Konzentration.
Inzwischen war auch Jakobus mit dem Arzt zurück, der nun erstaunt und bewundernd den Bewegungen und Handlungen Sedûns zusah.
Als Sedûn fertig war machte sich der Arzt daran meinen Vater zu untersuchen.
Im Nachhinein erscheint es mir seltsam dass damals alle ganz selbstverständlich akzeptierten, dass Sedûn, der nicht Arzt war, meinen Vater zuerst untersuchte und dann erst der Arzt seine Untersuchungen vornahm. Niemand rief: „Nun lasst endlich den Arzt ran“. Sedûn strahlte eine solche Ruhe und Sicherheit aus, dass sich ihm ganz selbstverständlich jeder nachordnete.
Nachdem schließlich auch der Arzt meinen Vater sehr gründlich untersucht hatte, beriet er sich sehr lange mit Sedûn. Der inzwischen ebenfalls anwesende Rabbi betete für meinen Vater.
Dann endlich wandte sich der Arzt an meine Mutter und erklärte ihr was Sedûn und er festgestellt hatten.
Mein Vater hatte sich bei seinem Sturz vom Dach die Schulter und das linke Bein gebrochen, Verletzungen, die wieder heilen würden. Gott sei Dank waren aber, so wie es schien, keine inneren Verletzungen entstanden. Der Brustkorb war geprellt, aber keine Rippe gebrochen.
Was aber Anlass zur Sorge gab, war diese tiefe Bewusstlosigkeit meines Vaters. Die Querstrebe hatte ihn am Kopf in Nähe der Schläfe getroffen. Dort, man konnte es bereits sehen, entstand ein großes Hämatom.
Nach gründlichem Betasten des Schädels waren sich sowohl Sedûn als auch der Arzt sicher, dass der Schädel selber nicht verletzt sei. Aber beide konnten nicht sagen, welche Auswirkungen der Schlag an den Kopf und der damit zusammenhängende Sturz vom Dach für meinen Vater haben würden.
Der Arzt riet zur Geduld.
Zuerst einmal bandagierte er die Schulter und schiente das Bein. Dann bereitete er einen Umschlag aus Kräutern für den Brustkorb und den Kopf. Danach sprach er eindringlich auf meine Mutter ein und ich sah, wie sie dankbar nickte.
Mein Vater lag inzwischen auf dem Bett im Wohnraum. Er war sehr blass und atmete flach.
Manchmal durchlief ein Zittern seinen Körper, dann bewegten sich die Augen unter den geschlossenen Liedern.
Obwohl mein Vater in tiefer Bewusstlosigkeit dalag, hatte ich das Gefühl, dass er die Dinge um ihn herum wahrnahm. Ich kann nicht sagen warum, denn schließlich gab er keinerlei Rückmeldung und doch ahnte ich dass er die ihm entgegengebrachte Liebe und Fürsorge spürte und dass sie ihm auch letztlich half wieder aufzutauchen und die Augen wieder aufzuschlagen.
Doch bis dahin sollten für uns noch Bange zwei Monate vergehen.
In dieser Zeit erfuhr ich eindringlich was es bedeutet Freunde zu haben und in ihrer Gemeinschaft leben zu dürfen.
Alle standen uns bei, halfen uns wo sie nur konnten und teilten mit uns was sie besaßen.
Die Freunde meines Vaters nahmen mich mit zur Arbeit, ließen mich leichte Dinge machen und teilten mit mir ihren Lohn, so dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen konnten.
Meine buddhistischen Freunde waren mir jedoch der größte Trost. Ich war jeden Tag bei ihnen, betete und meditierte mit ihnen und bat Sedûn darum mir beizubringen, was ich ihn bei meinem Vater tun sehen hatte.
Er musste über meinen kindlichen Enthusiasmus lachen, war aber gerne bereit mich in die Geheimnisse seiner medizinischen Lehren einzuweihen, soweit ich die Dinge bereits begriff.
Nur, so betonte er, bedarf es dazu eines lebenslangen Lernens und offener Ohren, Augen und eines offenen unvoreingenommenen Herzens.
Als er dann zu erzählen begann hörte ich ihm aufmerksam zu und sog alles wie ein Schwamm in mich auf.
Er war ein geduldiger Meister und ich, so hoffe ich wenigstens, ein gelehriger Schüler.
Was ich in diesen Monaten von ihm erfuhr, und was ich in dieser Zeit über das Mitleid begriff, hat mich für mein Leben geprägt und mir später die Ausbildung eigener heilender Kräfte ermöglicht.
Ich begriff, dass es wichtig ist immer den ganzen Menschen zu betrachten, ihm in sein Inneres zu sehen und zu ergründen versuchen, wo sich seine Stärken und Schwächen befinden.
Nur in einem ganzheitlichen Betrachten des Menschen liegt die Heilung.
Alles andere ist ein Herumdoktern an Symptomen.
Endlich nach langen zwei Monaten erwachte mein Vater aus dem Koma.
Die Zeit der Ruhe hatte seiner Schulter und seinem Bein gut getan. Beide Brüche waren verheilt, die Prellungen im Brustraum seit Wochen abgeklungen.
Doch diese Zeit der geistigen Abwesenheit hatte Spuren in ihm hinterlassen. So erinnerte mein Vater sich anfangs nicht an uns. Mein Vater musste sich seine Erinnerung an sein Leben vor dem Unfall mühsam zurückerkämpfen, wobei ihm leider nur wenige lichte Momente vergönnt waren und auch seine motorischen Fähigkeiten waren stark eingeschränkt.
Wenn es nicht so traurig gewesen wäre hätten wir über seine Ungeschicklichkeit beim Essen lachen können. Dieser Mann, der ein Meister seines Handwerks gewesen war und uns Kindern einst die wunderbarsten Tiere und Figuren geschnitzt hatte, musste nun erst wieder mühsam lernen wie man richtig isst und wie man Hände und Füße zu koordinieren hat, um damit effektiv zu arbeiten.
In dieser Zeit verspürte ich eine große Last auf meinen jungen Schultern.
Vieles lag nun in meinen Händen.
Die Freunde meines Vaters nahmen mich noch immer mit zur Arbeit und teilten ihren Lohn mit mir.
Nun war ich plötzlich der Mann im Haus, hatte Entscheidungen meine Geschwister betreffend zu treffen, zahlte die monatlichen Abgaben und hielt den Kontakt zur jüdischen Gemeinde aufrecht.
Am Schabbat betete ich mit den Männern in der Synagoge.
Aber in meiner Freizeit, die plötzlich einen ganz anderen Stellenwert für mich bekommen hatte und mir heilig geworden war, hielt ich mich bei meinen buddhistischen Freunden auf und ließ mich in ihre Kunst des Betens, des Meditierens und Heilens einweisen.
Mit meinen zwölf Jahren fühlte ich mich plötzlich erwachsen und dazu berufen meine Familie, die inzwischen aus neun Personen bestand, zu versorgen.
Die Rollen hatten sich vertauscht.
Mein Vater, der kluge, starke und besonnene Jehosaf, war nun ein Kind geworden, in einigen Dingen ungeschickter und ungelenker als es unser Nesthäkchen Rahel war.
Meine Mutter sah, wie ich von einem Moment auf den anderen erwachsen werden musste.
Für sie muss die Belastung noch größer gewesen sein als für mich, denn letztlich war sie für alles verantwortlich.
So gut es ging versuchte ich ihr die Dinge abzunehmen, doch ihre Sorge um unsere Familie konnte ich ihr nicht nehmen.
Und obwohl wir uns in Alexandria in all den Jahren sehr wohl gefühlt hatten entschied sie, dass wir unter diesen Bedingungen zurückgehen sollten. Zurück in unsere Heimat. Zurück nach Nazareth in Galiläa.
Dort lebten Verwandte die uns beistehen würden. Da war ein Heim für das nicht monatlich Miete zu zahlen wäre. Dort würden ihre Kinder in der Tradition der Väter aufwachsen und erzogen werden. Dort war, zumindest in ihren Augen, Sicherheit.
Noch eine Veränderung hatte sich ergeben. Mirjam teilte nun mit mir ihre Überlegungen die Rückkehr in die Heimat betreffend. Vater konnte ihr dabei keine Hilfe mehr sein. Er war im Moment, so schien es uns, glücklich in seiner eigenen Welt, doch nicht zugänglich für den täglichen Überlebenskampf im Hier und Jetzt.
Obwohl mich der Gedanke die Freunde verlassen zu müssen sehr schmerzte, war ich doch gleichzeitig auch innerlich aufgewühlt und erregt ob der Vorfreude auf die Heimat der Väter.
Nun endlich sollte ich das Paradies der Erzählungen meiner Mutter und meiner daraus ersponnenen Träume kennen lernen.
Wehmut beschlich mich.
Es war eine Zeit des Wechselbades der Gefühle.
Wie sollte ich nur mit der Trennung von unseren Freunden umgehen?
Wie den Verlust des täglichen Gesprächs mit Sedûn und seinen Mönchsbrüdern verkraften?
In all der Zeit hatten sie meiner Familie und besonders mir beigestanden, hatten mich das Leben gelehrt und mich, den Juden, in ihrer Mitte aufgenommen. Ohne die Kraft die sie mir schenkten und mir dadurch vermittelten, dass sie mich in ihre Religiosität und ihren Glauben eintauchen ließen, hätte ich die damalige Zeit nicht so unbeschadet überstanden.
Ich glaube dass das auch ein Grund war, warum Mutter in die Heimat zurück wollte. Sie erkannte dass besonders mir, aber auch meinen Geschwistern die Kindheit genommen werden würde, wenn wir hier in Alexandria bleiben würden.
Sie hat niemals über diesen Aspekt unserer Rückkehr in die Heimat gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass dies für sie der wichtigste Grund war.
Sie wollte uns schützen, uns ein unbeschwertes und freies Aufwachsen und Erblühen ermöglichen und sah dafür die besseren Chancen zu Hause, im Umfeld unserer Verwandten.
Manchmal murmelte sie leise vor sich hin: „Blut ist dicker als Wasser“.
Ich habe damals nicht verstanden was sie damit meinte. Heute weiß ich es.
Sie musste sich selber Mut machen den Schritt zurück in die Heimat zu wagen.
Zwölf Jahre waren sie nun schon aus Nazareth fort. Eine lange Zeit. Und wenn auch immer ein spärlicher Kontakt bestanden hatte, so war man sich in den Jahren doch fremd geworden.
Hier im Umfeld unserer Freunde war uns alles vertraut. Man teilte Freud und Leid miteinander.
Aber die Menschen, die Familien kamen und gingen. Man begleitete sich immer nur ein Stück des Lebensweges und trennte sich dann doch wieder irgendwann auf nimmer Wiedersehen.
Die Heimat, die Verwandtschaft versprach Kontinuität und Sicherheit, man würde sich nie ganz aus den Augen verlieren.
Außerdem glaube ich, dass meine Mutter trotz all ihrer Freundinnen und ihrer guten nachbarschaftlichen Beziehungen immer Heimweh nach zu Hause gehabt hat.
So brachen wir dann am 15. September15 auf um in das Land unserer Väter zurückzuwandern.
Voll Vorfreude aber auch voll Wehmut nahmen wir Abschied von Alexandria.
Wir waren einst zu dritt, mit nichts in den Händen außer der Energie, dem Fleiß, der Handwerkskunst und dem Willen meines Vaters und meiner Mutter nach Ägypten gekommen. Jetzt kehrten wir also zurück, wiederum mit nichts in den Händen.
Unsere Familie bestand inzwischen aus neun Personen. Doch es fehlte der tatkräftige, sich seines Geschickes gewisse Vater.
Die Sorge um unsere Zukunft lastete nun allein auf den Schultern meiner Mutter und zum Teil auch auf den meinen. Und so waren Mirjams und meine Gedanken auf dem Weg zurück in die Heimat ein wenig schwerer und finsterer als jene der anderen Familienmitglieder.
*
Auch um diese Wanderung zurück in die Heimat rankt sich heute eine Legende, die ich hier aufklären möchte.
Auf unserem Weg zurück nach Nazareth in Galiläa – der mich auch nach Beer-Sheva führte, dem Wohnort unseres Erzvaters Abraham und seines Sohnes Isaak, dem Stammvater unseres Volkes, die dort in der Wüste eigenhändig Brunnen gegraben hatten, um das Überleben ihrer Sippe zu sichern – machte unsere Familie, wie es bei Juden so Brauch ist, Station in Jerusalem.
Mutter wollte für Vater und die ganze Familie beten und gleichzeitig Gott danken, dass es uns bisher so gut ergangen war. Alle ihre Kinder waren gesund, was in jenen Jahren nicht selbstverständlich war. Mirjam war inzwischen sechsundzwanzig und mein Vater dreißig Jahre alt. Außerdem sollte in Jerusalem meine Bar Mitzwah gefeiert werden. Ich war inzwischen fast dreizehn Jahre alt und damit reif für die rituelle Aufnahme in die Gemeinschaft der Männer.
Auf dem Weg zurück nach Jerusalem und von dort weiter nach Nazareth waren immer wieder Erinnerungsbruchstücke in Jehosaf aufgestiegen und es gab Momente, in denen man klar und vernünftig mit Vater reden konnte.
Ein Hoffnungsschimmer zeichnete sich ab.
Auch dafür wollte Mutter im Tempel danken und beten. Und so verweilten wir einige Tage in Jerusalem um uns anschließend einer Pilgergruppe anzuschließen die sich auf dem Rückweg nach Galiläa befand.
Da es Frauen nur sehr bedingt erlaubt ist die Heiligtümer des Tempels zu betreten, war es an mir, die Opfer darzubringen und die Gebete im Tempel zu sprechen.
In einer solchen Situation nun ergab sich die Gelegenheit mit einigen der damals führenden Köpfe der Jerusalemer Geistlichkeit ins Gespräch zu kommen.
Zu Anfang war es nur gutmütiges Wohlwollen das sie mir, einem zwölfjährigen Jungen entgegenbrachten, doch im Laufe der Gespräche wandelte sich ihr väterliches Wohlwollen in Interesse. Ich hatte das Glück auf progressive Geistliche zu treffen, die mit wachsendem Interesse meinen Betrachtungen und Interpretationen der Worte der Propheten lauschten.
Damals fiel mir auf, dass im Zentrum der Macht, hier der Glaubensmacht, die Toleranz Andersdenkender gegenüber wesentlich stärker ausgeprägt ist als an der Peripherie.
Vielleicht liegt es daran, dass jene, die sich im Zentrum der Macht befinden keine so große Angst mehr vor Machtverlust haben müssen. Das lässt sie scheinbar offener und unbefangener werden.
Auch wenn ich mit meinen Gedanken von damals in der Runde meiner Zuhörer niemandes Gedanken- und Glaubensgebäude erschüttern konnte, so waren sie doch in sich sicher und gefestigt genug andere Gedanken und Auslegungen zu ertragen und zu tolerieren. Zumindest konnten sie vorurteilsfrei zuhören.
Während dieser Diskussionen hatte ich die Zeit vollkommen vergessen. Ich fühlte mich erinnert an meine tiefgehenden und ausführlichen Dispute mit meinen buddhistischen Freunden und hatte darüber aus den Augen verloren, dass wir mit der Pilgergruppe weiterreisen wollten.
So geschah es, dass meine Familie ohne mich gen Galiläa aufbrach.
Da es sich um eine recht große Pilgergruppe handelte, war meiner Mutter und meinen Geschwistern vorerst gar nicht aufgefallen dass ich fehlte. Außerdem hatten sie sich um meinen Vater und die jüngeren Geschwister zu kümmern und so nahmen sie an, dass ich mich wohl mit Gleichaltrigen irgendwo in der Gruppe aufhalten würde.
Ich war indes so in die Diskussionen mit den Schriftgelehrten vertieft, dass ich jegliches Zeitgefühl verloren hatte.
Erst als Jakobus mich einen Tag nach ihrem Aufbruch im Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel fand, wurde mir bewusst, wie viel Zeit inzwischen verstrichen war und was eigentlich wichtig gewesen wäre, nämlich die gemeinsame Weiterreise und die Mithilfe bei der Versorgung meiner Familie.
Schuldbewusst begleitete ich Jakobus und wir erreichten erst bei Anbruch der Dunkelheit des zweiten Tages, nach ihrem gemeinsamen Aufbruch, die Pilgergruppe und meine Familie.
Mirjam machte mir keine Vorwürfe. Sie war nur besorgt gewesen.
Aber das war nicht nötig gewesen und Vorwürfe machte ich mir schon selbst.
Ich empfand mich als unverantwortlich und egoistisch meiner Familie gegenüber.
Gleichzeitig hatte ich das Gefühl im Tempel ausgenutzt worden zu sein.
Meine buddhistischen Freunde hatten mich immer darauf hingewiesen, dass ich Grenzen zu setzen hätte, und dass neben dem Gebet und der Meditation gerade der Mensch und die Familie ein wichtiges Gut darstelle und nicht vernachlässigt werden dürfe. Sie hatten es verstanden Grenzen zu ziehen und die Zeit einzuteilen gelernt, so dass bei ihnen niemand und nichts zu kurz kam. Ihnen war an der Gesamtheit gelegen.
Bei den Schriftgelehrten nun hatte ich feststellen müssen, dass sie nur die Auslegung der Schriften im Auge hatten. Für sie existierte nichts anderes als die Schrift. Sie ließen sich bedienen und lebten wie in einem goldenen Käfig.
Sie hatten es interessant gefunden was ich zu sagen hatte, hatten meine Deutungen und Auslegungen zwar skeptisch doch auch anerkennend zur Kenntnis genommen.
Aber sie hatten mich benutzt, benutzt um Anregungen zu sammeln und hatten dabei meine zwischenmenschlichen Verpflichtungen vollkommen außer Acht gelassen.
Ihnen wäre niemals in den Sinn gekommen mich auf meine Familie und meine Pflichten ihr gegenüber aufmerksam zu machen. Für sie zählte nur die Schrift.
Sie saßen in ihrem „geistigen Elfenbeinturm“ und glaubten, dass alles sich ihnen unter- und nachzuordnen hätte. Der Mensch und das alltägliche Leben außerhalb der Tempelmauern war zweitrangig oder spielte gar keine Rolle für sie.
Ich erkannte, dass ein so enges Fixiert sein auf die Schrift und das Gesetz nicht gut sein konnte.
Ich war froh wieder bei meiner Familie zu sein. Meine beiden kleinsten Geschwister Schimon und Rahel begrüßten mich mit stürmischen Umarmungen. Die ganzen folgenden Nächte lagen sie, ihre Ärmchen eng um mich geschlungen, an mich gedrückt und träumten, wie ich, von unserem neuen Zuhause, von dem Mutter, Jakobus oder ich ihnen immer wieder erzählen mussten.