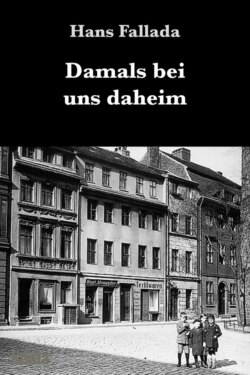Читать книгу Damals bei uns daheim - Ханс Фаллада - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Penne
ОглавлениеIn der Schule, oder, wie wir sie nur nannten, in der Penne spielte ich zu jener Zeit eine höchst unselige Rolle. Ich ging auf das Prinz-Heinrich-Gymnasium in der Grunewaldstraße, und das war damals ein sehr feines Gymnasium, womit gesagt werden soll, daß dort in der Hauptsache die Söhne vom Offiziers- und Beamtenadel, auch von reichen Leuten die Schulbank drückten. Meine Eltern aber waren für äußerste Sparsamkeit, so kam es, daß ich, war eine Hose durchgerutscht, keine neue bekam, sondern daß meine Mutter ein paar handfeste Flicken in die arg verwundete setzte. Da sie nun aber oft keinen genau passenden Stoff hatte, so wurden ohne erhebliche Hemmung auch andere Stoffe dafür gewählt. Das ist nun gut fünfunddreißig Jahre her, und doch sehe ich diese Hose des Unheils noch genau vor mir: es war eine dunkelblaue Bleyle-Hose, und mit grauen Flicken wurde sie geziert.
Ach, über den Hohn und das Gespött, die mir diese Hose eingetragen hat! Es waren natürlich nicht die wirklich »Feinen« in der Klasse, die mich damit aufzogen. Die übersahen den Defekt vornehm, freilich war ich auch für jeden Umgang mit ihnen erledigt. Fragte ich sie etwas, so antworteten sie mir nur kurz mit geringschätziger Herablassung, was mich tief schmerzte und auch empörte. Aber die andern, die Coyoten der Wölfe gewissermaßen, wie offen und schamlos verhöhnten sie mich! Da war einer, ein langer Laban, über einen Kopf war er größer als ich, Friedemann hieß die Canaille, im Unterricht durch äußerste Unwissenheit ausgezeichnet, schon dreimal bei der Versetzung »kleben« geblieben – aber etwas verstand dieser Bursche ausgezeichnet: mich zu zwiebeln!
Wenn die große Pause gekommen war, die wir alle auf dem Schulhof verbringen mußten, machte er sich an mich heran, bugsierte mich viel Schwächeren in eine Ecke des Hofes, wo wir vor den Augen des aufsichtsführenden Lehrers einigermaßen sicher waren, und begann ein Gespräch mit mir, über Näh- und Flickarbeit etwa. Bald hatte sich ein ganzer Kreis von Zuhörern um uns gesammelt die »Feinen« natürlich nur an seiner äußersten Peripherie. Bei besonders trefflichen Witzen wurde tobend gelacht und applaudiert, Friedemann auch zu noch besseren Leistungen angefeuert.
Ich sehe mich da noch stehen, blaß, kränklich, verzweifelt in meinem Mauerwinkel. Die ganze Penne freute sich ihrer Freiviertelstunde, mir war sie eine Qual. Immer atmete ich auf, wenn es wieder zum Unterricht läutete. Listig versuchte ich, meinen Peinigern zu entgehen. Ach, ich war nicht so überaus listig! Versteckte ich mich beim Beginn der großen Pause im Klassenzimmer, so stöberte mich sicher in den ersten drei Minuten ein Lehrer auf und schickte mich mit einem strengen Verweis auf den Hof, denn wir sollten nun einmal in der großen Pause frische Luft schnappen. Riegelte ich mich aber auf der Toilette ein, so hatte mein Quälgeist das bald heraus. Er trommelte so lange gegen die Tür, bis ich klein beigeben und mich ihm stellen mußte.
Oh, wie ich ihn gehaßt habe, diesen langen Friedemann mit seinem weißen, pickligen Gesicht, mit den frechen blassen Augen hinter einer Nickelbrille! Wenn er da mit seiner näselnden, überlegenen Stimme anfing, mich nach meiner Ansicht über Flickschneiderei zu befragen, über die Farbwahl bei Flicken, ob ich Rot nicht für eine wunderschöne Farbe hielte, nein, nicht? Aber vielleicht Grün mit Rot, rechts Rot, links Grün, und ein gelber Flicken vorne –? (Beifallsgejohle der andern.) Mein Vater flickte ja wohl auch meine Schuhe, der Rüster an meinem rechten Schuh sehe ihm ganz danach aus! Da könne man eben nichts machen, es gebe heile Familien und es gebe geflickte Familien. Es sei nur gut, daß ein Exemplar der Flickfamilien auf diesem Gymnasium vertreten sei, als Anschauungsmaterial.
Auf all diese öden und bösen Scherze antwortete ich meinem Quälgeist nie mit einem Wort. Ich starrte ihn nur an, ich starrte den Kreis der Zuhörer an, Verzweiflung im Herzen und doch immer in der Hoffnung, mir werde ein Retter erstehen. Aber nie sprach auch nur einer von den Jungen für mich. Mit all der Grausamkeit der Jugend duldeten sie dieses endlose Verspotten, ermunterten es durch Zuhören, wurden seiner nie müde.
Man hatte damals eben sehr ausgesprochene Ansichten über das, was schicklich war. Und am Prinz-Heinrich-Gymnasium waren geflickte Hosen eben unschicklich, es war nur richtig, wenn mir das begreiflich gemacht wurde! Und meine gute Mutter war ohne alles Verständnis für meine Klagen.
»Sag nur deinen Jungens«, meinte sie, »daß du drei Geschwister hast und daß wir sehr sparen müssen. Berlin ist schrecklich teuer, und Vater geht nicht davon ab, alle Jahre zehn Prozent seines Einkommens zurückzulegen, für Notzeiten. Das kommt euch Kindern allen doch einmal zugute. Nein, dein Anzug ist heil und sauber, wo kämen wir da hin, wenn ich für jede durchgerutschte Hose eine neue kaufen sollte –?!«
Ich sah das ein, und ich sah es doch wieder nicht ein. Ich fand, meine Eltern sollten mich lieber nicht auf eine so feine Schule schicken, wenn sie nicht in der Lage waren, mich wie die andern Jungens zu halten. Ich versuchte auch, meiner Mutter wenigstens anzudeuten, wie sehr ich gequält wurde. Aber das nahm sie nur leicht, das verstand sie gar nicht.
»Das sind so Jungenswitze«, meinte sie. »In einer Woche haben sie es über, dann kommt wieder etwas Neues. Und du bist auch viel zu empfindlich, Junge, du verstehst wirklich schlecht Spaß. Es ist ganz gut, wenn du dich mal an so etwas gewöhnst.«
Aber weder gewöhnte ich mich daran, noch kam etwas Neues, an dem Friedemann seinen Geist hätte laben können. Unerbittlich blieb ich das Ziel seines Spottes. Immer neue Versionen fand er, darin war sein Kopf recht anschlägig, Bis mich in irgendeiner Pause meine Verzweiflung zu einem Angriff auf den viel Stärkeren trieb, ich sprang an ihm hoch, warf ihm die Brille von der Nase und zerkratzte ihm das Gesicht. Er fiel hin, so überraschend war ihm mein Angriff gekommen. Ich lag auf ihm, mit einem Gefühl überwältigender Genugtuung verprügelte ich ihn, und er wagte nicht einen Schlag gegen mich, er, der große starke Kerl gegen mich Schwächling!
Ja, bei dieser Gelegenheit stellte es sich heraus, daß der Verhöhner Friedemann ein ausgemachter Feigling war. Die ganze Klasse sah es, und von diesem Moment an waren er und sein Spott für alle erledigt, das muß ich zugestehen. Er machte Tage später, als er sich von meinem Angriff erholt hatte, noch einen einzigen Versuch, wieder von meinen Flicken anzufangen, aber sofort verwies es ihm einer: »Du hältst die Klappe, Friedemann! Damit ist ein für allemal Schluß!«
Ich hatte mir Duldung meiner Flicken erkloppt, aber damit war noch nicht viel gewonnen. Ich blieb der Außenseiter. In den Pausen wollte keiner mit mir gehen, niemand mochte mein Freund sein. So geriet ich allmählich immer mehr in einen Zustand tiefster Niedergeschlagenheit, der meinen Leistungen im Unterricht nicht förderlich sein konnte. Und ich muß sagen, wir hatten, um das noch zu verschlimmern, damals einige Lehrer, die alles andere, nur keine Pädagogen waren. Jedem durchschnittlichen Beobachter hätte schließlich mein verschüchterter, elender Zustand auffallen müssen, doch nicht diesen Erziehern der Jugend.
Da war unser Deutschlehrer, ein noch jüngerer, mit sehr viel Schmissen gezierter Herr, der eine gewisse Vorliebe für mich hatte. Freilich äußerte er diese auf eine mir sehr peinliche Weise. Da ich zu den schlechtesten Schülern der Klasse gehörte, saß ich in der vordersten Bankreihe, direkt unter dem Lehrerpult. Herr Gräber, so hieß dieser Lehrer, verachtete es, oben auf dem Pult wie ein Gott über seinen Schülern zu thronen. Er begab sich mitten unter sie, wandelte die Gänge zwischen den Pulten auf und ab, stand aber am liebsten vor meinem Platz. Und während er nun von hier seine Knaben lebhaft und mit schallender Stimme unterrichtete, beschäftigten sich seine Hände pausenlos mit meiner Frisur ...
Trotzdem ich damals schon elf oder zwölf Jahre alt war, trug ich noch immer mein Haar lang. Meine Mutter hatte sich trotz all meiner Bitten nicht entschließen können, mein fast weißes Blondhaar der Schere eines Friseurs auszuliefern. So fielen mir lange blonde Locken fast bis auf die Schultern, und in der Stirn hatte ich etwas, das offiziell »Ponnies« hieß, das meine böswilligen Mitschüler aber »Simpelfransen« nannten. Diese Ponnies oder Simpelfransen übten eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf die Finger von Herrn Gräber aus. Die ganze Unterrichtsstunde hindurch waren seine Finger nur damit beschäftigt, aus den Fransen Zöpfchen zu drehen, kleine, sehr feste, steif von der Stirn abstehende Zöpfchen. Das hatte wohl den nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß Herr Gräber mich nie nach etwas fragte. Für die Deutschstunde war ich stets aufgabenfrei und bekam doch eine gute Zensur. Aber wenn Herr Gräber mich dann beim Schluß der Unterrichtsstunde aufforderte, mich zu erheben, und meinen Anblick der Klasse darbot, wenn dann die unausbleibliche Lachsalve losbrach, so hätte ich lieber eine Fünf statt dieser Heiterkeit hingenommen.
Selbst in meinem damaligen Zustande tiefster Niedergeschlagenheit war ich mir klar darüber, daß dies alles von Seiten Herrn Gräbers ohne den geringsten bösen Willen geschah. Es war reine Spielerei von ihm, in die wohl auch ein Gutteil Nervosität gemengt war. Ihm bedeutete es nur Spaß, und er wäre sicher sehr erstaunt gewesen zu hören, daß ich diesen Spaß gar nicht sehr spaßhaft fand.
Wesentlich böser dachte ich über Professor Olearius, unsern Klassenlehrer, der uns in die Geheimnisse der lateinischen Sprache einführte. Das war ein langer, knochiger Mann, schwarzbärtig, mit einem hageren Gesicht und glühenden schwarzen Augen. Er war ein Altphilologe von reinstem Wasser. Für ihn hatte auf der Welt nur das Lateinische und Altgriechische Bedeutung, und den Schüler, der sich in diesen Sprachen untüchtig erwies, haßte er mit einem ausgesprochen persönlichen Haß, als habe der Schüler dem Lehrer eine schwere Beleidigung zugefügt. Er hatte eine verdammt höhnische Art, die schwächeren von uns aufzurufen und zu zwiebeln, die heute hoffentlich ausgestorben ist.
Da hieß es etwa: »Jetzt wollen wir mal unser Schwachköpfchen aufrufen. Zwar weiß es nichts und wird auch diesmal nichts wissen, aber er diene uns allen zum abschreckenden Beispiel.« Oder: »Der Fallada, der Fallada ist bloß zum Sitzenbleiben da!« Oder: »O Fallada, der du hangest! Wenn das dein Vater wüßte, das Schulgeld würde ihn reuen!«
Bei solchen ermunternden Aufrufen verflüchtete sich natürlich auch der letzte Rest meines Wissens, und ich stand wirklich da wie ein rechter Schwachkopf! Je mehr er auf diese höhnische Art fragte, um so tiefer versank ich im unergründlichen Sumpfe des Quatsches und muß ein wirklich klägliches Bild geboten haben. So konnte Professor Olearius mit einigem Recht sagen: »Seht ihn euch an! Was er hier eigentlich auf dem Gymnasium will, wird mir ewig rätselhaft bleiben!« Und mit allem dummstolzen Akademikerdünkel: »Die Pantinenschule wäre gerade das Rechte für ihn!«
Worauf ich prompt in Tränen ausbrach!
Überhaupt gewöhnte ich mir das Heulen bei Professor Olearius an. Es war das einzige Mittel, das ich entdeckte, seiner Anmaßung zu entgehen. Sobald er mich nur aufrief, fing ich an zu heulen. Ich machte überhaupt nicht mehr den Versuch, eine seiner Fragen zu beantworten. Er würde mich doch über kurz oder lang zum Heulen bringen, also heulte ich lieber gleich los. Dies kam so weit, daß die Klasse vor der Lateinstunde Wetten abschloß, ob ich heulen würde oder nicht. Ich wurde ermuntert, scharf gemacht: »Tu uns den einzigen Gefallen und heul heute einmal nicht! Mensch, nimm dich doch einmal zusammen!«
Aber ich konnte mir noch so viel Mühe geben, ich heulte doch. Als Steigerung meiner Qualen hatte sich Professor Olearius ausgedacht, mich aufs Lehrerpult an die schwarze Wandtafel zu rufen. Da ich vor Heulen nicht sprechen konnte, sollte ich meine Antworten auf die Tafel schreiben. Wenn dann dort, statt amavissem, amatus essem stand, klopfte er mit seinem harten Knöchel kräftig gegen meinen Schädel, wobei er den Spruch zitierte: »Denn wer da anklopfet, dem wird aufgetan!«
Dieses Klopfen, das er so lange wiederholte, bis die richtige Antwort an der Tafel stand, tat ausgesprochen weh. An diesem feinen Gymnasium war alles Schlagen der Schüler dem Lehrer aufs strengste verboten – es ging das Gerücht von einem Professor, der einem Schüler eine Ohrfeige gehauen und ihm dabei mit dem Siegelring eine leichte Schramme versetzt hatte, dieser Lehrer sei sofort aus dem Schuldienst entlassen worden. Aber dieses neckische Klopfen von Professor Olearius konnte keinesfalls als körperliche Züchtigung gelten, obwohl es zweifelsohne eine war.
Einige Jahre später hat es der Zufall gefügt, daß ich mit Professor Olearius auf der Hinterplattform eines Straßenbahnwagens zusammentraf. Er erkannte mich sofort wieder, wie ich ihn sofort erkannte und sofort wieder den alten Haß gegen ihn im Herzen spürte. Damals ging ich längst auf ein anderes Gymnasium und war löblicher Obertertianer ...
Mit der alten dünkelhaften Überlegenheit wandte sich Professor Olearius, ohne die geringste Rücksicht auf die andern Fahrgäste, an mich und sprach: »Nun, du beklagenswerter Fallada? – An welcher Erziehungsanstalt bringst du jetzt unselige Lehrer ihrem Grabe näher?«
Aber ich war nicht mehr der verschüchterte Junge aus der Quinta oder Quarta. Ich hatte mittlerweile die Erfahrung gemacht, daß ich nicht dümmer war als andere und bestimmt klüger als dieser alte Pauker, für den die Welt aus lateinischen und griechischen Verben bestand. So antwortete ich ganz laut: »Ich kenne Sie nicht, und wenn ich Sie kennen würde, würde ich einen Menschen wie Sie niemals grüßen!«
Sprach's, sah ihn bleich werden bei dieser öffentlichen Kränkung und sprang ab von der Elektrischen, Jubel über meine doch recht schülerhafte Rache im Herzen.
Aber damals war an Rache noch nicht zu denken. Jeden Morgen beim Aufwachen lag die ganze Penne mit Kameraden, Lehrern, Schularbeiten wie ein Alpdruck vor mir. Wenn ich mich irgend von ihr drücken konnte, tat ich es. Da ich sehr kränklich war und meine Eltern in steter Angst um meine Gesundheit lebten, war es nicht sehr schwer für mich, oft zu Haus bleiben zu dürfen. Sah ich gar zu wohl aus, und schien der Tag mir ganz unüberwindlich, so schlich ich mich heimlich in die Speisekammer und nahm ein paar kräftige Schlucke aus der Essigflasche. Dann wurde ich so geisterbleich, daß meine Mutter mich ganz von selbst ins Bett schickte.
Da lag ich dann Stunden und Tage und las und las. Ich wurde es nicht müde, meinen Marryat und meinen Gerstäcker und den heimlich geliehenen Karl May zu lesen. Je untragbarer mir mein Alltagsleben erschien, um so dringlicher suchte ich Zuflucht bei den Helden meiner Abenteuerbücher. Mit ihnen fuhr ich zur See, bestand die schwersten Stürme, auf einer Rahe beim Segelreffen schaukelnd (ich wäre beim leisesten Windstoß hinuntergeflogen!), schwamm zu einer wüsten Insel (ich konnte nicht schwimmen) und führte dort ein Robinsondasein, ferne allen geflickten Hosen, gedrehten Zöpfchen und Heulerchen im Latein.
Von diesen Träumen war es nur ein Schritt bis zu dem erst spielerischen Gedanken, all diesem Elend hier zu entfliehen, wirklich ein Schiffsjunge zu werden und wirklich Schiffbruch und Landung auf einer Insel zu erleben. Je öfter ich daran dachte, um so leichter erschien mir die Ausführung.
Erst nur andeutungsweise, dann schon ernster sprach ich mit Hans Fötsch darüber und fand zu meiner Überraschung bei ihm ein offenes Ohr. Auch Hans Fötsch war es müde, länger dieses ungerechte Dasein zu ertragen. Zwar in der Schule hatte er, wie er mir erzählte, keine Schwierigkeiten. Dafür aber war er »Schuss« mit seinem Vater, der den Sohn, mehr als dieser für angemessen hielt, mit Backpfeifen und Prügeln traktierte und überhaupt ein höchst ungerechter, tollwütiger Berserker war.
Allmählich nahmen unsere Pläne immer festere Gestalt an. Wir beschlossen, nach Hamburg zu fahren und uns dort als Schiffsjungen auf einer Bark oder Brigg anheuern zu lassen. Am schwierigsten schien es, nach Hamburg zu kommen. Waren wir erst einmal dort, würde alles schon glatt gehen. Nach dem, was wir gelesen hatten, war man in allen Häfen ganz wild nach Schiffsjungen aus den besseren Ständen. Wir erkundeten, daß ein Zug nach Hamburg um die Stunde ging, zu der wir uns morgens in der Schule einzufinden hatten, das war also in Ordnung. Auch die Beschaffung von Reiseproviant konnte im Hinblick auf die elterlichen Speisekammern nicht schwierig sein. Vorsorglich fingen wir schon an, Konserven aller Art zu klauen, und trugen dadurch lebhafte Unruhe und schwarze Verdächte in den Schoß unserer Familien ...
Am schwierigsten erschien die Beschaffung des Reisegeldes. Wir setzten den Mindestbetrag, den wir brauchen würden, auf zwanzig Mark fest – aber zwanzig Mark waren eine ungeheure Summe, ferne allen Schülermöglichkeiten. Hans Fötsch verlegte sich darauf, die Taschen des väterlichen Mantels zu revidieren. Ich hielt fleißig Ausschau nach dem Portemonnaie meiner Mutter. Aber was wir erbeuteten, waren nur Groschen – nach drei Wochen kleiner Mausereien hatten wir noch keine zwei Mark zusammen.
Da entschloß ich mich zu einem großen Wagnis. Ich wußte, daß Vater das während des Monats benötigte Geld im Mittelfach seines Schreibtisches aufbewahrte: Silber und kleines Geld in einer offenen Drahtkassette, die Goldfüchse aber in zwei netten kleinen weißen Beutelchen, auf die Fiete im Kreuzstich »zehn Mark« und »zwanzig Mark« gestickt hatte. Diese Schublade war zwar immer verschlossen, aber es gab soviel Schränke und Kommoden in unserm Haus, in denen Schlüssel steckten, daß ich überzeugt war, einer davon werde schon passen.
Morgens stand ich nun als allererster auf und schlich, während alles noch schlief, auf Socken durch die Wohnung, Schlüssel probierend. Schließlich paßte zu meinem Unheil wirklich einer. Die Geldschublade lag offen vor mir, und in den beiden kleinen Geldsäckchen klingelte es angenehm. Nach langem Überlegen entschloß ich mich, ein Zehn- und ein Zwanzig-Mark-Stück zu nehmen. Ich glaubte, mein Vater werde den Verlust weniger leicht merken, wenn in jedem Beutel nur ein, als wenn in einem Beutel zwei Goldstücke fehlten. Trotzdem Hans Fötsch und ich fest ausgemacht hatten, noch aus Hamburg von der Anzahlung auf unsere Heuer Vater das Geld zurückzusenden, klopfte bei dieser Zwangsanleihe mein Herz doch sehr. Wohl war mir dabei nicht zumute, und stumm saß ich, mit gesenkten Augen, beim Kaffeetisch.
Noch auf meinem Schulweg gelang es mir, Hans Fötsch abzufangen und ihm zu sagen, daß mein Vorhaben gelungen sei. Da uns beiden noch längeres Verweilen unter so drückenden Umständen unmöglich schien, wurde die Flucht schon auf den nächsten Morgen festgesetzt.
An diesem Nachmittag hatten wir unendlich viel zu tun. Mit einer wahren Wonne warfen wir die Bücher aus unserer Schultasche und füllten sie mit Konserven und sehr wenig Wäsche. Schularbeiten wurden natürlich nicht mehr gemacht, wir hatten unsere Schiffe hinter uns verbrannt. Vom Bäcker holten wir Schrippen und vom Fleischer Leberwurst, dies schien uns der richtige Reiseproviant. Das Geld wurde zwischen uns so geteilt, daß Hans Fötsch das Zehn-Mark-Stück, ich aber den Zwanzigmärker bekam. Am späten Abend erst trennten wir uns, beide sehr erregt. Als Zeit unseres Treffens am nächsten Morgen war halb acht Uhr festgesetzt.
Ob ich in dieser Nacht viel geschlafen habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls werden durch meine Träume Briggs, die mit geblähten weißen Segeln vorm Winde dahinflogen, gespukt haben.
An der Frühstückstafel am nächsten Morgen nahm ganz ungewohnt mein Vater teil, der sonst immer erst um zehn, halb elf Uhr frühstückte, da er, der größeren Ruhe wegen, meistens nachts bis gegen zwei, drei Uhr morgens arbeitete. Aber ich achtete nicht auf diese befremdliche Änderung seiner Gewohnheiten, wie ich nicht auf seine Blicke achtete. Ich war viel zu sehr mit meinen Plänen und Hoffnungen beschäftigt. Endlich war es so weit!
Kurz vor halb acht Uhr schnappte ich meine ungewohnt schwere Tasche und rannte auf die Straße vor Fötschens Haus. Ich mußte fünf, ich mußte zehn Minuten warten – meine Aufregung wurde immer fieberhafter. War etwas dazwischen gekommen oder war es nur die gewöhnliche Bummelei von Hans Fötsch –?
Dann kam er – aber wie ward mir, als ich ihn an der Hand seiner Mutter daherwandeln sah –?! Zur Salzsäule erstarrt blickte ich auf meinen blassen, verheulten Freund und das strenge Gesicht seiner Mutter, die ihn eher als Gefangenen mit sich schleppte, denn wie eine Mutter ihren Sohn führte! Nahe, ganz nahe gingen die beiden an mir vorüber. Hans wagte mich nicht anzusehen, seine Mutter aber bedachte mich mit einem vor Empörung sprühenden Blick und zischte: »Du Bube du!«
Dann waren sie an mir vorüber, sie schritten die Luitpoldstraße hinab und verschwanden um die Ecke meinen Blicken. Ich war völlig zerschmettert. Also war unser Vorhaben doch verraten, und ich war dazu verurteilt, weiter die verhaßte Schulbank zu drücken, Spott und Kränkungen zu ertragen! Ade du freies Schiffsjungendasein! Ade fröhliche Fahrten vor dem Wind, während die Delphine um unser Schiff spielen! Ade ihr sonnigen Palmeninseln der Südsee!
Aber was sollte ich jetzt tun –? Was in aller Welt sollte ich jetzt tun –?! Ich konnte doch nicht wieder hinauf zu uns, den Inhalt meiner Schultasche wechseln und einfach in die Penne gehen? Ich hatte ja nicht einmal Schularbeiten gemacht!
Ich stand noch völlig unentschlossen, keines rechten Gedankens fähig, als mein Vater, der mich so lange hinter einer Litfaßsäule hervor beobachtet hatte, mich an der Schulter faßte. »Also ist es wirklich wahr«, sagte er tieftraurig, »was mir Frau Fötsch erzählt hat, daß ihr ausreißen wolltet? Und mit gestohlenem Gelde –! Komm, Hans, du mußt jetzt deiner Mutter und mir erzählen, wie unser Junge zu etwas Derartigem kommen konnte. Du hast ja einen Diebstahl begangen, einen schweren Diebstahl sogar, du kennst doch die Unterscheidungen! Und Hans Fötsch hast du auch verführt!«
Wir waren oben. Mit angstvollem Gesicht hatte meine Mutter mich erwartet. Jetzt ging sie uns voran in meines Vaters Arbeitszimmer, die Tür schloß sich hinter uns, und ich stand als Angeklagter vor meinen Eltern. Jetzt half kein Lügen und Leugnen mehr, es gab zu viel Beweismittel gegen mich, denn Hans Fötsch hatte alles gestanden!
Am Abend zuvor war seiner Mutter zufällig die Schultasche in die Hand geraten, grade weil sie Hans an einem ungewohnten Platz aufbewahrt hatte, ihre Schwere hatte sie stutzig gemacht, und von da bis zu einem Geständnis war nur ein kurzer Schritt gewesen. Leider aber hatte sich Hans nicht als getreuer Freund erwiesen, sondern hatte sich völlig als den Verführten hingestellt, auch meinen Diebstahl gebührend angeprangert, während er seine eigenen kleinen Mausereien mit Stillschweigen übergangen hatte. Noch in der Nacht waren Fötschens zu meinen Eltern geeilt und hatten lebhafte Klage über mich geführt. Ihrem Sohn war jedenfalls aller weitere Verkehr mit mir untersagt worden.
All dies hatte meine Eltern natürlich sehr schwer gekränkt. Meinen Vater betrübte am meisten der Diebstahl, den er grade als Richter schwerer nahm als jeder unjuristische Vater. Mutter verstand nicht, daß mir bei all ihrer liebevollen Fürsorge die Verhältnisse im Elternhaus so unerträglich erschienen waren. Besonders mein Mangel an Vertrauen hatte sie tief verletzt.
Leider habe ich von Kind auf nie die Gabe besessen, mich aussprechen zu können. Wie ich keinem, nicht einmal dem Freunde Hans Fötsch, etwas Näheres über meine Schulmiseren hatte erzählen können, so war es mir auch in dieser Stunde notwendiger Geständnisse nicht gegeben, meinen Eltern mehr als ein paar kümmerliche Fetzen von meinen Drangsalen zu berichten. Was sie da hörten, schien ihnen ganz unbefriedigend, keinesfalls ausreichend zur Begründung eines so wahnsinnigen Schrittes.
Immerhin hielt es mein Vater, der wohl wußte, daß ein Untersuchungsrichter Material nicht nur gegen, sondern auch für den Beschuldigten zusammenzutragen hat, es für seine Pflicht, sich erst einmal in der Schule zu erkundigen, was eigentlich mit mir los sei. Bis dahin wurde ich in meinem Zimmer bei hinreichend Schularbeiten eingeschlossen.
Mit inniger Befriedigung muß Professor Olearius den betrübten Bericht meines Vaters angehört haben. Dahin kamen also die Burschen, die sich weigerten, lateinische Verben zu lernen! Schiffsjunge – wahrhaftig! Und er gab meinem armen Vater die schwärzeste Schilderung von meinen Neigungen, Charakter, Fähigkeiten.
»Ich muß Ihnen empfehlen, mein sehr verehrter Herr Kammergerichtsrat«, schloß Professor Olearius triumphierend, »Ihren Sohn sofort vom Gymnasium abzumelden. Schon damit er einem consilium abeundi entgeht, denn ich fühle mich verpflichtet, das mir von Ihnen Mitgeteilte dem Lehrerkollegium zu unterbreiten. Für die weitere Bildung Ihres Sohnes halte ich nun freilich eine Volksschule für das höchst Erreichbare, vielleicht wäre noch richtiger eine Anstalt für geistig zurückgebliebene Kinder. Dieses ewige Heulen, diese Unfähigkeit, auch die einfachsten lateinischen Formen zu erlernen, scheinen mir auf einen leichten Schwachsinn zu deuten.«
Mein Vater war geneigt gewesen, schwarz, sehr schwarz von meinen Vergehen zu denken. Aber diesen böswilligen Übertreibungen gegenüber empörte sich sein Vaterherz. Er meinte seinen Sohn anders und besser zu kennen. Und wenn dieser Lehrer seinen Sohn so beurteilte, sprach das nicht gegen den Sohn, sondern gegen den Lehrer!
Recht erregt antwortete er, daß er seinen Sohn allerdings mit sofortiger Wirkung vom Gymnasium abmelde, aber nur, um ihn sofort auf einem andern Gymnasium anzumelden. Er hoffe dort auf einsichtigere Pädagogen.
Mit unerschütterlicher Überlegenheit behauptete Professor Olearius, auch dort werde ich völlig versagen, ich sei nun einmal unheilbar schwach begabt ...
Die Herren trennten sich in einiger Erregung, nicht sehr Gutes von einander denkend. Professor Olearius beklagte die Affenliebe mancher Väter, mein Vater die Einsichtslosigkeit des Schulmonarchen. Immerhin habe ich es aber nur den bösen Auskünften von Professor Olearius zu danken, daß mein Vater in wesentlich milderer Stimmung nach Haus kam. Der Diebstahl blieb wohl immer noch ein sehr dunkler Fleck, aber die Verzweiflung, in der ich mich bei einem so verständnislosen Lehrer befunden haben mußte, entschuldigte vieles.
Noch am gleichen Tage wurde ich beim Bismarck-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf angemeldet. Vorsichtig ließ mein Vater ein paar Worte über meine Verschüchterung und Mutlosigkeit fallen. Und sie fielen bei meinen neuen Lehrern auf guten Grund. In der ersten Zeit ließen sie mich ganz zufrieden, und als sie mich dann langsam in das Wechselspiel von Frage und Antwort einbezogen, geschah dies mit solcher Vorsicht und Güte, daß ich nie mehr verschüchtert war, sondern sagen konnte, was ich wußte.
Da nun auch meine Klassenkameraden nicht ahnten, daß ich einmal der armselige Prügelesel einer Klasse gewesen war, und da am Bismarck-Gymnasium keinerlei Vorurteil gegen geflickte Hosen bestand, habe ich armer, schwachsinniger Knabe mir bald einen guten Platz erobert und war schon bei der nächsten Versetzung der Sechste unter Zweiunddreißig.
Mein lieber Vater aber, dessen Herz sonst nie etwas von Rache wußte, ließ eine beglaubigte Abschrift dieses Zeugnisses anfertigen und sandte sie an Professor Olearius mit einem kleinen Begleitschreiben, wie der Herr Professor jetzt über meine Fähigkeiten denke? Ob er nicht doch vielleicht einräume, sich mit seiner Beurteilung geirrt zu haben?
Natürlich ist nie eine Antwort gekommen.
Manchmal sahen Hans Fötsch und ich uns noch auf der Luitpoldstraße. Aber wir sprachen nie wieder ein Wort miteinander, wir wagten nicht einmal, einander ins Auge zu sehen ...