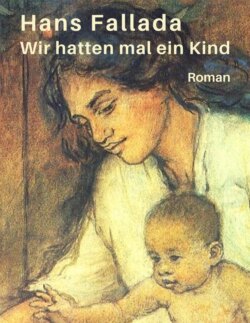Читать книгу Fallada - Wir hatten mal ein Kind - Ханс Фаллада - Страница 5
Zweiter Abschnitt: Die Jugendgeschichte des Helden I.
ОглавлениеSolcher Art waren die Vorfahren, solcher Art war die Hofstätte des Johannes Gäntschow, der am zwölften März 1893 geboren wurde. Er war eins von vielen Geschwistern, aber, obgleich er den Hof erbte, war er weder der älteste noch der jüngste Sohn, sondern der dritte oder vierte. So genau kann man das gar nicht sagen, denn im ganzen waren es elf Kinder, die aus der Ehe des Malte Gäntschow mit der Hedwig, geborenen Düllmann, entsproßten, und da manche von den Kindern sehr früh starben, wußten, nachdem eine Reihe von Jahren vergangen war, selbst die Eltern nicht mehr so genau, das wievielte Kind ein jedes war. Nur die Schlußsumme blieb haften: elf – und wenn man bedachte, dass nur fünf Kilometer weiter ein Dorf Baumgarten lag, unterhalb des Leuchtturms von Sagitta, in dem die Leute überhaupt nie Kinder kriegten und in dem Hof auf Hof, von Generation zu Generation, ausstarb und immer wieder an entfernte Verwandte fiel, die dann auch wieder ausstarben, so kann man das Ergebnis auf Warder nicht schlecht nennen.
Und doch war es schlecht, denn als Johannes Gäntschow, achtundzwanzig Jahre alt, den Hof nach seines Vaters Tode übernahm, da war kein einziges von seinen zehn Geschwistern mehr da, das ihm den Besitz streitig gemacht hätte. Sie waren jung und älter gestorben, an Krankheiten oder Unglücksfällen, oder sie waren auch einfach abhanden gekommen, wie sein ältester Bruder Alwert – für das ganze Leben abhanden gekommen, und das war vielleicht die schlimmste Art, einem Bruder im Erbe Platz zu machen. Es war ganz, als sei aller Lebenswille der ganzen Nachkommenschaft von der Zerfahrenheit und Ziellosigkeit der geborenen Düllmann angesteckt worden. Da waren sie da, aber sie mussten nicht da sein, sie waren ganz zufällig da, und so gingen sie wieder durch Zufall ab, bei irgendeiner kleinen lächerlichen Krankheit, oder auch in einem Jauchenloch – es kam schon nicht darauf an.
Dieses letzten Falles, des mit dem Jauchenloch, erinnerte sich Johannes Gäntschow durch sein ganzes Leben sehr genau, denn damit war sein schlimmer Streit mit dem Vater verknüpft, der ihn vom Hof und in die Welt hinaustrieb. Das war in einer jener Zeiten gewesen, da sein Vater wieder einmal – zum wievielten Male! – Freundschaft mit allen seinen Nachbarn, mit denen er sich durch Jahre verstritten hatte, schloß und entweder im Kirchdorfkruge oder auf den umliegenden Höfen oder bei sich wochenlang herumtrank. Malte Gäntschow war ja sonst ein sehr pedantischer, verschlossener, wortkarger Mensch, der am liebsten ganz für sich allein lebte. Aber da war diese Frau, die immer wie ein Huhn war, das in der Küche erwischt wird und sinnlos gegen alle Wände, Töpfe, Fenster anflattert, obgleich die Tür weit offensteht. Da waren diese Kinder, die gerade anfingen, einem zu helfen und Freude zu machen, Händchen in Hand mit dem Vater aufs Feld zu laufen, und schon starben sie oder waren weg. Und da war der zweite Malte in der eigenen Brust, der da fand, es sei wirklich Einsamkeit genug auf diesen ewig umstürmten, ewig nebligen Einzelhöfen, in einem kleinen Bauernhaus, in dem es immer angeschmuddelt und unpünktlich zuging, mit verdorbenen Eßvorräten und verdorbenen Dienstmädchen. Und dann brach es aus ihm und er fühlte die Eiseskälte in der Brust, er löste die Zunge, er trank, er saß mit den anderen Bauern, gierig hörte er ihnen zu, er schwelgte mit ihnen. Goldene Welt der Gemeinschaft, aus dem klaren Korn des Schnapsglases. Guter Freund aller guten Freunde, aus dem lockeren, zitternden Schaum der Biergläser.
Dann ging er beschwingt heim, er sang, er pfiff, er wirbelte den Handstock – alles war gut. War es kalt draußen, so lief ihm eines der Kinder entgegen und bugsierte den Vater nach Haus, denn es war vorgekommen, dass Malte Gäntschow sich einfach in einen Graben zum Schlafen gelegt hatte und nach vielen Stunden Suchens halb erfroren gefunden worden war. Die Kinder taten das gerne, denn nie war der Vater zutunlicher und fröhlicher, als wenn er so angedudelt heimmarschierte. Anzumerken war ihm sonst äußerlich kaum etwas, nur eben, dass er viel redete. Er ging bolzengerade, so viel er auch getrunken haben mochte. Er war eben immer ein riesenstarker Mann.
An diesem Abend im ersten Drittel Dezember hatten die Kinder stundenlang beisammengesessen und auf den Vater gewartet. Ein paarmal war die Mutter erschienen und hatte heftig und böse mit ihnen gescholten, als seien sie schuld daran: die Sauftour müsse nun endlich ein Ende nehmen, was sich Vater wohl dächte, keinen Pfennig Geld mehr im Hause, bei jedem Kaufmann im Kirchdorf Schulden, dass man sich nicht ein Pfund Zucker zu kaufen getraue, und es würde ja doch nur wieder Feindschaft aus all diesen betrunkenen Anbiedereien. Dann hörten die Kinder sie seufzend, scheltend und weinend den Säugling im Nebenzimmer besorgen, und dann wurde es ganz still, dass man nur den fürchterlichen Ostwind gegen die Fenster stoßen hörte.
In diesem Jahre war der Frost sehr früh und ganz überraschend gekommen – bei abnehmendem Monde. Jetzt bei vollem Monde war es noch kälter, die Fenster standen bis oben hin voll Eis, und man musste in Vaters Stube lange gegen die Scheibe hauchen, um auf dem Außenthermometer zu sehen, dass es zwölf Grad Kälte waren. Trotzdem man dreimal aufgelegt hatte, war die Stube nicht warm zu kriegen gewesen. Es zog durch die Tür- und Fensterritzen, und so hatten sich alle Kinder, eins nach dem anderen, in die Betten verkrochen, bis auf Alwert, den Ältesten, die große Schwester Frieda und Johannes.
Johannes fror auch sehr und eigentlich war er müde, aber er war heute daran, dem Vater entgegenzulaufen, und das wollte er sich nicht entgehen lassen. Er war nämlich des Vaters Liebling, und er war vielleicht der einzige, der es dem Vater beibringen konnte, dass weder Kartoffel- noch Rübenmieten ordentlich gegen den starken Frost zugedeckt waren und dass der Kühmann angefangen hatte, heimlich Milch beiseite zu bringen. Davon flüsterte der Neunjährige leise mit Frieda, der Elfjährigen. Sie durften keinesfalls den großen Bruder Alwert stören, der in einem Buche las.
Du musst eben sehen, wie Vater ist, hatte Frieda gesagt. Redet er viel, so wartest du eben, bis er ein bißchen schläfrig wird. Aber die Hauptsache ist doch, dass du ihn bei diesem Wetter nach Haus kriegst, Hannes.
Ja, ja, sagte Johannes gedankenvoll, und dachte böse an die drei hölzernen Eggen, die angefroren auf dem Felde liegengeblieben waren und die nun verkamen. Er hatte versucht, sie allein in den Schuppen zu schaffen, aber dafür war er noch zu schwach. Der Pferdeknecht hatte ihn spöttisch gefragt, ob er jetzt der Großbauer geworden sei, dass er schon Anordnungen gäbe, und Alwert hatte natürlich wieder mal keine Zeit gehabt.
Johannes saß da mit dem langen, schmalen, mageren Gesicht, über dem Nasensattel selbst jetzt Sommersprossen, mit sehr hellen Augen. Die Zähne hatte er fest aufeinander gebissen, er brummte sein Jaja nur, er musste immer an alles denken, was jetzt auf dem Hof verkam und gestohlen wurde. Er war sehr böse, auf die Schule, die ihn nicht zur Hofarbeit kommen ließ, auf Alwert, den Gleichgültigen, auf Schwester Frieda, die nicht einsehen wollte, dass Hofarbeit wichtiger war als Hausarbeit, auf die Mutter, die ewig Kinder kriegte und darüber zu nichts kam, nur nicht auf den Vater, der eben so war, wie er war. Daran war nichts zu ändern, wie eben auch an dem Frost draußen nicht. Aber er sprach von alldem nicht. Er biß die Zähne zusammen und dachte darüber nach, wie er es dem Vater beibringen könnte, ohne dass der zornig würde. Als sie nun so alle drei dasaßen, alle drei Kinder derselben Mutter, in derselben Stube und jedes sehr allein für sich, als da der Wind gegen die Scheiben fauchte, die Eisränder immer höher krochen, die Nacht fast von Minute zu Minute mondheller und strahlender wurde, hörten sie heranklingendes Schlittengeläute, dann das rasende, zornige Gebell der Hundemeute, das Knallen der Fahrpeitsche, Winseln getroffener Hunde und das beruhigende Hoho! des Kutschers zu den Pferden.
Johannes war der erste draußen. Nachbar Schlicht rief ihm zu, dass der Vater nicht habe mitfahren wollen, aber schon kurz vor ihm aufgebrochen sei aus dem Krug. Der Schlitten klingelte wieder los. Hannes schlüpfte in seine kaninchenfellgefütterte Joppe, setzte eine Pelzmütze auf und lief in Holzpantoffeln los, ohne auf das zu achten, was ihm Frieda nachrief. Kaum war er von der Hofstatt, sprang ihn der eisige Ostwind an, dass das Atmen in Nase und Lunge schmerzte. Aber er lief scharf weiter. Auf der Chaussee schlitterte er lange, lange Strecken im Mondlicht auf dem spiegelglatt gefahrenen Schnee. Es war bis auf das Windrauschen und das Brummen der Telegrafendrähte totenstill. Kein menschlicher Laut, kein Hundebellen, alles hatte sich in die Häuser verkrochen.
Der Junge lief immer weiter. Er sah schon in der Ferne über dem flachen Land die weiß beschneiten Dächer des Kirchdorfes, er überlegte, in welchem der Häuser der Vater vielleicht klebengeblieben sein könnte. Dann sah er ihn in der Auffahrt zum Windmühlenhügel sitzen, mit offener Joppe im Winde auf einem Stein. Auf einem andern Stein stand in Reichweite eine Selterbuddel.
Macht kalt, Vater, sagte der Junge und blieb vor dem Alten stehen. Der Alte sagte nichts. Er saß stillschweigend da. Sein Gesicht sah grauweiß aus im Mondlicht, die Augen waren schwarze, grundlose Höhlen, der Mund mit dem Bart ein schwarz hingewischter dicker Strich. Kommst du nicht heim, Vater? fragte der Junge. Ist doch kalt auf dem Stein.
Der Vater machte eine abwehrende Handbewegung. Er murmelte was wie: Laß, hat doch keinen Zweck. Damit faßte er nach der Flasche.
Der junge Johannes begriff, dass Vaters Sauftour wieder einmal am Ende war, dass der Vater aber an diesem Abend so viel getrunken hatte, dass er jetzt ganz verzweifelt war und sich selbst vor ihm, seinem Sohne, schämte. Er begriff, dass es jetzt nicht mehr um schlecht zugedeckte Kartoffelmieten und gestohlene Milch ging, sondern nur darum, den Vater heimzukriegen. Dass der aber gar nicht mehr heim wollte, sondern hier sitzenbleiben, voller Wut auf die Welt und voller Scham über sich selbst, sitzenbleiben, bis er steifgefroren war.
Der Junge begriff das alles in den zwei oder drei Sekunden, die der Vater nach der Schnapsflasche grabbelte, und gerade als der Vater sie an den Mund setzen wollte, sagte er: Mich friert mächtig, Vater, laß mich auch einen trinken.
Der Vater behielt die Flasche weiter an den Lippen, aber er hob das Gesicht etwas gegen den Sohn. Er trank noch nicht, er fragte: Trinkst du jetzt Schnaps, Hannes?
Wenn mich so friert, sagte der Sohn trotzig.
Der Vater hatte die Schnapsflasche halb sinken lassen, der Sohn sah genau an seinem Gesicht, wie er sich mühte, nachzudenken. Er wartete darauf, dass der Vater zornig werden würde, denn dann war alles gut. Darum sagte er noch: Schnaps wärmt schön, Vater. Wieder das bemühte Nachdenken. Der Vater bewegte die Lippen, atemlos wartete der Sohn – da lachte der Vater plötzlich schallend los, hielt dem Jungen die Schnapsflasche hin und sagte: Na, nimm einen, Hannes.
Der erste Versuch war missglückt. Aber schon hatte Hannes einen zweiten Plan gefaßt: er musste dem Vater möglichst viel Schnaps wegtrinken. Der Junge wußte vom Geruch, von ein oder zwei Versuchen mit Gläserneigen her, dass Schnaps bitter und scharf, also schlecht schmeckte. Es gab darum nur ein Mittel für ihn, dem Vater möglichst viel wegzutrinken, er musste den Schnaps, so rasch es ging, in sich hineingießen.
Er legte also den Kopf zurück, setzte den Flaschenhals an die Lippen und goß den Schnaps hinter. Er war nur ein neunjähriger Junge, und es war ein richtiger achtunddreißigprozentiger Kornschnaps. Er brannte im Hals wie Feuer und fraß die Luft weg. Ein- oder zweimal verschluckte sich der Junge, Ekel und Übelkeit stiegen in ihm hoch, aber er kämpfte sie nieder, er musste doch den Vater, auf den er unverwandt während des Trinkens sah, von seinem Stein hochkriegen. Ihm kam es vor, als schluckte er schon stundenlang an diesem widerlichen Gift, ehe der Vater den Kopf hob und mühsam sagte: Laß mir auch was drin, Hannes.
Der Junge setzte die Flasche ab, er wollte sprechen, er wollte sagen – das hatte er sich überlegt –, dass ihn immer noch fröre und dass er darum weitertrinken wollte, aber er brachte nichts heraus wie einen heiser krächzenden Laut, seine Stimmbänder waren gelähmt.
Der Vater sah aufmerksamer hoch, der Sohn machte einen Schritt zurück, er setzte wieder die Flasche an und trank wieder. Nun war sein ganzer Schlund schon eine brennende Spur den Leib herunter. Der Magen war eine dumpfe, aufwärts stoßende Masse, in der ein schmerzhaftes Feuer brannte. Aber er sperrte einfach den Rachen auf und goß weiter Schnaps in sich.
Laß das! sagte der Vater scharf, es war beinahe der alte Stimmklang, wenn er böse war.
Hannes machte nur eine abwehrende Bewegung mit den Händen und trank weiter. Er glaubte, er könne es nicht mehr ertragen. Jetzt wurde sein Kopf schwindlig, er kämpfte mit einer schrecklichen Übelkeit, aber er trank doch.
Gib die Flasche her, rief der Vater böse und griff nach ihr. Hannes machte wieder einen Schritt zurück, um der Hand auszuweichen, der Vater stand auf, da rutschte Hannes aus und fiel, die Flasche loslassend, rücklings hin.
Er lag auf der Erde, er hatte sich weder erschreckt noch weh getan, aber da lag er und war sehr zufrieden, denn er hörte neben sich im Schnee die Flasche auskluckern.
Plötzlich verdunkelte sich der Himmel über ihm, es war sein Vater, der sich über ihn beugte und drohend fragte: Willst du gar nicht wieder aufstehen?
Doch, sagte er gehorsam und sprang so rasch auf, dass er gleich wieder hinfiel. Dies belustigte ihn so, dass er in ein lautes Lachen ausbrach, und trotz allen Drohens des Vaters wollte sein Lachen nicht enden. Dann wurde ihm wieder übel und sein Kopf drehte wie eine Mühle.
Sein Vater musste ihn hochgehoben und auf die Füße gestellt, musste ihn eine Weile geführt haben, denn plötzlich sah er sich und ihn auf der Chaussee nach dem Hof. Er hörte sich laut reden. Er erzählte von allem, was er im letzten Jahre verstanden hatte und was ihm das Herz schwergemacht hatte: von der verludernden Wirtschaft, der Mutter, die alles falsch machte, dem fremdtuenden Alwert, und wie die dreizehnjährigen Schuljungen mit den Schulmädchen richtig Mann und Frau im Stroh spielten. Zwischendurch hörte er den Vater mit einem Ton fast ingrimmig schreienden Schmerzes rufen: Hör damit auf! Laß das, Hannes, hör auf!
Zugleich merkte ein zweiter, scharfer Beobachter in ihm, dass sie nicht etwa gerade auf der Chaussee gingen, sondern bald auf der rechten, bald auf der linken Seite. Auch, dass sie oft beinahe in die Gräben gerieten, dass sie also genauso torkelten, wie der alte Säufer Timmermann im Kirchdorf, dem die Schuljungen so gern nachäfften. Der Gedanke, dass sein Vater und er wie der olle Timmermann hier auf offener Straße herumtorkelten, belustigte ihn derart, dass er zwischen seinen Schmähreden immer wieder in ein brüllendes Gelächter ausbrach. Er forderte seinen Vater auf, stehenzubleiben, damit er ihm im Schnee die Torkelspur beweisen könnte.
Dazwischen übertrug die zitternde, schweißnasse Hand seines Vaters ein sehr genaues Gefühl auf ihn von der zornigen Traurigkeit, der tiefen Verzweiflung, die den Mann erfüllten. Er dachte flüchtig daran, dass er mit dem Vater gleich nachher in der Stube richtig ernsthaft würde sprechen müssen und mit ihm ein großes Freundschaftsbündnis schließen zur Rettung des Hofes.
Während all dies – und noch viel mehr – in ihm vorging, waren sie doch schließlich von der Chaussee auf den Weg zum Hof abgebogen und näherten sich nun, immer stöhnend, schwatzend, torkelnd, den beiden gemauerten Torpfeilern, zwischen denen der Weg auf die Hofstätte führte. Im Windschutz eines dieser Pfeiler hatte Schwester Frieda auf die beiden gewartet. Sicher hatte sie schon längst den Lärm gehört, das Torkeln gesehen und trat zornig auf sie zu. Pfui, Vater! Pfui, Hannes!
Dabei zerrte sie an der Hand ihres Bruders, um ihn vom Vater loszureißen. Sie hatte nicht wissen können, welch plötzliche Bewegungen ihr Bruder in seinem jetzigen Zustand machte, auf wie schwachen Beinen er stand. Als sie ihn loshatte, taumelte er mit sechs, acht raschen, torkelnden Schritten gegen die Wegkante nach der Dungstätte hin, Frieda mit sich reißend. Ehe der Vater noch auf sie zukonnte, fielen die beiden, rollten die Böschung vom Wege hinab auf die Dungstätte, einen Dunghaufen hinunter und fielen auf das Eis der tiefen gemauerten Jauchengrube, das unter ihnen zerbrach. Hannes schrie noch gellend auf, ehe der Dreck ihm den Mund stopfte, Frieda versank lautlos. Der Vater stand ohne Bewegung, starrte in das dunkle Loch und schrie. Und schrie. Im Hause wurde es hell. Knechte kamen gelaufen, die Mutter weinte aus einem Fenster. Frieda war tot, aber Johannes lebte. Dass er am Leben geblieben und nicht Frieda, quälte viele Jahre noch sein Gewissen, peinigte ihn im Traum, führte ihn immer wieder zurück auf den Windmühlenhügel und stellte ihn von neuem vor den Stein. Dass er den Schnaps getrunken, um den Vater zu retten, das war richtig gewesen, aber warum musste nun dadurch Frieda sterben?
Das war nicht zu verstehen. Und dann war auch noch die Geschichte mit Alwert, dem hochmütigen, einzelgängerischen Alwert nicht zu verstehen, der etwa zwei Jahre darauf abhanden kam. Das konnte man ja nun einsehen, dass nach diesem Ereignis der Vater den Johannes mied und den Alwert vorzog. Aber warum musste Alwert wieder durch dieses Vorziehen zugrunde gehen, verschwinden, ausgestrichen werden aus der Liste der lebenden Gäntschowschen Kinder?
Das war so gekommen (aber zu verstehen, was da geschehen war, war es erst viele Jahre später): Mitten in der Silvesternacht sagte der Vater: Nun komm.
Alwert schlich hinter dem Alten aus dem lärmenden Haus über die Hofstatt zum Kuhstall. Es fror leicht, die Sterne funkelten. Der Vater zog die Tür auf und sie kamen in warmes Dunkel.
Überall knisterte Stroh, eine Kuh käute wieder, Halfterketten rasselten. Die Stallaterne wurde angebrannt, ein Fenster geöffnet. Die kalte Winterluft drang ein, kämpfte mit der Wärme und war plötzlich überall. Der Junge stand im Schatten beim Rübenschneider und schwieg. Da deutete der Vater zum offenen Fenster: die Glocken begannen zu läuten, Silvester vorbei, das neue Jahr hatte begonnen.
Der Vater ging zur ersten Kuh, er sagte kein Wort, aber er verbeugte sich vor ihr und bekreuzte sie dreimal. So tat er bei der nächsten, bei der dritten, bei der vierten. Bei der fünften, der einzigen, die stand, stutzte er einen Augenblick, der Knabe sah es wohl. Aber dann ging Vater weiter, reihauf, reihab. Das Jungvieh beachtete er nicht, auch nicht die Pferde. Er ging wieder ans Fenster und schloß es. So, nun kannst du reden, Alwert, sagte der Vater und nahm den Jungen bei der Hand. Jetzt will ich dir etwas zeigen.
Die beiden kletterten über die Krippen weg, gingen zwischen zwei Kühen durch und zu jener fünften, die gestanden hatte und noch stand. Da sah Alwert freilich sogleich, um was es ging: die Kuh bekam ein Kalb. Die Vorderpfoten und der Kopf schauten schon heraus, der Vater faßte die Pfoten und zog leicht, und nun war es, als schlenkerte er etwas unendlich Langes, Schwarzweißes auf die Erde.
Da lag das Kälbchen auf der Seite, den Kopf von sich gestreckt, und atmete hastig. Lauf und hol Schrot, rief der Vater, und Alwert lief und holte Schrot. Damit wurde das Kalb bestreut und der Kuh zum Ablecken hingelegt. Der Vater sprach: Gerade zur zwölften Stunde in der Silvesternacht hat es das Licht erschaut. Das wird kein gewöhnliches Kalb.
Und nun zeigte er dem Sohn, dass es auch nicht wie die andern einen weißen Fleck, einen Stern auf der Stirn trug, sondern eine Krone. Man konnte ganz leicht erkennen, dass es eine Krone war. Jetzt wurde es noch sicherer, dass dies kein gewöhnliches Kalb war. Es ist ein Kuhkalb, sagte der Vater noch und beide gingen wieder in das Haus hinüber. Das Mädchen wurde in den Stall zum Ausmelken und Tränken geschickt. Sie aber traten in das Wohnzimmer, wo der Besuch war.
Es war dies zu einer Zeit, da der Bauer Gäntschow wieder einmal gut Freund mit allen Nachbarn war, und so saßen viele Leute in der guten Stube und viel Geschrei und Gelächter begrüßten die beiden. Der lange Gemeindevorsteher Wilms rief: Du alter Heide, kannst du gar nicht von deinen Heidentücken lassen?
Es war nun gar nicht so sicher, dass er selbst völlig erhaben über solch Heidentum war. Wer weiß, vielleicht hatten seine Frau oder sein Sohn daheim zur gleichen Stunde das gleiche getrieben, vielleicht hatten sie sich sogar unter eine aufgestellte Egge gesetzt und versucht, in die Zukunft zu schauen. Aber zugegeben durfte so etwas keinesfalls werden. Und Alwert war ganz glücklich, als der Vater antwortete: Heidentücken? Was meinst du denn, Adolf? Meine Klio hat eben gekalbt, darum bin ich mit dem Jungen in den Stall gegangen. Sind das Heidentücken?
Welches Geschrei, welcher Unglaube! Sie zogen alle in den Kuhstall, und da sahen sie nun freilich das Kalb und mussten still sein. Sie taxierten es auf achtzig Pfund und fanden, es sei ein strammes Kalb. Das war alles. Alwert verachtete sie tief. Sie hatten die Krone nicht gesehen, das Geheimnis nicht erraten. Das Geheimnis war geheim geblieben, es war nicht verlorengegangen. Alwert brauchte sich nur in den frühen Dämmerstunden, wenn die Kühe satt und still waren, in den Stall zu setzen und sein Kalb anzuschauen. Dann war das Geheimnis wieder da. Das war keine Kunst, dachte Alwert, zu entdecken, dass hinter den Augen einer Kröte eine verzauberte Prinzessin wohnt. Jeder, der diese schönen, traurigen Augen in dem häßlichen Leibe sah, musste es gleich erraten. Aber die Verzauberung seines Kalbes, das Wunderland, aus dem seine Seele kam, war viel schwerer zu entdecken. Dass sie mit Menschen nichts zu tun hatte, war sicher. Mit menschlichen Wundern hatte sie nichts gemein. Da war nun die Wanderung der Kinder Israel durch das Rote Meer, von der sie solch Geschwätz beim Kantor in der Schule machten. Das war doch nur ein menschliches, ein ausgerechnetes Wunder. Diese Mauern, die das Wasser bildete, und sie gingen trockenen Fußes über den Sand, Gott ja, aber ein Tunnel war ebensolch ein Wunder. Es war alles einfach, ausgerechnet. Es war gar nicht geheimnisvoll und rätselhaft.
Nimm nun einmal ein Kalb, das ist es, was ich ein Wunder nenne! Kann man sich etwa einbilden, es hätte je schon auf einer Graswiese, über die Menschen hingehen können, geweidet? Das war einfach lachhaft! Man nehme die feinste, zarteste Prinzessin, die Krötenprinzessin etwa: schon aus der Art, wie eine Kröte hüpft, sich hinsetzt, das Maul auftut, sieht man, sie weiß auf dieser Erde Bescheid, sie ist immer hier gewesen. Aber sieh nur ein Kalb aufstehen, die ersten Torkelschritte machen, nach einem Euter tasten, und du begreifst sofort, dass es ganz neu auf dieser Erde ist, dass es alles von Anfang an erlernen muss. Es ist eben einfach nicht auszudenken, wie und wo es früher war. Ausrechnen, vorstellen läßt sich da nichts, man muss es träumen.
Selbstverständlich kamen auch sehr schwere Zeiten für Alwert und das Kuhkalb. Es kam die Zeit, wo es nicht mehr saugen durfte, wo es Milch aus dem Eimer zu trinken bekam, und da trieb es natürlich Unfug mit allem, was es von Alwert fassen konnte. Es saugte an Händen, Haaren und dem Rock. Es leckte die Wichse von den Stiefeln ab, von oben bis unten machte es ihn mit seinem Speichel naß. Es wäre ganz zwecklos gewesen, darüber böse zu werden und nach ihm zu schlagen, alles kam daher, dass es noch nie auf dieser Welt gewesen war. Langsam musste es sich an sie gewöhnen, und vielleicht würde es sich nie ganz an sie gewöhnen können, keine Möglichkeit lag zu solcher Veränderung vor.
Dann kam die Zeit, wo der Vater den Entschluß fassen musste, ob das Kalb angebunden werden sollte oder ob es der Fleischer bekam. Alwert wurde weiß vor Angst. Aber er verbarg das und wurde dafür belohnt: das Kalb sollte hierbleiben. Die Mutter schalt natürlich darüber, über das viele, unnütze Jungvieh, diese Fresser. Aber der Vater nickte Alwert zu. Nun wurde er glühend rot, er verkroch sich mit dem Kopf unter den Tisch: hatte der Vater etwas von seinen Besuchen im Kuhstall bemerkt? Aber er beruhigte sich wieder. Der Vater sprach davon, dass dies Kalb in der Neujahrsnacht geboren sei, und dass er es deshalb behalten wollte. Nichts wußten Eltern noch Geschwister von seinen heimlichen Besuchen, er konnte sich weiter in den Stall schleichen, zur stillen Stunde, und mit ihm sprechen und bei ihm träumen und mit ihm spielen. Ganz ruhig konnte er den Vater fragen, wie denn dies Kalb heißen sollte, und der Vater war einverstanden, dass es einen Namen bekam, da es doch nun unter den Nachwuchs des Stalles aufgenommen war. Und als Alwert den Namen Blanka vorschlug, war er auch damit einverstanden. Es war ein sehr vornehmer Name für ein Dreimonatskalb, nun musste es sich zeigen, ob es dieses Namens auch wert sei.
Jetzt vergingen zwei glückliche Jahre für Alwert und Blanka. Alwert wurde vierzehn Jahre alt und konfirmiert, aber das war gar nichts, wenn man bedachte, wie Blanka wuchs und gedieh. Sie wurde eine starke und schöne Färse, eine wahre Pracht. Den ganzen Sommer, so lange sie auf der Weide getüdert wurde, lag er bei ihr mit seinen Büchern, und sie lernten alles sozusagen gemeinsam. Nun höre einmal zu, Blanka, was das nun wieder ist, konnte Alwert sagen, und dann kam ein schrecklicher Name aus dem vaterländischen Geschichtsbuch. Blanka hörte zu. Sie hob den Kopf hoch und sah ihn an. Sie stieß den warmen Laut aus, den sie nur für ihn hatte, sie hörte das Wort an, und auch ihr schien es ganz ungeheuer, was sich diese Menschen da wieder ausgedacht hatten. Dann senkte sie den Kopf und fraß weiter. Blanka musste alles hören, über den Dreißigjährigen Krieg und Friedrich den Großen, sie erfuhr, was der Kleine und der Große Katechismus war, sie ertrug auch eine Rechnung mit Zinsen. Und das Schönste war, dass dies beider Geheimnis blieb. Kein Mensch ahnte, dass Blanka und Alwert überhaupt etwas miteinander zu tun hatten. Wer weiß, wie der Junge es fertigbrachte, wieviel hundert Lügen er ersann, um sein ewiges Fortsein, sein Niezeithaben zu erklären. Er brachte es fertig, und es sollte sich ja dann zeigen, dass er später noch viel Schwereres für Blanka fertigbrachte. Aber dies waren doch die glücklichsten Jahre.
Für Bauer Gäntschow waren sie nicht so glücklich. Er hatte zuviel getrunken, zuviel Geld ausgegeben und die Wirtschaft verlottern lassen. Er hatte auch Pech auf den Feldern gehabt, einen zu trockenen Sommer. Dazu war ein Pferd gefallen, das Geld war alle. Eines Tages hieß es beim Mittagessen, dass es nun nichts mehr helfe, morgen käme der Händler, alles Jungvieh, das bloß fresse, solle verkauft werden. Der Junge neigte die Stirn, er verbarg sein Gesicht im Schatten. Blanka fort! Blanka verkauft! Es war unmöglich. Er fühlte, wie stark sein Herz pochte, und auch dieses Pochen sagte ihm, dass es unmöglich sei. Blanka war nicht zu verkaufen. Den ganzen Nachmittag lag er bei ihr und weinte. Da gehst du, Blanka, schluchzte er, und frißt. Du weißt nichts von dieser Welt, dein Herz sehnt sich erst, wenn wir getrennt sind.
Er zerbrach sich den Kopf, hundert Pläne waren da, aber keiner ausführbar. Wie, wenn man zum Vater ginge und alles gestände … dass er Blanka liebte? Aber der Vater würde ihn nur auslachen. Aber selbst wenn er ihn verstehen würde, da war die Geldnot. Sie war ja nur eine Fresserin, die nichts brachte. Blanka! Blanka! schluchzte er und legte die Arme um ihren Hals.
Und da wußte er es, plötzlich wußte er es. Nun hatte er immer diese Bücher gelesen, den Robinson, den Karl May, den Lederstrumpf. Große Abenteuer geschahen, und er hatte gemeint, dass sie draußen seien, auf den unendlichen Meeren, an fremden Küsten, unter wilden Völkern.
Aber nein, das Abenteuer war hier wie dort. Es war auf jedem Hof und in jedem Wald, am Grugenteich war es und in Vaters Kuhstall. War nicht Abenteuer genug, was ihm schon geschehen? Er liebte eine verzauberte Prinzessin aus fernen Landen, er allein wußte um sie, und sie stand als Kalbe in seines Vaters Stall! Welchem andern Jungen geschah dies? Und darauf kam es nun eben an, sich dieses Abenteuer nicht fortnehmen zu lassen, nicht zu werden wie die andern. Alle Abenteuer kommen zu uns. Robinson hätte auch zu Haus bleiben und Kaufmann werden können. Nichts zwang den Arzt Gulliver, sich immer von neuem einzuschiffen: sie wollten das Abenteuer! Auch er wollte es! Seine Blanka, seine … auch er wollte es!
Am nächsten Morgen war der Kuhstall erbrochen und Blanka gestohlen. Es war eine Sache, von der die Halbinsel Fiddichow noch nach Monaten redete. Der dicke Landgendarm war nun jeden Tag auf dem Hof und sprach mit dem Vater. Dann betrachteten sie das Vorhängeschloß, das so seltsam zerschlagen war, so unsinnig zerwütet mit einer Axt, und kamen wieder zu dem Schluß: ein Neuling hatte das getan. Aber diese Kalbe war ja nicht zu verkennen. Sie musste wieder auftauchen; hatte Alwert den Vater nicht daran erinnert, dass sie eine Krone auf der Stirn trug, eine weiße, etwas verwischt gezeichnete Krone? Nun, an dieser Krone würde man sie wiedererkennen. Und in der Folge machte der Vater manche lange Reise über das Land, wenn ihn das Gerücht von dem Auftauchen seiner Blanka irgendwohin rief.
Unterdes lag der Knabe im Wald, und seine Blanka graste bei ihm. Der Wald war verwachsen und dicht. Hier fand sie keiner. Nur der Großvater hatte gewußt, dass sich durch dieses Tannendickicht ein Wildwechsel schlängelte, der zum Grugenloch führte. Das war ein Teich, ein kleiner Teich, mitten in den Tannen. Hierher war Alwert mit dem Großvater gekommen, und die beiden hatten sich auf den Grugenstuhl gesetzt, eine abgehauene Tanne. Und der Großvater, dieser seltsame Mann mit dem langen, weißen Bart, der nie Hosen trug, sondern die Enden seines unmäßig langen Leibrocks in die Schäfte der Stiefel steckte, der Großvater hatte ihm von den Grugen und Quaken erzählt, kleinen Geistern, die an diesem Teich ihr Wesen trieben.
Nun waren die andern Wunder gekommen. Der Großvater war gestorben und mit ihm waren die ein wenig künstlichen Wunder der Quaken und Grugen vergangen. Nun hatte sich Alwert seine echten Wunder selbst geholt. Da graste Blanka, schon hatte sie sich an das härtere, spärlichere Waldgras gewöhnt. Sie sah prall und voll aus, ihr ging nichts ab, das sah man. Und neben ihr liegend, in der Sonne, unter dem leisen Rauschen der Tannenzweige, durch die raschelnd die Vögel schlüpften, träumte Alwert davon, wie er jahraus, jahrein zu seiner Blanka kommen würde, zu diesem schwarzweißen Geheimnis, an dem niemand teilhatte. Er begriff nicht, dass man anderes lieben könnte als dieses Tier. Das war das Wunder. Menschen lieben? Menschen sind der Alltag, sie sagen etwas, sie tun etwas, und man konnte sie erraten, man konnte hinter sie kommen, und plötzlich schien die Sonne klar durch sie hindurch. Menschen sind nichts.
Wer aber kam hinter Blanka? Da lag sie und käute wieder, aber das war nur ihr Vorwand, den man nicht beachten durfte. Wenn man in ihre Augen sah, begriff man, dass sie dies alles, Bäume, Sonne, Gras, Wasser und Alwert dazu nur obenauf sah. Was aber sah sie tiefer drin, was sah sie wirklich? Nicht dass alles leicht war. Gewiß, dort war Blanka und hier im Bett lag Alwert. Aber diese Blanka war so unvernünftig, da lag sie nun in der dunklen Nacht allein im Walde, konnte nicht die Sehnsucht sie nach den andern, nach Alwert überkommen? Konnte sie sich nicht losreißen und auf den Hof laufen? Das war es, dass man ihr nicht erzählen konnte, sie würde verkauft. Sie war eben eine Prinzessin, sie begriff nichts von diesem Leben, alles musste man für sie tun. Und indes der Regen gegen die Fensterscheiben spritzte, sagte er immer wieder zu sich: da liegt sie draußen, die Blanka, und ich hier.
Auch das war ein Rätsel, dass man eines liebte, an es dachte und getrennt war von ihm. Es war so eine dicke, greifbare Sache, die die andern sich ausgedacht hatten. Gewiß, nach den Augen, mit dem Verstande war es so, dass sie dort war und er hier. Aber war es nicht vielleicht doch unwahr? Lag er nicht etwa auch neben ihr in der Mulde, die er für sie gegraben, unter dem Tannendach, das er für sie geflochten? Er war hier und er war dort. Das war die eigentliche Wahrheit. Ebenso wie Blanka hier und in einer andern Welt war. So ging das zu.
Es war ein glücklicher Sommer! Es war ein seliger Sommer. Endlose Träumereien des Knaben auf dem Grugenstuhl, indes oben langsam Wolken dahingingen, sich ballten, zergingen. Dann schien die Sonne. Sie waren wunderbar diese Wolken, aber sein größeres Wunder hatte er sich aus seines Vaters Kuhstall geholt. Er hatte es gezwungen, wahr zu sein, und gegen sie alle hatte er es behauptet. Die kleinen Grashalme um ihn, die Tannenzweige über ihm, das Wasser vor ihm, der Himmel oben, sie bestätigten es. Da graste sie, sie war schwarzweiß, in einer Neujahrsnacht war sie geboren, sie trug eine Krone auf ihrer Stirn. Sie hätte eine Kalbe wie alle Kalben werden können. Er hatte sie vereinzelt. Er hatte ein Schicksal geschaffen, abseits von allen andern.
Da saß er auf seinem Grugenstuhl, mit seinem langen braunen Jungengesicht voller Sommersprossen, ein Bauernjunge wie alle andern, der in die Dorfschule ging und alltags barfuß lief: ein Junge wie keiner. Solch endloser Sommer! Die kleinen Fliegen schwirrten, und die kleinen Mücken sangen: Ji-Ji, und die Zeit rauschte ganz fern. Oh, meine Blanka!
Dann kam der Herbst mit seinen langen, sonnigen Tagen, und das Futter wurde knapp. Er hatte daran gedacht, für den Winter Heu zusammenzutragen, aber das wenige, was er gesammelt hatte, war im Umsehen zu Ende. Was Blanka auch fraß! Und es war natürlich ausgeschlossen, dass man ihr etwas abgehen ließ. Nun musste man eben jede Nacht mit einer Traglast Heu zu ihr. Dann war er den ganzen Tag müde, er wurde blaß, er wurde mager, er schlief ewig, wenn er zu Haus war.
Und sie paßten so auf nun! Eines Nachts war der Vater im Zimmer der großen Kinder gewesen und hatte sein Bett leer gefunden. Da musste er nun endlose Lügengeschichten erfinden, um sie und sich zu retten. Nun blieb nichts, als ein paar Nächte zu Haus zu bleiben, aber dann das Muhen, mit dem ihn Blanka empfing! Er zitterte, er kroch zu ihr, er sprach sanft zu ihr. Es quälte ihn namenlos, dass sie leiden musste um seinetwillen. Wo waren die sorgenlosen Sommertage hin? Und dies war erst der Herbst!
Aber noch gab er den Kampf nicht auf. Noch gab er sich nicht zu, dass er sich zuviel vorgenommen hatte. Dies war zu sehr Teil seines Lebens, als dass er es hätte aufgeben können. Er musste sich eben wach halten, bis der Vater nachgesehen hatte, und dann gehen. Aber das hieß, die ganze Nacht wachen, überhaupt nicht schlafen. Und doch führte er es durch. Er gewöhnte sich auch daran, er stahl sich aus dem Tag ein paar Schlafstunden, er wurde ein Nachttier. Und alles war belohnt, und alles war gut, wenn er bei Blanka war. Blanka war nicht mehr Blanka, Blanka war der Weg, aber Blanka war auch das Ziel. Blanka war seine Stellung zu den Menschen. Gab er Blanka auf, gab er sich auf.
Dann fiel der erste Schnee. An ihn hatte er nicht gedacht. Nun waren Spuren da. Jeder konnte ihm nachgehen, jeder konnte Blanka finden. Er wurde eiskalt, als er dies dachte. Nun ist das Ende da, sagte er, aber er glaubte es noch nicht. Ich werde etwas finden, beharrte er. Ich werde auch diesmal etwas finden. Auch diesmal wird es mir glücken.
Der einzige Ausweg, auf den er geriet, war der, Blanka vorläufig im hintersten Keller des Hauses zu verstecken. Dorthin kam so leicht niemand. Es war ein schlechter Ausweg, das wußte er, ein besserer würde ihm später einfallen.
In der Nacht nahm er Blanka am Strick, er führte sie auf den Hof, er führte sie die Treppe hinauf ins Haus, die Treppe hinab in den Keller. Auf dieser Treppe glitt Blanka aus und fiel. Es gab einen ungeheuren Lärm. Mit der Lampe stand der Vater da und fragte: Was in aller Welt machst du hier mit der Kuh? Der Junge starrte ihn totenbleich an. Der Schein der Lampe fiel auf Blankas Stirn. Aber das ist ja Blanka! Das ist ja Blanka! rief der Vater.
Es war eine Katastrophe. Es war ein maßloser Skandal. Niemand glaubte dem Jungen, dass er das Tier »nur so« geliebt hatte. Zuerst begriff er nicht, was sie meinten, was sie alle meinten, von der Mutter bis zum Kantor. Aber sie sorgten schon dafür, dass er begriff. Blanka, seine Blanka und er!
Von da an war ihm alles gleich. Er wurde von der Schule gejagt, am liebsten hätte man die Konfirmation rückgängig gemacht. Und dann war natürlich kein Gedanke daran, dass er je den Hof bekam. Ein Mensch, der sich in so jungen Jahren schon so schwer verging! Man gab ihn auf ein Schiff und schickte ihn auf fremde Meere, dass die Schande nur aus den Augen kam.
Oh, meine Blanka!
In den zwei oder drei Wochen, die Alwert nach der Aufdeckung seines Verbrechens noch auf dem Hof war, schlichen natürlich auch seine Geschwister wortlos um ihn herum, als sei er nicht da. Schande bedeutet stets ein von der Mehrheit gefälltes Urteil, und Kinder gehen eigentlich immer mit der Mehrheit. Auch Johannes Gäntschow machte da keine Ausnahme, auch er sprach nie wieder mit dem Bruder. Manchmal, wenn er nach der Schule pfeifend in die Dachstube kam und sah den Bruder still und bewegungslos am Fenster sitzen, mit dem blassen, langen Gesicht, und den Blick ohne Zwinkern auf der grauen Bretterwand der Feldscheune, die, kaum acht Meter entfernt, jede Aussicht versperrte, – manchmal also, wenn er den Bruder so starr sitzen sah, überkam ihn zwar nicht Mitleid, aber etwas wie ein Gefühl von Verbundenheit. Johannes, der kein Träumer war wie sein Bruder, wußte ganz genau, dass die Großen unrecht hatten, von Alwert zu glauben, was sie glaubten. Dafür kannte er den hochmütigen Einzelgänger viel zu gut. Nein, Johannes hatte sich längst aus seinem praktischen Verstand heraus eine sehr andere Theorie über die beiseite gebrachte Blanka gemacht, und für Schande war da kein Raum.
Wenn er darum aber doch nicht mit Alwert sprach, den Boykott mitmachte, so war es einmal deswegen, weil die Kronprinzen immer von ihren Geschwistern gehaßt werden, dann aber, weil er schon damals alle Verwandtschaft, vom Vater abgesehen, nicht ausstehen konnte. Da saßen sie in diesem viel zu vollen Haus, sie überfüllten es mit ihrem Lärm, ihrem Gezänk, sie fuhrwerkten immer in den Sachen und im Leben der andern herum, sie beschwatzten alles, kommandierten, verhöhnten, neckten bis aufs Blut – Verwandtschaft war Vormundschaft, Fessel, Feindschaft.
Nun hatte wohl gerade Alwert all dies nicht besonders deutlich mitgemacht, und ein einsames Tannengeflecht am Grugenteich mit dem Grugenstuhl (Johannes hatte sich das alles angesehen, wie sich die halbe Insel den Schandplatz ansah) –, für all das konnte niemand mehr Verständnis haben als Johannes. Aber kann man denn verzeihen, wenn man, selber voll Haß gegen die andern, vom Bruder in diesen gleichen Haß einbezogen wird? Nein, nein, der hatte immer spöttisch die Augen eingekniffen, wenn Johannes mal den Versuch gemacht hatte, ihm etwas zu erzählen, er hatte eine so infame Manier gehabt zuzuhören und dabei in seine Bücher zu schielen, »Richtig« zu sagen und überhaupt nicht hingehört zu haben, nein – auch Johannes sprach kein Wort mit Alwert, gab ihm auch bei der Abfahrt nicht die Hand. Wie das keiner tat.
Als Alwert aber erst weg war und es sich so machte mit dem Alten, beim Strohhäckseln auf der Tenne, da sagte der elfjährige Hannes dem Vater sehr genau, dass es alles Schiet sei mit Alwert und seiner Blanka, dass sich der Vater mal wieder habe anmeiern lassen, von der lieben Verwandtschaft und der Mutter … Alwert, der sich dreimal am Tage die Hände wäscht! Was du nur denkst, Vater!!!
Und Hannes grinste verächtlich mit all seinen Sommersprossen, spuckte verächtlich einen Strohhalm aus.
Der Vater ließ das Schwungrad von der Häckselmaschine los, sah seinen Sohn prüfend an und fragte: Und was denkst denn du?
Hat sich ’ne Kuh retten wollen, weil der Hof sein Erbteil ist, sagte Hannes bedeutungsvoll und kniff, ohne es zu wissen, die Augen genau so ein wie sein Bruder.
Retten wollen? fragte der Vater.
Hannes spürte den nahenden Sturm, aber er sagte doch: Es bleibt ja doch nichts, Vater. Es verkommt ja doch alles. Und darum hat er die Blanka beiseite gebracht? Dass wenigstens was bleibt?
Ja, Vater.
Nein, der Junge hatte keine Angst. Da stand er mit seinem schmalen, verfrorenen Gesicht und den etwas abstehenden, feuerroten Ohren, ein zehnmal geflickter, zusammengestoppelter Anzug, lange, schwarze, rauhwollige Strümpfe, Holzpantoffeln, elf Jahre – aber Angst hatte er nicht.
Der Vater besann sich auch. Dösbartel, sagte er nur, spuckte aus und griff wieder nach dem Schwungrad. Er drehte es gewaltig. Der Junge hatte zu tun, dass er genug Langstroh ranschaffte. Das Häcksel musste er auch wegkehren. Eine lange Weile war man stille. Nur die Häcksellade machte unermüdlich und scharf: Ssssiete-Ssssiete. Immer der scharfe Schnitt.
Dann musste der Bauer Atem holen. Er stand da, aber Hannes hatte noch mehr auf dem Herzen. Und was soll denn das, Vater, dass du die Blanka dem Fleischer Frehle für sechzig Mark verkauft hast? Sie ist mindestens das Vierfache wert.
Der Vater sagte ernsthaft: Weil sie keiner haben wollte. Frehle musste sie extra nach Berlin schicken, da weiß keiner was von ihr.
Und warum haben wir sie nicht behalten? Im Frühjahr hätte sie zum Bullen kommen können.
Weil … fing der Vater an und brach ab. Nun war sein Gesicht doch sehr rot geworden. Ach, Schiet, sagte er. Bist du hier der Bauer oder ich?
Du, sagte der Junge und kniff wieder spöttisch die Augen ein. Es lag eine ganze Menge in diesem Du, und der Vater verstand das auch sehr gut.
Hitziger sagte er: Was du immer vom Hof dröhnst – vor dir kommt jedenfalls noch der Max.
Bekommt ihn aber auch nicht, sagte Hannes trotzig. Schneide man weiter, Vater.
Stellst du hier an oder ich? schrie der Vater. Ich schneide, wann’s mir paßt.
Gerade darum, sagte der Junge, man müßte schneiden, wann’s das Vieh braucht.
Der Vater war zornrot bis auf die Glatze hinauf, der Junge sah es. Er erinnerte sich eben gerade an das hundertmal unregelmäßig gefütterte Vieh, besonders aber an eine Kiste mit Nägeln, die er, der Junge, Stück für Stück aus alten Brettern zusammengesucht, und die der Alte in seiner Betrunkenheit hingeworfen hatte. An die ganz besonders.
Es sah aus, als wollte der Vater für diesmal den Jungen prügeln, was er nie tat, er schlug nie ein Kind. Aber er besann sich wieder. Ach was, murrte er, nahm seine Jacke vom Stroh, zog sie an, den Jungen immer finster ansehend, und ging aus der Scheune. Entweder hatte er die Häcksellade ganz vergessen, oder er wollte nun gerade nicht häckseln.
Der Junge sah dem Vater nach. Der Vater ging nicht ins Haus, auch nicht zu den Ställen, auch nicht aufs Feld – er ging den Weg zur Chaussee.
Der Junge brannte lichterloh in seinem Zorn und Kummer, er sah den Bruder Max, er schrie über den Hof: Max, komm längs, Häcksel schneiden! Vater geht in den Krug!
Der Vater machte mit einem Ruck kehrt. Er lief fast auf den Jungen zu, der sich eng gegen den Bansenverschlag drückte. Nun hatte er doch Angst. Der Vater war ganz weiß, er war so aufgeregt, dass er kaum sprechen konnte.
Du, stotterte er, du kriegst den Hohohof doch nie! Der Sohn sah den Vater wortlos an. Der Vater wurde noch zorniger: Ich schwöre hier, wie ich steh, nie sollst du einen Pflug auf diesem Hof anzufassen kriegen. Der Junge sah den Vater an. Nie sollst du säen, nie sollst du ernten, schrie der Vater noch, aber der Hauptzorn war vorbei. Er drehte sich um mit einem Ruck und ging doch ins Dorf.
Dieser Streit zwischen Sohn und Vater, der einzige in vielen Jahren, änderte an dem Verhältnis der beiden äußerlich fast nichts. Hannes war weiter sein Liebling, viel mehr als der kleine, untersetzte, schwerfällige Bruder Max. Der Vater sprach weiter mit Hannes, lachte mit ihm, aber nie wieder nahm ihn der Vater mit aufs Feld hinaus, nie wieder ging er mit ihm in einen Stall. Wenn die eiligste Heuernte war, und alles musste mit zufassen, Hannes wurde ausgeschlossen. Suchte er sich aber selbst eine Arbeit, so kam sicher irgendein Knecht oder eines von den Geschwistern oder der Vater selbst und nahm sie ihm stillschweigend aus der Hand. Der Junge war und blieb ausgeschlossen von der Arbeit und damit von dem Leben auf dem Hof. Er hätte sich vielleicht stärker dagegen aufgelehnt, immer wieder sein Recht auf Mitarbeit gesucht, wenn der Vater damals, an jenem Streittage, wirklich in den Krug gegangen wäre. Aber dahin war der Vater nicht gegangen. Der Vater hatte einen Schwur getan, und der sollte nicht eben so hingesagt sein, im Zorn, nein, er hatte richtig geschworen. Nein, der Vater war zum alten Superintendenten Marder gegangen und hatte seinen Sohn Johannes für fünf Schulstunden täglich zur Vorbereitung aufs Gymnasium da angemeldet. So, nun wurde der Sohn kein Bauer, aber ein Garnichts sollte er darum doch nicht werden. Er sollte die Wissenschaft lernen. Es war eine teure Sache für den Bauern Gäntschow, denn »ol Superdent Marder« war bekannt dafür, dass er nicht nur redensartlich, sondern wirklich von den Lebenden und Toten zog, aber es musste gehen.
Und dieser Streit hatte noch eine andere Wirkung: der Vater schwor für viele Jahre das Saufen ab. Da hatte dieser Knirps, dieser Garnichts vor dem Vater gestanden und gesagt, behauptet, angedeutet und behauptet, es würde eines Tages nichts mehr zu erben da sein, der Hof würde verludert werden. Warum hatte der Vater getrunken, dann einmal und zwei Monate später wieder einmal? Weil er allein war, weil sich nichts lohnte, weil die Frau nichts taugte, weil es doch nicht auf ihn ankam. Weil es egal war, wie man seine Felder bestellte, weil wir doch eines Tages alle tot sind und dann all unser Tun zwecklos geworden ist. Nun aber hatte dieser Bengel vor ihm gestanden, ach ja, der Vater hatte ganz gut kapiert, dass es nicht Gehässigkeit und Streitsucht gewesen waren, die dem Sohn die Zunge geführt hatten, sondern heiliger Zorn, Sorge, Erbitterung. Siehe, es kam doch auf ihn an, ein kleines Geschöpf, siebzig Pfund Fleisch und Knochen, nicht der Rede wert Hirn, zürnte mit ihm. Nichts zu erben?
Dir wollen wir’s zeigen! Saufen, verludern – was verstehst denn du? Erben, nichts zu erben, jawohl, einen ganzen Bauernhof, hundertachtzig Morgen, alles weizenfähiger Boden, vier Pferde, acht Kühe, Jungvieh, Schweine, voller Beschlag, jawohl, erben! Aber nicht du, du Naseweis! Du sollst sehen! Ein Schreibknecht sollst du werden, ein Federfuchser, wie dein Onkel Gäntschow, dein Vatersbruder, in der steinernen Stadt Berlin, zwischen Mauern und auf einem Büro. Geh du nur zum alten Superintendenten Marder, büffele, lerne, Bücher, Tinte, Staub.
Und Johannes Gäntschow ging zum Superintendenten, jeden Werktag, fünf Jahre lang, fünf Stunden jeden Werktag lang. Es wäre die unerträglichste Geschichte von der Welt für einen an viel Luft, weite Äcker und rauschende See gewöhnten Bauernjungen gewesen, wenn er nicht einen Leidensgefährten gehabt hätte, eine Leidensgefährtin heißt das: die Christiane Freiin von Fidde.
Die Grafen von Fidde saßen ja nun mindestens ebenso lange wie die Gäntschows auf der Halbinsel Fiddichow. Sie leiteten ihren Ursprung von jenem Herzog Wisso her, der in grauen Zeiten einen Heidenmann, Gunnar, am Kehlteich hatte hinrichten lassen, weil ihm sein Lieblingsschimmel geschlachtet worden war. Es wäre übertrieben, wollte man behaupten, die Feindschaft zwischen den Gäntschows und den Grafen Fidde datiere von jenem sagenhaften Doppelopfer her. So weit braucht man nicht zu suchen. Ein Bauer kann nie und niemals Freund eines Grafen über Tausende von Morgen Land sein. Wer selbst hinter seinem Pflug geht, sorgsam Furche um Furche umlegt, muss den verachten, der durch seinen Inspektor zwanzig Pferde- und Ochsengespanne zum Pflügen schickt. Jedenfalls, hätte Bauer Gäntschow gewußt, dass in Superintendent Marders verräuchertem Amtszimmer sein Sohn der Freiin Fidde gegenübersitzen würde, er hätte sich den Fall mit der höheren Bildung noch einmal überlegt. So aber sagte Marder nur hastig: Das ist also der Johannes Gäntschow, Christiane, zeig ihm mal die erste Seite von deiner Syntax. Er weiß noch rein gar nichts. Ich muss mal rasch …
Und damit fuhr er aus der Stube. Superintendent Marder fuhr immer hastig durch die Weltgeschichte, außer seinen Schülern, einer großen Pfarrei, hatte er auch noch einen Bauernhof zu besorgen, immer war er überall und nirgend.
Der Junge stand unter der Tür und sah nach dem Mädchen auf dem Sofa mit zusammengezogener Stirn hin. Er hatte keine Ahnung, wer sie war. Vielleicht hatte er sie einmal im Kutschwagen vorüberfahren sehen, aber daran dachte er nicht mehr. Das aber sah er jedenfalls, dass sie in ihrem glatten, dunkelblauen Kleid mit dem schweren, dunklen Scheitel und den Schnecken über den Ohren keine Bauerntochter war. Außerdem schien sie ihm, trotzdem sie gleichaltrig mit ihm war, viel älter als er. Und dass sie ihn nun gewissermaßen unterrichten sollte, und dass er rein gar nichts wußte, kränkte ihn sehr.
Du brauchst mir nichts zu zeigen, sagte er brummig von der Tür her. Ich will doch nichts lernen. Ich werde doch Bauer. Und wenn ich nicht Bauer werde, werde ich Schmied.
Christiane hatte zwar keine Mutter, dafür aber einen ältlichen, kränklichen, oft missgelaunten Vater. Darum war sie der Lage gewachsen und sagte ernsthaft: Ein Schmied ist aber immer schmutzig.
Johannes Gäntschow bedachte es und sagte: Aber er versteht viel von Pferden. Er kann ein Pferd für immer lahm machen, wenn er das Beschlagen nicht ordentlich versteht.
Sie antwortete: Ein Trainer versteht aber noch viel mehr von Pferden, ich würde Trainer werden. Dann brauchst du dich auch nicht schmutzig zu machen.
Was ist ein Trainer? fragte er.
Ach, sagte sie, er sagt, wie die Pferde gefüttert werden sollen, und schimpft immer die Stallburschen, dass sie nicht ordentlich putzen, und er erzählt den Leuten, wie sie reiten müssen. Und reitet immer am schönsten.
Reiten? fragte er. Reitpferde sind Quatsch. Ich brauch ordentliche Arbeitspferde, die was ziehen können, nicht solche verhungerten Engländer.
Sie sah ihn nachdenklich mit einer kleinen, senkrechten Falte zwischen den Augenbrauen an.
Und vielleicht gehe ich überhaupt zur See wie mein Bruder Alwert, sagte er und brach rotübergossen ab. Sie zogen ihn genug auf mit seinem Bruder Alwert. Was ist eine Syntax? fragte er hastig.
So ein Buch, aus dem man lernt, wie … begann sie.
Es war ein Wunder. Sie hatte entschieden keine Ahnung, was sein Bruder Alwert getan hatte. Draußen ertönte rasches Räderrollen auf dem Kopfpflaster des kleinen Marktplatzes vor der Superintendantur.
Das sind unsere Pferde, rief sie rasch und lief ans Fenster. Er stellte sich neben sie. Der offene gräfliche Jagdwagen rollte, von zwei Füchsen gezogen, vorüber. Der backenbärtige Kutscher hatte seine kleine Herrin gesehen und grüßte sie ernsthaft, indem er die Peitsche gegen den Zylinder hob.
Er hat mich hergefahren, sagte sie eifrig. Er fährt mich jeden Morgen her, und mittags holt er mich wieder ab. Siehst du den Fuchs mit der Blässe? Sie sollte voriges Frühjahr fohlen, aber der Tierarzt hat alles verkorkst, und das Fohlen ist an der Nabelschnur erstickt. Die Senta wäre beinahe verreckt.
Was habt ihr mit ihr getan? fragte er gespannt.
Papa – sie betonte auf der zweiten Silbe – hat den Tierarzt rausgeworfen und hat ihr einen Liter schwarzen Kaffee mit Kognak gegeben. Sie hatte schon Herzschwäche.
Der Wagen war längst über den Marktplatz fortgerollt, beide aber standen sie noch am Fenster.
Ist das dein Papa? fragte er mit kräftigem Ton auf der ersten Silbe, der auf dem Bock?
Aber nein doch, sagte sie sehr erstaunt, das ist bloß der Kutscher Eli! Und als er noch immer nicht verstand: Ich bin doch die Christiane!
Er hatte keine Ahnung, wer die Christiane war, aber wie sie es sagte, musste es eine sehr wichtige Person sein, und in ihm dämmerte etwas. Zudem hatte er ihre sehr großen, dunklen Augen ganz dicht vor sich, und er fühlte irgendwas, dass sie nicht nur Christiane hieß, sondern wirklich »die Christiane« war, ganz gleichgültig, was das nun sein mochte.
Dann gehört dir also der Wagen? Und die Pferde? Und der Kutscher?
Nein, meinem Papa.
Und du wohnst auf dem Schloß?
Er hatte das Schloß immer nur wie einen Märchenpalast durch Busch- und Baumlücken aus weiter Ferne gesehen, denn es lag in einem großen, umgitterten Park.
Ja, da wohne ich, sagte sie und fing leise an, über den Bauernjungen zu lächeln.
Da habt ihr wohl so viel Geld, wie ihr wollt? fragte er unerbittlich weiter.
Das kommt auf die Jahreszeit an, sagte sie. Manchmal sehr wenig, gar nichts. Dann schickt der Rentmeister alle mit ihren Rechnungen weg und Papa ist ewig brummig. Aber nach der Raps- und Weizenernte kann ich mir wünschen, was ich mag.
Er war nicht sehr zufrieden über diese Auskunft. Geldmangel auf einem Schloß störte seine Illusionen. Und wie sagst du zu deinem Papa? Redest du ihn Herr Graf an?
O Gott, nein! lachte sie nun hell heraus. Ich sage zu ihm »Nuschelpeter« oder »Armer Einsamer« oder »Alter Greiser«. Er hat furchtbar viele Namen. Meistens sage ich aber einfach Pitt.
Johannes Gäntschow wurde immer unzufriedener. Ihn befriedigten ihre Antworten gar nicht. Er kam auf den Verdacht, dass sie vielleicht doch nicht die richtige Tochter sei.
Darfst du denn mit ihm essen? fragte er vorsichtig.
Natürlich, sagte sie, ich und die Miss und die Mademoiselle essen immer mit Papa.
Wer sind denn das?
Das sind meine Erzieherinnen.
Und warum gehst du dann zum alten Marder, wenn du zwei Erzieherinnen hast? Er war jetzt fest davon überzeugt, dass sie ihn anlog.
Weil ich richtig aufs Gymnasium soll. Weil ich Pitts Einzige bin und das Gut erben soll. Und Pitt sagt immer, ich kriege doch nur einen Flachkopf, wir Fiddes haben kein Glück im Heiraten. Und dann muss ich die Wirtschaft allein führen können.
Johannes starrte sie immer fassungsloser an. Sicher war sie eine schreckliche Lügnerin, wenn sie auch mit ihren Augen gar nicht danach aussah. Er bereitete schon wieder eine neue Frage vor, mit der er sie richtig ins Gedränge bringen wollte, als die Tür aufging und Superintendent Marder hereinwutschte. Er rieb sich die kalten, frostroten Hände und sagte eilig: Na, am Fenster? Jetzt ist Schulstunde. Da ist dein Platz, Hannes, los! Bitte, setze dich, Christiane.
Und sofort begriff Johannes, dass sie doch die Wahrheit gesagt hatte, die ganze Wahrheit, begriff es aus dem verschiedenen Ton, mit dem Marder sie und ihn anredete.
Na, wie ist es mit mensa? fragte der eilig. Los, los, Johannes, mensa, mensae … jede Stunde kostet deinen Vater Geld, denke immer daran, mensae, mensam, aber was ist das mit dir? O mensa! Na, nichts, – Christiane?
Wir haben erst einmal Bekanntschaft geschlossen, Herr Marder.
Schön, schön, aber dieser Junge muss richtig lernen. Er kostet seinen Vater immerzu Geld. Und sein Vater hat nicht viel, Christiane.
Ich muss auch richtig lernen, Herr Marder, sagte Christiane ernsthaft, und ich koste meinen Vater auch jede Stunde Geld. Sieh her, Hannes, hier auf der ersten Seite, das ist eine lateinische Satzlehre, Syntax heißt Satzlehre. Du hast mich vorhin gefragt. Und mensa heißt auf lateinisch der Tisch …
Na schön, na schön, sagte der Superintendent, macht denn so fort. Ich muss nur mal … Er rannte hinaus, in die Scheune, wo sie mit dem Flegel Roggen droschen, damit Langstroh zu Ernteseilen da wäre. Es hatte ihm so geklungen, als wenn der Takt stolperte, nicht munter vorwärts ging. So lief er eilig und ärgerlich (er war immer eilig und ärgerlich), er hatte gar keine Zeit mehr dafür, richtig auf den Dreschtakt zu achten, sondern er nahm dem nächsten Mann gleich den Flegel weg.
Aber Kinnings, rief er zu den großen Tagelöhnern, zwischen denen er wie eine kleine rötliche Ratte stand, heißt das dreschen? So muss das gehen! Und er schlug los, wobei er den Takt wie eine liturgische Antwort mit einem alten Bauernvers vorsang: Der Walter im Malter, da drischt er das Korn. Ich komm nicht dahinter, so machst du’s von vorn.
Hoppla, Herr Superdent, sagte der alte Behn und traf den Flegel des Geistlichen hart, diesmal haben Sie aber nachgeklappt.
Na also, Kinnings, macht weiter, Schmidt, so muss man dreschen. Ich muss nur mal …
Und er rannte wieder in das Wohnhaus, denn es war ihm eingefallen, dass er sich ein Brautpaar auf neun Uhr zu einer pastoralen Vermahnung bestellt hatte, weil die Braut schon zum zweitenmal schwanger ging und die beiden noch nicht die geringsten Anstalten zum Aufgebot gemacht hatten.
Aber er kam zu spät, denn die beiden waren schon in die Studierstube zu seinen Schülern hineingegangen, und als er da an der Tür stehenblieb und auf das eifrige Reden drinnen lauschte, merkte er, dass auch seine Vermahnung schon überflüssig geworden war, denn er hörte den Johannes Gäntschow, diesen elfjährigen Bengel, wütend sagen: Das weiß doch jeder, und das hast du selber im Kruge erzählt, Adi, dass du die Lisbeth nur an der Nase rumführst, und du hast sogar mit Bohrmanns Erwin gewettet, dass du ihr sechs Kinder andrehen willst und sie doch nicht heiratest.
Du, du, machte der Windmüllersohn Adi wütend, du mit deinem Bruder Alwert …
Tut! Tut! Grade mit meinem Bruder, sagte er wütend, aber was du für Schweinereien machst –!
Geht runter, Kinder, sagte der Superintendent milde. Es ist Frühstückszeit. Ja, jetzt, sofort. Ich bin sehr böse mit dir, Hans Gäntschow. Denkst du gar nicht an die Freiin Christiane? Geht jetzt …
Vielleicht hatte Christiane den mageren, geflickten Johannes Gäntschow mit seinen viel zu kurzen Ärmeln, recht flüchtig gewaschen und gar nicht gekämmt, bisher für einen rechten dummen Bauerntöffel gehalten. Aber wie sie nun durch den Pfarrgarten gingen und von den wilden Wasservögeln redeten, die man jetzt im Winter vom Meeresufer her im Schloß Tag und Nacht schreien hörte, war ihr Ton ganz anders. Es war ihr nicht recht klargeworden, was für Schlechtigkeiten der dem Müllersohn eigentlich vorwarf, aber der Ton seiner Empörung war so überzeugend gewesen, dass das alles nicht mit irgendwelchen Schimpfen, wie’s der Inspektor daheim auf dem Hof machte, oder mit Zänkerei zu verwechseln war. Wie der große, fünfundzwanzigjährige Flaps rot und verlegen stammelnd vor dem Jungen gestanden hatte, das war gut gewesen – ein Blick in eine andere Welt war’s gewesen, eine neue Saite war in ihr erklungen. Und sie beschloß, den Vater nicht, wie sie noch vor einer Woche vorgehabt hatte, zu bitten, die nutzlosen Stunden bei dem eilfertigen Marder aufzugeben, sondern erst einmal dazubleiben und sich diesen Jungen, wie sie keinen bisher auf der Welt getroffen, näher anzusehen.
Eigentlich ist er wohl nichts für uns, sagte der Vater nachdenklich auf ihre Erzählung, und ich glaube auch nicht, dass er zu uns kommen wird. Er ist doch der Erbfeind!
Wieso ist er denn der Erbfeind? fragte sie erstaunt. Was ist denn ein Erbfeind? Ich denke, die Franzosen sind das.
Und genauso ist es mit den Fiddes und den Gäntschows. Der Graf überlegte, ob er ihr die alten Geschichten erzählen sollte, und beschloß, es vorläufig lieber zu lassen. Nach einem Vormittag Bekanntschaft schien ihm seine ruhige Christiane schon hinreichend angetan. Nun, du wirst ja hören, was er weiter sagt.
Christiane sah ihn nachdenklich an. Schön, Papa, sagte sie, und jetzt muss ich mich hinsetzen und büffeln.
Büffeln? fragte der Graf erstaunt. Ich dachte, wir wollten schnell noch einmal vor Dunkelwerden zum Wasser sehen, ob ich nicht ein paar Gänse schießen kann.
Heute nicht, entschied sie. Ich muss wirklich jetzt mehr arbeiten, wo ich einen Mitschüler habe.
Sie verschwieg, dass sie nicht so sehr einen Mitschüler, wie einen Schüler bekommen hatte. Denn von Superintendent Marder waren nicht mehr als abschließende, aber eilige Aufklärungen zu erhalten.
Das ist nicht schlecht, dachte der Vater, das jedenfalls ist nicht schlecht, wenn sie durch den Bengel ehrgeizig wird. Nun, man muss abwarten.
Drei oder vier oder fünf Tage schien auch alles gutzugehen. Johannes sprach nicht mehr von Schmied werden und Bauer, sondern war bereit, sich mit all den neuen Dingen in den Büchern zu beschäftigen. Er hatte einen wirklich seit vielen Generationen ausgeruhten Kopf, und sein Gedächtnis fraß den Lernstoff in sich herein wie eine Dreschmaschine die Roggengarben. Aber dann kam es so, dass Neuschnee fiel, einen ganzen Vormittag lang. Am Morgen war sie noch im Jagdwagen zur Superintendantur gefahren, als sie aber mittags nach Schulschluß vor die Tür traten, fuhr Eli mit dem Schlitten und zwei fröhlich klingelnden, aufgeregt tänzelnden Rappen vor.
Au fein! sagte sie aufgeregt. Ist die Schlittenbahn gut, Eli? Komm, steig schnell ein, Hannes, fahr ein Stück mit!
Und dieser Schlitten, ein großer weißer hölzerner Schwan, zwischen dessen Flügeln sie sitzen durften, auf roten Polsterbänken, den Eli auf einem kleinen, schwebenden Bänkchen hoch hinter und über sich, mit den aufgeregten, dampfschnaubenden Pferden vor sich – dieser Schlitten war ja ein solches Wunder, dass er sich überrumpeln ließ und neben ihr saß, er wußte nicht, wie es gekommen war.
Schon ging es fort. Nichts mehr von klapperndem Kopfsteinpflaster – in einer schönen Kurve, in die sich die Pferdeleiber richtig einschmiegten, ging es über den Marktplatz in die enge Dorfstraße hinein. Still unter ihren Schneebuckeln saßen die Häuser, und die Leute blieben stehen und starrten und grüßten.
Plötzlich wurde Johannes hellwach. Da war eben der Ernst Menz stehengeblieben und hatte den Schlitten gegrüßt. Als er aber neben Christiane den Johannes Gäntschow entdeckt hatte, war sein ganzes Gesicht in ein breites und, wie es schien, höhnisches Grinsen auseinandergelaufen.
Plötzlich empfand er mit einer peinigenden Klarheit den Gegensatz zwischen den reinlich gebürsteten roten Polsterbänken, dem fleckenlos weißen Schwan, dem klingelnden Geschirr mit dem blitzenden Neusilberbeschlag und seinem alten, schmuddligen, geflickten Anzug, den schon Vater und Alwert getragen hatten und der noch dazu häßlich geflickt war. Und als nun auch noch der Müllersohn Adi Dittmann stehenblieb, breit Front machte, die Mütze zog und irgend etwas rief, das im Schellengeklingel unterging, aber sicher etwas Höhnisches gewesen war, als Christiane auch noch sagte: Ist es nicht schön? und ihn strahlend mit ihren dunklen Augen ansah, da schrie er ihr beinah in das erschreckende Gesicht: Anhalten, sofort anhalten!
Im ersten Augenblick begriff sie nichts von seinen Gefühlen. Sie starrte ihn verständnislos an, aber da war er auch schon aufgesprungen, hatte sich umgedreht und den Kutscher mit weißem, zuckendem Gesicht angeschrien: Anhalten sollen Sie, Eli, anhalten, verstehen Sie wohl! Eli war nun freilich ein viel zu vornehmer Kutscher, um Befehle von so einem Bauernjungen zu hören, Befehle in solchem Ton noch dazu. Und für alle, außer seiner Herrschaft, war und blieb er zudem »Herr Wacker«.
Eli gab dem Sattelpferd einen Schmitz mit der Peitsche, ließ sie einen Augenblick auf dem Rücken des Handpferdes tanzen – und in beschleunigtem Tempo fuhren sie nun aus dem Dorfe heraus, die schöne, glatte Landstraße nach Fidde entlang.
Aber dem Jungen waren Eli und Tempo und Christas Fragen ganz egal. Ihm war, als sei er übertölpelt worden, die grinsenden Gesichter, sein Bruder Alwert, ol Gäntschow, de Supkopp – wie ein gefangenes wildes Tier sah er auf die rasch vorübergleitende Chaussee, hörte kein Wort von dem, was Christa sagte, riß sich los von ihr – und warf sich mit aller Gewalt, die Hände voraus, auf die Fahrbahn, die ihm immer glitzernder und weißer entgegenkam. Er landete trotz der vorgestreckten Hände wie eine Padde auf dem Bauch, rollte sich ein paarmal um, schlug mit dem Kopf gegen einen Stein, ein ganzes Feuerwerk von Rot, Gelb und Schwarz ging in seinem Kopfe los. Wie aus weiter Ferne hörte er das beruhigende Hoho! des Kutschers zu den aufgeregt schnaubenden Pferden, die ängstliche, sehr laut rufende Stimme Christas. Nun wird sie wohl auch noch kommen und ihn aufheben und bedauern! Er sprang hoch, sah um sich: sie waren erst drei-, vierhundert Meter aus dem Dorf, er brauchte nur über den Chausseegraben in die Tannenschonung von Rickmers, da fanden sie ihn nie …
Er warf sich in den Graben, alle Glieder schmerzten, der Kopf brummte und summte, er zog sich an einem Tannenzweig hoch, kroch mühsam durch das enge Gestrüpp. Der Schlitten, der gewendet haben mochte, klingelte wieder näher. Hier kriegen sie mich nie. Und nach all dem Zorn erfüllte ein seltsames Gefühl von Befreiung, ein seliges Unabhängigsein die Brust. Mochten sie doch alle … mochten sie doch alle … ach geht … Ich, Johannes Gäntschow …
Ein echter Gäntschow, sagte auch der Papa, ganz wie die Gäntschows sind: unbeherrscht, jähzornig, eigensüchtig.
Christiane hatte dem Vater gar nichts sagen wollen, sie hatte sofort nach ihrer Heimkunft den alten Doktor Westfahl, den einzigen Arzt der Halbinsel, angerufen und gehört, dass kein Johannes Gäntschow tot, mit einem Schädel- oder Beinbruch in seine Behandlung gekommen war. Die haben Pferdsknochen, kleine Baroneß!
Aber der untadelige Kutscher Eli hatte dem Grafen Meldung von diesem Zwischenfall gemacht. Eine Giftkröte, wenn ich so sagen darf, Herr Graf, hat mich angeschrien, Herr Graf schreien nicht so. Ich bin aber schuldlos, wenn ihm was passiert ist … Mit tiefer Verachtung: Solche Leute sind ja nie in einer Unfallversicherung …
Ein echter Gäntschow, sagte der Graf zu seiner Tochter. Weißt du, dein Großvater hat mal einen Gäntschow, es muss der Großvater von diesem Jungen gewesen sein, direkt beim Wildern auf unserer Flur getroffen und hat ihn ganz höflich deswegen zur Rede gestellt. Dein Großvater war immer sehr höflich. Und da ist doch dieser Gäntschow, warte einmal, Malte, ja richtig, Malte hieß er, derart wütend geworden, wohl aus Beschämung, dass er dem Großpapa, als sei der der Wilderer, Flinte, Jagdtasche und Patronen beschlagnahmt hat. Der Graf lachte. Papa war ja so ratlos! Was mache ich nur mit dem Menschen? fragte er immer wieder. Wildert und behandelt mich als Wilderer!
Aber ich habe ihn doch nicht beschämt, Papa, sagte Christiane verständnislos.
Nein, du nicht, du sicher nicht, sagte der Papa sanft. Aber da ist noch diese uralte Geschichte vom Kehlteich. Er erzählte sie ihr jetzt doch und schloß: Und wie der Junge da nun in unserem Schlitten gesessen hat und irgendein Bauerntöffel hat ihn sicher angegrinst, da ist ihm wohl erst eingefallen, bei wem er da eigentlich zu Gaste fuhr – nein, die Gäntschows sind unberechenbar, im Grunde sind sie zehnmal stolzer als die Grafen Fidde.
Aber Johannes ist bestimmt nicht so, sagte Christiane. Bitte, Papa, laß noch mal anspannen, und ich fahre zu ihm und erkundige mich.
Ich würde es nicht tun, Christa, sagte der Vater. Christa, ich würde es nicht tun. Gerade nicht bei einem Gäntschow. Erkundigen können wir uns auch ohne das. Ich werde einmal den Doktor Westfahl anrufen …
Da musste Christiane denn gestehen, dass sie das schon getan hatte. Graf Fidde sah seine Tochter lange an. Er entdeckte plötzlich ganz neue Seiten an ihr. Ich will und werde dir über deinen Umgang nie Vorschriften machen, Christa, sagte er, aber ich rate zur Vorsicht. Zu äußerster Vorsicht und Zurückhaltung.
In den nächsten Tagen musste Superintendent Marder leider die Beobachtung machen, dass der so angenehm begonnene Selbstunterricht der beiden Kinder schon wieder zu Ende war. Johannes Gäntschow saß blaß, mit langen, schmalen Lippen, übrigens auch mit einer kräftigen Beule auf der Stirn, an seinem Platz und beschäftigte sich ganz entschieden überhaupt nicht mit seinen Büchern. Christiane aber, auf dem schwarzen Wachstuchsofa, las wohl, schrieb auch was, gab aber womöglich noch verdrehtere Antworten als der Junge. Er hätte sich entschließen müssen, sich stundenlang zu seinen Schülern zu setzen, dazu aber hatte er jetzt am Wochenende, wo die Predigt gemacht werden musste, gar keine Zeit.
Was habt ihr nur, Kinder, fragte er, habt ihr euch gezankt?
Ich zanke mich nie, Herr Marder, sagte Christiane sehr von oben herab.
Die Kühe haben sicher noch kein Futter, Herr Superdent, sagte Johannes, die brüllen schon mindestens seit ’ner Stunde.
O Gott, ja! Also, Kinder, nicht wahr, ich bitte euch, einen Augenblick, ich muss mal schnell …
Er huschte hinaus, und die beiden saßen wieder allein. Christiane nahm ihr Buch vor, Johannes sah sie von der Seite an, etwas scheu, und stand dann rasch auf, als er merkte, sie war entschlossen, ihn wieder anzusehen. Er betrachtete ein Bild an der Wand: »Heimkehr des verlorenen Sohnes«, die Hände in den Taschen.
Johannes, sagte eine Stimme hinter ihm.
Er bohrte die Hände tiefer ein.
Hannes, klang es dringlicher.
Er zog die Schultern hoch und fing an zu pfeifen.
Hannes!! Das war schon beinahe ein Befehl.
Er drehte sich um, sah sie kühl an und pfiff melodisch weiter (was sehr schwer war). Dann wandte er sich einem zweiten Bild zu: »Gott gibt Moses die Gesetzestafeln«.
Du hättest ganz gut in unserm Schlitten mitfahren können.
Keine Antwort.
Warum bist du denn rausgesprungen?
Keine Antwort.
Wegen der alten Geschichte vom Pferdeschlachten? Papa hat mir das erzählt. Ich finde es einfach dumm.
So.
Oder weil mein Großvater deinen Großvater beim Wildern erwischt hat?
Schiet!
Wie?!
Schiet! Dein Großvater hat gewildert!
Mein Großpapa? Sie lachte so überlegen, dass er am Platzen war.
Warum hat er denn sein Gewehr hergegeben, die Bangbüx? Ich hätte mein Gewehr nie hergegeben.
Sie wurde auch etwas rot, aber sie bezwang sich. Das konnte sie, wie gesagt, ihr Papa war sehr oft krank und dann launisch.
Du würdest eben nie wildern gehen, sagte diese Evastochter.
Er sah sie wutfunkelnd an. Natürlich würde ich wildern gehn!! Gerade würde ich das.
Nein, nie würdest du etwas Schlechtes tun, sagte sie.
Immer! Immer gerade das Schlechte, schrie er wütend. Heute nachmittag noch gehe ich bei euch wildern. Und wehe, wenn mir einer von euch in den Weg kommt –!
Er machte eine drohende Gebärde. Er sah lächerlich und schrecklich zugleich aus. Sie sah ihn ein bißchen amüsiert an, wie man ein kleines Tier betrachtet, das sich abstrampelt. Also schön, sagte sie. Ich werde Papa sagen, dass ich dir die Erlaubnis zum Jagen auf unserer Flur gegeben habe – kannst du überhaupt schießen?
Die letzte Frage war rein rhetorisch. Sie setzte sich in ihrer Sofaecke zurecht und nahm endgültig ein Buch vor. Er war so erschlagen, dass er mindestens zwanzig Sekunden nichts sagen oder tun konnte. Er starrte sie nur an. Aber sie sah ihn nicht wieder an. Sie las geruhig, nur ihre Backen waren ein wenig gerötet.
Zum Donnerwetter! schrie er plötzlich und rannte zum Fenster. Gerade kam der Superintendent über den Hof ins Haus. Herr Superdent, schrie er aus dem Fenster, ich mach Schluß, ich mach Feierabend, ich geh nach Haus.
Der alte Marder sah erstaunt zu dem Fenster hinauf und machte eine abwehrende Handbewegung. Dann faßte er sich an die Stirn, als habe er nun alles begriffen, und schoß in das Haus. Der Junge aber, der wußte, er musste ihm auf der Treppe begegnen, war mit einem Schwung über die Fensterwand und kletterte wie eine Katze am Spalier hinunter. Er sah nicht zu ihr hinauf, die zu ihm herunterrief. Es war seine zweite Flucht vor ihr binnen einer Woche, und er wußte das ganz gut. Er rannte wie ein Amokläufer über den Hof und verschwand durch die kleine Pforte, die zu Kirche und Friedhof führte.
Er hatte dreiundeinhalb Stunden vor sich, bis der Unterricht offiziell zu Ende war, und es war ein bitterkalter Wintertag. Er dachte einen Augenblick nach, rannte dann hinter dem Dorf herum und schlug den Weg nach Dreege ein. Ihm war eingefallen, dass er im Hafen mal nachsehen könnte, ob da ein Dampfer lag. Am Hafen würde sich die Zeit am besten vertreiben lassen, und er blieb warm. Er war sich gar nicht klar darüber, wie die Sache nun weitergehen sollte, er würde mit seinem Vater, mit dem Superintendenten, mit allen Leuten Krach kriegen, er würde wieder auf die Dorfschule müssen, Doofschule hatte er noch gestern zu Nachbar Lindemanns Jürgen gesagt. Aber vorläufig mussten erst einmal diese dreieinhalb Stunden untergebracht werden. Er war sich vollkommen klar darüber, dass er in seiner Wut einen schönen Unsinn gemacht hatte. Weil man den einen Tag aus dem Schlitten gesprungen war, brauchte man nicht den andern Tag aus einem Fenster zu klettern. Weil Windmüllers Adi dämlich gegrinst hatte, brauchte man nicht mit Christiane Streit anzufangen. Aber so war er – und nun mach mal was dabei!
Als er an Müllers Adi gedacht hatte, hatte er unwillkürlich Schnee zu einem Schneeball aufgesammelt. Er knetete ihn voll Wut so lange, bis es ein richtiger Eisball geworden war, und wäre jetzt Adolf Dittmann in Wurfweite gewesen, hätte er eine Beule zu besehen gehabt.
Aber kein Adi Dittmann kam. Dafür aber hörte er hinter sich den Hufschlag eines Pferdes. Erst schielte er argwöhnisch, vielleicht waren ihm »die Feinde schon auf der Spur«. Dann aber sah er, dass es ein gewöhnlicher Einspänner war. Als er den Fahrer erkannte, war es der Fleischer Frehle aus Dreege, der vor ein paar Wochen die Blanka bekommen hatte. Der Fleischer war schon halb an dem Jungen vorbei, als er einen Blick zur Seite tat. Er parierte das Pferd. Bist du nicht einer von den Gäntschows Jungen? Willst du nach Dreege? Spring auf. Es ist heute frisch.
Der Junge kletterte auf den Karren.
Da, nimm den Pferde-Woilach um. Es pustet heute tüchtig. Der Bodden ist schon ganz zugefroren.
Liegen Dampfer unten?
Nein, keiner, nur der Blücher.
Der Blücher ist doch auch ein Dampfer, ein Raddampfer sogar, widersprach Johannes.
Der Blücher ist doch kein Dampfer, sagte der Fleischer. Der Blücher ist doch ein Malheur.
Und nun lachten sie beide, denn der Blücher war so alt und betagt, dass er für eine Fahrt nach Stralsund, die ein anderer Dampfer in drei Stunden fuhr, neun brauchte. Wenn er überhaupt hinkam.
Bist du nicht der Gäntschow, der beim alten Marder jetzt Unterricht hat? fragte der Fleischer.
Ja, sagte Hannes unwillig, denn jetzt musste ja unbedingt die Frage kommen, warum er denn nicht im Unterricht, sondern auf der Landstraße sei.
Vielleicht aber interessierte sich der Fleischer nicht so sehr für die Zeiteinteilung des jungen Gäntschow. Ist das wahr, fragte er, dass du mit der Gräfin zusammen Schule hast?
Das ist doch keine Gräfin, äffte ihm Johannes nach, das ist doch eine Freiin.
Wieso, sagte der Fleischer, aus allen Himmeln gefallen, ließ die Peitsche sinken und starrte den Jungen groß an. Wenn’s die Tochter von einem Grafen ist, ist es ’ne Gräfin, und wenn’s die Tochter von ’nem Freiherrn ist, ist’s ’ne Freiin.
Sie hat mir aber selbst gesagt, dass sie ’ne Freiin ist.
I du Donner, dann ist er vielleicht gar nicht Graf? Dann ist er bloß Freiherr?! Er überlegte. Oder ist Freiherr mehr als Graf?
Viel mehr, sagte Johannes aufs Geratewohl. Manche sagen auch Baronesse zu ihr.
Dann wäre er wieder Baron? Nee, auf den Holzrechnungen steht aber Gräflich Fiddesche Forstverwaltung. Er sah Johannes bekümmert mit seinen kleinen, eiligen Augen über den feisten, blaurot gefrorenen Backen an. Na, du weißt wohl auch noch nicht so damit Bescheid, dass du mir das Zeugs richtig erklären kannst. Wie sagst du denn zu ihr?
Ich sage Christiane.
Christiane? Einfach Christiane? I du Donner! Ja, ich habe es schon gehört, du bist mit ihr im Schlitten gefahren. Die Leute haben was gestaunt.
So, sagte Johannes mürrisch.
Ja, ja, nickte der Fleischer, wo viel Wolle ist, ziehen sich die Motten hin. Paß nur auf, dass du nicht zu hochnäsig wirst.
Was sagen denn die Leute, fragte Johannes nun doch.
Ach, das sind doch alles bloß Neidhammel, sagte der Fleischer verächtlich. Solche Bauern, die nicht von ihrem Mist runterkommen. – Na, wenn du zum Hafen willst, musst du jetzt absteigen. Ich fahr hier links.
Schön, sagte Johannes und schlitterte langsam und gedankenvoll zum Hafen hinunter. Der erste Mensch, den er dort traf, war sein Bruder Max. Und der zweite sein Vater. Sie verluden Roggen in einen Kahn.
Was machst du denn hier, Hannes?
Hab was zu bestellen für Herrn Superdenten, sagte Hannes streng, ging eilig weiter, um das Bollwerk herum, auf den Blücher zu, über die Laufplanke. Ein Maschinist, Putzwolle in der Hand, hielt ihn an.
Junge, wo willst du denn hin?
Wo is’n der Käpten?
Zu Hause.
Wo zu Hause?
Auf ’m Lande.
Wo auf ’m Lande?
Bei Stralsund.
Wo bei Stralsund?
In Triebkendorf, aber …
Wie weit is es denn von Stralsund bis Triebkendorf?
Drei Stunden zu laufen, aber …
Hat denn Triebkendorf auch ’n Hafen?
’n Hafen? Wo soll denn da das Wasser für herkommen?
Also kein Hafen?
Nein.
Warum sagen Sie mir das nicht?
Ich hab’s doch gesagt!
Na, denn ist’s ja gut. Guten Morgen.
Und Johannes ging gravitätisch über die Laufplanke wieder ans Ufer.
Hallo, rief der Maschinist hinter ihm.
Hallo, rief Johannes und drehte sich um.
Was hast denn eigentlich gewollt?
Das hab ich dir doch gesagt.
Nee, das hast du mir nicht gesagt.
Na, denn ist’s ja gut. Guten Morgen. Und Johannes ging entschlossen weiter.
Hallo, schrie es hinter ihm. Der Maschinist, seinen Wisch schmutzige Putzwolle immer noch in der Hand, war über den Laufsteg an Land gekommen.
Hallo, rief Johannes und blieb in zwölf Schritten Abstand stehen.
Was haste gewollt, sollst du sagen, schrie der Maschinist wütend.
Düsige Schmierjacke, schrie Johannes zurück. Ätsch! und rannte los, dass die Beine flogen.
Eine Stunde später betrat ein sehr fideler, aufgeräumter Johannes die superintendentliche Arbeitsstube, wo der Geistliche noch immer von seiner Schülerin zu erfahren suchte, was eigentlich mit dem Johannes, mit ihr, mit ihnen beiden los sei.
Tag, Herr Superdent. Vater hat gesagt, ich soll doch was lernen. Entschuldigen Sie man. Tag, Tia. Sag mal, wie kommt das, dass dein Vater Graf ist und du bist Freiin? Ist denn dein Vater auch Freiherr?
Johannes, rief der Geistliche, wo kommst du her?
Von Vater.
Johannes! Dein Vater ist heute um halb neun hier vorbeigefahren.
Nach Dreege, Roggen in den Kahn verladen, da war ich auch. Stimmt alles, Herr Superdent.
Der Superintendent seufzte. Also jedenfalls scheinst du dagewesen zu sein. Und warum bist du an meinem Spalier runtergeklettert?
Darf ich das nicht, Herr Superdent? Wir haben zu Haus auch ein Spalier, Da klettern wir immer in die Giebelstube rauf. Vater sagt nichts.
Ich glaube, sagte der Geistliche, du spielst augenblicklich ein bißchen Theater, mein Sohn. Da aber deine Mitschülerin Christiane auch etwas geheimnisvoll ist, will ich euch fünf Minuten einander überlassen und hoffe, dass dann ohne alle Geheimnisse weitergearbeitet wird. Jetzt will ich nur mal schnell …
Also, wie ist es mit der Freiin? fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. Warum bist du denn wiedergekommen?
Ich weiß auch nicht, sagte er plötzlich in ganz anderm Ton. Ich habe erst einen und dann noch einen verklapst, und da war ich so guter Laune, dass ich nicht mehr wütend sein konnte. Außerdem hast du wirklich an nichts schuld.
Sie schüttelte wieder den Kopf. Das mag ich aber gar nicht. Wenn du immer erst ein paar verklapsen musste, um zu sehen, dass du unrecht hast. Das will ich nicht.
Ich bin doch nun mal so, und Vater ist auch so, und Großvater war auch so. Alle waren überhaupt so. Da kann man gar nichts machen, Tia.
Da kann man viel bei machen, sagte sie streng.
Bist du schon mal oben auf dem Leuchtturm gewesen? fragte er. Hundertdrei Meter ist der hoch. Ich hab gehört, man kriegt fünfzig Mark von dem verrückten Maler in Fabiansruh, wenn man den Blitzableiter runterklettert. Fünfzig Mark wären fein.
Das möchtest du wohl tun? Und dir alle Knochen dabei zerbrechen!
Ich brech mir doch nicht die Knochen. Ich mach die Augen zu und rutsche einfach runter.
Wegen lumpiger fünfzig Mark?
Fünfzig Mark sind doch nicht lumpig, na weißt du! Fünfzig Mark, sagte er eifrig, weil er einen Gedanken hatte, das ist ein ganzer Morgen Roggen. Denk mal: schälen, eggen, pflügen, wieder eggen, säen, im Frühjahr noch mal eggen, mähen, binden, puppen, dreschen, sacken, auf den Boden bringen, wieder sacken, verladen, alles für fünfzig Mark. Das ist eine Masse Arbeit. Du könntest sie nicht tun – für das lumpige Geld.
Aber für den Roggen ist es gutes Geld, und für den Blitzableiter ist es schlechtes Geld.
Ach nee, sagte er ganz erstaunt. Gibt es gutes Geld und schlechtes Geld?
Jawohl gibt es das, sagte sie sehr böse. Wenn man stiehlt, ist es auch schlechtes Geld.
Aber Blitzableiter und Stehlen ist ein riesiger Unterschied.
Das ist genauso, wie wenn man fröhlich dadurch wird, dass man Leute veräppelt, rief sie und brach in Tränen aus.
So fand sie, wieder ganz ratlos, der Superintendent.
Ja, sie waren beide so verschieden, jedes war ganz anders aufgewachsen wie das andere, in fast nichts waren sie einer Meinung. Er haßte Heulen – und doch waren es diese ihre Tränen, die für lange Zeit alle Spannungen zwischen ihnen lösten. Irgendwie begriff dieser Bengel, dieser ewige Stacheligel, dass er ihr ernstlich weh getan hatte – und warum sollte er das eigentlich? Er hätte kein Tier sinnlos geschlagen – bloß weil sie eine Freiin Fidde war? Aber, wie gleichgültig ihm das war! Was gingen ihn die alten Geschichten an. Außerdem hatte sein Großvater wirklich gewildert. Und doch hatte er dem Grafen Fidde damals die Flinte zurückgeschickt, mit einem Hasen dazu: Schönsten Dank, aber sie tauge nichts, sie schösse zu tief. Nein, keine Ursache, auf die Fiddes böse zu sein.
Sie hatte da ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel, dass man anders werden könnte. Er war nicht überzeugt davon, aber vielleicht hatte sie doch recht. Er musste darüber nachdenken. Es war etwas daran. Auch er sah ja zum Beispiel, dass Vater nicht so war, wie er sein müßte, und vor allem, wie er hätte sein können. Mit sich war er auch nicht ganz zufrieden. Gutes Geld und schlechtes Geld, jawohl, das konnte sie sagen, aber das war nun wieder anders. Dass sie so etwas sagen konnte, das kam daher, weil sie nie wirklich ohne Geld war. Gewiß, man durfte nicht stehlen, man tat es wenigstens nicht, aber einen Viehhändler durfte man reinlegen, einen Blitzableiter durfte man herunterklettern – und: Du, Christa, sagte er eifrig, dann ist es aber auch schlechtes Geld, das der Marder für seinen Unterricht bekommt. Er tut doch fast gar nichts, und mein Vater denkt, er sitzt fünf Stunden bei uns. Sie machte nicht die geringsten Umschweife. Das ist es auch, gab sie zu.
Und das Geld, das er als Pfarrer bekommt, ist denn das gutes Geld?
Ich weiß nicht, sagte sie zögernd.
Na, du siehst doch, wie er seine Predigten macht. Husch, husch, drei Bücher nachgeschlagen, husch, husch, fertig. Das kann ich auch. Das kann jeder. Und wie er sich um die Leute kümmert!
Ja, er hat viel zuviel vor, gab sie zu. Nun auch noch der Hof.
Nicht wahr, er wird doch als Pfarrer bezahlt, und nun spielt er dazu den Großbauern. Weißt du das mit dem Ziegenbock?
Nein, sie wußte es nicht. Der Superintendent, der Marder, war doch solch misstrauischer, knifflicher Mensch. Keinem traute er. Keine Arbeit wurde gut genug und schnell genug gemacht, nach allem sah er selbst, und immer wurde zuviel veraast. Da hatte er nun diese vier Pferde im Stall stehen, wie im vorigen Winter, so jetzt im Winter, und sie taten rein gar nichts. Auf den Acker konnte man nicht, zu fahren war nichts mehr, sie standen im Stall, fraßen immer weiter den teuren Hafer, zu acht Mark den Zentner, und schlugen die Stände vor lauter Übermut kaputt.
Der Superintendent war ein moderner Landwirt. Er besaß gedruckte Fütterungstabellen: verdauliches Eiweiß, Kohlehydrate, Stärkewerte. Der Superintendent rechnete und rechnete. Er rechnete für seine Pferde ein »lebenerhaltendes« Futter heraus, ein Minimum an Nährstoffzufuhr, und er dachte dabei nicht daran, welches Futter seinen Pferden nun auch bekömmlich war. Das verdauliche Eiweiß, der Stärkewert, die machten es!
Darüber wurden die alten Schinder immer jämmerlicher und hinfälliger. Die Knechte, die ihre Pferde gern gehabt hatten, sagten den Dienst auf, und es kamen Lumpen an ihrer Statt, denen die Tiere gleichgültig waren. Ja, die den Superintendenten, in ihre Bärte grienend, noch in seiner Sparsamkeit bestärkten. Es war ein Anblick, der einem das Herz im Leibe umdrehen musste, kam man in den Stall: mit gesenktem Kopf, trüben Augen, lang herunterhängenden, schlaffen Lippen, rauhem, strubbligem Haar standen die Pferde auf zitternden Beinen in den Ständen und wußten nicht mehr, ob sie sich zum Leben oder Sterben entschließen sollten. Sie gewöhnen sich, es ist nur der Übergang, sagte der Superintendent zu Besuchern, die wortlos diesen Jammer betrachteten. Ich habe es genau berechnet. Es ist ein Futter, das das Leben erhält und doch keinen Übermut aufkommen läßt. Und dann, sagte er hoffnungsvoller, habe ich schlechte Knechte gehabt, die immer nur Hafer füttern wollten – mit Hafer können alle füttern! Aber jetzt habe ich tüchtige Leute, die meine Futterprinzipien verstehen.
Der Besucher überlegte trübsinnig, ob man nicht an den spitzen Schulterknochen gut die Mütze aufhängen könnte. Aber der Geistliche fragte eifrig den Knecht: Na, was macht der Schimmel, Ernst?
Oh, er macht sich, Herr Super, sagte der Knecht. Er macht sich. Heute früh hat er einmal tüchtig geschnaubt und mit dem Vorderhuf im Stroh gekratzt.
Sehen Sie, sagte der Superintendent, es ist nur die Umstellung, der Mann sagt auch, er macht sich.
Mittlerweile stellte sich der Schimmel so um, dass er sich hinlegte und krepierte. Aber nicht an Futtermangel, beileibe nicht. Sicher hatten die früheren Knechte ihm aus Rache was eingegeben. Aber schließlich wurde es doch klar, dass auch die andern Pferde zum mindesten »krank« waren, das war nun schlimm. Zum Tierarzt bis nach Sagard zu schicken, war viel zu teuer, außerdem fürchtete der Superintendent vielleicht im geheimen für seine Futtertheorie. Dann gab es noch den Schäfer Hundertmark. Aber ein Schäfer war gar nichts, unwissenschaftlich, bloßer Aberglaube.
In dieser Not fielen dem Geistlichen nun die preußischen Kavalleriepferdeställe ein, in deren jedem traditionsgemäß ein Ziegenbock gehalten wird, der, wie jedermann weiß, keine Krankheit im Stall aufkommen läßt, sondern alles auf sich zieht. Man könnte nun freilich sagen, dass ein Ziegenbock auch Aberglaube ist, aber erstens ist ein Bock in Pferdeställen eine offizielle militärische Einrichtung, zweitens hängt es irgendwie ganz wissenschaftlich mit dem starken Geruch, den Böcke absondern, zusammen, und drittens konnte der Ziegenbock die Ziegen der kleinen Leute in Kirchdorf decken, sparte ihnen den weiten Weg bis Riek, und der Superintendent strich noch Deckgelder ein.
Ein Ziegenbock wurde gekauft. Ein wahrer Patriarch an Körper und Ehrwürdigkeit, mit langem, zottigem Haar, einem herrlichen, weißen Spitzbart, den schamlosesten, frechsten und neugierigsten Augen von der Welt und breiten, weitausladenden, geschwungenen Hörnern.
Alles ging verquer! Dieser Ziegenbock war der Vater der Neugierde, ein Großvater der Frechheit und ein wahrer Satan der bösen Streiche. Im Stall war er ein Fehlschlag, vielleicht war er zu spät gekommen, jedenfalls fiel noch ein Pferd, und der Superintendent kehrte schweigend und grimmig zum Hafer zurück. Aber dieser Bock, von den Pasewalker Offizieren auf den schönen Namen Phryne getauft, verliebte sich in den Geistlichen und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Keine Kette half, keine noch so kunstvolle Fesselung, kein Lattenverschlag, plötzlich rannte er laut meckernd im Triumph über den Hof, stieß die Tür zur Superintendantur auf, erkletterte, tripp, trapp, die Treppe, war im Studierzimmer, suchte das Dorf ab und ruhte nicht eher, bis er seinen breitschultrigen Marder gefunden und ihm, zufrieden meckernd, ein paar sanfte, aufmunternde Stöße ins Gesäß versetzt hatte.
Der arme Superintendent. Diese Wochen waren schwere Wochen für ihn! Der Bock war kein billiger Bock gewesen. Bis zur Deckzeit im Frühjahr, da er ein bißchen Geld einbrachte, sollte er mindestens durchgehalten werden. Der Geistliche, schon immer hastig, bekam jetzt etwas Flüchtiges, Scheues, einen beklagenswert angstvollen Blick über die Schulter. Immer floh er vor Phryne, versteckte sich vor ihm, schloß Türen ab, fragte mitten im Gespräch: Hören Sie nichts? Wie?!
Und diese ollen Heimtücker von halben Heiden, diese rechten Insulaner, begriffen so rasch die Lage ihres Seelsorgers, es hatte sich herumgesprochen – Da meckert doch was, Herr Superdent? fragten sie.
Weg war er. Weg von Vermahnungen, Tröstungen, Geschäften!
Aber die Ereignisse dann am sechsten Februar, dem fünften Sonntag nach Epiphanias, gaben dem Bock und seinem Herrn doch den Rest. Herr Superintendent Marder war in der Kirche, und seine Gemeinde, seine Schäflein, mit ihm. Die Gemeinde sang das Lied vor der Predigt. Sechs Strophen. Und der Superintendent ging frierend und wartend in der eiskalten Sakristei auf und ab. Die Hände hatte er ganz in die Ärmel seines Talars gesteckt. Nun waren sie bei der dritten Strophe. Nun fingen sie die vierte an …
Der Kantor Bockmann hätte bei solcher Kälte das Zwischenspiel auch gern etwas kürzer machen können! Was aber der eigentliche Kirchendiener war, so hieß er Wollenzien, Gabriel Wollenzien. Ein Kirchendiener muss ein geschickter, rascher Mann sein. Gabriel Wollenzien aber war man tüterig. Das war dem Superintendenten lange klar. Doch das Kirchendieneramt (für fünf Zentner Roggen jährlich und zwei Dutzend Eier zu Ostern) war erblich in der Familie Wollenzien. Nein, sie kamen mit der vierten Strophe nicht klar. Was sie nur hatten? Gottlob hielt die Orgel sie bei der Stange, aber nun tat plötzlich auch die Orgel einen ganz unziemlichen Hüpfer – und stürzte sich wie schuldbewußt in um so lautere Akkorde. Alle Register, alle Register.
Der Superintendent machte die Sakristeitür ein bißchen auf, trotzdem er das eigentlich für ganz unziemlich hielt, denn die Minuten während des Gemeindegesanges hat der Geistliche sich in der Sakristei innerlich auf seine Predigt vorzubereiten. Er sah nur einen spitzen Ausschnitt von drei Bänken, mit den Bauersleuten Lau und Gierke, die sich aber umgedreht hatten …
Sicher war etwas nicht im Lot. Vielleicht war, wie schon einmal, der Dorfsüffel Timmermann in den Gottesdienst geraten, und Wollenzien war wieder einmal der Lage nicht gewachsen.
Mutig ging die Orgel das Zwischenspiel zur fünften Strophe an, klang, psalmodeite und tat einen tiefen, hinsterbenden Seufzer: keine Luft. Der Bälgetreter auch nicht auf dem Posten. Na warte, Jungchen!
Der Superintendent raffte den Talar und kletterte die Treppe zur Kanzel empor. Na wartet, ich will euch umdrehen lehren!
Er trat hinaus vor seine Gemeinde. Sie sahen nicht hin zu ihm, sie merkten sein Kommen gar nicht einmal. Alle Gesichter waren von der Kanzel fortgewendet, nach dem Kirchenchor zu, und weder Wollenzien noch der Kantor waren zu sehen. Jawohl, der Platz an der Orgel war verlassen, mitten im Vorspiel zur fünften Strophe, da doch sechs gesungen werden sollten!
Friedfertigkeit erfüllte nicht des Superintendenten Herz, da er sich einmal, ein zweites Mal räusperte. Er musste sich ein drittes Mal räuspern, ehe alle zu ihm hersahen. In allen Gesichtern lag etwas Verhaltenes, sie sahen ihn so erwartungsvoll an, viele waren rot, andere zuckten, Kinne wackelten, Bärte sträubten sich. Der Geistliche spähte. Er sah nichts. Er verlas das Schriftwort, er merkte, sie hörten ihn gar nicht – worauf warteten sie noch?
Er begann seine Predigt. Sie hörten nicht zu, ja viele Gesichter hatten sich wieder von ihm fortgewendet.
Superintendent Marder war sehr böse. Er war so böse, dass er die Predigt unterbrach und energisch mit einem Finger auf die Kanzelbrüstung pochte. Zögernd kamen die Gesichter zurück zu ihm, jetzt schien auf der Orgelempore ein verhaltenes Gerenne, ein leises Gehusche zu sein.
Der Superintendent wollte neu einsetzen. Da klang von der Orgelempore schrill in höchstem Jagdeifer plattdeutsch eine grelle überkippende Jungenstimme: Ick heff em, Herr Kanter. Kamen Se längs! Ick hol dat Undiert nich …
Und hinter der Orgel hervor jagte polternd die grausige, wilde, verwegene Jagd: Phryne, der weiße Bock, an seinem Stummelschwanz hängend, verzweifelt schreiend, der Junge Bälgetreter. Aus der Chorbank links, wo er sichtlich wie ein Jäger auf Ansitz gesessen hatte, schoß hervor, einen Schirm schwingend, der kleine verwachsene Kantor Bockmann, erregt flüsternd und scheuchend: Wistu!
Und aus der Bank rechts der tüterige Wollenzien: Min leiwe Zickenbuck! Kumm to ol Vadder Wollenzien!
Aber der Bock, über seine Feinde triumphierend, riß sich los, der Junge stürzte, der Kantor floh in Bankdeckung vor den Hörnern, kläglich protestierte Wollenzien: I du Deibelsvieh! Stöten wist du?
Der Bock sprang auf eine Chorbank, auf das breite, geschnitzte Geländer des Chors, hoch thronte er über der Gemeinde, aus der unterdrückte Rufe, Gelächter, Angstkreischen laut wurden. Mit wackelndem Bart, drohenden Hörnern, frechen Augen stand der Bock unerreichbar auf dem Geländer – und sah plötzlich seine Liebe, den Superintendenten, den versteinerten, auf der Kanzel. Phryne schmetterte sein triumphierendes Meck und Mäh, er schien den Zwischenraum zwischen Chor und Kanzel zu messen, näher wollte er seiner Liebe, und der erwachte Superintendent warf mit einem lang nachhallenden Knall die Tür hinter sich zu. Die Kanzel war leer.
Aber ach, diese Wut in der Sakristei, diese hilflose, zitternde Wut! In allen Häusern der Insel, in ihren spätesten Geschlechtern wird man immer noch die Geschichte vom Ziegenbock erzählen, der seinen Superintendenten von der Kanzel vertrieb. Marder hatte eine kräftige, lederhafte Haut. Sie mochten ihn filzig, flusig, sonstwas schelten, aber lächerlich, dies nein. Lächerlich durfte er nicht sein! Er biß die Zähne zusammen, er überwachte selbst den Abtransport des Bockes, er schloß ihn selbst in die Räucherkammer ein, aus der unmöglich zu fliehen war. Er steckte den Schlüssel in die Tasche und begann den Gottesdienst von neuem. Mochte aller Hausfrauen Essen anbrennen, so leicht wollte er es ihnen denn doch nicht machen. Und er betete unerbittlich lange für die bösen Buben, die solche Streiche trieben …
Aber, wieder zu Hause, schickte er sofort zum Viehhändler Frehle nach Dreege und ließ ihn kommen. Sonst schloß er nie ein Handelsgeschäft am Sonntag ab. Nein, auch dies wurde kein Handel: er verschenkte den kostbaren Bock, unter der Bedingung, dass ihn niemand mehr zu Gesicht bekommen dürfte und dass er gleich am nächsten Tage von der Insel verschwinden müßte. Phryne protestierte aus seiner Räucherkammer gegen diese Abmachungen mit kläglichem Gemecker.
Am nächsten Tag, am Montagmorgen, stand der Superintendent Marder halb versteckt hinter dem Ladeschuppen auf dem Dreeger Kai, sah den Blücher ablegen und ächzend, krächzend, Dampf abblasend, pfeifend die Höhe des Dreeger Boddens gewinnen. Auf dem Verdeck war lange ein weißer Fleck zu erblicken, der entschwindende Phryne. Dann verschwamm der weiße Fleck mit dem Schiff, der Dampfer tutete noch einmal und drehte sich um den Finkenhaken.
Erleichtert aufseufzend, machte sich Herr Marder auf den Rückweg. Das Kapitel Phryne war abgeschlossen, und er würde den Leuten schon die Mäuler stopfen. Und während er die Dreeger Chaussee langsam fürbaß mit seinen breiten Schultern entlang schaukelte, wurde er wieder beinahe ganz fröhlich beim Anblick der mit Wintersaat bestellten Äcker. Trotzdem im Januar eine Reihe von Tagen schweren Kahlfrost gebracht hatten, waren Roggen wie Weizen gut durchgekommen. Schön smaragdgrün lagen die Flächen in der klaren Wintersonne unter dem schon nicht mehr ganz blassen Blauhimmel. Um die Zweige der Kirschbäume an der Chaussee lag schon etwas wie eine Vorahnung des Frühlings. Die Spatzen stritten sich vergnügt und eifrig tschilpend um einen Pferdeapfel. Der Geistliche überlegte, wie er am nächsten Sonntag Septuagesimä diese Vorfrühlingsahnung in seinen Predigttext einflechten könnte.
Dann aber, an diesem selben Montagabend, tat er noch etwas Heroisches: er trotzte allem Gerede der Leute und ging in den »Schwedischen Hof«, der der Superintendantur gerade gegenüber auf der andern Seite des Marktplatzes lag. Da waren heute am Montag drei Skattische in Gang, ein Bauern-, ein Kaufleute- und ein Gutsbesitzerskattisch. Da würden sie heute beisammensitzen, die ihn durchhecheln wollten, und gerade darum ging er hin.
Heroisch an diesem Gang war aber, dass Superintendent Marder, der sonst nie in Gasthäuser ging und sonst nie Alkohol trank, fest entschlossen war, an diesem Abend bis zum letzten Mann sitzen zu bleiben und so viel Alkohol zu trinken, wie zu diesem langen Sitzen gehörte. Alkohol haßte er, Alkohol machte ihm angst, vor Alkohol schüttelte er sich – aber das war heute alles gleich.
Da ging er, ein kleiner, rötlicher Kerl, mit lächerlich breitem Rücken, aber zum Trommeln gab er sich nicht her, Kalbfell wurde er nicht. Er würde trinken und nicht betrunken werden.
Mit dem Trinken aber war es bei ihm so bestellt, dass sein Großvater schon gerne getrunken hatte und sein Vater sehr gerne. Er war die nächste Generation, er hatte statt einer Neigung eine Abneigung, aber sein strahlender, junger Bruder, fast gleichaltrig, hatte wieder zu gerne getrunken. Und Marder hatte an diesem Bruder, den er so herzlich wie nie einen andern Menschen wieder geliebt hatte, langsam, langsam allen Verfall durch den Trunk erlebt: den Schmutz, das Verkommen, die Verlogenheit, die Gier. Allmählich hatte der Feind – und was war das für ein schrecklicher, erbarmungsloser Feind – die Strahlenzüge des Bruders gestohlen, aufgeschwemmt und verschwommen war alles in diesem Gesicht untergegangen, was auf eine herrliche Zukunft hingedeutet hatte. Dann war der Zusammenbruch gekommen, die Anstalt, das krampfhafte, irre, schreckliche Flehen und Beschwören um einen einzigen Schnaps. Es war gekommen das Geheiltwerden, das Wieder-in-Freiheit-Leben des Bruders, die heimliche Angst um ihn und die schreckliche Gewißheit, dass er von neuem trank.
Es waren schreckliche Auseinandersetzungen gekommen, Schwüre, die in der Stunde schon, da sie gegeben waren, gebrochen wurden, die von vornherein nicht gehalten werden sollten. Und schließlich jene schreckliche Nacht, da die beiden Studenten auf ihrer Bude in Kampf gerieten, da die Seele des andern schon auf der Flucht, schon von ätzendem Alkohol ganz aufgelöst gewesen war. Wie in dem zerrütteten Trinkergehirn Visionen von Verfolgern, huschenden Tieren auftauchten, wie er zu schreien anfing, zu schreien wie selber ein Tier … Nein …
Bis er ein paar Tage danach auslöschte und zusammengefallen auf dem Totenbett lag als ein stiller, ernster Bruder jenes einst so herzlich Geliebten.
Ja, wie Superintendent Marder jetzt durch den Pfarrgarten und über den Marktplatz geht, denkt er natürlich an all diese Dinge nicht. Sie sind so lange her, sind wie versunken in ihm, unter der stets neuen Ernte stets neuer Erlebnisse. Aber die Angst sitzt in ihm …
Natürlich, er könnte Himbeerwasser trinken oder einen Tee und noch einen, aber er weiß doch, wie seine Insulaner sind: wer nicht plattdeutsch spricht und nicht mittrinkt, gehört nicht zu ihnen. Und heute muss er zu ihnen gehören.
Im Flur trifft er gottlob die Wirtin, Frau Reese, und er benutzt die Gelegenheit, ihr möglichst laut und sonor ein paar Worte zu sagen, und sie begrüßt ja auch recht lebhaft den ungewohnten Gast. Richtig, in der Gaststube links wird es plötzlich still. Ganz auffallend still. Und so platzt er wenigstens nicht unangenehm in ein Gespräch über sich hinein, als er eintritt und seinen guten Abend sagt.
Sie sind alle schön vorbereitet, und er muss viele Hände drücken und viele Fragen stellen und beantworten, ehe er sich an einen Tisch beim Ofen setzen kann, auf den Tisch klopfen und rufen darf: Herr Reese, einen Grog!
Es geht wie eine Welle verblüfften Schweigens durch den Raum. Aber das ist nur ein Augenblick, und dann haben sie alle, alle kapiert und reden doppelt laut: Kiekeda, der Herr Superintendent will sich wohl anbiedern. Er denkt, er hat es nötig – und laut reden sie von allen, allen andern Dingen.
Stark oder schwach? fragt der Wirt.
Stark, sagt der Superintendent und langt sich eine Zeitung.
Der Grog riecht gemein nach Fusel. Mit Widerstreben nur tut der Geistliche in den übelriechenden Trank den schönen, klaren, weißen Zucker. Er rührt gedankenvoll, lange, er sieht dabei gedankenvoll durch den Raum. Er sitzt schön in der Mitte. Sie können es weder rechts noch links wagen, über ihn zu sprechen. Natürlich denken die, er wird bald wieder abrücken. Aber da sollen sie sich geirrt haben!
Er nimmt den ersten Schluck. Ein schlimmes Getränk, viel schlimmer noch, als er gedacht. Er schüttelt sich, aber er trinkt mutig einen großen Schluck von dem Gebräu. Dann liest er weiter in der Zeitung.
Bis halb elf geht alles glatt. Bis halb elf kann er sich mit Zeitungen helfen. Er hat bis dahin drei Gläser Grog getrunken, und der Trank widersteht ihm nicht mehr so. Es wärmt schön, solches Gebräu. Übrigens hat es auch eine schöne, bernsteinhafte Farbe. Und das Gehirn wird langsam groß und weich. Als der Superintendent die letzte Zeitung aus der Hand legt und sich im Gastzimmer umsieht, ist er ganz andrer Stimmung. Da sitzen sie, jetzt reden sie nur noch, wenn ein Spiel fertig ist, und dann sprechen sie nur von den Fehlern, die die andern gemacht haben – an ihn denken sie gar nicht mehr. Aber er möchte jetzt, dass sie an ihn denken, eine Anspielung machen. Sein ursprünglicher Plan, ihnen nur das Reden unmöglich zu machen, ist ganz vergessen. Jetzt möchte er ihnen Bescheid sagen, diesen selbstherrlichen Bauern, diesen Sittenrichtern im Glashaus. Da sitzt Bauer Behn mit dem noch immer schwarzen, krausen Haar, siebenundfünfzig ist er, und in den letzten zehn Jahren haben drei Mägde in seinem Haus ein Kind bekommen: Vater unbekannt. Aber Marder kann mit dem Finger auf den Vater zeigen, wenn er mag. Er sieht ihn ja an!
Reese, noch einen Grog und stärker.
Der da so laut krakehlt, ist der Kaufmann Stavenhagen, was schreit der? Weiß der Superintendent etwa nicht, dass der fette, rosige Mann einen heimlichen Schnapsausschank hinter seinem Laden hat? Doch, das weiß er, und er weiß noch mehr. Er weiß, dass jetzt zur Stunde vielleicht die Frau dort mit irgendwelchen Bürschlein Liköre trinkt. Er braucht nicht durch die Fenster zu sehen, er kann durch die Wände schauen! Zuhälter der eigenen Frau, wahrhaftig, aber ihm einen Bock vorwerfen, einen lächerlichen Zufall, seinen Ruf zerreden, zerwalken, dass er schließlich mit dem Konsistorium Schwierigkeiten hat, das können die.
Nicht ein Wort von euch –!
Kein schlechter Trank, nein, gewiß nicht, dies tut gut, es stärkt noch die Stärke, es macht angriffslustig. Der betrübt Aussehende da, der Lange, Bleiche, mit der weißen, höckrigen Schnüffelnase, das ist Finnig aus Fabiansruh, Pensionär nennt er sich – oh, du trauriger Wucherer, du. Umherschnüffeln tust du mit deiner Höckernase, im Winter ausschnüffeln, wo kein Geld ist bei den Bauern, und ihnen Geld anbieten, das Geld direkt ins Haus zwängen und drängen und dafür die ganze Ernte des nächsten Jahres kaufen, für – ach, man mag es nicht sagen, welches Schandgeld! Einen Ziegenbock hört ihr meckern auf der ganzen Insel, aber eure eigene Schande hört ihr nicht schreien zum Himmel! Ein guter Satz für die Predigt am nächsten Sonntag, wahrhaftig – worüber wollte er doch predigen? Er erinnert sich nicht mehr genau, aber er würde gut hineinpassen, das würde er.
Der rasche, wieselige Superintendent ist plötzlich ein breiter, schwerer Mann geworden, ein Kämpfer, er steht langsam auf und geht durch das Lokal. Auf den Flur. Wenn er nur wüßte, wo hier die Toiletten sind. Er weiß bloß, dass sich sonst die Gäste auf den Marktplatz stellen; wenn er beim Mondschein nachts ans Fenster der Superintendantur trat, hatte er oft den ganzen kläglichen Aufmarsch vor Augen. Auch eine Schande, wieder eine Schande … Er steht zögernd auf dem Gang, er könnte schnell einmal zu sich hinüber, aber man läuft nicht als Geistlicher nachts aus und ein in dem Gasthaus. Zögernd geht er nach hinten, den schlecht beleuchteten Gang hinunter. An seinem Ende, hinter einer Klapptür, ist ein ganzes Durcheinander von verschiedenen Türen. Alle fast dunkel. Eine Treppe führt da auch nach oben …
Er steht so da. Es ist still im Haus. Nur manchmal hört er den auftrumpfenden Knöchelschlag eines Skatspielers auf dem Holztisch. Er öffnet aufs Geratewohl die nächste Tür und sieht in eine spärlich beleuchtete, düstere, verräucherte Küche. Am Herd sitzt ein junger Mensch mit langen, blonden Haaren. Er hat ein Mädchen auf dem Schoß, dessen Kopf er weit zurückgebogen hat. Er küßt sie, sie küßt ihn. Der Geistliche hört das Geräusch des Küssens. Er will sich lautlos zurückziehen, da hat das Mädchen ihn gesehen, es stößt einen leisen, hellen Schrei aus und fährt hoch. Der Bursche schaut auch nach der Tür, in seinem Gesicht liegt ein Ausdruck aus Wut und Ertapptheit.
Entschuldigen Sie, sagt der Superintendent, wo sind hier die Toiletten?
Über die Treppe, sagt der Hausdiener mürrisch und sieht den Geistlichen böse an.
Der steigt die Treppe hinauf. Plötzlich bleibt er stehen. Plötzlich hört er die Stimmen der Leute in der Gaststube so laut, als säße er zwischen ihnen. Er sucht. Ein matter Lichtschein liegt auf seinem Beinkleid, er bückt sich, da ist eine Lüftungsklappe von der Gaststube nach der Treppe und diese Klappe steht offen. Er hört Stimmengewirr …
Ziegenbock, sagt einer und ein brüllendes Gelächter platzt los.
Er richtet sich steil auf, nein, er will nicht lauschen, das ist unter seiner Würde, und er steigt rasch die letzten Stufen der Treppe empor.
Oben liegt ein langer Gang vor ihm. Türen, Türen. Zehn oder zwölf. Die Gast- und Privatzimmer des »Schwedischen Hofs«. Er geht leise über den grellfarbenen Kokosläufer und blinzelt nach den Türnummern. Hinter einer Tür hört er reden, das ist die Stimme des Wirts, und das ist die weinerliche Stimme der Wirtin. Aber jetzt weint sie wirklich. Reese sagt heftig und böse etwas, und nun ruft die Frau schluchzend: O Gott, ich halte das nicht mehr aus! Was soll denn bloß in aller Welt werden mit mir …
Der Superintendent geht hastig den Gang zu Ende. Seine Stimmung hat sich in den letzten Minuten wieder ganz verändert, nichts mehr von Kampflust, nur Düsternis, Missmut, ja etwas wie Verzweiflung.
Keine Tür deutet auf das hin, was er sucht. Wieder geht er den Gang zurück. Er geht an der Tür vorüber, dreht um, als käme er eben erst von unten, und ruft laut: Herr Reese, bitte! Herr Reese!
Der Kopf des Wirtes fährt wild aus der Tür – und sein Gesicht glättet sich sofort, als er den Geistlichen sieht: Bitte, Herr Superintendent?
Wo sind denn hier die Toiletten, Herr Reese?
Auf dem Hof, Herr Superintendent, auf dem Hof!
Der Superintendent steht einen Augenblick schweigend. Er versteht den Hausdiener nicht – ist denn alle Welt heute böse? Dann sagt er: Bitte, zeigen Sie mir den Weg.
Aber gewiß doch, Herr Superintendent, sofort. Hier, bitte, ja. So weit wie in der Superintendantur sind wir noch nicht, einfach auf dem Hof, keine Wasserspülung.
Was macht denn eigentlich Ihre Frau?
Oh, danke der Nachfrage, Herr Superintendent. Alles in Ordnung, alles munter.
Wollte sie sich nicht operieren lassen? Ich habe mal so was gehört.
Ach, die kleine Sache – ja, Herr Superintendent, das ist nun so bei uns: im Winter blüht den Gastwirten ihr Weizen, da kann die Frau nicht fort. Aber vielleicht im Sommer, wenn dann noch Geld da ist. Er lacht herzhaft.
Warten Sie nur nicht zu lange, Herr Reese.
Ach, diese kleine Sache! Doktor Westfahl übertreibt ja immer. Nun, das kann man ihm nicht übelnehmen, Trommeln gehört zum Handwerk. Und der dicke Reese lacht. Aber sein Seelsorger ist hartnäckig: Haben die Leute nicht von Krebs geredet, Reese?
Krebs! Wenn ich das nur höre. Wie die Leute so was verantworten mögen. Eine ganz kleine Geschichte. Frauen stellen sich ja auch immer an. Übrigens … Er stockt.
Aber, fängt der Superintendent an.
Übrigens, sagt Reese böse, wissen Sie ja selbst, Herr Superintendent, wie es ist, Herr Superintendent, Ihnen ist ja auch die Frau gestorben, und Sie haben immer gesagt, es ist nur ein bißchen Husten.
Auch, denkt der Superintendent und hört die jammervolle Stimme oben wieder. Jetzt gehe ich wieder rein, sagt er.
Ja, es ist noch immer frisch, bestätigt der Gastwirt. Noch einen Grog, Herr Superintendent?
Sie können mir, sagt der Superintendent langsam, Sie können mir erst einen großen Kognak geben, und dann einen Grog.
Schön, Herr Superintendent. Ja, es ist frisch. Der Vollmond bringt uns neue Kälte …
In der Gaststube ist ein neuer Kunde eingetroffen: der Nachtwächter Marsiske steht da in seinem langen, grauen, dutzendfach geflickten Mantel, das Tutehorn an einem Lederband um, das dicke Gesicht mit der knolligen Nase frostgerötet, an einem geknoteten Bindfaden seinen Schäferspitz mit den hellen, klugen Augen. Er hat aufgeregt etwas erzählt, aber er ist schon gewarnt. Im Augenblick, da die Tür geht, schnappt er ab und sagt dann langsam: Ja, an der Post sind’s wieder zwei Grad.
Der Roggen wird noch auswintern.
Vor allem der Weizen.
Guten Abend, Marsiske, sagt der Geistliche, geht langsam durch das Gastzimmer und stellt sich an den Ofen. Nun, was haben Sie eben erzählt, als ich hereinkam?
Der Nachtwächter sieht seinen Seelsorger verlegen an: Ich? Gewiß nichts, Herr Super. Wir haben von der Kälte gesprochen.
Bitte, Ihr Kognak, sagt Reese. Der Grog kommt auch gleich.
Und was haben Sie von der Kälte erzählt? beharrt der Geistliche, nachdem er seinen Kognak mit einem Schluck hintergegossen hat.
Aber nichts, sagt Marsiske beteuernd, gar nichts! Wir sind eben erst rein. Nicht wahr, Polli?
Der Spitz sieht hoch mit seinen wachen Augen zu dem Mann und wedelt langsam mit der buschigen Rute.
Einen Augenblick ist Stille. Also du reizt, sagt Kaufmann Lindemann zu Kaufmann Stavenhagen.
Du kannst es ihm ja ruhig sagen, meint der schwarze Behn langsam zum Nachtwächter und deutet mit dem Kopf zum Geistlichen. Das ist nämlich wieder mal soweit, sagt er selber langsam und deutlich, Herr Superintendent, dass es wieder spöken soll auf Ihrem Kirchhof.
Der Superintendent trinkt seinen Grog aus, auch den trinkt er auf einen Zug ganz aus. Er ist böse und erleichtert. Reese, noch einen Kognak, sagt er. Wissen Sie, Marsiske, dass Sie noch immer diese alten Albernheiten aufwärmen mögen, vom Kapitän Schlung, der sich aufgehängt hat und keine Ruhe findet. Und dass Sie so was weitertragen mögen, Herr Behn. Dass hier große, erwachsene Männer sitzen und hören sich so etwas an, nun, ich für meine Person finde so etwas einfach kindisch.
Er trinkt schon wieder und macht eine Kopfbewegung zum Gastwirt, der ihm das Glas neu füllt. Der Nachtwächter sieht ziemlich betreten aus. Aber unerschüttert läßt sich Behn mit seiner langsam knarrenden Stimme vernehmen: Es ist diesmal aber nicht Kapitän Schlung, Herr Superintendent, es ist diesmal …
Alle Gesichter haben sich dem Superintendenten zugewendet und starren ihn erwartungsvoll und schadenfroh an. Es ist Ihr Bock, Herr Superintendent. Diesmal hat sich Ihr Bock auf dem Kirchhof gezeigt.
Der Geistliche macht eine wütende Bewegung, will etwas sagen, besinnt sich und trinkt aus. Sein Glas wird sofort wieder gefüllt. Und das kann man ja wohl verstehen, knarrt Behn unerträglich langsam weiter, wo das Untier doch das heilige Gotteshaus geschändet hat. Dass es da keine Ruhe findet und umgeht an der Stätte seines Verbrechens, das kann ja auch ein dummer Bauer verstehen, Herr Superintendent, sagt Behn.
Das ist nun schon die reine Ironie, und es ist eine rechte Qual, diesen Heiden Behn, der sicher seit seiner Trauung nie wieder in der Kirche gewesen ist, vom heiligen Gotteshaus reden zu hören. Marder ist ganz kochende Wut, jetzt wird er es ihnen geben, in ihre schadenfroh grinsenden Gesichter hinein, jetzt aber …!
Zu seiner Überraschung tut er etwas ganz anderes. Er dreht das Gesicht von all den Leuten weg, er ruft zu Reese: Noch einen und zahlen! Er trinkt hastig, fragt ungeduldig: Wieviel? Was, sechs Mark dreißig?! Na ja, schön, gut. Guten Abend, meine Herren. Für Ihre Albernheiten habe ich wenig Sinn.
Dabei ist er sich klar dessen bewußt, dass er das Gegenteil von dem tut, was er vorhatte. Dass er ganz entgegen seinen Plänen in dem Augenblick fortgeht, wo sie über ihn zu reden anfangen. Aber er geht, geht über den Marktplatz und zuckt nur verächtlich mit der Achsel, als er ein schallendes Gelächter aus der Wirtschaft hört.
Es ist der Alkohol bei mir, sagt er sich, aber ich bin noch ganz klar. Ich kann auch noch sehr gut gehen, trotzdem es wieder übergefroren hat.
Er freut sich, dass er das gemerkt hat, dass es übergefroren hat. Er ist also noch ganz in Ordnung. Jetzt gehe ich noch über den Kirchhof, und dann lege ich mich ins Bett. Lächerliche Geschichten. Erstens ist der Bock noch gar nicht geschlachtet und zweitens habe ich ihn um den Finkenhaken herumfahren sehen.
Er geht auf den Kirchhof. Dort ist es im Mondlicht geisterhaft bleich, wie es ja auch gar nicht anders sein kann. Die schön polierten schwarzen und grünen Grabsteine haben weiße Hauben, und auch in die eingemeißelte Schrift hat sich Schnee gesetzt. Der Superintendent ist wieder einem Gedanken für seine nächste Predigt auf der Spur, der diesem Schnee, der Grabschriften verwischt, gerecht würde. Aber er kommt davon ab, als er entdeckt, dass die schöne Fliederhecke an der Kirchhofsmauer noch immer ihre vertrockneten Blütendolden aus dem vergangenen Frühjahr trägt. Dieser Mensch, dieser Wollenzien, hundertmal hat er es ihm gesagt, und nun ist es doch immer noch nicht geschehen! Aber dann kam der Superintendent auch davon wieder ab, er stolperte nämlich, und als er sich wütend umdrehte und nach dem Gegenstand ausschaute, über den er gestolpert war, wurden seine Beine plötzlich ganz weich. Sie fingen an zu zittern – und Superintendent Marder setzte sich sanft auf den Kirchensteig. Ganz sanft. Nein, er hatte sich nichts getan. Da saß er nun und starrte ärgerlich auf seine Beine, die ihn so schmählich und verräterisch im Stich gelassen hatten. In den ersten Minuten übersah er das neue Erlebnis noch nicht in seiner vollen Tragweite. Er saß nicht schlecht, er wollte sich nur einmal besinnen und dann wollte er schleunigst nach Haus gehen und sich ins Bett legen.
Aber ein wenn auch nur leicht übergefrorener Boden ist zu kühl für längeres Sitzen. Marder wollte hoch. Er sah rasch um sich. Es war alles totenstill und einsam. Kein Mensch beobachtete ihn. Er stützte sich auf beide Hände und wollte hoch, etwa wie eine Kuh, die auch mit dem Hinterteil zuerst aufsteht. Es ging nicht. Die Beine versagten ihm, er setzte sich wieder. Es ging und ging nicht. Zornig starrte er auf seine Beine. Er holte langsam mit der Faust aus und traf zielbewußt erst das eine, dann das andere. Es war, wie er befürchtet hatte: er fühlte nichts! Von oben gerechnet, war bis zum Gesäß Leben in ihm, aber von da an war alles tot, abgestorben, wie einfach nicht da.
Er starrte diese Beine an, da lagen sie im Mondlicht klar und deutlich vor ihm, in den derben Schuhen, den schwarzen, etwas beutligen Hosen. Über den Schuhrand sah ein Wulst der grau gestrickten Wollstrümpfe. Sie waren da, aber sie waren nicht da. Es war wie verhext! Nein, es war gar nicht verhext. Alles war ganz klar, es war der Alkohol. Plötzlich musste er an seinen so schrecklich gestorbenen Bruder denken. Er merkte, dass der den ganzen Abend in ihm gewesen war und gespenstert hatte. Wahrhaftig, er hätte doch Bescheid wissen sollen, er hätte doch wissen sollen, dass für die Marders wenigstens Alkohol das reine Gift war! Und er ging hin mit seinen siebenundfünfzig Jahren und soff sich wie der dümmste grüne Bengel einen an, bloß um bei den Bauern etwas zu gelten!