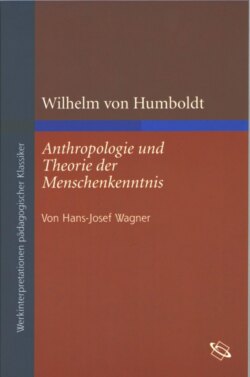Читать книгу Wilhelm von Humboldt: Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis - Hans-Josef Wagner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Quellen und Hülfsmittel. Nothwendige Geistesstimmung.
ОглавлениеWenn der individuelle Charakter des Menschen zum Behuf seiner möglichen Idealisirung erforscht, und dieser Stoff nicht fragmentarisch bloss an einzelnen Fällen, sondern in allgemeinen Sätzen, als eine Theorie, bearbeitet werden soll; so muss seine Behandlung alle Arten der Betrachtung der Natur durchgehen, und zugleich naturhistorisch, historisch und philosophisch seyn.
Der Mensch, auch als Gattung betrachtet, ist offenbar ein Glied in der Kette der physischen Natur. Er artet, wie die übrigen Thiere, in Rassen aus, diese Rassen pflanzen ihre Eigenthümlichkeiten fort, und erzeugen mit einander halbschlächtige Blendlinge. Hier und in andern ähnlichen Fällen sind oft Naturwirkungen, die nicht zurückgewiesen werden können, nur benutzt und geleitet werden müssen. In dieser Rücksicht gehört der Mensch schlechterdings der Natur an. Er kann, wie sie, beobachtet werden, und, was das eigentlich charakteristische Kennzeichen hiebei ist, es ist möglich, mit ihm zu experimentiren.
Der Naturnothwendigkeit im Menschen am meisten entgegen steht seine Willkühr. Vermöge dieser beginnt und endigt er Handlungen, ohne weder durch Naturzwang, noch auch gerade durch Vernunftnöthigung getrieben zu werden. Er folgt, wie man zu sagen pflegt, dem Zufall, äusseren Einwirkungen, oder inneren augenblicklichen Antrieben. Was er auf diese Weise thut, ist zwar oft physisch, da es auch nicht einmal mittelbar aus Vernunft entspringt, es ist aber doch immer das Resultat physischer oder andrer Veränderungen auf eine freie Natur, und daher weder nach Naturgesetzen zu berechnen, noch auch eines Experimentes fähig. Von dieser Seite kann der Mensch bloss historisch erkannt werden. So ist er; so ward er. Das Warum? erlaubt keine befriedigende Antwort.
Natur und Willkühr werden verknüpft in der ächt menschlichen Freiheit durch Vernunft. Denn die Vernunft bringt eine ebensogrosse Nothwendigkeit nach Gesetzen hervor, als die Natur, aber sie thut der Freiheit nicht den mindesten Eintrag, da sie sich selbst das Gesetz giebt. Hier sind also Gesetze, und zwar solche, die, ausserhalb des Gebiets der Erscheinungen, aus einer selbstständigen Kraft emaniren. Hier beginnt demnach das Gebiet der philosophischen und ästhetischen Beurtheilung.
Jede theoretische Bearbeitung eines Stoffs setzt eine Beurtheilung nach Gesetzen voraus, und nur insofern der menschliche Charakter einer solchen fähig ist, verstattet er eine wissenschaftliche Behandlung.
Die organische Natur des Menschen lässt allerdings Gesetze sehen, die regelmässig und unfehlbar eintreffen. So ist es z.B. ein allgemeines Naturgesetz, dass ein Theil der Individualität der Eltern auf die Kinder übergeht. Aber die verwickelte Oekonomie des menschlichen Körpers, seine noch unbegreiflichere Verbindung mit dem moralischen Charakter, und die grosse Schwierigkeit, mit dem Menschen zu experimentiren, macht, dass jene Gesetze noch immer so unvollkommen, und schwerlich je durchaus vollständig erkannt werden. So ist es in dem vorigen Beispiel nicht möglich zu bestimmen, was gerade, in welchem Grade, und unter welchen Umständen mehr oder minder durch die Zeugung forterbt. Selbst, was doch bei weitem einfacher ist, die physische und physiologische Eigenthümlichkeit eines Individuums als ein Ganzes zu kennen, giebt es noch nicht einmal eine allgemeine Formel oder Methode. Man beobachtet und kennt bloss einzelne Verschiedenheiten, aus denen sich wenig oder nichts schliessen lässt.
Die grösseste Strenge und Gesetzmässigkeit verstattet die philosophische Beurtheilung, allein auch mehr da, wo sie dem Menschen für seine Gesinnungen Regeln vorschreibt, als da, wo sie zum Behuf der Erweiterung seines Wissens den wirklichen Zusammenhang zwischen seinen Kräften aufzudecken bemüht ist. Zwar wird sie einzelne Verhältnisse unfehlbar richtig bestimmen und aufklären, aber da diese nie ganz allein und vereinzelt vorhanden, also die Fälle nie rein gegeben sind, so werden die innern intellectuellen und moralischen Verhältnisse nie ganz fehlerlos dargestellt, oder vollständig erschöpft werden können.
Am wenigsten Gesetzmässigkeit zeigt ein bloss historisch behandelter Stoff. Alles Einzelne erscheint in demselben eben so regellos, als der Zufall und die Willkühr, die es hervorbringen. Dennoch kehren auch hier, sobald man nur grosse Massen auf einmal ins Auge fasst, gleiche Ereignisse in einer gewissen, obgleich weniger strengen und schwerer zu beobachtenden Regelmässigkeit zurück.
Der Stoff, den die vergleichende Anthropologie darbietet, ist daher nicht gerade einer wissenschaftlichen, ja nicht einmal durchaus einer theoretischen Behandlung fähig. In. wie hohem Grade er indess auch empirisch seyn mag, so zeigen doch die einzelnen Erscheinungen immer eine gewisse Stätigkeit, Folge und Gesetzmässigkeit, und diese letztere muss nothwendig sowohl mit der Erweiterung unsrer Kenntniss, als mit der Veredlung der menschlichen Natur selbst, noch mit dem Fortschritte der Zeit immer höher steigen. Der Bearbeiter hat sich daher zwar zunächst so genau als möglich an die Wirklichkeit anzuschliessen, aber mit der Beobachtung muss er zugleich immer soviel als möglich eine streng philosophische Behandlung verbinden, theils um die Masse der Thatsachen nach Gesetzen theoretisch zu ordnen, theils um die durch die Beobachtung erhaltenen Charaktere praktisch nach Gesetzen zu beurtheilen.
Wer hierin glücklich seyn, und die individuelle Menschenkenntniss wahrhaft erweitern will, der muss gewissermaassen die verschiedenen Geistesstimmungen des Naturbeobachters, des Historikers und des Philosophen in sich vereinigen. Wie der erstere muss er überall von dem Begriff der Organisation ausgehen, durchgängig vollkommene Gesetzmässigkeit voraussetzen, alles aus den innern und eignen Kräften des Wesens erklären, in diesen jede zugleich als Zweck und als Mittel betrachten, und nie zu andern als physischen Erklärungen seine Zuflucht nehmen. Wie dem zweiten liegt es ihm ob, mit der antheillosesten Gleichgültigkeit bloss nach dem, was geschehen ist? zu fragen, und das Ganze, zu dem die einzelnen von ihm beobachteten Thatsachen gehören, weder als ein Naturprodukt, noch auch als ein reines Willensprodukt anzusehen, damit er auch nicht einmal versucht werde, von Ursachen und Gesetzen auf die einzelnen Erscheinungen, sondern immer von diesen auf jene überzugehen. Denn das ist es gerade, was den Historiker, wenn man ihn nemlich dem Naturbeobachter und Philosophen entgegensetzt, auszeichnet, dass er es einzig und allein mit dem, was geschehen ist, zu thun hat, und das Feld, auf dem er thätig ist, weder als das Gebiet der Natur, noch als das Gebiet eines reinen Willens, sondern als das Reich des Schicksals und des Zufalls betrachtet, von dessen Launen wenigstens im Einzelnen niemand Rechenschaft zu geben fähig ist. Wie der Philosoph endlich darf er nicht vergessen, dass ein freies und selbstständiges Wesen der Gegenstand seiner Betrachtung ist, bei dem er erste, nothwendige, ausserhalb der Erscheinungen liegende Ursachen voraussetzen, und das er streng nach Gesetzen, nach Venunftidealen beurtheilen muss.
Was das Schwierigste ist, so dürfen diese drei so verschiedenen Geistesstimmungen nicht einmal immer, wenn auch freilich oft, einzeln bei einzelnen Theilen der Charakterkenntniss thätig, sie müssen sehr häufig sehr nahe mit einander verbunden seyn. Denn da der Mensch ein freies Wesen in der Kette der Natur ist, so wird auch dasjenige, was durchaus selbstständig aus ihm entspringt, leicht zu einer Art von Organisation, und wenn daher der Stoff des Charakters einmal hinlänglich historisch erforscht ist, so ist es immer nothwendig zugleich zu versuchen, ihn als Natur und Organisation zu erklären, und als die freieste Exertion rein menschlicher Kräfte idealisch zu beurtheilen. In der moralischen Natur des Menschen muss man gleichsam eine bewegliche Organisation annehmen, eine bewundernswürdige Leichtigkeit etwas zur Natur werden zu lassen, und es doch, bei veränderter Charakterrichtung, wieder gegen etwas anderes zu vertauschen. In der That sehen wir, dass auf der einen Seite der Mensch sich Eigenschaften dergestalt anzueignen vermag, dass sie sich mit allem in ihm verbinden, in seine physische Beschaffenheit sogar übergehen, und von ihm aus sich auch auf andere fortpflanzen; dass er auf der andern, sobald sein Geist eine andere Wendung nimmt, aus der bisherigen Form heraustreten und sie mit einer andern verwechslen kann. Diese letztere Kraft zeigt sich manchmal in dem Kampf individueller Züge mit dem Charakter des Geschlechts, oder der Nation in einem bewundernswürdigem Grade. Diese dem ersten Anblick nach so wenig begreifliche Verbindung der Stätigkeit und Versalität findet unstreitig ihre Erklärung in dem Zusammenwirken der sinnlichen und rein geistigen Kräfte im Menschen. Die ersteren streben immer alles zu assimiliren, alles in Habitus und Natur zu verwandeln. Dagegen ist den letzteren jede Stätigkeit fremd, die nicht auf einer fortwährenden Billigung des gegenwärtigen Augenblicks, sondern auf einer Fortdauer voriger Eindrücke beruht. Nun gewinnen zwar im Kampfe die geistigen Kräfte immer die Oberhand, da aber die sinnlichen doch auch immer thätig bleiben, so entsteht immerfort eine habituelle Natur, die nur, wenn sie mit veränderten Geistesrichtungen in Widerspruch geräth, nicht alleinherrschend werden kann.
Die gehörige Mischung, in welcher die in so hohem Grade ungleichartigen Anlagen mit einander zu einer richtigen Menschenkenntniss verbunden seyn müssen, künstlich und regelmässig zu finden, dürfte schwer, wo nicht unmöglich seyn. Auch findet man in der That meistentheils entweder zu empirische oder zu speculative Menschenbeobachter. Die beste Schule für die Menschenkenntniss ist daher das Leben, und derjenige wird am besten in derselben gelingen, dessen Charakter selbst in vorzüglichem Grade kultivirt ist, der zugleich formenreich und hinlänglich gewöhnt ist, sich nach Gesetzen zu beurtheilen. Denn demjenigen, der selbst die nothwendige Freiheit und Gesetzmässigkeit in sich verbindet, wird es auch weder an der Empfänglichkeit fehlen, den gegebnen Stoff aufzufassen, noch an der Kraft, ihn einer strengen Prüfung nach Gesetzen zu unterwerfen.