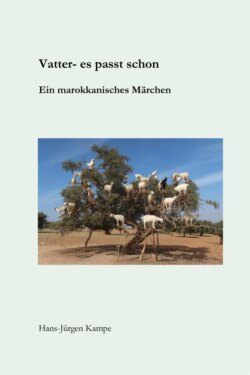Читать книгу Vatter - es passt schon - Hans Jürgen Kampe - Страница 4
Marburg – in diesem Jahr
Оглавление1
Anton Thaler erwachte schweißgebadet und setzte sich unbeholfen auf seiner durchgelegenen Seegrasmatratze auf. Immer wieder dieser Albtraum.
Alle paar Wochen sah er, wie sie sich ihm aufreizend im weißen Sand wie ein Schlemmerfilet entgegenräkelte, wie sie sich ihm förmlich anbot und entgegenstreckte. Noch unberührt. Wie sie ihn geradezu anbettelte, sie endlich zu nehmen und sich ihm gänzlich geöffnet hatte. Antons Puls und Atem ging immer schneller.
Und dann hörte er wieder hinter sich das Keuchen, Schritte im Sand, während seine eigenen Beine immer schwerer wurden. Nur noch zehn Meter, noch fünf! Anton ruderte mit den Armen, um vorwärts zu kommen. Es half alles nichts. Ein Schatten glitt an ihm vorbei. Seine Füße schlurften nur noch bleiern im Sand.
Tief enttäuscht musste er wieder mit ansehen, wie sich sein eigener Vater, mit einem kompromisslosen „Haben wollen“ in den Pupillen auf das Objekt seiner Begierde stürzte und sie wie immer zuerst in den Händen hielt.
Die weiße, handtellergroße Drehmuschel, makellos hingespült an den Strand von La Herradura, wo Antons Eltern, Klaus und Andrea Thaler, sich vor Jahren ein kleines Ferienhaus bauen ließen. Und in dessen Zimmern sich mittlerweile die übervollen Glaszylinder reihten, in denen sein Vater seit geraumer Zeit seine Beutestücke, die immer seltener werdenden Drehmuscheln, hortete.
Was Anton, dem ältesten „Stammhalter“ von Klaus, am meisten schockierte, war nicht die Tatsache, dass er wie immer im Traum bei der Drehmuschel gegen seinen „Vatter“ den Kürzeren zog, sondern, dass er unbewusst seinem Vater, den er seit Jahren mit seinen Macken auf die Schippe genommen hatte, immer ähnlicher wurde.
Was er nie im Leben wollte.
Es waren ja nicht nur die Drehmuscheln, die ihn seit einiger Zeit faszinierten und die er auch so liebend gern suchen und sammeln wollte. Andere Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Semester, die er mit seinem langjährigen Freund Artur, genannt „Lutscher“, wegen dessen früherer Vorliebe für klebrige Lollis, in Marburg Jura studierte, eingeschlichen hatten, wunderten Anton selbst immer mehr.
Da war zum Beispiel seine aufkommende Begeisterung für sehr alte Beatles Songs aus den frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, über die er sich früher nur lustig gemacht hatte. Denn in der Schulzeit wollte Anton nur Punk, Heavy Metal und Hardrock hören, und zwar sehr laut. Wahrscheinlich, weil die halbe Schule das so gemacht hatte. Und jetzt mit über zwanzig? Ein richtiger Softie war er geworden.
Das Gleiche galt auch für seine aufkommende Begeisterung für Joggen. All das durfte sein „Vatter“ erstmal nicht erfahren. Der fühlte sich sonst noch bestätigt
Anton hatte sich von den sehr überschaubaren Überweisungen seines knausrigen Vaters ein paar Laufschuhe abgespart und joggte dreimal die Woche den steilen Berg bis zum Marburger Schloss hoch. Das hätte Klaus, der selber mit seinen Freunden regelmäßig lief, mit Sicherheit sehr gefreut, was Anton aber gern verhindern wollte. Nachher würde sein „Vatter“ auf die Idee kommen, am Wochenende in Kassel mit ihm eine Runde zum hohen Herkules laufen zu wollen. Und da hätte Anton wahrscheinlich richtig alt ausgesehen.
Richtig geschämt hatte sich Anton aber, als er in einem Reformhaus in der Marburger Altstadt ein Schild sah, auf welchem Weidenröschen Tee im Sonderangebot beworben wurde. Er hatte sich mit größten Gewissensbissen in den Laden geschlichen und sich zweihundert Gramm von dem immer noch teuren Tee gegönnt. Der Tee war seinem Vater seit Jahren heilig, weil er der Meinung war, seine Prostata würde es ihm im Alter sicherlich danken. Wahrscheinlich hatte die Verkäuferin Anton auch deshalb so merkwürdig angesehen, weil kein Student normalerweise diesen heuähnlichen Tee mit dem Geschmack von Pferdepippi kaufen würde. Und weil die Ausgabe für das Gesöff sein Budget bei weitem überschritt, beschloss Anton, jede Portion mindestens dreimal aufzubrühen. Auch deshalb wäre sein sparsamer Vater wieder sehr stolz auf ihn gewesen. Anton konnte machen, was er wollte, seine Erziehung und seine Gene schlugen voll durch.
Die schlimmste Eigenschaft, die sich bei Anton immer stärker zeigte, durfte der „Vatter“ aber nie im Leben mitkriegen: Anton spürte selber, dass er in den zwei Jahren, die er nun schon in Marburg lebte, immer sparsamer wurde. Ein Wesenszug, den er bei seinem „Vatter“ bislang einfach nur peinlich fand.
Die Sparsamkeit hatte sich bei Anton erst langsam entwickelt. Am Anfang war er froh, wenn er am Monatsende etwas von den knappen Überweisungen seiner Eltern übrigbehielt. Er sparte beim Putzen in seinem Zimmer und bei den Staubsauger Beuteln für den alten Sauger, den ihm Klaus zum Einzug großzügig überlassen hatte. Entsprechend sah Antons kleines Zimmer im Dachgeschoß des alten Fachwerkhauses am Marktplatz auch aus.
Die „Wollmäuse“ unter seinem ausgelegenen Bett bildeten mittlerweile eine harmonische Wohngemeinschaft mit der zunehmenden Zahl von übergroßen Silberfischen, die in Antons jahrzehntealter Seegrasmatratze seit Generationen nisteten. Und die nach vier Semestern fast handzahm geworden waren, weil sie bei Anton eh nichts zu befürchten hatten. Lutscher war sowieso der Meinung, die vielen Silberfische wären das Ergebnis eines besonders guten Mikroklimas in ihren Studentenbuden.
Wobei man mit dem Begriff „Klima“ in den Dachzimmern sehr vorsichtig umgehen musste.
Im Sommer glich das kleine Zimmer unter dem nahezu ungedämmten Dach des über fünfhundert Jahre alten Fachwerkhauses einem Römertopf im Backofen. Da musste keiner frieren.
Im Gegensatz zum Winter, in dem Anton versuchte, ökonomisch und ökologisch nur minimal zu heizen, sodass Lutscher, der im Nachbarzimmer hauste, der Meinung war, jede offene Bushaltestelle in Jakutsk wäre im Januar noch gemütlicher, als Antons Zimmer.
Oft genug weigerte sich der Jurastudent, sein Zimmer halbwegs warm zu halten. Denn die einzige Heizquelle war ein steinalter Ölofen der Marke Degussa, den Anton mit einer Kanne regelmäßig befüllen musste. Entsprechend stanken seine Haare, seine Haut und seine Kleidung das gesamte Wintersemester nach Heizöl, sodass Anton nur wenig Lust hatte, die vier Stockwerke in den Keller runter und wieder hoch zu steigen. Erst wenn die Eisblumen jeden Blick nach draußen versperrten und kaum noch Tageslicht ins Zimmer drang, bequemte sich Anton, eines der drei Fässer im Keller anzuzapfen, die dort unter Missachtung jeglicher Umwelt- und Brandschutzauflagen auf dem uralten Lehmboden standen.
Und wenn Anton den Ofen aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts doch benutzte, konnte es schnell passieren, dass eine Verstopfung in der Leitung jegliches Heizen verhinderte. Von seinem Vermieter kam dann immer nur die gleiche Antwort: „Ich schicke Ihnen einen Spezialisten vorbei“.
In den nächsten Tagen hörte Anton dann irgendwann am frühen Abend ein heftiges Trampeln, Keuchen und Schnaufen im Treppenhaus, als käme eine Dampflok nach oben.
Gregori, der „Spezialist“ wuchtete seine drei Zentner die alte Holztreppe bis ins Dach. In der linken Hand trug der Deutschrusse das einzige Werkzeug, das er hatte: eine gekürzte Dachlatte. Mit der stocherte Gregori heftig in der Brennkammer, trat zweimal mit den verstärkten Kappen seiner Arbeitsschuhe roh an den scheppernden Ofen, bis das Öl vor lauter Erschütterungen wieder floss.
Der einzige Satz, den der Dicke nach dem dritten Deutschkurs relativ flüssig in Deutsch sprechen konnte, lautete: „Host`n Schnops?“ Letzten Endes war das keine Frage, sondern eine Aufforderung, denn Gregori hatte sein Leben bereits vor langer Zeit dem Alkohol geweiht.
Deshalb hatte sich Anton auch für die Besuche des gewichtigen „Spezialisten“ in einem Billigdiscounter eine Literflasche des billigsten Korns zugelegt, von dem Gregori nach jedem Besuch ein Wasserglas runterstürzte, bevor er mit Getöse die zitternde Holztreppe wieder nach unten stapfte.
Nur - es konnte passieren, dass nach einer Behandlung durch den „Spezialisten“ viel zu viel und zu schnell Öl in die Brennkammer floss, sodass die gusseisernen Platten rot glühten und sich Anton ängstlich überlegte, auf welchem Fluchtweg er die vier Stockwerke nach unten kommen könnte. Also blieb der Ofen lieber aus.
Seit Anton eine feste Freundin hatte, versuchte er noch weiter zu sparen, denn er wollte Frida, der Politik- und Pädagogikstudentin aus dem Norddeutschen, ja ab und zu auch etwas bieten.
Also änderte Anton zwangsweise seine Essgewohnheiten. Er gönnte sich nur noch dreimal die Woche das billigste Stammessen in der Mensa. Zum Beispiel durchgekochte, rosa Labskaus mit Gurke, Linsensuppe oder auch mal ein Spiegelei mit Bratkartoffeln. Ansonsten bestand sein Mittagessen aus einem der großen Mohnstriezel in der Mensa, die nur die Hälfte des Stammessens kosteten, dafür aber den Blutzuckerspiegel schön nach oben trieben.
All das reichte aber nicht, um seine Freundin, die selber auch knapsen musste, ab und zu mal ins Kino oder zum Billardspielen einschließlich Getränk einzuladen.
Also suchte Anton krampfhaft nach weiteren Quellen, um zu sparen. Nicht nur, dass er festgestellt hatte, wie er bei Konzerten in der Marburger Stadthalle durch den Bediensteten Eingang ohne zu zahlen zu einem Kulturerlebnis kam. Wobei ihn ja meistens die Konzerte, in die er sich einschleichen konnte, noch nicht mal sonderlich interessierten. Aber egal - es war kostenlos, und da nahm Anton auch schon mal eine Schlagerparade von abgehalfterten „Stars“ aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Kauf.
Lutscher hatte ihm zudem vorgeschwärmt, dass man durch Blutspenden auch zu einer monatlichen Mehreinnahme ohne großen Aufwand kommen konnte. „Man könne ja auch noch ganz andere Sachen in der Uni Klinik von sich spenden, was sogar sehr angenehm sein kann“, war Lutschers Überlegung, sein selbstloses Angebot an Körpersäften noch zu diversifizieren.
Zu beiden Möglichkeiten, sich kurzzeitig zu schwächen, hatte Anton aber keine Lust, denn er hatte noch eine weitere Möglichkeit entdeckt, wie er beim Essen weiter sparen konnte.
In Marburg gibt es, wie in allen anderen Universitätsstädten auch, zahlreiche studentische Verbindungen. Und die hatten laufend Nachwuchssorgen. Also wurden die „Frischlinge“ an der Uni mit Handzetteln, Mailings und durch persönliche Ansprachen von „Füchsen“, den Einsteigern bei Verbindungen, eingeladen, das gesellige Leben der Korpsstudenten kennenzulernen. Und dann möglichst auch Mitglied zu werden.
Aber vorher durften sich die neuen Studenten als Gäste abends in den großen Verbindungshäusern so richtig den Bauch vollschlagen. Und damit die Leber nicht vertrocknete, gab es Bier bis zum Abwinken.
Auf diese Weise hatten Anton und Lutscher schon diverse Abendessen kostenlos genossen, teilweise sogar mit Bedienung. Aber beide hatten immer dem wachsenden Druck standgehalten, in eine der Verbindungen einzutreten. Wenn die Erwartung an eine Mitgliedschaft zu groß wurde, wechselten die beiden schnellsten als nicht zahlende, aber anfangs willkommene Gäste in ein anderes Verbindungshaus.
Heute Morgen hatte Anton auf seiner dreiteiligen Matratze verschlafen. Gestern Abend war es bei der „Fidelia“, einer schlagenden Verbindung, wieder hoch her gegangen und sehr spät geworden. Der Jurastudent sprang aus dem Bett, wusch sich sehr flüchtig an dem Fünf Liter Boiler auf dem Gang, sparte sich den Gang auf die nur achtzig Zentimeter breite Toilette, schnappte sich zuerst hektisch seine Unterlagen und dann den alten grünen Parka, der schon in der Ecke stehen konnte und rannte die Barfüßerstraße zwischen den restaurierten Fachwerkhäusern runter. Sein Ziel war das „Landgrafenhaus“, in dem seit über hundert Jahren tausende Studenten mit öffentlichen und zivilen Rechtsfragen gelangweilt wurden.
Als er keuchend vor der Tür des großen Vorlesungssaals L 100 angekommen war, hörte Anton schon, wie von innen ein Schlüssel ins Schloss geschoben wurde. Hastig riss Anton die Tür auf und stand Auge um Auge Professor Fuchs gegenüber. Grauer Anzug mit Weste, Fliege auf weißem Hemd mit verblichenem Kragen, graue Haare und bereits jetzt schon ein hochrotes Gesicht, das auf eine gewisse Reizbarkeit schließen ließ.
Professor Fuchs las Strafrecht, dessen Auswirkungen er durch Überschreitungen der Gesetze regelmäßig bei Selbstversuchen zu spüren bekam.
Denn Wotan Ignaz Egon Fuchs war ein ausgemachter Choleriker vor dem Herrn. Der Pate des kleinen Egon hatte auf dem zusätzlichen Namen Wotan bestanden, weil das Baby bereits in seinen ersten Lebenstagen extreme Schreikrämpfe und plötzlich auftretende, nicht zu bremsende Wutanfälle zeigte. Egons Mutter hatte zwar immer beschwichtigt: „das sind nur Blähungen“, oder „das verwächst sich noch“. Aber als der erste Zahn kam und das Kleinkind aus purer Bosheit seine Mutter heftig beim Stillen gebissen hatte, stimmte sie resigniert dem Namen des germanischen Kriegsgottes zu.
Der Kleine blieb hochcholerisch.
Aus Sicht der meisten Studenten war der Professor, der kurz vor der Emeritierung stand, ein Fall für die „Klapsmühle“. Und ein klassisches Beispiel für die Anwendung des Paragraphen 51 des Strafgesetzbuches.
„Schuldunfähigkeit aufgrund Unzurechnungsfähigkeit wegen Alkoholgenuss“.
Fast wöchentlich stürmte der Professor ins Foyer des Landgrafen- oder des Savigny Hauses und riss wutentbrannt die Büchertische der Studenten um. Am Anfang waren die Tische der Marxisten, Leninisten, Spartakisten, oder der Maoisten das Ziel seiner Attacken. Auf die Farbe Rot reagierte der Professor wie ein spanischer Kampfstier in der Arena. Später hatte sich der Choleriker auch auf Grün eingeschossen und rammte die Tische der strickenden Vertreter der Umweltbewegung. Seit Neuesten verschmähte er noch nicht einmal die Farbe Gelb, der liberalen Gattung, und sogar der Tisch der Schwarzen, des Rings Christlich Demokratischer Studenten, flog in seltener Einigkeit mit den anderen Fraktionen durch den Flur.
Weitere, bei den Studenten immer wieder gern erzählte Beispiele seines Jähzorns, waren das Eintreten einer Tür des Stadtbusses, weil der Fahrer nicht da hielt, wo der Herr Professor gerade mal aussteigen wollte. Oder das hilflose Zusammensacken seines Architekten, weil der krachend in der Linken des Gelehrten gelandet war, dem die neue Garage doch nicht hundertprozentig gefallen hatte. Auch die junge Frau, die bei Dunkelgelb nicht noch über die Ampel gefahren war, sondern sich erdreistet hatte, zu bremsen, sodass der Wissenschaftler ebenfalls nicht mehr über die Ampel, sondern vier Minuten zu spät zum Mittagessen nach Hause kam, konnte ein Lied von der Tobsucht des Strafrechtlers singen. Sie rettete in letzter Sekunde der Verschlussknopf an der Tür ihres „Käfers“, die der Erzürnte aufreißen wollte, um die „total unfähige“ Fahrerin vom Lenkrad zu entfernen. Der prügelnde Welfenprinz Ernst August war dagegen ein Musterknabe an selbstbeherrschter Zurückhaltung.
Deswegen schaute Anton sehr betreten nach unten, als er an der Lehrkraft vorbei auf einen der hinteren, noch freien Plätze schlich. Im Vorlesungssaal nahm Anton wieder den betäubenden Geruch nach Bohnerwachs, abgestandener Luft und saurem Angstschweiß vor Professor Fuchs wahr. Er hatte sowieso keinen guten Stand bei Professor Fuchs, denn die Ergebnisse seiner letzten Strafrechtsklausur waren „serbisch“, sehr beschissen.
Wie jeden Morgen holte der Professor seine Taschenuhr aus der Westentasche, schaute missmutig auf das Ziffernblatt und verschloss um Punkt neun Uhr fünfzehn, cum tempore, die Tür des Vorlesungssaales. Kein/e Student/in kam ab jetzt mehr in den Saal und keiner kam mehr raus. Auch die Fenster mussten geschlossen bleiben. Nichts durfte die geistigen Ergüsse des Professors stören. Lutscher grinste seinen Freund fünf Reihen unterhalb wissend an. Anton musste jetzt schon austreten.
2
„Salve Studiosi“, begrüßte Wotan Fuchs wie üblich die fast zweihundert Studenten vom Katheder, die teils mit übermüdeten Augen auf ihren Laptop oder auf den Bildschirm hinter dem Professor starrten. In der ersten Reihe saßen die üblichen „Verdächtigen“, die „Speichellecker“, die möglichst nah bei der Lehrkraft ein Gesichtsbad nehmen wollten. In der Mitte, nur zwei Meter vom Pult entfernt, hatten Olaf, das „Fressbrett“ und Berti, der „Käse“, ihren Stammplatz belegt. Beide hatten bereits schon gegen halb neun vor der grauen Doppeltür des L 100 rumgelungert, um dem Strafrechtler möglichst nahe zu kommen.
Olaf wurde von den meisten Kommilitonen nur als „Fressbrett“ bezeichnet, weil seine Unterlippe unnatürlich groß war und sehr weit nach vorne hing. Und Bertis Teint und sein Körpergeruch erinnerten alle an einen überreifen französischen Brie. Beide hätten als Bekannte bei Anton und Lutscher niemals landen können, wenn sie nicht Mitglied in einer der wenigen Verbindungen gewesen wären, die Anton und sein Freund noch nicht zum kostenlosen Abendessen beehrt hatten.
Für heute Abend hatte Olaf die beiden zu einer fröhlichen „Kneipe“ mit Offizium und Inoffizium eingeladen. Will heißen, nach dem Abendessen sollte sich höchst akademisch zugedröhnt werden.
Während Herr Fuchs alle nur denkbaren Straftaten bei Vorsatz, bedingtem Vorsatz, Fahrlässigkeit und Unterlassen erläuterte, ruhte sein Blick wohlwollend auf dem „Fressbrett“.
Denn Wotan Fuchs war „Alter Herr“ in Olafs und Bertis schlagender Verbindung „Rheumania“ und bemerkte mitfühlend und begeistert das große Pflaster auf Olafs linker Wange. Gestern Abend war „Mensur“ Nacht. Ein Fechten von Studenten aus unterschiedlichen Verbindungen mit messerscharf geschliffenen Klingen. Der Höhepunkt von Olafs und Bertis monatelangen Paukübungen mit stumpfen Waffen.
Obwohl die Probanden an Körper, Hals und Kopf geschützt waren, blieb doch sehr bewusst der Wangenbereich frei, um den Klingen wenigstens eine kleine Möglichkeit zu eröffnen, den Gegner mit einem gekonnten Nachfedern des Schlägers im Gesicht zu zeichnen. Berti hatte sehr viel Pech und überstand alle zwanzig Gänge der Mensur leider unverletzt. Ein schöner breiter Schmiss, möglichst tiefrot durchblutet, hätte seinem quarkähnlichem Aussehen erst die richtige Note gegeben. Berti hatte sich deshalb gleich für die nächste „Mensur“ Nacht eintragen lassen.
Olaf befürchtete schon, dass ihn das gleiche herbe Schicksal wie Berti ereilen würde und er ohne akademische Auszeichnung das Lokal verlassen müsste. Gott sei Dank senkte Olaf bei der letzten Quart der zwanzig Fechtgänge etwas zu früh den Schläger, sodass die Spitze der gegnerischen Waffe tief in Olafs Wange drang. Sofort sprangen die beiden Sekundanten dazwischen. Nach einem kurzen Moment hatte Olaf den ersten Schock schnell überwunden und bemerkte stolz, wie sein Blut in den Kragen sickerte. Um den anderen Burschenschaftlern eine kleine Freude zu machen, drückte der Gezeichnete seine Zunge durch die offene Wunde und winkte mit der Zungenspitze durch die Wange. Herzlicher Applaus und allseits Begeisterung für diese gelungene Einlage. „Das gibt einen richtig schönen Schmiss“, motivierte ihn der Paukarzt.
Olaf wurde zu einem Schemel geführt, und der Paukarzt holte seinen Koffer. Berti organisierte etwas neidisch eine Flasche Cognac und goss seinem Freund ein Wasserglas ein. Ex und hopp, und schon hielten die beiden Sekundanten den Gezeichneten ganz fest. Ohne Betäubung zog der Arzt dem stolzen Fechtbruder die gebogene Nadel mit blauem Faden durch die Wange und nähte die Wunde mit acht derben Knoten gekonnt zu. Dafür durfte Olaf mit Tränen in den Augen ein zweites Glas Cognac leeren.
Am nächsten Morgen hatte Olaf von der Wunde und vom Cognac einen pochenden Kopf. Die Wunde klopfte auch insofern wie ein Kupferhammer, weil der Gezeichnete gestern nach dem Nähen noch den Wunsch geäußert hatte, den Schmiss mit Bier zu spülen und mit Salz zu bestreuen. Einem Gerücht unter Burschenschaftlern zufolge sollte diese Spezialbehandlung den Schmiss erst so richtig zum Blühen bringen und den Betroffenen zu allen Lebzeiten als standesgemäßen Mensur Schläger kennzeichnen.
Professor Fuchs war das Ergebnis der Mensur Nacht nicht entgangen. Schon deshalb wählte er Olaf und Berti gern aus, ihn diese Woche in die „Sonne“ am Marktplatz zu begleiten. Denn einmal die Woche lud der streitbare Wissenschaftler zwei schleimende Studenten aus der ersten Reihe zum Mittagessen in das alte Restaurant ein, um sich in einer wissenschaftlichen „Disputation“ seine fachlichen und didaktischen Qualitäten von zwei Speichelleckern bestätigen zu lassen.
Olaf konnte heute das Mittagessen leider nicht richtig genießen, denn er konnte nicht kauen und auch nicht ausdrucksstark sprechen. Deshalb musste er zu seinem Bedauern die sehr einseitige Konversation Berti überlassen und konzentrierte sich eine Stunde auf die Vorsuppe. Eine klare Brühe, die ihm immer wieder über das Kinn lief.
Um kurz nach neunzehn Uhr klingelten Anton und Lutscher an der gewaltigen Doppeltür des großen Verbindungshauses unterhalb des Marburger Schlosses. Die pompöse Sandsteinvilla wirkte mit ihrem Turm und den zwei Fachwerkerkern selber wie ein kleines Schloss und stammte aus den seligen Zeiten, als Kaiser Wilhelm noch das Land regierte.
Berti hatte angedeutet, man würde ein weißes Hemd und einen gedeckten Schlips erwarten. Am besten in Grün oder Blau, den Farben der Rheumania. Außerdem wäre ein blaues, graues oder schwarzes Jackett angenehm. Jeans gingen gar nicht, auch keine Turnschuhe. Aber Lederschuhe wären gern gesehen.
All solche Sachen hatten die beiden angehenden Juristen nicht in Marburg im Schrank. Es hatte beide den ganzen Nachmittag gekostet, bis sie nach endlosen Telefonaten, Whatsapps und persönlichem Betteln bei Freunden die gewünschte Kleidung leihen konnten. Allerdings nicht ganz in der benötigten Größe.
Bei Lutscher hörte die viel zu weite Hose fünf Zentimeter über den drückenden Schuhen auf, und das blaue Jackett hing ihm wie ein Poncho über den Schultern. In dem viel zu großen Hemd, dessen Ärmel Lutscher über die Hände rutschten, hatte sein dünner Hals noch jede Menge Spiel. Anton wiederum bekam sein weißes Hemd nicht zu und konnte die graue Jacke nicht schließen. Am bequemsten wäre es gewesen, wenn er das Jackett lässig nur über den Arm geworfen hätte. Seine schwarze Hose in Überlänge hatte er mit vier Sicherheitsnadeln unten umgesteckt, damit er mit den braunen Halbschuhen, in denen seine zu kleinen Füße kaum einen Halt fanden, halbwegs laufen konnte. Beide sahen aus, als wären sie gerade aus einer russischen Clown Schule geflüchtet.
Über dem wuchtigen Eingangsportal des Verbindungshauses protzte das Motto der Rheumania tief in Sandstein eingemeißelt.
„Nihil vocatus et non solution“
Lutscher hatte das mal gegoogelt. Frei übersetzt hieß es: „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“. Das versprach ja heiter zu werden. Ein „Fuchs“, ein dienender Frischling in der Verbindung, öffnete mit einem korrekten Diener und führte die beiden Gäste in die große Eingangshalle. In den Ecken waren zwei Ritterrüstungen aufgebaut. Links und rechts von dem Wappen der Rheumania prangten Ölbilder von längst verblichenen erstchargierten Vorsitzenden. Die großen Kerzen in den Metallständern warfen ein flackerndes Licht auf die Köpfe der Anwesenden. Überall standen Korporierte in „Vollwichs“ mit Lederstiefeln, engen, weißen Hosen und einer „Pekesche“, einer Kneipjacke im historischen Husarenstiel mit Kordeln herum. Andere trugen nur die schwarze Kneipjacke mit den goldenen Knöpfen und den Stickereien, und einige wenige hatten sich mit einem schwarzen Anzug begnügt. Aber alle hatten ihre Verbindungsbänder in den Farben der Rheumanen an, ihre „Zipfel“, die kurzen Bänder, welche am Hosenbund hingen und die bunten Mützen auf dem Kopf. Anton und Lutscher wirkten so deplatziert, als wären sie gerade vom Mars gelandet.
Beide wurden höflich gebeten, sich mit einem Füllfederhalter in ein großes, aufgeschlagenes Gästebuch einzutragen. „Hoffentlich ist das nicht schon eine Eintrittserklärung“, argwöhnte Anton und Lutscher murmelte: „Ich fühle mich hier wie in Walhalla“, während er seinen Namen sehr unleserlich in das dicke Buch schrieb.
Hinter allen anderen Namen war ein „Zirkel“ gezeichnet, der erste Buchstabe der Burschenschaft mit Verschlingungen drum herum. Bei den Rheumanen also ein großes R mit kunstvollen Ziselierungen links und rechts. So wie es auch im grün/blauen Wappen der Fechtbrüder dargestellt war. Eigentlich wollten Anton und Lutscher ja nur schnell was essen und trinken und dann unbemerkt schleunigst wieder verschwinden. Aber ganz so einfach würde es wohl heute Abend nicht werden.
Endlich entdeckten Anton und Lutscher das Pflaster des Kommilitonen und die weißen Pickel von Berti. Ansonsten kannten sie niemand hier. Beide standen einige Zeit verunsichert mit dem frisch gezapften Pils in der Hand neben dem Ständer des Gästebuchs, bis Olaf und Berti ihre Gäste freudig begrüßten. Lutscher ließ sich aus Höflichkeit hinreißen, Olaf ein halbherziges Kompliment zu seiner ersten Mensur mit geglücktem Schmiss zu machen. Und Anton wünschte dem Gezeichneten eine möglichst große, breite und dauerhaft rot Narbe, was Olaf mit einem versuchten Lächeln quittierte.
„Es soll ja auch Frauen geben, die auf solche männlichen Verzierungen stehen“, versuchte Anton das Gespräch positiv im Fluss zu halten. Olaf und Berti nickten eifrig. Genau das hatten sie sich erwünscht. Anton wurde jetzt unruhig. Er konnte das Knurren seines Magens kaum noch verbergen. Denn wegen dem versprochenen Abendessen hatte er heute Mittag sogar auf den Mohnstriezel verzichtet, um sich heute bis zur Magenerweiterung voll zu essen.
Das erste Pils spürte Anton daher schon. Aber ohne weitere Nachfrage hatte ihm einer der servilen „Füchse“ bereits ein zweites, frisch gezapftes Helles in die andere Hand gedrückt, bloß weil das erste Glas nur noch halb voll war. „Bei uns wird kein Bier schal“, zwinkerte ihm die aufmerksame Bedienung zu und schwenkte das Tablett Richtung Olaf und Berti, die bereits mit zwei Bier in Vorlage waren.
Alle anderen in der Halle waren anscheinend die endlosen Bierlieferungen gewöhnt und betrachteten die laufend nachgereichten Bierchen als willkommene Grundlage für eine gelungene „Kneipe“.
Endlich war es soweit. Der Erstchargierte bat zu Tisch. Der Hausmeister, dem Anlass entsprechend in schwarzer Hose, weißem Jackett und schwarzer Fliege gekleidet, öffnete die Doppeltür in den Speisesaal. Ein riesiger Raum mit holzverkleideten, dunklen Wänden und einem neugotischen, sehr hohem Deckengewölbe empfing die hungrigen Gäste. Dreißig Gedecke standen auf massiven Eichentischen, die in U-Form aufgestellt waren. Vor Kopf würde das Präsidium sitzen. Die schweren, geschnitzten Stühle stammten noch aus der Gründerzeit vor dem ersten Weltkrieg und hatten Generationen von süffigen „Kneipen“ überstanden. Neben den Tellern standen so große Bierhumpen, dass sich die Maßkrüge auf dem Oktoberfest wie Schnapsgläser ausmachten.
Anton und Lutscher blickten sich hilflos an. Sie würden sich ihr Essen hart ertrinken müssen.
Und ausgerechnet morgen wollten Antons Eltern, Klaus und Andrea Thaler, nach Marburg kommen, um Frida das erste Mal zu treffen. Anton musste also zumindest etwas fit sein, um bei Frida und seinen Eltern einen halbwegs annehmbaren Eindruck zu hinterlassen.
Der Vorsitzende hielt eine Eröffnungsrede, gespickt mit vielen lateinischen Wendungen und begrüßte die beiden Gäste, die als Kommilitonen von Olaf und Berti herzlich willkommen waren. Er äußerte unverblümt die Hoffnung, dass ihnen das lustige Verbindungsleben so gut gefallen würde, dass sie sich als dienende „Füchse“ in ihre Gemeinschaft einbringen wollten. Donnernder Applaus und heftiges Klopfen auf die Eichentische.
„Ein jeder bringt sich bei uns ein, hilft und dient der Gemeinschaft, wo er nur kann. Und feiert gern und kräftig. Dafür kann man dann auch sicherlich das Studentenleben drei Semester länger genießen,“ motivierte der Erstchargierte die ausgehungerten Gäste, deren Magen zunehmend wie ein Hofhund knurrte.
Nach einem weiteren Bier registrierte Anton nur noch leicht verschwommen, dass der Hausmeister endlich die Vorspeise servierte.
Lauwarme Biersuppe mit ein paar verlorenen Zwiebelringen. Auf dem linken und rechten Arm seines noch weißen Jacketts balancierte der vielbeschäftigte Mann jeweils gekonnt drei schwappende Suppentassen, um die illustre Gesellschaft in einer noch tolerierbaren Zeit zu bedienen. Als Lutscher mitbekam, dass immer wieder Schweißtropfen des überlasteten Hausmeisters von der Stirn in die vorderen Tassen tropften, war der Hunger bereits vor dem ersten Gang wie weggeblasen.
Bis alle aufgegessen hatten und der nächste Gang kam, hatte einer der verpflichteten „Füchse“ bereits aufmerksam jedem der Gäste einen frischen Humpen Pils vor die Nase gestellt. Das freundliche Zuprosten des Präsidiums beantworteten Anton und Lutscher nur noch widerwillig.
Der angewelkte Salat als nächster Gang konnte die Wirkung des Humpens nicht im Geringsten mildern. Berti nahm aus den Augenwinkeln wahr, dass seine Gäste bereits schon am frühen Abend erhebliche Ausfälle zeigten. „Ihr seid doch nicht dehydriert?“ sorgte sich der Burschenschaftler um seine beiden Kommilitonen. „Eer`s Gegnteill“, nuschelte Anton unsicher.
„Alles nur Trainingssache. Nach zwei Semestern als „Fuchs“ gibt sich das von alleine“, erklärte Berti, als er für sich und Olaf die nächste Lage herbeiwinkte.
Anton hatte sich mittlerweile als Selbstschutz einen Bierdeckel über sein riesiges Glas gelegt, als endlich der Hauptgang kam. Klöße und Schweinelende in einer Schwarzbiersoße, zu der man Prost sagen konnte. Das etwas zähe, biergetränkte Fleisch ließ Anton lieber liegen und konzentrierte sich auf die Kartoffelklöße. Er hatte nur leider bereits so viel Bier im Magen, dass er nach einem Kloß schlapp machte.
Lutscher erhob sich nach dem zweiten Kloß und schlurfte schwankend zur Toilette. Der Vorsitzende schaute ihm verständnisvoll hinterher, während der Rest der Gemeinschaft mit gutem Appetit zulangte.
„Kann ich Dein Fleisch noch haben?“, fragte Berti Anton, der matt und hilflos nickte. Berti durfte bereits Olafs Fleischportion übernehmen, da Olaf nach der Biersuppe mensurbedingt streikte.
Die Nachspeise wurde von der fröhlichen Zechgemeinschaft bejubelt und die Frau des Hausmeisters wurde mit Beifall bedacht. Es gab ein „Bieramisu“. Ein Tiramisu, welches mit Schwarzbier und schwarzem Kaffee angemacht wurde. Es gab bei den Rheumanen nichts, was nicht in irgendeiner Form mit Bier veredelt wurde.
Die Wirkung war bei Anton verheerend. Während er durch das dunkle Bier in einen zunehmenden Drehschwindel fiel und sich einfach nur noch nach Hause wünschte, putschte ihn gleichzeitig der Kaffee extrem auf. An Schlaf war diese Nacht vermutlich nicht mehr zu denken.
Eigentlich wollten sich Anton und Lutscher nach dem Nachtisch schnellstens verabschieden und Richtung Marktplatz torkeln. Aber der gestrenge Vorsitzende ließ noch keinen vorzeitigen Abschied zu, denn die Gäste müssten ja erst noch die eigentliche „Kneipe“ erleben. Deswegen wären sie ja sicherlich gekommen.
Anton und Lutscher fielen fast vom Stuhl, als der Vorsitzende um „Silentium“ bat, nochmals die beiden volltrunkenen Gäste begrüßte und die „Füchse“ aufforderte, die Kommersbücher zu verteilen.
Jetzt wurde es richtig heiter, denn die Gemeinschaft wollte singen. Der Vorsitzende gab die Liednummern vor, und alle, außer Lutscher und Anton, schlugen begeistert ihre Gesangbücher auf. Nach der feierlichen Ansage „Autem cantabo“ begannen achtundzwanzig Männerkehlen kraftvoll zu singen. In der folgenden Pause entdeckte Anton nach einem kurzen Nickerchen, dass sein bedeckelter Humpen durch ein neues Gefäß mit schäumenden Pils ausgetauscht worden war. Anton versuchte jetzt, beim nächsten Lied noch höflich mit zu lallen, während Lutscher nur noch glasig in sein Buch starrte. „Als ordentlicher Korpsstudent bekommt man vom Biertrinken immer so einen Durst“, nuschelte Olaf erklärend.
Beim nächsten Lied war Olaf etwas unaufmerksam und es passierte ein unverzeihlicher Fauxpas. Der Verbindungsbruder hatte sein Kommersbuch einfach zugeschlagen, bevor der Erstchargierte sein Gesangbuch geschlossen hatte. Die Gemeinschaft hieb grölend die Hände auf die schweren Holztische, als der Vorsitzende die Strafe verkündete.
Olaf musste die Gläser aller Anwesenden austrinken! Und wenn ihm das noch einmal passieren würde, müsste er das Bier seiner Verbindungsbrüder erst in seine Mütze schütten und dann aus der Mütze trinken. Alle, außer Anton und Lutscher, lachten lauthals, weil das so eine lustige Strafe war.
Olaf erhob sich bereits etwas unsicher, ging gehorsam von Platz zu Platz und schüttete sich die Reste jedes Glases seiner Korpsbrüder in die Kehle. Donnernder Beifall, als sich der Verlierer schwankend an seinen Platz tastete. Anton und Lutscher hingegen waren heilfroh, dass Olaf ihnen die Humpen austrinken musste, denn beide hätten ihre Reste nicht mehr in ihrem Körper unterbringen können.
Die Freude währte allerdings nicht allzu lang, denn nach kürzester Zeit standen zwei neue, randvoll gefüllte Humpen vor den beiden Gästen. Beide hatten die Schnauze gestrichen voll und wollten jetzt endgültig nach Hause torkeln. Beim ersten schwankenden Versuch blickte der Erstchargierte vorwurfsvoll zu den beiden Besuchern.
„Haalt-hiergeblieben! Erst wird mit uns noch ein ordentlicher Salamander gerieben!“
Anton und Lutscher erstarrten. Jetzt artete die ganze Veranstaltung zu später Stunde noch in eine Tierquälerei aus. Als Lutscher gerade protestieren wollte, dass „Tsallmanda“ aber artengeschützt wären, erhoben sich alle Teilnehmer der Kneipe sehr förmlich. Der Vorsitzende befahl mit leicht lallender Stimme das alte Ritual:
„ad exercitium salamandri!“
Es folgte ein allseitiges, lautstarkes „Prost“, jeder setzte den Humpen an seine Lippen, und auch die beiden Gäste fühlten sich verpflichtet, ihr Glas bis auf einen Rest zu leeren, der beiden an den Mundwinkeln bis in den Hemdkragen runterlief.
Auf Kommando wurden die leeren Humpen von allen lautstark auf den Tisch geknallt und dann kräftig auf der Holzplatte gerieben. Die ganze Zeremonie wurde dreimal wiederholt. Der Klassiker eines „geriebenen Salamanders“.
Der dann einsetzende Moment absoluter, feierlicher Stille wurde nur von einem unbeabsichtigten, aber dennoch sehr heftigen Entweichen von Kohlensäure aus Lutschers willenlosem Körper unterbrochen. Der Rest der Gemeinschaft nahm das bekannte Geräusch mit verständnisvollem Wohlwollen zur Kenntnis.
Nach dem nächsten, lauthals geschmetterten Lied, hatte der Vorsitzende endlich ein Einsehen. Die beiden Gäste sahen so erbarmungswürdig aus, dass sie vorzeitig entlassen wurden. Der Erstchargierte gab ihnen noch die Erwartung mit auf den Heimweg, dass die Burschenschaft beide doch bald wieder als Gäste und möglichst auch als junge „Füchse“ begrüßen könne.
Als Lutscher und Anton von dem Hausmeister hilfsbereit unter den Armen gefasst und schwankend zur Tür begleitet wurden, schmetterten ihnen achtundzwanzig gut angefeuchtete Kehlen noch ein „Vale fratres spiritu“-„Auf Wiedersehen, Ihr Brüder im Geiste“ nach.
Zum Glück ging es von der trutzigen Verbindungsburg nur abwärts bis zum Marktplatz. Die beiden Gastesser mussten sich gegenseitig stützen, als sie über glattes Kopfsteinpflaster und holprige, ausgetretene Sandsteinstufen, schwankend wie ein Kieslaster in der Kurve, nach unten torkelten. Lutscher schlitterte in eine dunkle Ecke und hielt sich mit der linken Hand würgend an der Hauswand fest. Anton registrierte leicht schadenfroh, dass seinem Freund das günstige Abendessen anscheinend wohl nochmal durch den Kopf ging.
Währenddessen hatte Anton die Stange eines nagelneuen Hinweisschildes für den Aufstieg Richtung Schloss zu fassen bekommen und versuchte, in aufrechter Körperhaltung zu bleiben. Da das Schild aber erst am Nachmittag frisch einbetoniert worden war, stellte Anton mit vernebeltem Hirn verblüfft fest, dass sich die Stange mit ihm gedreht hatte und jetzt in bedrohlicher Schieflage zur Lahn zeigte.
„Is au egaaal,“ meinte Lutscher, als sich die beiden die letzten Meter bis zu ihrem Haus am Marktplatz schleppten. Aber jetzt kam das Schwierigste - die steile, ausgetretene Holztreppe mit den Holzstufen in unterschiedlichen Höhen. Eine Steilvorlage für gelungene Stürze, die beide aber so laut fluchend und grunzend schafften, dass ein Teil der Mitbewohner schimpfend wach geworden war. Anton hatte noch einen halbwegs klaren Moment und hangelte sich den Putzeimer im Flur in sein Zimmer, bevor sein Freund auf die Idee kam, dass ein Eimer vor dem Bett nicht die schlechteste Idee wäre.
„Nie mehr“, ging es Anton, durch den Kopf, als er sich das dritte Mal über den Eimer beugen musste. „Lieber ess´ ich jeden Tag wässrigen Labskaus in der Mensa, als mich noch einmal einladen zu lassen“.
Mit einer unendlichen Rotationsgeschwindigkeit seines Drehschwindels im Hirn versuchte der Jurastudent den Rest der Nacht irgendwie hinter sich zu bringen, damit er den morgigen Besuch seiner Eltern überstehen konnte.
3
Als Anton verkatert wachgeworden war, musste er zwangsweise wieder sparen. Er sparte sich das Frühstück, das er sowieso nicht bei sich behalten hätte. Und er sparte sich auch die kostenlose Dusche im Institut für Leibesübungen, einfach, weil er keine Zeit mehr hatte. Denn es klopfte nicht nur heftig in seinem Kopf, sondern auch an seiner Tür. Draußen stand Frida, seine Freundin seit dem vorletzten Semester und scheuchte ihn mit Vorwürfen am Morgen aus den Federn. Nebenan durfte Lutscher laut schnarchend noch ausschlafen. Beneidenswert.
Richtig, heute war ja Samstag, und die Eltern wollten stören kommen. Antons Mutter, Andrea, hatte schon seit letztem Semester darauf gedrängt, die erste feste Freundin ihres ältesten Sohnes endlich mal kennenzulernen. Klaus, Antons „Vatter“, war die Begegnung dagegen relativ egal. „Der Bursche tobt sich sowieso noch aus und hat bald wieder eine andere. So wie in der Vergangenheit ja auch“, maulte Klaus, der keine richtige Lust hatte, nach Marburg zu fahren. Vor allem nicht, unter diesen Bedingungen.
Denn Anton hatte seiner Mutter sehr vorsichtig am Telefon beigebracht, dass bei Frida der Humor bei jeglicher Umweltverschmutzung flöten ging. Und Klaus` alter Kombi wäre ein Megabeispiel an Umweltverschmutzung. Davor käme nur noch ein veraltetes Kohlekraftwerk in der Ukraine. Was Anton niemand, auch Lutscher nicht, verraten hatte, war die Tatsache, dass Fridas Libido auch nur dann richtig in Fahrt kam, wenn die CO2 Werte auf niedrigem Niveau stabil blieben. Ansonsten musste sich Anton bei hohen Feinstaub- und Abgaswerten nur anhören, dass seine Freundin vollkommen überreizt wäre. „Ich auch, ich auch“, seufzte der Jurastudent resigniert, dem im Wintersemester oder bei Tiefdrucklagen eine harte Zeit bevorstand.
Deshalb hatte Anton seiner Mutter der guten Stimmung wegen vorgeschlagen, dass seine Eltern doch bitte, bitte mit dem Zug nach Marburg kommen sollten. „Und bringt die Räder mit, damit wir etwas rumfahren und unternehmen können“ hatte Anton noch zu einer Zeit ergänzt, als er von den Folgen der Einladung zur „Kneipe“ noch nichts ahnen konnte.
Zu guter Letzt bat Anton seine Eltern noch leicht verschämt darum, seinen „Genderstern“ nicht mit einer falschen Ansprache zu reizen. Frida legte nämlich viel Wert auf eine bewusste, genderspezifische Sprache. Klaus hatte dazu seine eigene Meinung, die er zu Hause ungefragt zum Besten gab. Er genderte auf Teufel komm raus und suchte ständig neue Begriffe, wie er die deutsche Sprache gendergerecht umstellen konnte.
„Der Störenfried – die Störenfrieda, die Krankenschwester - der Krankenbruder; der Sündenbock-die Sündengeiß;“, war noch das Harmloseste, was der Familienvater grinsend vor sich hin brabbelte, während Andrea ihren Mann eindringlich ermahnte, seine Meinung bei dem Besuch in Marburg doch besser für sich zu behalten.
Frida war Samstagvormittag mit ihrem alten Damenfahrrad gekommen und nervte Anton mit ihrer Energie am Morgen. „Ich wünschte nur, die hätte einmal einen Abend bei den Rheumanen erlebt, dann ging`s ihr aber auch anders“, dachte Anton griesgrämig, als er barfuß zu dem Fünf Liter Wasserboiler im Flur schlich, und sich eine flüchtige Katzenwäsche gönnte, was bei der reinlichen Frida eine erste Runzel auf der Stirn provozierte.
Andererseits war dem verkaterten Jurastudenten aufgefallen, dass Fridas Finger aufdringlich nach Terpentin rochen und schwarze Farbreste an Daumen und Zeigefinger klebten. Die Farbe stammte von einer selbstlosen Aktion der jungen Aktivistin. Frida hatte heute Nacht über das „o“ der Mohrenapotheke zwei Punkte getupft. Der Apotheker der nun umbenannten „Möhren Apotheke“ würde sich wundern.
Trotz Antons Bitte sah es Klaus überhaupt nicht ein, seinem ältesten Abkömmling zuliebe mit den Fahrrädern im Zug nach Marburg zu fahren. Viel zu umständlich, zumal er von der Fahrradtour zum Edersee am letzten Wochenende noch den Fahrradgepäckträger auf der Anhängerkupplung sitzen hatte. Außerdem war der Familienvater viel zu ungeschickt, den Träger ohne Hilfe seines Schwiegervaters Herbert auf- und abzubauen. Also blieb das Gerät vorerst auf der Anhängerkupplung sitzen.
„Wir brauchen den Studenten ja nicht alles auf die Nase zu binden. Ich schlage vor, wir fahren mit dem Auto zum Marburger Bahnhof, parken da und fahren vom Parkplatz mit den Rädern in die Stadt. Von mir aus sollen die glauben, wir wären mit dem Zug gefahren“, bestimmte Klaus und hievte mit Andrea die beiden schweren E Bikes auf den Träger. Dass man den gewichtigen Akku abmachen und sich das Heben damit erleichtern könnte, wäre dem unpraktischen Steuerberater niemals in den Sinn gekommen.
„Und Du hältst schön dicht und erzählst Anton und auch Emil nichts“, ermahnte Klaus seine jetzt dreizehnjährige Tochter Emma, die in die Blüte ihrer Pubertät hineinwuchs und häufig genau das Gegenteil machte, was Klaus und Andrea erwarteten. „Ist mir doch vollkommen wumpe, wie Ihr nach Marburg kommt, „Schimmelchen“, Hauptsache Ihr fahrt mich vorher noch auf den Pferdehof“.
Klaus nickte ergeben. Das war zwar ein Umweg, aber Emma wollte den ganzen Tag auf dem Pferdehof mit ihren Freundinnen und ihrem Pony „Schmidtchen“ verbringen, was für die Eltern ein Glücksfall war, denn so war das Kind beschäftigt. Das Wort „Papi“ hatte Emma mittlerweile aus ihrem Sprachschatz entfernt. Seitdem bei ihrem fünfzigjährigen Vater die Haare immer grauer wurden, strich die pferdebegeisterte Amazone ihrem Vater regelmäßig liebevoll über die Haare und nannte ihn nur noch „Schimmelchen“, was Klaus im Familienkreis sogar ganz gut gefiel. Vor Freunden und Bekannten war ihm das reiterliche Kosewort allerdings etwas peinlich.
Thalers mittlerer Sohn, Emil, der mit achtzehn Jahren in der Schule glatt durchgelaufen war und im Frühsommer sein Abitur bestanden hatte, verbrachte jetzt ein ganzes Jahr in Granada, um ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren.
„So wie Anton mache ich es auf keinen Fall und fange gleich mit irgendeinem Studium an. Ich will erstmal den Kopf frei bekommen, mir ganz in Ruhe überlegen, was ich mal machen möchte, und mich dann in einem Jahr entscheiden“, hatte Emil seinen Eltern nach der Zeugnisübergabe im Gloria Kino erklärt.
Bei Anton hätte Klaus noch die größten Einwände für so eine Idee gehabt, aber jetzt nickte er verständnisvoll. Granada hieß ja auch, dass der Junge ab und zu mit dem Bus an die Küste nach La Herradura fahren und sich um Thalers, außerhalb der Ferien leerstehendes Ferienhaus kümmern konnte. Emil war vernünftig, würde das Haus in Ordnung und sauber halten. Bei Anton war sich Klaus nach dem Chaos Urlaub vor zwei Jahren nicht ganz so sicher.
Außerdem wollten Opa Herbert und Oma Gisela, Andreas Eltern, die in Baños de Fortuna, einem kleinen Thermalbad bei Murcia, im Hinterland der Costa Blanca, überwinterten, ihren Enkel in Granada regelmäßig besuchen und liebend gern verwöhnen.
Emil hatte kurz vor dem Abi noch den Führerschein bestanden. So wie Anton auch vor zwei Jahren in der Fahrschule von Claire Grube, genannt die „Klärgrube“. Zu Klaus großem Glück war der Führerschein diesmal auch nicht so teuer geworden, wie befürchtet, weil Emil, genau wie sein älterer Bruder, regelmäßig auf privaten Plätzen in dessen altem Kombi geübt hatte. Emil und Klaus gingen dabei etwas geduldiger miteinander um, als Klaus und sein Erstgeborener vor zwei Jahren. Aber Klaus empfand sich ja als sensibel, lernfähig und kompromissbereit, was er sich selber regelmäßig gern bestätigte, zumal das anscheinend kein anderer in der Familie bemerkte.
Nachdem Klaus mit Andrea und dem alten Kombi in Marburg angekommen war und lange eine kostenlose Parkmöglichkeit im Gewerbegebiet hinter dem Hauptbahnhof gesucht hatte, fuhren beide mit ihren E Bikes Richtung Elisabethkirche. Andrea hatte ihren Mann während der Autofahrt zweimal daran erinnert, dass es selbstverständlich sei, die erste feste Freundin ihres ältesten Sohnes auch zum Essen einzuladen. Das erste Mal hatte Klaus die Provokation seiner Frau einfach überhört. Beim beharrlichen Nachhaken von Andrea nickte er dann nur kurz. Ihm würde schon was Passendes einfallen.
Kurz hinter der achthundert Jahre alten, gotischen Hallenkirche mit den beiden markanten Türmen und dem Grabmal der Heiligen Elisabeth kam ihnen ihr Sohn mit Freundin entgegen. Beide trugen vorbildlich einen Helm. Unter Fridas Helm flatterte ein langer, roter Pferdeschwanz. Kleidungsmäßig sah die Politikstudentin aus, als gehörte sie zur Kelly Familie aus der Zeit ihrer Auftritte in der Fußgängerzone. Viel sackartiger Plunder, braun, beige und hellgrün, ließ keinerlei weibliche Körperkonturen mehr erkennen. Man konnte Antons Freundin also keine übertriebene Eitelkeit vorwerfen. Und der Große sah mit seinem Helm über den tiefen Augenringen aus, als wäre er gerade aus einem Überraschungsei geschlüpft, fiel Klaus belustigt auf.
Im nächsten Moment merkte Klaus aber mit Schrecken, dass er die Helme in Kassel in der Garage gelassen hatte. Da lagen sie jetzt gut. Aber außerdem hatte ihn sein Kopfschutz sowieso nur gedrückt und gejuckt. Nur - jetzt wäre es vielleicht doch besser gewesen, die Helme dabei zu haben, denn Frida musterte die Eltern ihres Freundes bereits von Weitem sehr kritisch. Eine zweite Falte der Missbilligung zeigte sich auf ihrer Stirn, als Anton seine Eltern seiner Freundin vorstellte.
Nach dem etwas labbrigen Händedruck von Frida, den er erst noch verarbeiten musste, überlegte Klaus fieberhaft, wieso ihm das Gesicht von Frida so bekannt vorkam. Es fiel ihm erst ein, als die Studentin mit einem „Ihr fahrt ja auch Fahrräder mit Lithium Batterien!“ eine gewisse Missbilligung gegenüber den Akkus von Thalers Rädern zum Ausdruck brachte. Jetzt hatte er es. Das Gesicht von Frida erinnerte Klaus erstaunlich an eine Mutation ihres Schafes Lotti, das Emma vor über zwei Jahren mit der Flasche aufgezogen hatte, und das jetzt bei Mike und Ellen Rusher ein Gnadenbrot in einem einsamen Tal der Alpujarras, in der südspanischen Sierra Nevada, bekam.
Klaus spürte, wie sich in seinem Hinterkopf ganz leicht eine gewisse Antipathie aufbaute. Trotzdem zwang er sich zu einem Lächeln, denn Andrea schien der ersten festen Freundin seines ältesten Sohnes auf der Beliebtheitsskala von eins bis zehn bereits schon im Vorfeld mindestens eine Acht gegeben zu haben.
Anton wirkte an diesem Samstagvormittag ziemlich apathisch. „Erstaunlich. Bis jetzt ist der Junge doch nur bergab gefahren“, wunderte sich Klaus, als er die nahe Mensa als Ziel ihrer Fahrradtour vorschlug. Er begründete den sehr fadenscheinigen, aber kostengünstigen Vorschlag damit, dass er das heutige Studentenleben in allen Facetten richtig kennenlernen wollte. Andrea schaute ihren Mann sehr streng an, während Anton spontan konterte: „Die hat am Samstag zu, Vatter. Da musst Du Dir schon was Besseres einfallen lassen“.
Andrea schlug daraufhin die „Dammühle“ vor, jenes beliebte Ausflugslokal, das etwas außerhalb von Marburg im Grünen lag.
„Aber wir haben doch gar nicht reserviert. Wahrscheinlich kriegen wir überhaupt keinen Platz und stehen uns nur die Beine in den Bauch“, versuchte Klaus die drohende, hohe Essensrechnung noch abzuwenden. Es half nichts. Der heute Vormittag so maulfaule Anton fand die Idee seiner Mutter auch gut.
Nur Frida zögerte noch und wollte wissen, ob die dort auch vegetarisches Essen hätten. „Bestimmt gibt es das dort“, legte sich Andrea fest, ohne die Karte zu kennen. Damit musste Klaus sich resigniert geschlagen geben, obwohl er in einem letzten verzweifelten Einwand noch darauf hinwies, dass die beiden Studenten, ohne elektrische Unterstützung, fast zehn Kilometer bergauf fahren müssten.
Auf der Fahrt fuhr Andrea mit Frida plaudernd vor und freute sich, die Freundin von Anton etwas kennenzulernen. Klaus blieb bei Anton, der heute ziemlich matt wirkte, und half dem Jungen, Anschluss zu halten.
Als sie nach einer lang gezogenen Steigung, bei der Antons Gesicht die Farbe einer ungekochten Garnele zeigte, Marburg hinter sich gelassen hatten, kamen Wiesen mit Apfelbäumen an der Straße in Sicht.
Andrea drehte sich zu ihrem Erstgeborenen um. „Ich hab‘ Dir auch Deine Lieblingsäpfel mitgebracht. Braeburn aus Neuseeland“. Andrea zeigte auf ihren gut gefüllten Rucksack. Fridas Stirn bekam eine weitere, sehr tiefe Falte.
„Ich dachte, Du magst meine selbstgesammelten Äpfel am liebsten“, maulte sie Anton enttäuscht an, der vergessen hatte, seine Mutter auch über diesen fruchtigen Punkt zu informieren.
Denn Frida liebte es, auf den Streuobstwiesen um Marburg Falläpfel zu sammeln und ihren Freund alle zwei Wochen mit einem Beutel voller schrumpeliger, wurmstichiger Äpfel zu verwöhnen.
Andrea reagierte instinktiv richtig, als sie Frida erzählte, dass sie ja auch regelmäßig Falläpfel rund um den Pferdehof sammeln würde, um Apfelmus zu kochen. Frida schien etwas versöhnt zu sein. Trotzdem verlief der Rest der Fahrt meist schweigend.
In der Ausflugsgaststätte angekommen, hatte Klaus einen sehr schönen runden Tisch am Panoramafenster entdeckt, der einen wunderbaren Blick auf den großen Garten bot. Alle waren sofort begeistert und nahmen Platz. Sogar Anton taute etwas auf und streichelte die Hand seiner Freundin, die ihm mit etwas besserer Stimmung die vielen Obstbäume auf dem weitläufigen Grundstück zeigte.
Als Klaus auf die Toilette ging, nahm er diskret das kleine Schild mit, das er auf ihrem runden Tisch blitzschnell eingesteckt hatte, und platzierte es auf einem kleinen, noch freien Tisch unmittelbar vor dem Herren WC.
Später registrierte Klaus mit Genugtuung, dass das fleischlose Gericht, welches sich Frida ausgesucht hatte, das preiswerteste auf der Karte war. Langsam wurde ihm die Freundin des Großen doch etwas sympathischer. Anton hingegen spürte nach dem nächtlichen Desaster, dem fehlenden Frühstück und der anstrengenden Fahrradfahrt einen aufkommenden Hunger und bestellte sich das teuerste Essen. Rumpsteak mit allem Schnickschnack und allen, nur denkbaren Zulagen. Klaus` Stirn umwölkte sich, aber seine liebe Frau gab ihm mit einem Tritt auf seinen linken Fuß zu verstehen, dass er besser jeden Kommentar unterlassen sollte.
Als die Ausflügler gerade begonnen hatten, ihr Essen zu genießen, flog die Pendeltür des Restaurants mit heftigem Schwung auf und ein herrischer Mann mit devot wirkender Frau sowie blassem Sohn im Schlepptau stapfte in den Speisesaal. Alle drei trugen Kniebundhosen aus braunem Cord, rot karierte Hemden und einen Tiroler Hut aus grünem Filz. Die Familie war anscheinend von Marburg die zehn Kilometer gewandert und jetzt sehr hungrig und durstig.
Mit Entsetzen erkannte Anton den dominanten Familienvater.
Professor Fuchs schaute sich um, entdeckte den besetzten Tisch am Fenster und verlor so schnell wie ein Chamäleon seine helle, frische Gesichtsfarbe. Im nächsten Moment baute sich der Strafrechtler vor Thalers Tisch auf.
„Sie sitzen hier auf unseren Plätzen. Wir haben ausdrücklich diesen Tisch reserviert. Ich erwarte, dass Sie sich umgehend an einen anderen Tisch begeben“.
Andrea und Anton schauten betreten nach unten. Vor allem Anton betete, dass ihn sein Professor nicht erkennen würde. Frida schaute dem Juristen herausfordernd in das gerötete Gesicht und Klaus reagierte selbstbewusst.
„Der Tisch war frei, als wir gekommen sind. Wenn Sie reserviert hätten, müsste hier ja ein entsprechendes Schild gestanden haben. Und? Sehen Sie hier etwa ein Reservierungsschild? Also besprechen Sie das bitte mit dem Wirt und lassen uns jetzt in Ruhe unser Essen genießen.“
Wotan Fuchs war im ersten Moment sprachlos, im zweiten Moment überlegte er kurz, ob er es hier wie mit den Büchertischen an der Uni handhaben sollte. Dann stürzte er wutschnaubend zur Theke und schnauzte den Wirt an, was für ein Saustall der Laden hier wäre, wo verbindliche Reservierungen nicht eingehalten würden. Der verunsicherte Besitzer blätterte nervös im Reservierungsbuch. Alle anderen Gäste genossen belustigt die Unterhaltung während des Essens.
„Ja, hier sehe ich, Sie hatten um eine Reservierung auf Professor Fuchs gebeten. Aber ein Tisch ist nicht vermerkt“.
„Werter Herr, immer wenn ich mit meiner Gattin und meinem Sohn zu Ihnen komme, nehmen wir diesen Tisch am Fenster, den diese Sippschaft jetzt blockiert“, zischte der Professor und kam dem Wirt bedrohlich nahe.
„Wollen sehen, welcher Tisch noch frei ist. Einen Tisch haben wir ja auf jeden Fall für Sie reserviert“, schwitzte der Inhaber und begab sich auf die Suche im Speisesaal. Sechzig Paar Augen folgten ihm interessiert.
„Richtig, hier steht ja das Reservierungsschild für Sie. Dreizehn Uhr Professor Fuchs. Sie sehen, alles hat seine Richtigkeit“. Und damit zog der Wirt erleichtert die Stühle unter dem kleinen Tisch hervor und bat Familie Fuchs, Platz zu nehmen.
„Nichts hat seine Richtigkeit. Garnichts. Sie wollen uns doch wohl nicht im Ernst unmittelbar vor das Herrenklo setzen. Und das, wo meine Frau so geruchsempfindlich ist. Das nächste Mal werden Sie uns wahrscheinlich gleich auf der Toilette bewirten wollen“. Jetzt brüllte der reizbare Jurist den eingeschüchterten Wirt an, dem die Sache immer unangenehmer wurde.
„So nehmen Sie doch erstmal Platz. Die Herrschaften an dem anderen Tisch sind doch bald fertig, und dann bekommen Sie den Tisch. Währenddessen gibt`s einen Schnaps auf`s Haus“, flüsterte der Patron beschwörend.
„Meine Frau und mein Sohn trinken keinen Schnaps. Also trinke ich drei. Und sehen Sie zu, dass Sie den Tisch am Fenster schnellstens frei kriegen“. Frau Fuchs und der Junior kannten die cholerischen Ausfälle ihres Familienoberhauptes schon und setzten sich wortlos an den kleinen Tisch. In Windeseile hatte der Professor drei Grappa runtergekippt und harrte mit trommelnden Fingern auf dem Tisch auf seinen Stammplatz am Fenster.
Thalers hatten mit Frida in der Zwischenzeit entspannt ihre Mahlzeit genossen. Klaus machte der Auftritt des Cholerikers so viel Spaß, dass ihn die Wahl des Restaurants durch seine Frau und die drohende hohe Rechnung nicht mehr schreckten. Im Gegenteil. Weil er Lust verspürte, den Professor noch weiter zu reizen, ließ er sich in aller Ruhe die Dessertkarte kommen. Anton schaute seinen „Vatter“ erstaunt an. Der hilflose Wirt blickte derweil flehentlich zu Klaus und machte Andeutungen, dass man auch mit einem Nachlass rechnen dürfe, wenn Thalers ihren Platz nur zügig räumen würden.
Aber nichts da. Klaus nötigte seine Familie geradezu, sich noch einen Nachtisch auszusuchen. So kannten Andrea und Anton Klaus bislang nicht. Anton war es recht. Und Frida lernte heute eben einen gänzlich anderen „Vatter“ kennen. Als der Patron nach der Süßspeise blitzschnell die Rechnung auf den Tisch legte, brachte Klaus das Fass zum Überlaufen und bestellte seelenruhig für alle noch einen Espresso. Frida, die norddeutsche Teetrinkerin, wollte stattdessen einen ökologisch unbedenklichen Sencha Tee aus hundert Prozent fairem Anbau. Den einzigen grünen Tee in der wiederum angeforderten Karte prüfte die Studentin zur klammheimlichen Freude von Klaus lange über ihr Handy, bevor sie nach geraumer Zeit eine Bestellung akzeptierte.
Die Adern auf der Nase des wartenden Juristen traten mittlerweile bläulich-violett hervor. Bevor Klaus gemächlich das Portemonnaie suchte, stellte er mit Genugtuung fest, dass der Speisesaal fast leer war, denn die Mittagszeit war rum. Hoffentlich würde die Küche auch bald schließen. Er schlenderte in aller Ruhe an Familie Fuchs vorbei, um nochmal kostenlos die Herrentoilette zu besuchen.
Nur, ganz unproblematisch war der Zugang zum WC nicht. Der Professor hatte seinen Stuhl provokant so weit nach hinten geschoben, dass für alle potentiellen Nutzer die Tür zum Herrenklo versperrt war. Wie in den Vorlesungen des Juristen. Keiner kam mehr rein und keiner kam mehr raus. Erst als Klaus dem verbockten Gast klarmachte, dass er weder bezahlen, noch den Tisch freimachen würde, wenn er sich nicht erleichtern könne, rutschte der wütende Familienvater ganze zwanzig Zentimeter nach vorn. Dafür nahm sich Klaus ausgiebig Zeit, die Hände zu waschen und dann noch fünfzehn von den gratis Werbepostkarten aus dem Wandregal auszusuchen.
Als Klaus dann endlich gezahlt hatte und mit der Familie das geleerte Lokal verließ, hörte er noch, wie der Strafrechtler den blassen Wirt anbellte: „Und merken Sie sich das jetzt für alle Zeiten. Dieser Tisch bleibt nur für Familie Fuchs reserviert. Fuchs wie Reinecke. Ansonsten hetze ich Ihnen das Gesundheitsamt einmal quer durch die Küche. Und dann gute Nacht. Und jetzt bringen Sie schon die Karte.“
„Karte ist aus. Aber es ist noch ein Rest Suppe da“, hörte Klaus beim Rausgehen den Wirt weinerlich stottern. Ein hässliches, klatschendes Geräusch, verbunden mit dem Krachen eines heftig umstürzenden Tisches beendete die unergiebige Auseinandersetzung zwischen dem cholerischen Professor und dem hilflosen Inhaber der Ausflugsgaststätte.
Vor der Tür lachte Frida heute das erste Mal. Klaus fand, es klang wie ein asthmatischer Presslufthammer. Auf der Rückfahrt, die meist bergab ging, entwickelte Anton nach dem ausgiebigen Essen eine Energie, als hätte er Kokablätter als Beilage bekommen.
Andrea wollte in mütterlichem Interesse unbedingt noch Antons Zimmer besichtigen. Klaus war es egal. Im Zimmer angekommen, war Andrea doch über die wohnmäßige Mülltonne ihres Sohnes überrascht. Klaus, der für sein Leben gern saugte, ließ sich von Anton den alten Staubsauger geben, den er dem damaligen Erstsemester zum Einzug geschenkt hatte, und saugte in allen Ecken. Keine Wollmaus mehr, aber der Beutel war voll.
Frida schlug vor, dass sie in dem nun gesäuberten Zimmer doch ein paar ihrer selbst verfassten Haikus vortragen könnte. Andrea war sofort begeistert und Klaus heuchelte ein Interesse an den japanischen Kurzgedichten, musste aber jetzt schon ein Gähnen unterdrücken.
Zufrieden klappte Frida ein kleines Notizbuch auf und begann die Lesung mit der Rezitation eines Obstgedichtes
„Apfel hart und sauer
Krüppelbaum im Hain
nur dem Wurm schmeckt`s fein“
Klaus und Andrea sahen sich hilflos an. Der Tiefgang der dreizeiligen Kurzgedichte „Land der aufgehenden Sonne“ konnte sich nicht jedem erschließen. Mittlerweile war Frida bei einer Ode an ihr Fahrrad gelandet.
„Quietschen, schieben und ermatten
Fahrrad, alt und schwer
gestern hatt` ich einen Platten“
Unmittelbar nach der ersten Zeile setzte passenderweise ein heftiges Quietschen aus dem Nachbarzimmer ein. Lutscher hatte Damenbesuch. Frida stockte und klappte irritiert das Buch zu. Anton feixte wissend und Andrea schaute ihren schmunzelnden Mann verlegen an, schaute dann auf die Uhr und meinte schnell: „Unser Zug fährt doch bald. Wir müssen, Klaus“.
Obwohl Andrea und Klaus es vehement ablehnten, dass die Kinder sie unnötigerweise zum Bahnhof bringen würden, beharrten Anton und Frida, der die Bekanntschaft mit Antons Eltern anscheinend gut gefallen hatte, darauf, den Besuch auf jeden Fall am Bahnhof zu verabschieden. Klaus und Andrea schauten sich so hilflos an, als stände ihnen eine Wurzelbehandlung bevor. Die Kinder gingen ja selbstverständlich davon aus, dass sie mit dem Zug gekommen wären.
Auf der Fahrt zum Bahnhof zeigte Anton seinen Eltern noch stolz das Lokal, in dem er Frida kennengelernt hatte.
„Ich gehe ja in keine Disco mehr. Wegen meinem speziellen Tanzstil hab` ich in Marburg schon dreimal Hausverbot bekommen. Das schein` ich auch von Dir geerbt zu haben, „Vatter“. Du tanzt ja auch wie ein Popcorn in der heißen Pfanne. Deswegen haben wir uns hier beim Billardspielen getroffen“, erklärte Thalers Großer den ungewöhnlichen Treffpunkt am Rande der Altstadt. Das Lokal befand sich im Erdgeschoß eines mittelalterlichen Fachwerkhauses, das sich seit über fünfhundert Jahren an den Schlossberg klammerte. Und weil die Fundamente in den letzten hundert Jahren durch den rumpelnden Autoverkehr immer mehr nachgegeben hatten, hing der Billardraum ziemlich schief.
Alle paar Jahre musste der Wirt die Billardtische mit der Wasserwaage neu vermessen und Keile unter zwei Füße schieben. Jetzt wäre es auch mal wieder überfällig, erklärte Frida, denn die Kugeln würden schon von allein in die Löcher auf der rechten Seite rollen. Billard fand Klaus sofort sehr gut, denn das hatte er selber als Student nächtelang gespielt.
„Wenn wir das nächste Mal kommen, lade ich Euch zum Billardspielen ein. Mal sehen, ob ich Euch schlagen kann. Aber jetzt finden wir schon allein zum Bahnhof. Genießt den Abend noch. Am besten, Ihr spielt gleich ein paar Runden Billard hier“, versuchte Klaus, sich auf die Schnelle zu verabschieden.
„Frida hat aber beschlossen, dass wir Euch auf jeden Fall zum Zug bringen und Euch noch bei der Abfahrt winken, und dann machen wir das dann auch so“, beharrte Anton, der seiner Freundin eine kostenlose Freude bereiten wollte.
Klaus und Andrea fielen keine Argumente mehr ein. Sie kamen aus der Nummer nicht mehr raus. Also fuhren Sie mit den Kindern bis zum Bahnhof und stellten sich mit den Rädern brav auf den Bahnsteig. Nur wenige Minuten später fuhr brausend der stündliche Regionalzug nach Kassel ein. Andrea und Klaus herzten ihren Großen und drückten auch die neue Freundin. Beide bestätigten immer wieder, wie schön doch der Besuch in Marburg gewesen wäre. Beim Einsteigen sprach Andrea eine Einladung für Frida nach Kassel aus, welche die auch wohlwollend dankend annahm. Zischend schlossen sich die Türen und der Zug fuhr ruckend los. Sie waren gefangen. Aber die Kinder winkten ihnen liebevoll hinterher.
„Schöne Scheiße“, fluchte Klaus, der auf dem Streckenplan über dem Fenster festgestellt hatte, dass der Zug das nächste Mal erst in Schwalmstadt hielt. Und das waren über vierzig Kilometer.
Erschöpft sanken beide in die abgewetzten blauen Velours Sitze, nachdem sie ihre Fahrräder im Gang befestigt hatten. Klaus war jetzt hundemüde und kurz vor dem Einschlafen, sodass er die Gefahr nicht spürte, die auf sie zukam.
Kurz vor Schwalmstadt-Treysa näherte sich Thalers von hinten eine blau gekleidete Dame mit fescher roter Kappe, kontrollierte und entwertete die Fahrscheine der mitfahrenden Reisenden. Als sie die dösende Andrea und den übermüdeten Klaus weckte, wussten beide im ersten Moment nicht, um was es ging. Dann fiel es Klaus mit Schrecken ein. In der Eile hatten sie keine Fahrscheine gelöst.
Die blau gekleidete Dame blieb trotzdem verständnisvoll und hilfsbereit. Selbstverständlich könnten sie bei ihr nachlösen. Klaus seufzte erleichtert. Aber es wäre auch neben dem üblichen Fahrpreis eine Strafgebühr von sechzig Euro pro Person fällig.
„Wir nennen das: erhöhtes Beförderungsentgelt“, erklärte die freundliche Dame dem entsetzten Klaus. „Das gilt, wenn Sie sofort zahlen. Ansonsten muss ich Ihre Personalien aufnehmen und die Sache zur Anzeige bringen. Aber dann wird es wirklich teuer“.
Klaus suchte aus Andreas und seinem Portemonnaie hektisch die letzten Scheine zusammen, drückte der verdutzten Kontrolleurin das Geld in die Hand und hetzte mit Andrea zu den Fahrrädern. „Es passt schon. Wir brauchen keine Quittung“, erklärte er der Frau, als sich bereits quietschend die Türen des Zuges öffneten, weil der Zug nur für zwei Minuten in Schwalmstadt hielt. Jetzt nur schnell raus aus dem Zug und zurück nach Marburg.
Mittlerweile war es dunkel geworden, und es hatte angefangen zu regnen. Mindestens zweieinhalb Stunden Fahrt auf der vielbefahrenen Bundesstraße lagen jetzt vor ihnen. Ohne Helm und ohne Regenschutz. Andrea und Klaus waren beide stocksauer. Andrea war auf Klaus sauer und der war ebenfalls auf sich sauer.
„Diese Mist Bahnfahrt war so sinnvoll wie ein zweiter Hintern“, schimpfte Klaus und Andrea maulte, dass sie besser von Anfang an mit offenen Karten hätten spielen sollen.
„Außer, dass Frida vielleicht etwas enttäuscht gewesen wäre, hätte uns doch nichts passieren können. Und wir wären jetzt schon bald zu Hause. Außerdem hätten wir das erhöhte Beförderungsentgelt gespart. Wir könnten das nächste Mal nach Marburg auch gleich die Bahn nehmen. Dann ist Ruhe bei den Kindern. Und billig ist es auch“, warf Andrea ihrem Mann vor, der sich stillschweigend eingestehen musste, dass seine bessere Hälfte mal wieder recht hatte. Er hatte die Fahrt gründlich verbockt.
Als Klaus` Akku nach dreißig Kilometern schlapp machte, weil Klaus das Teil natürlich nicht aufgeladen hatte, stellte Andrea eine berechtigte Frage: „Warum sind wir eigentlich nicht mit dem nächsten Zug nach Marburg zurückgefahren?“
„Weil unser Geld durch die saublöde Strafgebühr alle war und wir nicht nochmal schwarz mit dem Zug fahren können. Ich kriege sonst noch Sicherungsverwahrung und „Schwarzfahren“ darf ich vor Frida erst recht nicht sagen“, stöhnte Klaus pitschnass und trat kräftig in die Pedale, um seiner Frau auch ohne elektrische Hilfe bis zum Auto nach Marburg folgen zu können. Es wurde dreiundzwanzig Uhr, als die beiden durchgeschwitzt und völlig durchnässt bei ihrem alten Kombi ankamen und die Fahrräder aufladen mussten.
Die Rückfahrt nach Kassel verlief dann schweigend.