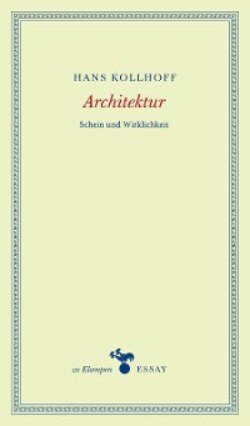Читать книгу Architektur - Hans Kollhoff - Страница 7
Die Stadt ist kein Mangelwesen
ОглавлениеWENN wir in alten Städten aus dem Wagen steigen und ganz selbstverständlich den Bürgersteig hinuntergehen – ja, es heißt heute immer noch Bürgersteig, obwohl der bürgerlichen Gesellschaft nach dem Kriege das Leben nicht eben leichtgemacht wurde, und dies nicht nur im Osten Deutschlands –, dann kommen wir in den Genuss einer der größten zivilisatorischen Leistungen der Menschheit.
Sie mögen lachen. Ich meine das tatsächlich ernst. Sind Sie jemals zu Fuß in Los Angeles unterwegs gewesen? Wenn Sie dort das Zentrum verlassen, sich am Straßenrand entlangbewegen müssen, um den Autos auszuweichen, kann es sein, dass spätestens nach zehn Minuten eine Polizeistreife anhält und fragt, was Sie hier tun. Dann werden Sie beginnen, mich zu verstehen.
Aber Sie müssen gar nicht so weit reisen: Bewegen Sie sich einmal in der sogenannten Agglomeration zwischen Zürich und Basel, so werden Sie ebenso vergeblich den Bürgersteig suchen wie in einer Plattensiedlung. Da war man in Pompeji schon weiter. Die Furchen von den Ochsenkarren in den Granitplatten können Sie heute noch sehen, und wenn Sie die Straße überqueren wollen von Bordsteinkante zu Bordsteinkante, schreiten Sie über Quader, die wie massive Zebrastreifen aus der Straße herausragen, freilich so, dass für Gespann und Räder eine Trasse ausgespart wurde. Dort, wo sich heute die Touristenmassen bewegen, konnte der Pompejaner flanieren, an Läden, Schenken und Bordellen vorbei, und die Häuser hatten eine Adresse, Straßennamen und Hausnummern.
Der Bürgersteig mit Bordsteinkante auf der einen und die Bauflucht auf der anderen Seite – diese Regel ist heute für Architekten und Städtebauer nicht mehr selbstverständlich. Dass es da einen Bereich gibt, der dem Fußgänger vorbehalten ist, entlang einer Hausreihe mit oder ohne Vorgarten, stets sauber getrennt vom Fahrverkehr (denn auch der Radfahrer hat hier nichts zu suchen) und breit genug, dass Menschen einander begegnen können, das beginnen wir vielleicht erst heute wieder zu schätzen – dank einer aufkommenden Sehnsucht danach, die Stadt nicht nur aus dem Auto wahrzunehmen.
Mir ist das wichtig, weil darin auch eine Trennung zwischen Architektur und Stadtbau angelegt ist – ich sage bewusst nicht Stadtplanung und auch nicht Städtebau, sondern Stadtbau –, ganz nach dem bewährten Prinzip, das bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein wirksam war. Ein ausgesprochen leistungsfähiges Prinzip, demzufolge James Hobrecht im Berlin des 19. Jahrhunderts innerhalb atemraubend kurzer Zeit einen Ring neuer Stadtquartiere als Zentrumserweiterung ausbilden konnte, um dem Bevölkerungsansturm Rechnung zu tragen. Diese Strukturen lassen sich im eigentlichen Sinne als Stadt bezeichnen. Vielleicht nicht in der Art, wie es Camillo Sitte vorschwebte, aber immerhin so, wie es heute von Bewohnern und Besuchern im Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg geschätzt wird – so dass sich dort ein wahrer Verdrängungsprozess abspielt, weil diese Stadtstrukturen inzwischen als attraktive Wohnquartiere erkannt werden, so geringschätzig sie auch seinerzeit betrachtet worden sein mögen. Denn das war keine Architektur. Das war reine Spekulantenangelegenheit. Die Protagonisten der Nachkriegsmoderne wollten deshalb alles abreißen, um ihre gleißenden Städte zu verwirklichen. In diesen Quartieren also funktioniert die Stadt auf wunderbare Weise wie eh und je.
Und was war Hobrechts Geheimnis? Er hat sich nicht für Architektur interessiert, sondern um die Infrastruktur gekümmert, um Straßen, Baufluchten und Bürgersteige, vor allen Dingen aber um die Abwassertechnologie. Er hat nämlich die Fäkalien nicht einfach in den Fluss, die Spree fließen lassen, wie man das seinerzeit noch in Paris und in London tat, sondern das sogenannte Radialsystem eingeführt, d. h., Straßen nach draußen bauen lassen und unter den Straßen die Kanalisation angeordnet. All das, was zur Infrastruktur gehörte – Elektrizität, Gas und Wasser –, wurde unter dem Bürgersteig verlegt, mit Granitplatten und Kleinpflaster abgedeckt, so dass zwecks Revision, Reparatur und Erweiterung immer wieder bequem heranzukommen ist und der öffentliche Raum dennoch nicht unansehnlich wird, wie das heute der Fall ist, wenn jeder seine Gerätschaften oberirdisch abstellt, wo und wie es ihm gerade passt. Nein, Hobrecht hat alles unterirdisch verstaut und darüber sauber seinen Bürgersteig gebaut, bis hinaus in die Randbezirke und Vororte. Die Abwässer wurden hinausgepumpt auf die Felder, und darauf wuchsen dann die berühmten heute wieder als Delikatesse gehandelten Teltower Rübchen.
Durch das Radialsystem wurden viele Grundstücke dieser parzellierten Blöcke schräg angeschnitten, es gab Ecken, die schwer zu bebauen waren. Aber ihre Größe hielt sich in Grenzen. Als Fußgänger konnte man die Blöcke bequem umrunden, ohne müde zu werden. Auf den Parzellen galt es, individuelle Häuser zu bauen, mehr oder weniger ambitionierte Häuser – bei Hobrecht eher weniger ambitionierte, aufgrund der Wohnungsnot und einer Bauindustrie, die schon vorwiegend auf Fertigteilproduktion zurückgreifen konnte. Dabei hat man sich jedoch nicht so unbeholfen angestellt wie beim Plattenbau, sondern mit einer handwerklichen Präzision und einem architektonischen Reichtum gearbeitet, der uns heute beeindruckt. Denn die tektonische Gliederung war eingegangen in die Produktion der Betonfertigteile, bis hin zur floralen Ornamentik. Deswegen ödet sie uns nicht an. Das haben freilich die Flaneure des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die an großbürgerliche Palast-Architektur gewöhnt waren, anders gesehen.
So also funktioniert Stadtbau, und wenn wir etwa in eine Stadt wie Görlitz kommen, erstaunt nicht nur, was sich dort in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, sondern auch die Vielfalt, die möglich ist im Rahmen dieses althergebrachten Prinzips, das keiner hochtrabenden Neuerungen bedarf, um weiter bestehen und auf noch so fortschrittliche Ansprüche reagieren zu können:
Auf Parzellen werden Häuser errichtet. Ein Haus ist dabei eine Einheit – nicht nur als Investment, sondern auch als Repräsentation eines Bauherrn, der persönliche Interessen hat und die Verantwortung für ein Projekt, das einer bestimmten Funktion dienen soll, übernimmt. So entstehen Typologien, die unendlich variiert werden können. Doch das Entscheidende dabei ist die Adresse. Solange ein Haus an einer gewidmeten Straße liegt, eine Hausnummer hat und der Eingang sich schon von weitem zu erkennen gibt, um den Besucher zu leiten – er sich also nicht in einer Megastruktur wiederfindet, mit einem Schilderwald, der ihn noch 500 Meter weiterschickt, um den Treppenaufgang Y23 zu finden –, solange verdient dieses Objekt den Namen Haus. Eine Stadt ist nun mal aus Häusern gebaut und nicht aus Megastrukturen, denn die beschädigen sie.
Ein Haus zu bauen ist heute nicht ganz einfach, aber es kann gelingen, wenn man als Architekt sensibilisiert ist und hin und wieder auch die Überzeugungskraft und Hartnäckigkeit aufbringt gegenüber einer Bauherrschaft, die es natürlich immer groß und schnell und billig haben möchte und bei der man oft den Bauherrn als Person vergeblich sucht. Das Phänomen zeitgenössischen Investments, das eines Developers bedarf, der dem Shareholder-Value zu dienen hat und sonst gar nichts, ein Prinzip, das hinübergreift in unsere Finanzmarkt-Besonderheiten und in eine Ökonomie, die letztlich von Aufsichtsräten und Rating-Agenturen abhängig ist – das alles droht, die Stadt zu zerstören.
Es wundert mich, dass die offizielle Politik diese Strukturen erst heute in Frage zu stellen beginnt – aus der Not heraus, wie wir wissen – und dass nicht sehr viel früher auf ganz breiter Ebene Widerspruch laut geworden ist. Denn diese Vermarktungsprinzipien aus der Sphäre des Massenkonsums, nach denen immer alles neu zu sein hat, dieses Neue sich allerdings wenig später schon von seiner bedrückenden Konventionalität zeigt, richten sich gegen die urbane Qualität, die unsere europäischen Städte noch immer auszeichnet. Mehr noch: Sie richten sich gegen unsere Lebensqualität insgesamt, denn Stadt und Architektur sind alles andere als Konsumgüter.
Man könnte durch Görlitz gehen und sagen: »Es ist ja verdammt schön hier. Das einzige, was fehlt, sind junge Leute und Häuser, die auch unsere Zeit im Stadtbild erfahrbar machen. Freilich ohne dieses stumpfsinnige Kontrastprinzip.« Doch muss man in aller deprimierenden Deutlichkeit sagen: Görlitz ist so fantastisch, nicht nur weil es vom Krieg verschont wurde, sondern weil seit 50 oder 60 Jahren hier im Stadtzentrum nichts Neues mehr gebaut worden ist, die Stadt also nicht durch Planung ruiniert wurde, wie das in Westdeutschland die Regel war, so dass dieses Görlitz heute als Musterbeispiel dasteht für die Idee der europäischen Stadt.
Nach dem Prinzip der Trennung von Stadtbau und Architektur, Infrastruktur und Hausbau hätte man weiterbauen können, bis heute. Dabei stößt man hin und wieder an Grenzen, etwa bei der Frage der individuellen Größe der Gebäude. Aber die lässt sich ausloten. Ich glaube nicht einmal, dass die Gebäudehöhe das Entscheidende ist. Wenn wir nach Manhattan gehen, gibt es neben den Brownstones vierziggeschossige Hochhäuser, und die vertragen sich ganz fabelhaft miteinander. Es geht mir auch nicht darum, eine Gestaltungssatzung aufzustellen, und eine einmal festgelegte Traufhöhe zwanghaft durchzusetzen. Wesentlich ist vielmehr, dass die einzelnen Stadtbausteine nach dem Prinzip »Haus« funktionieren. Auch das Chrysler Building ist nach dieser Definition ein Haus. Klare Adresse, ein Haupteingang und eine plausible Erschließung – eben keine Megastruktur. Und das ist nicht eine Frage der Größe.
Das Prinzip Haus also, damit ließe sich weiterarbeiten im Stadtbau. Was nun in Frankfurt am Main diskutiert wird im Rahmen der neugeplanten Altstadt, das ist ein Verzweiflungsakt. Dort wurde eine Megastruktur, nämlich das Technische Rathaus, jüngst abgerissen. Die Bürgerschaft hatte jahrzehntelang gegen diesen Bau opponiert. Die Mehrzahl derjenigen, die ihn schließlich zu Fall gebracht haben, waren noch gar nicht geboren, als er entstand. Man wollte dieses Monstrum ganz einfach nicht mehr, weil man wusste: Da hatte es diese Altstadt gegeben, von der Bilder zeugen, und hie und da stand noch ein Haus, das vom Krieg verschont geblieben oder wiederhergestellt worden war. Es ging auch nicht um die Wiederherstellung einer Fachwerkseligkeit, schließlich waren bereits im frühen 20. Jahrhundert reihenweise Fachwerkbauten abgerissen worden, um größeren Häusern Platz zu machen. Auch das gehört zum Prinzip des Stadtbaus, dass Häuser abgerissen werden können. Es muss durchaus nicht immer alles konserviert werden. Doch wenn ein neues Haus entsteht, dann muss es als solches in Erscheinung treten, und es darf in seiner Substanz nicht schlechter sein als das, was da vorher gestanden hat. Darüber hinaus muss es einen Beitrag leisten zum Kollektivgedächtnis der Stadt. Wenn ich etwas neu baue, habe ich mich auch mit dem auseinanderzusetzen, was vorher dort war. Das bedeutet keineswegs, dass ich wieder die gleiche alte Kiste hinstellen sollte. Doch es gilt unbedingt zu berücksichtigen, dass der neue Eingriff Teil eines Kontinuums baulicher, die Gesellschaft verkörpernder Ablagerung ist. Der Architekt Aldo Rossi hat das »Permanenz« genannt.
Zudem sollte, wer städtisch bauen will, noch einige Gepflogenheiten berücksichtigen: etwa eine klare Trennung zwischen öffentlichem Raum und privater Wohnung. Letztlich geht das bis hinein in die Materialisierung des Gebauten. Aus lauter Glashäusern werde ich keinen städtischen Raum schaffen können, der es erlaubt, sich einerseits zurückziehen zu können ins Private, und zwar auf diskrete Weise, und andererseits auf dem Bürgersteig spazierengehen zu können, um am öffentlichen Leben im Stadtraum zu partizipieren. Wir kommen hier also doch nicht um das Architektonische herum und gelangen zu der Einsicht, dass diese Form der Bürgerlichkeit nichts weniger darstellt als das konstitutive Prinzip der Stadt. Die Häuser sind ja nicht nur Nutzfläche und Rückzugsmöglichkeit, sondern der Bürger wendet sich mit seinem Haus auch der Öffentlichkeit zu, präsentiert sich ihr.
Das Haus, insbesondere dessen Gesicht, die Fassade, repräsentiert diesen Stadtbürger im Stadtbild. Aus der Addition solcher Hausindividuen, die in ihrer Physiognomie etwas vom Bauherrn verraten, entsteht also – wie an Görlitz zu sehen – ein vielfältiges, lebendiges Bild, ein Abbild der Gesellschaften, die an der Stadtstruktur mitgewirkt haben.
Wenn ich dieses Prinzip verlasse, indem ich wie in den 20er Jahren oder auch noch in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Zeilenbau praktiziere, die Häuser alle mit ihrem Balkon nach Süden ausgerichtet und im Norden Küche, Bäder und Toiletten, dann schaut man einander nicht mehr in die Augen, sondern nur mehr auf den Rücken. Noch ungeselliger ist das schweizerische Prinzip des Terrassenhauses, in dem man sich gegenseitig auf der Schulter hockt, ohne einander zur Kenntnis nehmen zu wollen.
Welcher Art nun sollte die Kraft sein, die eine Stadt hervorbringt? Ich behaupte, die Stadt darf kein Mangelwesen sein. Aus noch so vielen zusammengekratzten Subventionen wird man keine Stadt schaffen, ja noch nicht einmal eine Stadt erhalten können. Womit man eine Stadt hervorbringen und am Leben erhalten kann, ist die Identifikation der Bürger mit ihrem Gemeinwesen. Nur wird dieser Begriff des Bürgers – ich spreche lieber von Bürgerlichkeit – bei uns in Deutschland immer noch mit der Kneifzange angefasst. Unsere mittlerweile bürgerlichste Partei, die der Grünen, die einst paradoxerweise einen vehementen Kampf gegen alles Bürgerliche führte, es sozusagen schon beerdigte, scheint heute wieder dort anknüpfen zu wollen. Es entstehen aus dieser neubürgerlichen Haltung heraus durchaus beispielhafte Projekte, die zur Hoffnung Anlass geben, dass sich wieder eine Form von Bauherrschaft begründen ließe, die am Stadtbau interessiert ist, also nicht nur Häuser kauft, sondern auch baut. In Berlin erleben wir das mit den sogenannten Baugruppen, die sich per Internet zusammenfinden und Mehrfamilienhäuser errichten, wie es im ausgehenden 19. Jahrhundert der Maurermeister praktiziert hat, nur dass jener im Piano Nobile wohnte und den Rest des Hauses vermietete, um im Alter davon zu leben.
Solche Initiativen erscheinen heute oft noch etwas unbeholfen, aber die Menschen fangen an wahrzunehmen, was sich in ihrer Umgebung verändert, wenn sie ein Haus bauen. Der Blick auf die Umgebung ist ein anderer, als wenn man nur zur Miete wohnt und nach ein paar Jahren wieder auszieht. Nehme ich Geld in die Hand, um eine Eigentumswohnung zu kaufen, mache ich mich in gewisser Weise sesshaft, richte mich für einen längeren Zeitraum ein. Vielleicht spiele ich sogar mit dem Gedanken, dass die Kinder dermaleinst darin wohnen könnten. Dieser Gedanke mag etwas altmodisch anmuten, ich glaube aber, so anachronistisch ist er nicht mehr. Wir sehen ja, dass die meisten dieser Baugruppen-Eigentümer Familien gründen und sich tatsächlich mit dem Ort identifizieren, genau beobachten, was auf der anderen Straßenseite vor sich geht, was links und rechts neben ihnen passiert. Wird da irgendwo gebuddelt, werden sie sich erkundigen, weshalb und von wem. Wohne ich hingegen zur Miete, frage ich nicht nach, weil ich annehme, dass schon alles seine Ordnung haben wird.
Aus Wohneigentum kann offenbar so etwas wie bürgerliches Engagement eher erwachsen. Auch wenn die ersten Beispiele solcher Gemeinschaftsprojekte, etwa am Friedrichswerder in Berlin, noch ziemlich chaotisch daherkommen, zu bunt, zu überladen, sollte man nicht mit einer Gestaltungssatzung dagegenhalten. Die Gestaltungssatzung ist wieder so ein obrigkeitliches Instrument; das brauchen wir nicht. Wir benötigen einfach etwas Geduld. Das nächste Projekt wird sicherlich schon besser. Und dann, nach ein, zwei Generationen, wird es auch den Architekten einfach zu blöd geworden sein, immer nur von einem Extrem ins nächste zu wechseln, eben weil die Bauherren Haus und Stadt nicht länger als Konsumgut begreifen. Und eines Tages wird es vielleicht wieder feinere Unterschiede geben, so, wie man dies in einer Stadt wie Görlitz beobachten kann. Ausschließlich in dieses Prinzip setze ich Hoffnung beim Bauen von Häusern und Stadtquartieren, aber auch beim Erhalten von Stadtstrukturen. Keine noch so geniale »Vision« wird hier helfen.
Deswegen irritiert es mich, wenn im Rahmen der städtebaulichen Planung zahllose Fördermechanismen, Programme, Richtlinien, Strategien usw. aufgelistet werden. Das kenne ich aus den 1960er Jahren. Ich weiß, dass daraus nichts Brauchbares entstanden ist. Ich weiß aber auch, dass damals in Kreuzberg bei der Hämer-IBA junge Leute zusammengekommen sind, um den Spekulanten den Zugang zu den Häusern zu verwehren und zu verhindern, dass im Zuge der »Stadtsanierung« die Dächer aufgerissen werden und damit die Bausubstanz ruiniert wird. Denn die alteingesessenen Mieter hätte eine solche Stadtzerstörung, die lange Zeit als Glücksverheißung erschien, in die Großsiedlungen an den Stadtrand verbannt.
Das bürgerliche Engagement, das sich in den vergangenen Jahren in Stuttgart artikuliert hat, bedeutet für mich allerdings nur einen ersten Schritt: gegen etwas zu sein. Dort ist man zu Recht gegen etwas, nämlich gegen die Verscherbelung von Bahngrundstücken im großen Stil. Es wäre jedoch wichtig, diesen bürgerlichen Protest für etwas, für die Entwicklung von Stadt nutzbar zu machen – einer Stadt, in der man selbstverständlich wohnt, denn der Wohnsitz ist die primäre Voraussetzung für eine Identifikation mit der Stadt. Nach diesem traditionellen Prinzip vorzugehen und dabei heutigen Bedürfnissen Genüge zu tun, das ist die gesellschaftliche und architektonische Herausforderung. Die Häuser werden dann etwas anders aussehen als vor hundert Jahren, da wird etwas mehr Glas sein müssen, da wird man großzügige Terrassen und Loggien haben wollen und große Bäder und Küchen sowie alles, was den Komfort erhöht, wenn man es sich leisten kann. Aber das Prinzip ist das gleiche.
Ich hoffe, das klingt zuversichtlich, wenngleich junge Architekten nun vieles vergessen dürfen, was sie heute an der Hochschule lernen.