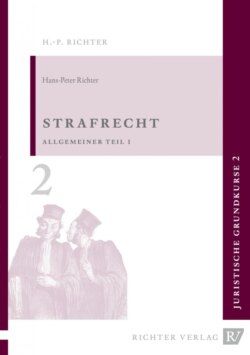Читать книгу Juristische Grundkurse - Strafrecht - Allgemeiner Teil - Hans-Peter Richter - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel – Tathandlung, Kausalität und Zurechnung
ОглавлениеDie Tathandlung
Es muss als Anknüpfungspunkt für strafrechtliche Verantwortung immer zunächst nach einem Verhalten des Täters gesucht werden. Dieses kann in einem Handeln oder einem Unterlassen liegen.
Zu den Unterlassungsdelikten siehe Juristische Grundkurse, Band 7, Strafrecht, Allg. Teil 2
Was sich hinter dem Begriff der Handlung exakt verbirgt, wird von verschiedenen Handlungslehren unterschiedlich beurteilt. So gibt es einen kausalen, sozialen und finalen Handlungsbegriff.
In der Rechtslehre hat sich überwiegend die finale Handlungslehre durchgesetzt, der auch in diesem Buch gefolgt wird, während die Rechtsprechung noch weitgehend der kausalen Handlungslehre anhängt.
Streng genommen wird meist keine rein finale oder rein kausale Handlungslehre vertreten, sondern die Ansätze gehen lediglich von dem einen oder anderen Leitbild aus. Teils werden einige dieser Ansätze auch als soziale Handlungslehre bezeichnet.
Vgl. näher zu den einzelnen Ansätzen die Übersicht bei Joecks, Stuko, Vor § 13, 6 ff.
Für die Fallbearbeitung ist dieser Unterschied zunächst ohne Bedeutung. Dort wo er sich auswirkt wird im weiteren Verlauf des Kurses auch darauf eingegangen.
Das erfasste Verhalten muss
tatbestandsmäßig
sein, d.h. die konkreten Umstände müssen den abstrakten Merkmalen einer im Gesetz beschriebenen und mit Strafe bedrohten Handlung entsprechen. Bei zahlreichen Strafvorschriften des Besonderen Teils des StGB handelt es sich um Erfolgsdelikte. So auch bei den in diesem Buch behandelten Delikten der §§ 211, 212, 223, 224, 303. Das Charakteristikum dieses Deliktstypus ist es, dass ein dort beschriebener Erfolg eintritt, z.B. der Tod eines Menschen (§§ 211, 212), eine Körperverletzung (§§ 223 ff), die Zerstörung einer Sache (§ 303). Diese Erfolge beruhen stets auf irgendeiner Ursache, meist einem menschlichen Verhalten. Ihre Aufgabe ist es, zunächst zu untersuchen, ob ein bestimmtes, im Sachverhalt dargelegtes Verhalten zu diesem Erfolg geführt hat. Als tatbestandsrelevantes Verhalten kommt
jedes von einem menschlichen Willen getragene Handeln oder Unterlassen
in Betracht.
Die Kausalität
Die Beziehung zwischen dieser Handlung und dem Erfolg muss in Form eines Ursachenzusammenhanges - Kausalität - vorliegen.
Kausalität bezeichnet einen Ursachenzusammenhang zwischen Tathandlung und Taterfolg
In der Feststellung, dass eine Tathandlung, ein Taterfolg und die diese beiden Komponenten verknüpfende Kausalität gegeben ist, erschöpft sich oftmals die Prüfung des objektiven Tatbestandes eines Erfolgsdeliktes. Kausalität wird zwar im Ergebnis oft mit einem rein naturwissenschaftlichen Ursachenzusammenhang übereinstimmen, aber vom gedanklichen Ansatz her handelt es sich um eine Ursächlichkeit im Rechtssinn.
Im Strafrecht folgt man bei der Kausalitätsprüfung im Grundsatz der sog.
Äquivalenztheorie
Danach sind
Ursache alle Bedingungen, die nicht hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele
Um zu prüfen, ob Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie vorliegt, nimmt man folgende Gedankenoperation vor:
→ 1. man denkt sich die Handlung (Bedingung) des Täters weg
→ 2. man prüft, was mit dem Erfolg dann geschehen würde
→ 3. Gelangt man zu dem Ergebnis, dass es ohne diese Handlung nicht zu dem Erfolg kommen konnte, der Erfolg also entfiele, so liegt Kausalität zwischen Handlung und Erfolg vor. Anderenfalls fehlt es an der Kausalität.
Der Erfolg ist dabei möglichst genau zu beschreiben. So genügt es streng besehen nicht, wenn A den B erschießt vom „Tod des B“ als dem Erfolg zu sprechen. Strafrechtlich relevant ist nämlich nur der Tod durch den Schuss des A, nicht etwa irgendein anderer Eintritt des Todes, z.B. durch Altersschwäche. Genau der exakt herausgearbeitete Erfolg muss dann bei Anwendung der Kausalitätsformel entfallen!
Die vorstehende Gedankenoperation bezeichnet man auch als
„conditio sine qua non“ Formel.
Dadurch werden freilich sehr viele Verhaltensweisen erfasst, die nicht alle strafrechtsrelevant sein können. Welches kausale Verhalten jedoch als unbeachtlich und welches als beachtlich anzusehen ist, wird an anderer Stelle (z.B. bei der Zurechnungsfrage) zu erörtern sein.
Abweichend davon wird nach anderer Ansicht die Kausalität nicht nach der Äquivalenztheorie, sondern nach der Adäquanztheorie bestimmt. Diese berührt jedoch auch gleichzeitig Zurechnungsfragen und daher soll auf die Adäquanztheorie erst im Rahmen der Zurechnung näher eingegangen werden.
Ähnlich geht die „Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung“ vor. Danach ist ein Verhalten dann Ursache eines Erfolges, wenn dieser mit dem Verhalten durch eine Reihe von Veränderungen in der Außenwelt gesetzmäßig verbunden ist.
Vgl. Wessels-Beulke, AT, Rn.168a; Sch-Sch-Lenckner-Eisele, Vor §§ 13ff, 75.
Da das Ergebnis dieses Ansatzes regelmäßig mit dem der „conditio-Formel“ übereinstimmen wird, ist in der Klausur eine gesonderte Abhandlung m.E. entbehrlich. In der Hausarbeit muss aber selbstverständlich dieser Ansatz dargestellt und verarbeitet werden. Aber auch dort bedarf es angesichts meist gleicher Ergebnisse keiner Streitentscheidung!
Zu ähnlich strukturierten Ansätzen vgl. Sch-Sch-Lenckner-Eisele Vor §§ 13ff, 73ff.
Fall 1:
A gerät mit B in Streit, in dessen Verlauf A ein Messer zieht und B niedersticht. B stirbt. Strafbarkeit des A?
Da der Tod eines anderen Menschen eingetreten ist, kommt eine Vorschrift aus dem Bereich der Tötungsdelikte in Betracht, hier § 212. Es soll auch zunächst nur § 212 geprüft werden. § 211 ist nicht einschlägig, weil es keinen Hinweis auf die Verwirklichung eines Mordmerkmales im Sachverhalt gibt. § 212 setzt im Einzelnen voraus: es muss der Taterfolg, der Tod eines anderen Menschen (dem Tatobjekt), eingetreten sein. Weiter ist eine Tathandlung des Täters erforderlich und schließlich Kausalität zwischen Handlung und Erfolg. Die „Wendung ohne Mörder zu sein“, hat heute keine Bedeutung mehr, sie ist vielmehr ein Relikt aus der Zeit der sog. Tätertyplehre.
Lösungsvorschlag
A könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er den B niederstach.
Dann müsste der Tod eines Menschen eingetreten sein. B, ein Mensch, ist laut Sachverhalt zu Tode gekommen, so dass der notwendige Taterfolg gegeben ist. Die Tathandlung liegt mit dem vom Willen des A getragenen Niederstechen ebenfalls vor. Weiter ist Kausalität zwischen diesem Erfolg und der Tathandlung erforderlich.
Die Kausalität bestimmt man im Strafrecht nach der Äquivalenztheorie. Danach ist jede Bedingung Ursache, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Denkt man sich hier das Niederstechen seitens des A weg, wäre B jedenfalls nicht durch den Stich zu Tode gekommen. Folglich entfiele der Erfolg in seiner konkreten Gestalt, so dass Kausalität nach der Äquivalenztheorie vorliegt. Damit ist der objektive Tatbestand erfüllt.
Da A auch vorsätzlich handelte, ist der subjektive Tatbestand gegeben. Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. Folglich hat sich A gem. § 212 strafbar gemacht.
Die weitere Prüfung - subj. Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld - erfolgt hier bewusst noch nicht in exakter Form.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Die Erfolgszurechnung
Die Weite der Äquivalenztheorie ist jedoch nicht unproblematisch, denn alle, auch noch so weit zurückliegenden Ursachen sind Bedingungen i.S.d. Äquivalenztheorie, sofern sie nur in einem naturwissenschaftlichen Sinne miteinander verknüpft sind.
Bsp.: Auch die Großeltern des Mörders sind für dessen Tat kausal geworden, denn hätten sie nicht ihre Kinder und die wiederum deren Kinder erzeugt, so hätte der Täter nicht gelebt, hätte folglich auch seine Tötungshandlung nicht vornehmen können, so dass das Opfer jedenfalls nicht durch das Handeln des Mörders zu Tode gekommen wäre.
Um einem Täter nur die Erfolge anzulasten, die einer strafrechtlichen Wertung zufolge auch in seine Verantwortung fallen sollen, bedarf es daher eines Korrektivs. Auf der Ebene des Tatbestandes bedient man sich des Begriffs der Zurechnung.
Wie die Zurechnung eines Erfolges zu geschehen hat, ist im Einzelnen stark umstritten.
Teilweise wird die Zurechnung als Kausalitätsproblem gesehen, in der überwiegenden Literatur wird sie dagegen als eigenständiges Merkmal des objektiven Tatbestands erfasst.
Vornehmlich die Rechtsprechung behandelt die Zurechnungsfrage (außer bei Fahrlässigkeitsdelikten) als Vorsatzproblem.
Vgl. dazu z.B. die Übersichten bei Wessels-Beulke, AT, Rn. 176 ff oder sehr ausführlich Sch-Sch-Lenckner-Eisele, Vor §§ 13ff, 84ff.
Teilweise wendet man zur Lösung der Zurechnungsfrage die im Zivilrecht herrschende Adäquanztheorie an. Diese geht zunächst von der Äquivalenztheorie aus, schränkt deren weites Ergebnis aber dahingehend ein, dass nur solche Bedingungen als kausal anzusehen seien, die
nach allgemeiner Lebenserfahrung dazu geeignet sind, einen derartigen Erfolg zu bewirken.
Die Anhänger dieser Auffassung leugnen damit die Existenz eines eigenständigen Zurechnungskriteriums. Sie wollen die Frage der Zurechnung vielmehr als Kausalitätsproblem verstanden wissen.
Merken Sie:
Die Adäquanztheorie ist keine Zurechnungslehre,sondern eine Kausalitätstheorie
!! Daher ist die Adäquanztheorie im objektiven Tatbestand unter dem Prüfungspunkt „Kausalität“ zu erörtern !!
Nicht durchgesetzt hat sich die Relevanztheorie, nach der zunächst Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie zur kausalen Verknüpfung von Handlung und Erfolg erforderlich ist. Die Zurechnung soll dann aber anhand der normativen Frage nach der strafrechtlichen Relevanz des betreffenden Verhaltens zu prüfen sein. Nur wenn es sich um strafrechtlich relevantes Verhalten handele, sei der Erfolg zuzurechnen.
Demgegenüber fassen die im Einzelnen voneinander abweichenden Lehren von der objektiven Zurechnung die Zurechnungsfrage als eigenständiges, im objektiven Tatbestand anzusiedelndes Problem auf.
Merken Sie:
Die Zurechnungslehren sehen die Erfolgszurechnung als eigenständiges Merkmal des objektiven Tatbestands an
Die einzelnen Ansichten weisen allerdings diverse Unterschiede auf.
Vgl. dazu die Übersicht bei Sch-Sch-Lenckner-Eisele, Vor §§ 13, 84 ff
Sie lassen sich aber überwiegend auf den Grundgedanken zurückführen, dass ein durch menschliches Verhalten verursachter Unrechtserfolg nur dann objektiv zurechenbar sei, wenn durch den Täter
eine rechtlich relevante Gefahr des Erfolgseintritts geschaffen wurde und diese Gefahr sich auch tatsächlich in dem konkreten erfolgsverursachenden Geschehen realisiert habe.
So der in der Literatur überwiegende Ansatz vgl. dazu näher Lackner-Kühl, Vor § 13, 14; StuKo Joecks, Vor § 13, 35 ff; Wessels-Beulke, AT, Rn 179, jeweils m.w.N, sowie Diehn, Streitstände 1, Strafrecht AT, Streitstand 3.
Einschränkungen im Hinblick auf die Zurechnung können z.B. nach dem Schutzzweck der Norm geboten sein oder bei fehlendem Risikozusammenhang vorliegen.
Näher dazu: Sch-Sch-Lenckner-Eisele Vor § 13, 95/96
Bsp.: A fährt auf der Autobahn bei Hamburg statt der erlaubten 100 km/h mit 180 km/h. In Hannover läuft ihm Fußgänger F vor den Wagen, der dabei zu Tode kommt. Dort hatte sich A absolut korrekt verhalten. - Sinn der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn bei Hamburg soll es sein, die Autofahrer dort einzubremsen, aber nicht im Stadtgebiet von Hannover. Nach dem Schutzzweck der Norm (Geschwindigkeitsbegrenzung) ist dem A der Tod von F nicht zuzurechnen. Auch fehlt es am Risikozusammenhang, denn die rechtlich relevante Gefahr durch zu schnelles Fahren schlägt sich nicht beim Überfahren des F nieder.
Auch in Fällen des sog. erlaubten Risikos oder bei Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos wird man die Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr zu verneinen haben.
Vgl. dazu Wessels-Beulke, AT, Rn 183f.
Die objektive Zurechnung entfällt auch, wenn ein Dritter vollverantwortlich eine neue selbständig wirkende Gefahr begründet, die sich ohne Fortwirken der vom Täter gesetzten Gefahr im Erfolg realisiert.
Vgl. dazu und zu den Ausnahmen: Wessels-Beulke, AT, Rn 192.
Ob darüber hinaus auch bei Fällen der sog. Risikoverringerung die Zurechnung entfällt, ist umstritten.
Vgl. dazu Wessels-Beulke, AT, Rn 193ff; Sch-Sch-Lenckner-Eisele Vor §§ 13, 94.
Ebenso ist die Behandlung sog. Retterfälle str, vgl. Wessels-Beulke, AT, Rn 192a.
Bei Fahrlässigkeitsdelikten kann auch fehlender Pflichtwidrigkeitszusammenhang die objektive Zurechnung ausschließen.
Vgl. dazu Wessels-Beulke, AT, Rn 197ff.
Schließlich wird die Zurechnungsproblematik auch als Frage der Risikoerhöhung aufgefasst. Danach ist objektive Zurechenbarkeit bereits gegeben, wenn durch das Verhalten des Täters die Chance des Erfolgseintritts verglichen mit dem normalen Risiko des Erfolgseintritts erhöht wurde. Abweichende Ergebnisse ergeben sich bei diesem Ansatz vor allem bei Unterlassungsfällen im Hinblick auf die Behandlung der hypothetischen Kausalität.
Näheres bei Wessels-Beulke AT Rn 198.
Herkömmlicherweise (vor allem von der Rechtsprechung) wird die
Erfolgszurechnung als Vorsatzproblem
aufgefasst und unter dem Schlagwort der
Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf
abgehandelt. Es geht dabei um die Frage der Deckungsgleichheit (Kongruenz) zwischen vorgestelltem und tatsächlichem Kausalverlauf. Sofern beide nicht übereinstimmten und die Abweichung wesentlich sei, könne man den Erfolg dem Täter nicht zurechnen. Die Abweichung sei im Grundsatz stets dann wesentlich, wenn sie außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung Voraussehbaren liege.
Der Unterschied liegt also darin, dass die Rspr. es im objektiven Tatbestand bei der Anwendung der Äquivalenztheorie belässt, während die Literatur überwiegend bereits dort zusätzlich die Frage der Erfolgszurechnung erörtert.
Hinweis: Die Frage der Zurechnung bei Fahrlässigkeitsdelikten und Unterlassungsdelikten wird in den entsprechenden Kapiteln im Band 7 Strafrecht AT-2 behandelt.
Sie haben damit in diesem Kurs erstmals eine Stelle erreicht, in der zu einer Frage verschiedene Meinungen vertreten werden, ein sog. Streitstand.
EXKURS: Behandlung von Streitständen
Derartige Streitstände gibt es an (viel zu) vielen Stellen im Strafrecht und dort zu den verschiedensten Fragen. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist eine wesentliche Aufgabe während des weiteren Studiums, insbesondere bei der Anfertigung von Haus- Seminar- und (ggf.) Examensarbeiten. Ein solcher Streitstand bedarf dort, aber auch in einer Klausur, einer ganz bestimmten Aufbereitung, Verarbeitung und Darstellung.
Es gilt zunächst, die verschiedenen Ansichten herauszuarbeiten und deren Inhalt und Aussage in kurzer, präziser Form zu skizzieren. Diese Übersicht muss sodann in den Fall aufgenommen, in ihm verarbeitet werden. Dazu ist wie folgt zu verfahren:
1. Schritt:
Man hat nach der Feststellung, dass an dieser Stelle im Gutachten ein Streit besteht, zunächst die erste Ansicht in ihren wesentlichsten Zügen darzustellen.
2. Schritt:
Diese ist dann auf den Fall anzuwenden und festzustellen, was sich als konkretes Ergebnis dabei ergibt.
Danach stellt man die zweite Ansicht entsprechend dar und erarbeitet wiederum, welches Ergebnis man mit diesem Ansatz erhielte. Gleiches gilt dann für die dritte Ansicht usw. Sie erhalten so eine Reihe von Ergebnissen.
3. Schritt (sog. Relevanzprüfung):
Stellen Sie fest, ob diese Ergebnisse übereinstimmen oder nicht. Liegt Übereinstimmung vor, so können Sie für die weitere Lösung von diesem einheitlichen Ergebnis ausgehen. Sie dürfen!! dann den Streit nicht entscheiden, weil er keine Auswirkung auf das Ergebnis hat, also irrelevant ist.
Eine Entscheidung wäre hier folglich nicht nur überflüssig, sondern nach Gutachtensregeln sogar falsch!
4. Schritt:
Stimmen dagegen die Ergebnisse nicht überein, ist der Streit zu entscheiden.
Die Streitentscheidung erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den Argumenten, die für und gegen die verschiedenen Meinungen ins Feld geführt werden. Die Studierenden sollen dabei zeigen, dass sie abwägen, argumentieren und auch eigene Gesichtspunkte in die Waagschale werfen können. Schließlich ist aus den dargestellten Argumenten (in logisch schlüssiger Weise) eine Entscheidung zu folgern und so das Ergebnis festzustellen.
Weichen die Ansichten nur teilweise voneinander ab, so ist es zumindest sinnvoll, den Streit nur soweit zu entscheiden, bis die verbleibenden Ansichten übereinstimmen.
Bsp.: Meinung 1 sagt (+); Meinungen 2 und 3 auch; Meinung 4 sagt (-). - Zulässig ist es, nur darzulegen, weshalb der Meinung 4 nicht zu folgen ist. Da die anderen Ansichten alle zum gleichen Ergebnis gelangen, braucht der Streit nicht weiter entschieden zu werden.
Für den Streit bezüglich der Zurechnung ergibt sich nun jedoch noch ein weiteres Problem, nämlich, an welcher Stelle er in einem Gutachten zu behandeln ist, da die verschiedenen Ansichten an völlig unterschiedlichen Stufen im Deliktsaufbau anzusiedeln sind. Da der Streit frühestens relevant wird, nachdem man festgestellt hat, dass Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie vorliegt, ist es m.E. empfehlenswert, daran anschließend den Streit zu behandeln. Dass dies in Bezug auf die Ansicht, die die Zurechnung im Vorsatzbereich behandeln will, systemwidrig ist, sollte man dabei in Kauf nehmen.
Ebenso systemwidrig wäre es jedoch andererseits, erst im subj. Tatbestand den Streit zu behandeln, müsste man doch z.B. die Lehre von der objektiven Zurechnung, die dem objektiven Tatbestand zuzurechnen ist, dann im subjektiven Tatbestand abhandeln.
Welchem Aufbau Sie folgen sollten, darf in Ihrer Arbeit nicht diskutiert werden.
Folgen Sie tunlichst der an Ihrer Uni üblichen Praxis!
Ein weiteres Problem ist, inwieweit, also wie detailliert, auf diesen Streit in einer Klausur einzugehen ist. In der Anfängerübung ist es m.E. ausreichend, die Äquivalenztheorie, die zusammengefasste Lehre von der objektiven Zurechnung und die Lösung über die Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf darzulegen.
Fall 2:
A schießt auf B, der verletzt zusammenbricht. Er wird mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert. Unterwegs verunglückt der Krankenwagen. Bei dem Unfall wird B tödlich verletzt. Strafbarkeit des A?
Lösungsvorschlag
A könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er B niederschoss.
Der Taterfolg ist mit dem Tod des B, eines anderen Menschen, eingetreten.
Weiter ist Kausalität zwischen diesem Erfolg und der Tathandlung, dem Niederschießen, erforderlich. Grundsätzlich bestimmt man die Kausalität im Strafrecht nach der Äquivalenztheorie. Danach ist jede Bedingung Ursache, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Denkt man sich das Schießen weg, wäre B nicht mit dem Krankenwagen abtransportiert und bei dem Unfall nicht tödlich verletzt worden. Mithin entfiele der Erfolg, so dass Kausalität nach der Äquivalenztheorie vorliegt.
Fraglich bleibt, ob dieser von A verursachte Erfolg ihm auch rechtlich zuzurechnen ist. Die Frage der Erfolgszurechnung ist stark umstritten.
Die Anhänger der Adäquanztheorie sehen die Frage der Erfolgszurechnung als Kausalitätsproblem an, indem sie die Zurechnungsgesichtspunkte als Teil der Kausalität begreifen. Sie leugnen damit die Existenz einer selbständigen Zurechnungsfrage. Kausalität liege danach vor, wenn es bei einer solchen Tathandlung nicht außerhalb aller Lebenswahrscheinlichkeit liege, dass ein derartiger Erfolg eintrete.
Da es in der Vergangenheit durchaus schon zu Unfällen von Krankenwagen während ihrer Einsatzfahrten kam und der Straßenverkehr stets ein immanentes Unfallrisiko birgt, das auch durch eingeschaltetes Blaulicht und Horn nicht völlig ausgeschlossen werden kann, wird man einen Unfall auf dem Transport jedenfalls nicht als außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit liegend ansehen können.
Dabei ist es wiederum nicht völlig ungewöhnlich, dass ein Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen erleidet. Kausalität (und damit Erfolgszurechnung) nach der Adäquanztheorie liegt also vor (andere Ansicht gut vertretbar).
Überwiegend wird demgegenüber die Zurechnung als Vorsatzproblem aufgefasst, sog. Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf. Weicht der subjektiv vorgestellte vom objektiv gegebenen Kausalverlauf erheblich ab, fehle es an der Kongruenz zwischen objektiver und subjektiver Tatseite, so dass eine Erfolgszurechnung ausscheide. Während sich A vorgestellt haben wird, dass der B durch den Schuss zu Tode kommen würde, geschah dies durch einen Unfall. Die damit vorliegende Abweichung wäre dann als erheblich anzusehen, wenn es außerhalb aller Lebenswahrscheinlichkeit läge, dass bei dieser Handlung der Tod derart eintritt. Das ist nicht der Fall, siehe oben. Mithin liegt keine erhebliche Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf vor, der Erfolg ist A zuzurechnen (auch hier andere Ansicht gut vertretbar).
Wieder anders behandeln die Lehren von der objektiven Zurechnung die Frage der Erfolgszurechnung. Nachdem man Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie festgestellt hat, sei zunächst zu fragen, ob der Täter ein rechtlich relevantes Risiko geschaffen habe. Auf jemanden zu schießen, schafft stets das Risiko für das Opfer, zu Tode zu kommen. Da dies auch rechtlich keine Billigung zu erlangen vermag, liegt ein rechtlich relevantes Risiko und damit diese Voraussetzung vor. Weiter müsse sich gerade dieses Risiko in dem konkreten Erfolg realisiert haben. Hier hat sich das jeder Verletzung innewohnende, nicht unwahrscheinliche Risiko realisiert, auf dem Krankentransport in einen Unfall verwickelt zu werden und dabei zu sterben. Dieses Verkehrsrisiko ist nicht untypische Folge schwerer Verletzungen, so dass eine Risikorealisierung im Sinn dieser Ansicht angenommen werden kann (andere Ansicht gut vertretbar). Auch nach dieser Meinung ist A somit der Erfolg zuzurechnen.
Folglich ist hier nach allen Ansichten A der Todeserfolg zuzurechnen, so dass eine Streitentscheidung entbehrlich ist.
Subjektiv ist Vorsatz bezüglich Tathandlung und Taterfolg erforderlich. Da A sowohl den den Tod verursachenden Schuss vornehmen wollte, als auch den Erfolg erstrebte, ist Vorsatz unproblematisch zu bejahen.
Rechtswidrigkeit und Schuld sind gegeben.
A hat sich somit gem. § 212 strafbar gemacht.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ersatzursachen
Nach der Äquivalenztheorie sind, wie oben gesehen, die zu untersuchenden Handlungen hinweg zu denken. Dabei ist jedoch streng darauf zu achten, dass man nicht an die Stelle der weggedachten Handlung eine Ersatzursache hinzudenkt.
Fall 3:
X schlägt mit einem Knüppel auf Y ein, um ihn zu töten. Er wird noch drei Schläge benötigen, um die Verletzungen des Y so schwer werden zu lassen, dass Y zu Tode kommen würde. Da tritt Q hinzu und erschießt Y. Strafbarkeit von X und Q gem. § 212?
Lösungsvorschlag
1. Teil: Strafbarkeit des Q
Bei mehreren Beteiligten ist grundsätzlich vorab gedanklich die Frage zu klären, mit welchem Beteiligten man die Prüfung beginnt. Diese Überlegung wird jedoch nicht in das Gutachten übernommen. Es lassen sich wenige allgemein gültige Regeln dazu aufstellen: Bei Teilnahme des einen an Taten des anderen ist stets zuerst der Haupttäter zu prüfen. Bei mehreren Tätern oder Teilnehmern ist ansonsten mit dem Tatnächsten zu beginnen. Im Übrigen können logische Abhängigkeiten der Prüfungen voneinander sowie Zweckmäßigkeit (Problemkonzentration, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit etc.) den Aufbau bestimmen. In Fällen wie dem vorliegenden gibt es keinen Grund, der eine Prüfung des einen oder des anderen Beteiligten vor dem jeweils anderen zwingend erfordern würde. Sie können also ebenso gut mit X beginnen.
Q könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er auf Y schoss.
Der Taterfolg ist mit dem Tod des Y, eines anderen Menschen, eingetreten.
Weiter erforderlich ist Kausalität der Handlung des Q für den Todeserfolg. Nach der Äquivalenztheorie darf der Schuss nicht hinweg zu denken sein, ohne dass der Tod des Y entfiele. Hätte Q nicht geschossen, so lebte Y noch. Zwar hätte ihn dann der X mit drei weiteren Schlägen erschlagen, das wäre jedoch ein unzulässiges Hinzudenken von Ersatzursachen, das mit der Äquivalenztheorie nicht vereinbar ist. Man hat vielmehr gedanklich an dem Punkte zu verharren, an dem man die betreffende Handlung hinweg denkt. Dies wäre hier der Zeitpunkt des Schusses. Also entfiele im vorliegenden Fall der Erfolg, Kausalität ist mithin zu bejahen und der objektive Tatbestand somit erfüllt.
Vorsatz, Rechtswidrigkeit und Schuld sind gegeben.
Q hat sich gem. § 212 strafbar gemacht.
2. Teil: Strafbarkeit des X
X könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er auf Y einschlug.
Fraglich ist, ob X den Taterfolg, den Tod des Y, verursacht hat. Denkt man sich die Schläge des X hinweg, so entfiele der tödliche Schuss des Q und damit der Taterfolg dennoch nicht. Dafür, dass Q den Y ohne die Schläge des X gar nicht angetroffen hätte, gibt der Sachverhalt nicht genügend Anhaltspunkte, so dass deshalb nicht vom Wegfall des Erfolges ohne das Handeln des X auszugehen ist. X hat sich mithin nicht gem. § 212 strafbar gemacht.
Die Frage einer anderweitigen strafrechtlichen Verantwortung des X ist nach der Fallfrage nicht mehr zu erarbeiten.
Der Vollständigkeit halber sei jedoch darauf hingewiesen, dass X sich gem. §§ 223, 224 und §§ 212, 22 strafbar gemacht hat. - Wäre der Sachverhalt so gebildet, dass Q die Situation, die X durch seine Schläge geschaffen hat, ausnutzt, wäre Ursächlichkeit der Schläge des X für den Tod des Y gegeben. Bei der dann zu prüfenden Zurechnung wird man aber nicht annehmen können, dass sich das typische Risiko bei einer Prügelei realisiert, wenn man durch einen völlig außerhalb des Geschehens stehenden Dritten unter Ausnutzung der Situation erschossen wird.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Abbruch rettender Kausalverläufe
Bei der Anwendung der Äquivalenztheorie auf Fälle, in denen eine Kausalkette, die zur Rettung des Opfers weiterführen würde, von einem Dritten unterbrochen wird, entstehen Schwierigkeiten. Exakt käme man dazu, dass sich das Opfer nach wie vor in einer Lage zwischen Leben und Tod befindet. Die Entscheidung, ob der (z.B.) Todeserfolg entfiele oder nicht, wäre nicht getroffen. In Fällen des sog. Abbruchs rettender Kausalverläufe besteht nun jedoch Einigkeit darüber, dass ein
Hinzudenken des rettenden Kausalverlaufes
zulässig ist, also, dass der Helfer das Opfer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet hätte.
Fall 4:
Bergsteiger B hängt in einer Felswand und droht abzustürzen. C will ein Seil holen und ihn retten. Da tritt A, ein Feind des B, auf C zu und hält diesen fest. B stürzt zu Tode. Strafbarkeit des A?
Lösungsvorschlag
A könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er den C festhielt.
Der Taterfolg des § 212 ist mit dem Tod des B, eines anderen Menschen, eingetreten. Fraglich ist jedoch, ob A diesen Erfolg verursacht hat. Denkt man sich sein Verhalten, das Festhalten des C, hinweg, so hinge der B nach wie vor in der Wand. Dass B gerettet worden wäre, lässt sich jedoch nur dann folgern, wenn man hinzudenkt, C hätte das Seil geholt und ihn hinauf gezogen.
Es besteht nun aber Einigkeit, dass ein Hinzudenken derartiger rettender Kausalverläufe mit der Äquivalenztheorie vereinbar ist. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass nach aller Wahrscheinlichkeit der C den B hier gerettet hätte. Mithin entfiele der Erfolg ohne die schädigende Handlung des A, also ist Kausalität zu bejahen und mangels anderer Angaben ist dieser Erfolg A auch zuzurechnen.
Vorsatz, Rechtswidrigkeit und Schuld sind gegeben.
Demnach hat sich A gem. § 212 strafbar gemacht.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Fälle der Doppelkausalität
Als Fälle sog. Doppelkausalität werden solche bezeichnet, in denen unabhängig voneinander zwei Ursachen wirken, die gleichzeitig denselben Erfolg herbeiführen, wobei jede der Ursachen für sich allein ausgereicht hätte, den Erfolg herbei zu führen.
Bsp.: A läuft jeden Samstag durch den Wald. Seine Frau pflegt ihm zu seiner Rückkehr in einem Glas ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse bereitzustellen. X schleicht sich an das Glas und schüttet eine tödliche Menge von einem Gramm Zyankali ins Glas. 10 Minuten später tut Y das gleiche, da er von der Tat des X nichts weiß. Nachdem sich das Gift aufgelöst hat, nimmt A seinen Erfrischungstrunk und stirbt sofort. - Auch diese Fälle lassen sich durch sachgerechte Anwendung der Äquivalenztheorie lösen. Bis zum Tod des A wirken nämlich beide Giftmengen zusammen auf den Körper des A ein. Dieser resorbiert das Gift beider Täter bis zur tödlichen Grenzmenge und dies ist der Zeitpunkt, den es mit der Conditio-Formel zu untersuchen gilt. Denkt man sich dort das Gift des einen Täters weg, so würde das verbleibende, resorbierte Gift des anderen unter der tödlichen Grenzmenge liegen. Folglich entfiele der Erfolg. Dass das im Glas verbliebene Gift auch noch resorbiert worden wäre und somit später ebenfalls den Tod bewirkt hätte, ist eine sog. Ersatzursache, deren Hinzudenken unzulässig ist. Somit gelangt man zum richtigen Ergebnis, dass sowohl X wie Y für den Tod des A kausal wurden.
Es bedarf also nicht der verschiedentlich in diesen Fällen behaupteten Modifizierung der Äquivalenztheorie!(unzutreffend daher z.B. Wessels-Beulke AT, Rn 157).
Überholende Kausalität
Damit beschreibt man Fälle, in denen ein Kausalverlauf angelegt ist, der einen bestimmten Erfolg herbeiführen würde. Nun tritt eine neue Ursache ein, die die Fortwirkung der vorherigen Bedingung vollkommen beseitigt und unabhängig von ihr den gleichen Erfolg herbeiführt.
Bsp.: Patient P stirbt am ärztlichen Kunstfehler. Er wäre ohnehin eine halbe Stunde später an einer verdorbenen Blutkonserve gestorben.
Da es auf den Erfolg in seiner konkreten Gestalt ankommt, gelangt man unter Anwendung der Conditio-Formel zum Ergebnis, dass ein Hinwegdenken des Kunstfehlers zum Fortfall des Todes durch Kunstfehler führen würde. Der Tod durch eine verdorbene Blutkonserve weist eine andere Gestalt auf und darf daher nicht zur Untersuchung der Kausalität in Betracht gezogen werden.
Alternative Kausalität
Alternative Kausalität bezeichnet Fälle, in denen zwei oder mehrere Kausalverläufe angelegt sind, die alle zum Erfolg führen würden, aber nur allein einer davon den Erfolg verursacht.
Bsp.: A läuft jeden Samstag durch den Wald. Seine Frau pflegt ihm bei der Rückkehr in einem Glas ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse bereitzustellen. X schleicht sich an das Glas und schüttet eine tödliche Menge von dem Gift 1 ins Glas. 10 Minuten später tut Y das gleiche, da er von der Tat des X nichts weiß. Jedoch verwendet er das Gift 2, das anders als Gift 1 erst nach Stunden seine tödliche Wirkung entfaltet. A nimmt seinen Erfrischungstrunk und stirbt sofort. - Bis zum Tod des A wirkt hier allein das Gift 1 auf den Körper des A ein. Dieser resorbiert daher nur das Gift von X bis zur tödlichen Grenzmenge und dies ist der Zeitpunkt, den es mit der Conditio-Formel zu untersuchen gilt. Denkt man sich dort das Gift des X weg so entfiele der Erfolg – dass der Tod dennoch durch das Gift des Y eintreten würde, bleibt als unbeachtliche Ersatzursache ohne Bedeutung. Denkt man sich dagegen das Gift des Y weg, so würde das Gift des X dennoch tödlich gewirkt haben. Daher entfiele der Erfolg nicht, also gelangt man zum Ergebnis, dass zwar X, nicht aber Y für den konkreten Tod des A kausal wurde - bei Y bleibt es bei einer versuchten Tat.
Hinweis: die Bezeichnungen Doppelkausalität und Alternative Kausalität werden nicht überall in gleicher Weise verwendet! So werden z.T. beide Fälle gleichgestellt.
Kumulative Kausalität
Kumulative Kausalität bezeichnet Fälle in denen mehrere unabhängig voneinander gesetzte Ursachen erst in ihrem Zusammenwirken gleichzeitig den Erfolg herbeiführen.
Bsp.: A läuft jeden Samstag durch den Wald. Seine Frau pflegt ihm zu seiner Rückkehr in einem Glas ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse bereitzustellen. X schleicht sich an das Glas und schüttet eine für sich nicht tödliche Menge Gift ins Glas. 5 Minuten später tut Y das gleiche, da er von der Tat des X nichts weiß. Nachdem sich das Gift aufgelöst hat, nimmt A seinen Erfrischungstrunk und stirbt sofort, da beide Gifte zusammen tödlich wirken. - Bis zum Tod des A wirken beide Giftmengen zusammen auf den Körper des A ein. Dieser resorbiert das Gift beider Täter bis zur tödlichen Grenzmenge und dies ist der Zeitpunkt, den es mit der Conditio-Formel zu untersuchen gilt. Denkt man sich dort das Gift des einen Täters weg, so würde das verbleibende, resorbierte Gift des anderen unter der tödlichen Grenzmenge liegen. Folglich entfiele der Erfolg. Somit gelangt man zum richtigen Ergebnis, dass sowohl X wie Y für den Tod des A kausal wurden.
Wiederholungsfragen zum 1. und 2. Kapitel
32 Fragen
(Um die Antwort zur jeweiligen Frage zu erhalten, blättern Sie eine Seite vor.)