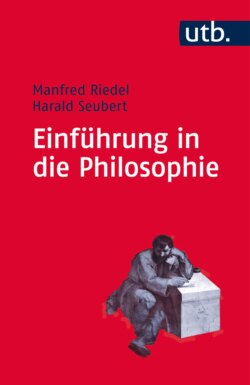Читать книгу Einführung in die Philosophie - Harald Seubert - Страница 8
Einleitung
Оглавлениеvon Manfred Riedel
Diese Vorlesung führt nicht in die Philosophie ein, sie soll zur Philosophie hinführen. Der Titel müsste genauer heißen: Hinführung zu den Grundfragen der Philosophie. Denn die Philosophie ist kein Fach wie andere Fächer, in die man jemanden „einführt“, indem man ihn mit den Grundlagen, den Arbeitsweisen, den in Lehrbüchern festgehaltenen Ergebnissen des betreffenden Faches vertraut macht. Denken Sie etwa an eine Einführungsvorlesung in die Geschichtswissenschaft, in die politische Wissenschaft, in die Sozialpsychologie oder an die Einführungskurse in die verschiedenen Gebiete der Medizin, der Chemie, der Physik usw. „Einführen“ heißt: Jemanden mit etwas vertraut machen, was ein anderer weiß. Ich führe jemanden in eine Gesellschaft ein, das will sagen: Ich mache ihn mit den mir bekannten Personen der betreffenden Gesellschaft vertraut, ich stelle ihn vor. Ich führe in ein Fach ein, das will dann sagen: Als Fachmann mache ich jemanden, der mit dem Fach noch nicht vertraut ist, mit den fachlichen Grundlagen, dem Gegenstand der betreffenden Wissenschaft, den allgemein anerkannten und bewährten Methoden, den Arbeitsweisen und Arbeitszielen vertraut, ich stelle das Fach vor. Lässt sich das, was Philosophie heißt, vorstellen – so vorstellen, wie wir Personen oder Sachen präsentieren? Ist sie ein Fach unter Fächern, deren Methoden und Ergebnisse bekannt und allgemein anerkannt sind? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Philosophie hat weder einen bestimmten Gegenstand noch eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Ziel, auf das alle Philosophen verpflichtet sind. Sie bleibt ein Fragen, das über jedes Ergebnis schon hinweggesprungen ist. Sie ist, so scheint es, überhaupt keine Wissenschaft. Wenn sich das so verhält, dann erhebt sich gleich zu Anfang die Frage: Was ist das – die Philosophie? Wenn sie nicht, wie andere [<<11] Fächer, einen bestimmten Gegenstand, bestimmte Methoden und ein bestimmtes Ziel hat, was ist dann ihre Sache?
Die Möglichkeit einer Antwort auf die Wozu-Frage scheint mir aus sachlichen Gründen begrenzt zu sein. Das folgt gewissermaßen aus der Grammatik der Frage, die zuerst der Klärung bedarf. Jede Frage motiviert sich durch eine bestimmte Fragesituation und enthält implizit Voraussetzungen, die ihrerseits bestimmte Antworten implizieren. Wozu-Fragen sind uns aus dem Alltagsleben vertraut. Sie werden gewöhnlich damit beantwortet, dass man entweder den Zweck von etwas angibt, was man tut, oder das Tun als Mittel versteht, um einen Zweck zu erreichen. Wir wollen diese Art von Fragen teleologische Fragen nennen. Danach ist Philosophieren ein Handeln, das grundsätzlich durch Vorerwartungen seiner Relevanz und unter Benutzung dieser Erwartung als Bedingung oder Mittel für rational erstrebte Zwecke oder Zweckzusammenhänge bestimmt ist.
Teleologische Fragen und Vorerwartungen einer Zweck-Mittel-Rationalität gibt es nicht erst seit heute. Wir begegnen ihnen im ältesten Anfang der Philosophie. Nach der Legende soll Thales, der zuerst hinter dem Wechsel des Vielen Einheit gewahrt und diese ins Wasser gesetzt hatte, statt Wasser zu schöpfen, in den Brunnen gefallen sein. Thales war Geometer und Astronom, der alles, was in den Tiefen der Erde und in der Höhe des Himmels ist, gemessen und dabei das Nächstliegende übersehen hat. Um Thales’ Gestalt rankt sich jedoch neben der Geschichte vom Brunnenfall und dem daran anschließenden Gelächter der Wasser holenden Magd eine weitere Legende: Er soll, von Bürgern seiner Vaterstadt mit der Nachrede provoziert, seine Armut beweise die Praxisferne der Philosophie, unter zweckrationaler Einsetzung astronomischer und ökonomischer Daten eine gute Olivenernte vorausgesehen, alle Ölpressen in Milet gemietet und durch Weitervermietung in der Erntezeit ein schwerreicher Mann geworden sein. Aristoteles, der diese Geschichte erzählt, fügt hinzu: Thales habe damit gezeigt, wie leicht den Philosophen der Gegenbeweis fällt, dass dies aber eben nicht Sache der Philosophie sei (Politik I 11, 1259a 5–8). Dies ist eine frühe Apologie – eine Verteidigung der Philosophie gegenüber der Ignoranz der Welt. Mit seiner großen ‚Apologie‘ wird Sokrates sich gegenüber der Bürgerschaft von Athen als Philosoph erweisen. [<<12]
Apologien dieser Art entspringen Fragen, die dem Philosophieren von außen gestellt und nach außen hin beantwortet werden. Wir könnten hier auch von pragmatischen Fragen sprechen. Obwohl sie seinen Gang von Anbeginn begleiten, treten sie innerhalb der Philosophie erst dann auf, wenn sie ihre Sache verfehlt oder sich zum Schuldogma verfestigt haben. In unserem Kulturkreis – die asiatischen Hochkulturen kennen ähnliche Erscheinungen – geschieht dies in den spätantiken Philosophenzirkeln, die das Christentum auflöst, in der Schulphilosophie der frühen Neuzeit, die sich dem geschichtlich neuartigen Typ der Erfahrungswissenschaften verschließt, und schließlich – mutatis mutandis – nach der spekulativen Erschöpfung der antik-christlichen Lehrtradition in Hegels Philosophie. Was das „Ziel“ und der „Zweck“ der Philosophie sei, – dies ist die Frage der griechisch-römischen Denker von Epikur bis Seneca an Platon und Aristoteles, der Märtyrer und Väter des frühen Christentums von Justin bis Augustin an die antiken Philosophenschulen, von Galilei und Bacon an die Scholastik, von Marx an Hegel, von Wittgenstein an Russel. Und die Antwort lautet: das Wohl der Seele, die Eudämonie des Einzelnen statt bloßer Theorie (so bei Epikur), der Glaube statt eudämonistischer Seelentechnik (so bei Augustin), Beherrschung der Natur statt bloßer Glaubenslehre (so bei Bacon), Weltveränderung statt Interpretation der Welt.
Mit der Hegel-Kritik von Marx wechselt freilich die Grammatik der Wozu-Frage den semantischen Kontext. Aus der 11. These über Feuerbach – „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern“ – hat Marx bekanntlich weiter gefolgert, dass Philosophie als universalhermeneutische Vernunftinterpretation im Sinne Hegels abgeschlossen und vollendet, ihr Anspruch einer vernünftig geordneten Welt aber erst noch praktisch zu verwirklichen sei. Weltveränderung, der Zweck von Wissenschaft und Industrie, setzt nicht mehr philosophische Theorie, sondern revolutionäre Politik und Sozialwissenschaft – die Kritik der politischen Ökonomie – voraus.
Marx’ Folgerung ist, makrohistorisch gesehen, eine Variante des ursprünglich positivistischen Geschichts- und Wissenschaftsbegriffs, wonach Philosophie den Mythos ablöst, bis sie ihrerseits durch Wissenschaft überwunden wird. Dem folgt Auguste Comtes Dreistadienlehre [<<13] mit der Aufeinanderfolge von mythischem – metaphysischem (also philosophischem) – und wissenschaftlichem Denken. Positivistische wie dialektische Geschichtsphilosophie – auf die Unterschiede gehe ich nicht näher ein – sind dabei nicht nur an pragmatischen Zweckbegriffen, sondern am Begriff von einem Endzweck im Sinne eines „Äußersten“ und „Letzten“ orientiert. Indem sie behaupten, dass Philosophie im Anderen der Wissenschaft und der ihr zugehörigen Gesellschaft sich aufhebt, verkünden sie das zeitliche Ende der Philosophie. Ihr Ende, so erläutert der späte Martin Heidegger, ein Denker, der sich selbst nicht mehr als Philosoph versteht, „zeigt sich als der Triumph der steuerbaren Einrichtung einer wissenschaftlich-technischen Welt und der dieser Welt gemäßen Gesellschaftsordnung. Ende der Philosophie heißt: Beginn der im abendländisch-europäischen Denken gegründeten Weltzivilisation.“1
Wir untersuchen zunächst nicht den sachlichen Kern dieser historischen Aussage, sondern fragen: Was ist eigentlich sprachlich gemeint, wenn von einer Sache behauptet wird, sie gehe zu Ende? In der Umgangssprache heißt „Ende“ nicht nur so viel wie „Aufhören“ und „Verschwinden“, sondern „Ort“. Von einem Ende zum anderen gehen heißt: der Gang von einem Ort zum andern. Wer von einem Ende der Stadt zum anderen geht, bleibt damit noch innerhalb derselben Stadt, wer in fremde Länder reist, verlässt damit noch nicht den Erdball. Obwohl sich auch Heidegger auf diesen Sprachgebrauch ausdrücklich bezieht, spricht er dem Wort „Ende“ im Sinne von „Ort“ eine andere („a-topische“) Bedeutung zu. Die Rede vom „Ende der Philosophie“ bezeichnet nach Heidegger einen „letzten Ort“, nämlich „dasjenige, worin sich das Ganze ihrer Geschichte in seine äußerste Möglichkeit versammelt“, die „Vollendung“ der Philosophie durch „Aufhebung“ in einem Anderen ihrer selbst. Wir können hier von einer dysteleologischen Bedeutung sprechen. In diesem Kontext – und nur in ihm – gewinnt die teleologische Frage die durch Enderwartung verschärfte Fassung: wozu noch Philosophie? [<<14]
Es ist die Frage, die während der Sechzigerjahre neben dem Denker der Seinsgeschichte vor allem die kritische Theorie, das Denken von Adorno und danach von Habermas in Bewegung gehalten hat. Wer so fragt, setzt den Satz vom „Ende der Philosophie“ voraus; er geht davon aus, dass im Zeitalter der Wissenschaft und Industrie die Zeit des Philosophierens abgelaufen und vorbei ist. Philosophie, so heißt es dialektisch-negativ beim späten Adorno, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Die Philosophie, sagt Heidegger, endet im gegenwärtigen Zeitalter. Sie hat ihren Ort in der Wissenschaftlichkeit des gesellschaftlich handelnden Menschen gefunden. Die parallelen Antworten der Antipoden deutscher Nachkriegsphilosophie überschneiden sich im Verzicht auf apologetische Rede. Sie gebrauchen dafür Sprechweisen der Eschatologie. Lässt sich, was Philosophie ist, in einem Augenblick verwirklichen?
„Eschatologie“ ist nach theologischem Sprachgebrauch die Lehre von den „letzten Dingen“ – von der großen Katastrophe, die, wenn sie „radikal“ oder die „letzte“ ist, Philosophie mit einschließt. Gott hält Gericht über seine Geschöpfe. Die Schöpfung wird zertrümmert, ein neuer Himmel, eine neue Erde geschaffen. Die Katastrophe ist die Vorstufe zum Heil. Auch die Philosophie ist eine Lehre von den letzten Dingen, nämlich die theoretische Beschäftigung mit den letztlich grundlegenden Dingen, die dem Menschen zu wissen möglich sind. Aber die These der Philosophie lautet: Von diesem Wissen müssen wir uns theoretisch Rechenschaft geben können, wir müssen den Grund seiner Möglichkeit untersuchen. Die Rede vom „Letzten“ ist Denkern, wenn sie nur radikal genug, das heißt Philosophen sind, die diesen Namen verdienen, nicht fremd. Radikale mögen, frei nach Marx, Leute heißen, die eine Sache an der Wurzel fassen, und die Wurzel – das ist für Philosophen die Möglichkeit des Begreifens, „der Begriff“. Philosophisch radikal sein heißt, jede Behauptung, eschatologische Rede nicht ausgenommen, auf ihre Begreiflichkeit hin überprüfen. Zu fragen wäre demnach: Wie kann man es wissen, dass Philosophie mit dem Übergang zur Moderne untergeht? Oder anders ausgedrückt: Wie ist eine Geschichte a priori möglich? Wenn ich es richtig sehe: durch Geschichtsphilosophie, indem man eine selber philosophische These aufstellt, die These vom Ende der Philosophie, [<<15] oder das Diktum Adornos, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barbarisch. Was besagt aber diese These? Oder mit Kant weitergefragt: Was will man hier eigentlich wissen, wenn man das zeitliche Ende der Philosophie prophezeit? Offensichtlich genügt es nicht zu wissen, ob diese oder jene Zeit des Philosophierens abgeschlossen und vollendet, dass Philosophie in ein „Anderes“ ihrer selbst umgeschlagen ist. Wir wollen wissen, ob es zum Begriff der Philosophie gehört, je in der Zeit zu enden oder sich in anderer Gestalt, in Wissenschaft und Technik, in Kunst, Religion und Politik zu erfüllen.
Fragen vom Typ: „Was ist Philosophie?“ sind zweideutig. Sie können einmal besagen: Welche Klasse von Personen bzw. Sätzen benennt das Wort „Philosophie“ – eine wiederum zweideutige Frage, die zweierlei meinen kann; 1. wie es traditionell gebraucht wird, etwa bei Platon oder Kant, bei Heidegger oder Popper, deren Wortgebrauch wir untersuchen und begriffsgeschichtlich vergleichen müssten; 2. kann die Frage meinen, welchen Wortgebrauch wir selbst vorschlagen, und das ist zuletzt eine Definitionsfrage, eine Frage der Festsetzung, die uns erlaubt, „Philosophie“ als „Wissenschaftstheorie“ zu definieren. Aber mit gleichem Recht kann dann der Wissenschaftstheoretiker behaupten: Alles dasjenige, was nicht Theorie der Wissenschaft sei, ist „Mystik“ oder Begriffsdichtung oder Okkultismus. Gleichzeitig weist die Was-ist-Frage über rein terminologische Festsetzungen wie über Begriffsgeschichten hinaus. Wenn wir etwa fragen, was die Zeit oder was der Mensch ist, dann wollen wir nicht wissen, was das Wort „Zeit“ und das Wort „Mensch“ heißt; wir verlangen vielmehr nach Sachkenntnis. Wer so fragt, will also etwas über die Sache wissen, mit der es der Philosophierende zu tun hat. Die These dieser Vorlesung lautet: Die Sache der Philosophie, das sind nicht irgendwelche vorstellbaren Gegenstände, keine Ergebnisse, sondern Aporien, – die Aporien, in die wir geraten, wenn wir die letztlich grundlegenden Fragen stellen, danach, was die Zeit ist oder wer wir selbst sind, die wir in der Zeit leben, einen Anfang und ein Ende haben. „Aporie“, ein griechischer Ausdruck für „Not“ und „Mangel“, bedeutet vorphilosophisch die Bedrängnis desjenigen, der unterwegs ist, die Not eines Reisenden, dem auf der Fahrt durch schwieriges Gelände plötzlich der Weg versperrt ist, daneben auch die Notlage desjenigen, [<<16] der bei der Verteilung von Gütern ausgeschlossen wird oder sonst in irgendeiner Weise zu kurz kommt. In dem Sinn, in dem wir hier das Wort zur Bezeichnung der Sache der Philosophie verwenden wollen, bedeutet „Aporie“ zweierlei: erstens die Verlegenheit, die uns dann überfällt, wenn wir nach den letztlich grundlegenden Dingen fragen, wenn wir an eine Grenze treffen, an der wir nicht weiterkommen, und zweitens den Inbegriff der logischen und hermeneutischen Schwierigkeiten, die uns bei der theoretischen Beschäftigung mit den letztlich grundlegenden Dingen erwachsen, insbesondere dann, wenn die Schwierigkeiten nicht nur als die Erfahrung der Grenze, sondern in der Form des Widerspruchs auftreten. In diesem Falle sprechen wir auch von „Antinomie“. Philosophie, so wollen wir als Erstes festhalten, ist keine Lehre, kein lehr- und lernbarer Bestand von Sätzen und Methoden, sondern die Tätigkeit des Philosophierens. Philosophieren – was immer das heißen mag – ist zunächst und zuerst Fragen-Können, und zwar radikales, an die Wurzel gehendes Fragen.
Hier geschieht etwas sehr Merkwürdiges, nämlich dies, dass sich die Aporie im Doppelsinn der Verlegenheit und logisch-hermeneutischen Schwierigkeit wie von selbst einstellt. Wir brauchen sie nicht zu suchen, sie ist immer schon da, nur wissen wir das nicht, solange wir nicht philosophieren. Ich verdeutliche das an einem Text von Augustin, der den Begriff der Zeit erörtert – radikal, nämlich im Ausgang von einer an den Gottesbegriff der christlichen Theologie gerichteten Frage: Was tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf?2
Das Wissen des Nicht-Wissens in der Bewegung des radikalen Fragens, dass wir auf einmal nicht mehr wissen, was das Wort „Zeit“ bedeutet, dies und nichts anderes, so behaupte ich, ist der Anfang des Philosophierens. Wer philosophiert, ist von dem, was er zu wissen meint, nicht mehr eingenommen. Er findet, was er meint, fragwürdig und setzt das Meinen der Frage aus. Sich der Fraglichkeit einer Meinung öffnen und unvoreingenommen weiterfragen zu können, das ist der Weg zur Philosophie. [<<17]
Philosophie, mit dieser Behauptung möchte ich die Vorüberlegungen abschließen, ist der Versuch einer Antwort auf radikales Fragen, das uns zuletzt vor die grundlegenden Dinge, die Grundfragen unseres Lebens führt. Wie lauten diese Grundfragen? Wenn wir uns dazu in der Philosophie der Gegenwart umsehen, so kommen wir wohl ebenfalls in eine Art von Verlegenheit. Die Grundfrage der Philosophie, so sagen die Anhänger der Dialektik, des dialektisch-historischen Materialismus, ist die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Was ist das Ursprüngliche: der Geist oder die Natur, theologisch variiert: Hat Gott die Welt erschaffen oder ist die Welt von Ewigkeit da? Und je nach dem, auf welche Seite sich eine Philosophie schlägt, ist sie entweder idealistisch oder materialistisch, es gibt nicht eine Philosophie, sondern grundsätzlich und notwendig zwei Philosophien3 (vgl. F. Engels, L. Feuerbach, 1888, Ww 21). Die Anhänger der Hermeneutik sehen hierin gar keine radikale, keine ursprünglich gefragte Frage. Weil diese Fragestellung die geschichtliche Motivation des philosophischen Fragens überspringt, bringt sie immer schon die Eingenommenheit von einer Meinung, den Dogmatismus einer abgeleiteten, sekundären Antwort ins Spiel. Die Philosophie, so entgegnet der Hermeneutiker, bezieht sich unmittelbar weder auf das Denken noch auf das Sein, sondern auf Sprache. Ihre Grundfrage ist das Verhältnis der Sprache, die wir sprechen, zum Text. Wie verhält sich das Gespräch, das wir sind, zur Tradition, aus der wir kommen? Philosophieren, sagt Hans-Georg Gadamer, heißt Wiedererkennen, nämlich so, dass es als Antwort auf eine Frage verstanden wird, die durch die Aussage des Textes erst geweckt wird.4 Die These, dass Philosophie nichts anderes als Wiedererkenntnis des Erkannten, die Hermeneutik von Texten, [<<19] sei, bringt ihrerseits einen Dogmatismus ins Spiel, nämlich die Eingenommenheit von der Tradition. Unter dieser Voraussetzung entfällt das radikal-ursprüngliche Fragen, da die hermeneutische Fragestellung abgeleitet oder sekundär ist: Sie richtet sich auf die Sprache der Texte und nicht auf die Sache, die infrage steht. Wenn dem so wäre, hätten die Analytiker, die Anhänger der dritten Position der Gegenwartsphilosophie, wahrscheinlich recht mit der These: Die Philosophie entspringt den Verhexungen unseres Verstandes durch die Sprache. Die meisten Sätze und Fragen, heißt es im ‚Tractatus logico-philosophicus‘, „welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen (sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne). Und es ist nicht verwunderlich, daß die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind.“5
Dem letzten Satz von Wittgenstein möchte ich zustimmen; er hätte hier nur unterscheiden müssen. „Problem“ ist die lösbare Aufgabe, eine Streitfrage, die wir entscheiden, ein Rätsel, das wir entschlüsseln können, nämlich dann, wenn wir uns der Mittel und Methoden der Wissenschaften bedienen. Was für Wittgenstein die „tiefsten Probleme“ sind, sind die mit wissenschaftlichen Mitteln und Methoden unlösbaren Aufgaben der Philosophie, die im Wesentlichen ein Vierfaches betreffen: die Frage nach der Wahrheit (1), die Frage nach dem Guten (2), die Frage der Freiheit (3) und zuletzt die Sinnfrage (4). Was hat es eigentlich mit dem Sein in seinen verschiedenen Bedeutungssinnen auf sich? Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts (Heidegger)? Kant hat die Grundfragen in die Formulierung gefasst: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? Nach Kant verweisen diese Fragen auf die Frage nach uns selbst: Was ist der Mensch? Ich denke, dass Heideggers Formulierung radikaler ist: Sie reicht an die Wurzel aller Fragen: Was [<<19] heißt uns Menschen danach fragen, was ist? Letztlich grundlegend ist die Seinsfrage: Was ist der Sinn von Sein? Es sind die Probleme, die Wittgenstein, obwohl er sie für die tiefsten hält, durch Sprachkritik zum Verschwinden bringt. „Wir fühlen“, heißt es am Schluss des ‚Tractatus‘, „daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.“6 Ist damit wirklich alles geklärt? Ich denke nicht. Der Wittgenstein des ‚Tractatus‘, der gegen die Philosophie geschrieben worden ist, kann für dieses Werk immerhin nicht auf einen der philosophischen Grundbegriffe, den Begriff der Wahrheit, verzichten. Er hält die Wahrheit seiner Sätze für unantastbar und definitiv, um sie wenig später gleichwohl selbst anzutasten und zu revidieren – das klassische Zeugnis dafür, dass die Grundfragen der Philosophie unhintergehbar sind, und zwar auch dann noch, wenn man, wie Wittgenstein, gegen die Philosophie philosophiert. Dem Philosophieren gegen die Philosophie kommt jedoch ein höchst wichtiges Verdienst zu. Er hat die radikal-philosophischen Grundfragen noch einmal radikalisiert, indem er die Philosophie selbst dem Fragen ausgesetzt hat. Was für eine Tätigkeit ist das Philosophieren? Mit welcher Art von Problemen hat es der Philosoph zu tun? Und wie geht er bei seinem Geschäft vor? Der erste Philosoph, der diese Fragen gestellt hat, war Sokrates. Wittgenstein hat sie nur sprachkritisch radikalisiert, sodass sich inzwischen sogar Berufsphilosophen mehr Gedanken über ihren Beruf machen als zuvor. Es ist die Gegenbewegung zur Philosophie, die sie in unserem Jahrhundert selbst fraglich gemacht hat. Diese Bewegung geht in unserem Jahrhundert von zwei Seiten aus: vonseiten der Wissenschaft, genauer: der Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft und vonseiten der Weltanschauung, genauer: der Ideologie. Damit komme ich zum ersten Teil der Vorlesung. Ist Philosophie Wissenschaft oder Weltanschauung? Oder ist sie beides in einem, eine „wissenschaftliche Weltanschauung“, wie der dialektisch-historische Materialismus den Begriff „Philosophie“ definiert? [<<20]
1 M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969, S. 65.
2 Vgl. Augustinus, Confessiones, 11. Buch, 12–14.
3 H.-G. Gadamer, Kleine Schriften IV, Variationen, 1977, S. 3.
4 Vgl. zum Verhältnis von Frage und Antwort in der Hermeneutik: H.-G. Gadamer, Hermeneutik II. Wahrheit und Methode, Gesammelte Werke Band 2, Tübingen 1986, S. 395 ff. Siehe auch Band I, S. 375 ff. Grundlegend für diese Dialogizität von Frage und Antwort ist R. G. Collingwood, Denken. Eine Autobiographie. Eingeleitet von H.-G. Gadamer. Übersetzt von H.-J. Finkeldei, Stuttgart 1955; und ders., Philosophie der Geschichte. Aus dem Englischen von G. Herding, Kohlhammer, Stuttgart 1955.
5 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1. Frankfurt/Main 1984, S. 26, Nummer 4.003.
6 Ebd., S. 85, Nummer 6.52.