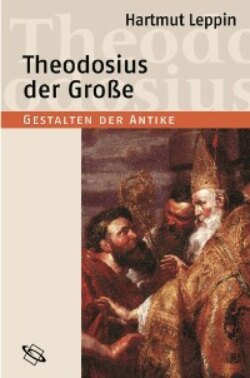Читать книгу Theodosius der Große - Hartmut Leppin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Einführung: Ein Reich der Vielfalt
ОглавлениеDas Römische Reich war ein Reich der langen Grenzen.1 Vom Euphrat bis zum Atlantik, von Britannien bis zur Sahara erstreckte es sich um die Mitte des 4. Jahrhunderts, und dieser gewaltige Raum schien bemerkenswert einheitlich organisiert. Überall galt römisches Recht. Überall wirkte eine vom Lateinischen geprägte Verwaltung. Überall prunkten die Beamten mit denselben klangvollen Titeln. Überall zirkulierten ganz ähnliche Münzen. Wer von einer Stadt in die andere zog, und mochte er auch Tausende von Kilometern überwinden, konnte sich in der neuen Umgebung rasch zurechtfinden, so musste es jedenfalls scheinen.
Doch der Eindruck von Uniformität trügt. Die ethnische Vielfalt des Mittelmeerraums hatte sich im Römischen Reich nicht nivelliert, selbst Jahrhunderte römischer Herrschaft hatten die regionalen Eigenheiten nicht völlig beseitigt, mancherorts entstanden gar neue Regionalismen. Viele Sprachen wurden in diesem Reich gesprochen, und gerade in der Spätantike erwachten manche, wie etwa das Syrische, zu einem neuen Leben; die Bedeutung des Griechischen im Osten wuchs, die des Lateinischen nahm langsam ab. Die Lebensformen waren sehr verschieden, die Mentalitäten gingen auseinander.2 Die einen Städte strotzten vor Reichtum, so etwa das syrische (heute türkische) Antiochia (Antakya), das sich eine nächtliche Straßenbeleuchtung leisten konnte, oder Trier mit seinen kaiserlichen Prachtbauten (Abb. 1), andere waren völlig verarmt und konnten ihren Bürgern weder Bäder noch Spiele bieten.
Auch die Nähe zur Grenze bestimmte die Lebensverhältnisse. Im Reichsinnern, in Italien zum Beispiel oder in Spanien, brauchte man Vorstöße fremder Völker nicht mehr – oder sollte man schon sagen: noch nicht – zu fürchten. In den Grenzprovinzen, zumal den westlichen, hingegen musste man damit rechnen, das Opfer derartiger Angriffe zu werden. Die Einfälle zielten zwar nicht darauf, das Reich zu zerstören oder Teile von ihm abzutrennen, doch waren sie für die Einheimischen bedrückend und oft lebensbedrohlich. Ob am Rhein oder an der Donau, ob in Ägypten oder im sonstigen römischen Afrika: die Grenzen waren nicht verlässlich geschützt. Immer mehr, immer weiter im Binnenland gelegene Städte wurden mit Mauern umgeben, auch Gutshöfe erhielten eigene Verteidigungsanlagen.
An den meisten Grenzen hatten die Römer es mit Stämmen oder besser: Stammesverbänden zu tun, die sich oft aus verschiedenen Ethnien zusammensetzten, von den Römern aber mit einem Namen wie Goten oder Mauren belegt wurden. Diese Gruppen waren bisweilen nur von kurzer Lebensdauer, zumeist aber von höchster Durchschlagskraft, da ihre Angehörigen von Kriegen und Plünderungszügen lebten. Am Euphrat hingegen stand das römische Heer einem anderen wohl organisierten Großreich mit einer regulären Armee gegenüber, dem Perserreich, das im Kriegsfall ein gewaltiges Potential entfalten konnte, das aber nach Friedensschlüssen gewöhnlich verlässlich still hielt. Fortwährend waren römische Truppen somit an den verschiedenen Grenzen in kleinere oder größere Kämpfe verstrickt, die an den Kräften zehrten, obschon die Römer zumeist siegreich blieben, wenn es zu einer größeren militärischen Konfrontation kam.
Abb. 1: Das spätantike Trier in der zeichnerischen (teils hypothetischen) Rekonstruktion.
Die Grenzsicherung bildete indessen die Hauptaufgabe des römischen Militärs; an Expansion war nicht ernsthaft zu denken.3 Während die fremden Völker aus scheinbar unerschöpflichen Bevölkerungsreservoiren Zustrom von Menschen erhielten, war die Bereitschaft von Reichsbewohnern, in der Armee zu dienen, generell begrenzt. Durch allerhand Zwangsmaßnahmen – die Söhne von Veteranen sollten wieder Soldaten werden, die Großgrundbesitzer sollten aus ihren Bauern Soldaten stellen und vieles mehr – versuchte die Verwaltung, mehr Römer zu rekrutieren, mit mäßigem Erfolg. Am ehesten konnte man noch in den bedrohten Grenzprovinzen junge Männer zum Militärdienst motivieren, doch diese Soldaten waren oft nicht willens, weiter entfernt Dienst zu tun. Sie bildeten zunehmend eine Art von Bauernmiliz mit starker regionaler Verwurzelung (limitanei). Das Heer, das aufgrund seiner Mobilität einst die Klammer des Reiches gebildet hatte, verstärkte jetzt die Tendenz zur Regionalisierung. Immerhin gab es noch andere Einheiten: so ein Bewegungsheer (comitatenses) von Elitesoldaten, dessen Verbände zu den schwersten Kriegsschauplätzen eilten und oft dem Kaiser eng verbunden waren, ferner eine Palastgarde, die organisatorisch von den übrigen Truppe getrennt war und stets in der Nähe des Herrschers blieb.
Der Unterhalt der Soldaten, die hohe Zahlungen fordern konnten, belastete die Staatskassen schwer. Auf ihn verwendeten die Kaiser einen Großteil ihrer Einnahmen. Denn ohne die Armee waren sie nichts. Der hohe Wert der Armee führte zu einem Verhalten, das leicht als Friedfertigkeit oder Feigheit missverstanden werden kann. Nur selten ließen die Römer sich auf Schlachten ein, bei denen ja auch im Falle eines Sieges wertvolle Kräfte verloren gehen konnten; oft zogen sie in vernünftiger Berechnung Verhandlungen vor.
Viele und immer mehr Angehörige des Heeres waren nichtrömischer Herkunft, vor allem germanische Stämme stellten eine große Zahl von Soldaten für Rom. Die Bedeutung dieses Faktors sollte man nicht dramatisieren; der gern benutzte Begriff ‚Barbarisierung des Heeres‘ vermittelt einen schiefen Eindruck. Denn die Auseinandersetzungen zwischen Germanen und Römern waren kein Krieg zwischen dem Römischen Reich und einer germanischen Nation. Vielmehr verfolgten die Germanen jeweils ihr eigenes Interesse, das gewöhnlich darin bestand, an die Fleischtöpfe des Römischen Reiches zu gelangen, und ob sie dahin auf Plünderungszügen kamen oder als reguläre römische Militärs, war letztlich gleich.
Die Germanen, die in römische Dienste traten, mussten sich normalerweise an die römische Ausrüstung und Kommandostruktur, nicht zuletzt an die Befehlssprache Latein gewöhnen. Zwar war ihnen die Ehe mit Römerinnen gewöhnlich verwehrt, doch scheinen sie sich nicht als einen Fremdkörper empfunden zu haben. Manch einer gerade aus der germanischen Elite integrierte sich auch sozial und kulturell. So korrespondierte Libanios, der als Rhetoriklehrer in Antiochia die Ideale klassischer Bildung hochhielt und ein höchst komplexes Griechisch schrieb, mit einem akkulturierten Germanen wie dem Heermeister Hellebich. Heiratsverbindungen banden einzelne Germanen an das Kaisergeschlecht. Erst als die germanischen Einheiten ihre spezifischen Kommandostrukturen erhielten und sich verselbständigten, wurden sie zu einer Gefahr für das Reich.
Die militärische Rangordnung war fein ausdifferenziert, von niederen Offiziersstellen über das Militärkommando in einzelnen Provinzen bis hinauf zum Heermeister (magister militum). Es gab den magister peditum, zuständig für die Fußtruppen, und den magister equitum, zuständig für die Reiterei, wobei diese Titel oftmals einen eher formalen Charakter hatten und verschiedene Truppengattungen unter einem Kommandeur standen, sodass der Titel magister utriusque militiae, Heermeister beider Truppengattungen, oder einfach magister militum immer gebräuchlicher wurde. Diese befehligten in der Zeit des Theodosius entweder einen Amtssprengel im Umfang mehrerer Provinzen oder konnten in unmittelbarer Nähe des Kaisers nachgerade die Rolle eines Oberkommandierenden einnehmen. Regelmäßig gab es im Reich deutlich mehr als zwei Amtsträger, wodurch der Übermacht Einzelner zumindest entgegengewirkt wurde.
So streng die militärische Hierarchie war, sie bot zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten, nach der Anciennität ebenso wie nach dem Leistungsprinzip. Viele Fremdstämmige vermochten bis in den höchsten Rang aufzurücken, von dem Heermeister Hellebich war schon die Rede. Dies zeigt die Integrationsbereitschaft auf beiden Seiten. Für traditionsbewusste Römer war die bedeutende Rolle von Germanen ein Graus, für den Schutz des Reiches ein Segen. Allerdings besaßen die Fremdstämmigen keineswegs ein Monopol auf militärische Leistungsfähigkeit. Auch Römer gelangten im Heer zu Macht und Ansehen und konnten ihre niedere Herkunft kompensieren: Die Familie des Theodosius bildet dafür ein Beispiel.
Neben der ethnisch gemischten militärischen Elite des Reiches gab es, deutlich von ihr getrennt, eine zivile, administrative, die sich allein aus Römern zusammensetzte und deren Hierarchie ebenfalls fein verästelt war.4 Die unterste Verwaltungsebene bildeten die Städte, die anders als im Mittelalter vom Umland rechtlich nicht getrennt waren, darüber lag die Ebene der Provinzen, die ihrerseits wieder übergeordnete Einheiten bildeten, darüber stand der kaiserliche Hof oder besser: standen die kaiserlichen Höfe. Es gab in der Regel mehrere Kaiser nebeneinander, die in unterschiedlichen Städten – etwa Trier, Mailand, Sirmium, Konstantinopel oder Antiochia – residierten.
Die Verwaltung der Spätantike bemühte sich mit – im Vergleich zur Moderne – wenigen Mitarbeitern und mit oft sehr schlichten Mitteln, den Missständen zu wehren, die man wahrnahm; dabei ergriffen die oberen Instanzen des Reiches selten die Initiative, sondern reagierten in der Regel auf Anfragen von Beamten. Die formellen Antworten, die uns in verschiedenen Sammlungen überliefert sind, gelten als Gesetze.5 Eines der zentralen Probleme, die hier behandelt wurden, bildeten die Steuereintreibung und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Die verschiedenen Glieder der Versorgungskette – Bauern bzw. Pächter (coloni), Müllerbäcker (pistores) und Reeder (navicularii) – versuchte die Administration an ihre Aufgaben zu binden. Die Bauern waren zwar inzwischen überwiegend frei und die Sklavenarbeit auf dem Lande weit zurückgegangen; doch immer mehr von ihnen wurden mitsamt Familien an ihren Boden gebunden, sodass sie nicht mehr entscheiden durften, wo sie tätig werden wollten. Viele traten dennoch die Flucht von ihren Äckern an. Oft hört man von agri deserti, verlassenem Land, aber es gab nach wie vor blühende Landschaften mit einer selbstbewussten Landbevölkerung.
Vergleichbares wie für die coloni galt für die Müllerbäcker, die ihre Tätigkeit nicht wechseln durften und den Beruf an ihre Söhne, möglichst sogar an die Schwiegersöhne, weiterzugeben hatten, und die Reeder, die ihr risikobehaftetes – aber potentiell profitables – Geschäft ebenso wenig aufgeben durften. Die Bedeutung dieser Bestimmungen für das Alltagsleben sollte man nicht überschätzen: Immer wieder wurden sie neu eingeschärft, was einerseits bedeutet, dass die Verwaltung sie für wichtig hielt, andererseits, dass sie nicht durchsetzbar waren. Schon deswegen ist es unangemessen, von einem spätantiken Zwangsstaat zu sprechen.6
In den Städten führten die Ratsherren, die man als Dekurionen oder Kurialen bezeichnet, die Geschäfte. Ihre Hauptlast bestand darin, für das Steueraufkommen ihrer Stadt und des zugehörigen Landes geradestehen zu müssen. Wenn sie bei den übrigen Steuerpflichtigen nicht genügend Abgaben eintreiben konnten, hielt die Reichsverwaltung sich an ihnen schadlos. Es gab reiche Städte, deren Ratsherren ohne weiteres mit diesem Verfahren zurechtkamen, doch auch arme Städte, deren Dekurionen alles daransetzten, sich diesen Belastungen zu entziehen. In unzähligen Gesetzen waren die Kaiser bemüht, mit Lockmitteln und Drohungen die Ratsherren, die sozial inhomogen waren, an ihre Aufgaben zu binden, doch bei immer geringerem Erfolg. Die Zugehörigkeit zum städtischen Rat, einst eine hohe Auszeichnung, war für viele jetzt eine schwere Bürde.
Weitaus attraktiver war der Dienst in der Reichsverwaltung. Hier konnte man Macht erwerben und hohe, reguläre wie irreguläre Einkünfte erzielen. Wie beim Militär, so spielte hier die persönliche Leistungsfähigkeit eine gewichtige Rolle für das individuelle Fortkommen. Das Studium des Rechts oder der Rhetorik, zumal der lateinischen, war das, was ehrgeizigen jungen Männern weiterhalf; daneben wirkten Protektion und Herkunft. Der Weg nach oben erfolgte, auch darin ist das Heerwesen vergleichbar, über viele Stufen, deren jeweiliges Rangverhältnis in Gesetzen genauestens festgelegt wurde. Die Gunst des Kaisers indes konnte die Karriere rasant beschleunigen und seine Ungunst sie jäh beenden. Valentinian I. (364–375) etwa genoss den Ruf, Aufsteiger zu begünstigen, besonders wenn sie aus seiner pannonischen Heimat kamen, zum Verdruss der etablierten Senatoren.
Der Handlungsspielraum der Provinzstatthalter war gewöhnlich nicht weit. Zum einen dauerte ihre Amtszeit nur etwa ein Jahr, sodass sie keine wirkliche Ortskenntnis gewinnen konnten; zum anderen hatten die zivilen Statthalter in vielen Provinzen Militärkommandeure neben, faktisch oft über sich. Über allen Provinzstatthaltern standen die Vikare, die anscheinend vornehmlich den Prätorianerpräfekten bei der Appellationsgerichtsbarkeit entlasteten. Eine Sonderstellung besaß im syrischen Bereich der comes Orientis, der offenbar eine Stellung ähnlich den Vikaren einnahm, ihnen aber dem Rang nach übergeordnet war.
Die Spitze der Verwaltung bildete der Prätorianerpräfekt. Der Titel hatte früher den Kommandeur der Garde Roms bezeichnet, jetzt war sein Träger aller militärischen Befehlsfunktionen entbunden, hatte aber die Versorgung der Armee zu gewährleisten und somit auch die eigentlich in Naturalien zu liefernde Grundsteuer zu überwachen. Vor allem wirkte er als der oberste Richter. Dieses Amt gewährte tatsächlich Macht. Allerdings gab es zeitgleich gewöhnlich drei oder vier, bisweilen noch mehr Prätorianerpräfekten, die für jeweils einen größeren geographischen Raum – etwa Vorderasien und Ägypten oder Illyricum, Italien und Africa – zuständig waren.
Noch andere Hofämter vermittelten Einfluss. Der magister officiorum leitete die Verwaltung des Hofes und regelte den Kontakt mit Gesandtschaften. Zudem gebot er über die Palastwache und gewann unter Theodosius die Aufsicht über die Waffenfabriken. Die staatlichen Einnahmen, soweit sie in Form von Geld abgeführt wurden, verwaltete der comes sacrarum largitionum; der comes rerum privatarum kontrollierte das kaiserliche Krongut. Schließlich ist unter den Hofbeamten noch der quaestor sacri palatii zu nennen, der nichts mehr mit dem republikanischen Magistrat zu tun hatte, sondern mit der Ausfertigung kaiserlicher Gesetze betraut war und dabei anscheinend so viel Spielraum besaß, dass manche Forscher den individuellen Stil einzelner Quästoren in den Gesetzen zu erkennen meinen; wie weit das Auswirkungen auf die Gesetzesmaterie hatte, steht dahin.7
Doch nicht allein die formellen Zuständigkeiten der Amtsträger darf man sehen. Wichtig ist darüber hinaus ihre persönliche Nähe zum Kaiser. Sie konnten unmittelbar auf ihn einwirken und dadurch die Dinge so lenken, wie es ihnen gut schien. In der Nähe des Kaisers bewegten sich auch ganz andere Personen, etwa ihre Frauen oder die Eunuchen. Deren Einfluss galt in traditionalistischen Milieus als illegitim, gewann aber weithin Akzeptanz, etwa wenn Kaisergattinnen als Fürsprecherinnen der Schwachen auftraten. Die Stellung der Eunuchen wurde gar im Amt des praepositus sacri cubiculi, des Oberkammerherrn, formalisiert. Weitaus wichtiger und wirklich neu war, dass im 4. Jahrhundert bestimmte Bischöfe einen persönlichen Einfluss auf den Herrscher erlangten – ein Einfluss, der ihren religiösen Gegnern natürlich nicht behagte.
Inhaber von Hofämtern waren oft verhältnismäßig niedriger, etwa kurialer Herkunft und bekleideten automatisch den senatorischen Rang; auch andere erfolgreiche Staatsdiener konnten in diesen Stand erhoben werden. Dies verstärkte die ohnehin gegebene Inhomogenität der Senatorenschaft, zu der neben Angehörigen der großen alten Familien eben solche Aufsteiger standen. Zwar gab es noch die berühmtesten der alten republikanischen Ämter wie Prätur und Consulat, aber sie hatten ihre einstigen Befugnisse verloren und besaßen vornehmlich eine zeremonielle Funktion; vergeben wurden sie vom Kaiser, nicht von den Standesgenossen. Weitaus bedeutender war inzwischen die Stadtpräfektur zumal in Rom, welche die Alltagsgeschäfte in der Stadt verwaltete. Als politisches Gremium hatte der Senat schon lange ausgedient, und nur eine Minderheit von Senatoren pflegte an Senatssitzungen teilzunehmen. Der alte Senat von Rom versammelte sich zwar an würdiger Stätte, doch weit entfernt von den Zentren der Macht; nur selten suchte noch ein Kaiser die alte Hauptstadt auf. Immerhin gehörte es für die Herrscher zum guten Ton, den Senat über kaiserliche Beschlüsse zu unterrichten. Mithilfe von Sendschreiben und Gesandtschaften mochte dieser zudem den Kaiser zu beeinflussen suchen, doch durchsetzen konnte er sich nur selten. Der neue Senat von Konstantinopel war dem Kaiser räumlich näher. Er durfte sich häufiger kaiserliche Verlautbarungen anhören und in den unterschiedlichen Graden des Jubels die Intensität seiner unvermeidlichen Zustimmung zum Ausdruck bringen. Als Gremium verfügte er über keine Macht.
Obwohl nur wenige Senatoren über Einfluss am Hof verfügten, gehörten sie alle zur sozialen Elite des Reiches. Sie zeichneten sich durch Wohlhabenheit aus und oft durch weitreichende Kontakte in die Provinzen, wo manch ein Senator über gewaltige Macht verfügte und den kaiserlichen Statthaltern durchaus Paroli bieten konnte; zugleich verklammerten sie als Personen die Provinzen mit den politischen Zentren.
Die Senate von Konstantinopel und Rom unterschieden sich nicht allein in Hinblick auf die Nähe zum Kaiser, sondern auch in ihrer Zusammensetzung. Die stadtrömischen Senatoren behaupteten mit Erfolg und meist zu Unrecht, sie wären Nachkommen der großen Geschlechter der römischen Republik. Aufsteiger hatten es hier schwer, und der alte Glaube hielt sich lange dort, obgleich zur Zeit des Theodosius die Christen wohl bereits überwogen.8 In Konstantinopel war der soziale Aufstieg tendenziell leichter als im Westen, da die senatorische Elite sich hier auf keine uralten Traditionen berufen konnte: Der östliche Senat war erst unter Konstantin dem Großen (306–337) begründet und von seinem Sohn Constantius II. (337–361) mit dem stadtrömischen Senat fast gleichgestellt worden. Viele Mitglieder waren durch Dienste am Kaiser in dieses Gremium aufgenommen worden; ihre Geschlechter waren somit vergleichsweise jung.
An der Spitze stand der Kaiser mit seinem Hof.9 Der Herrscher war durch ein prunkvolles, respektheischendes Hofzeremoniell aus der übrigen Bevölkerung herausgehoben. Er besaß überdies eine überragende Macht und konnte über Leben und Tod seiner Untertanen entscheiden. Viele Kaiser ließen das gerade die Angehörigen der Elite stets spüren; auch hierfür galt Valentinian I. als Beispiel, dessen Grausamkeit gegenüber Senatoren allenthalben gefürchtet war. Der Monarch selbst musste durchaus nicht hoher Herkunft sein. Noch der Vater Valentinians war vom Bauern zu einem hohen Offiziersamt aufgerückt; der Sohn bestieg den kaiserlichen Thron, nachdem er zuvor lediglich einen höheren Offiziersposten bekleidet hatte. Hierin zeigt sich erneut die bemerkenswerte Mobilität dieser Gesellschaft.
So mächtig der Kaiser war, überschätzen sollte man seinen Handlungsspielraum nicht. Er musste darauf achten, Akzeptanz bei den Eliten, namentlich den Militärs, und bei der Bevölkerung zu gewinnen und zu wahren. Unter der breiten Bevölkerung waren die städtischen Massen gefährlicher, da sie zu Unruhen neigten und dann gleich Regierungsgebäude bedrohen konnten. Die ländliche Bevölkerung hingegen wurde überwiegend in drückender Abhängigkeit gehalten und besaß weder den Spielraum noch die Organisationsmöglichkeiten, um aufzubegehren.
Im Hippodrom, dem Ort der Wagenrennen, fokussierte sich das politische Leben der städtischen Bevölkerung. Indem der Kaiser Spiele veranstaltete, bewies er dem Volk seine Großzügigkeit; außerdem ergab sich hier eine der wenigen Anlässe, bei denen es den Kaiser zu Gesicht bekam. Der Hippodrom Konstantinopels war mit dem Palast direkt verbunden; von dort aus konnten der Kaiser und sein Hof auf eine Tribüne treten, aus der man die Rennen verfolgte. Indem das Volk ihm dankend applaudierte und zugleich gemeinsam mit ihm die Rennen verfolgte, vereinte sich der Kaiser mit seinen Untertanen. Andererseits konnten die Auftritte im Hippodrom eine Gelegenheit sein, bei der man Widerspruch äußerte. Oft tadelte das Volk in Sprechchören das Verhalten des Herrschers: Insofern dienten die Auftritte dort als Stimmungsbarometer. Der Monarch hatte dabei die Chance, sich seine Beliebtheit bestätigen zu lassen oder strittige Maßnahmen zu korrigieren.
Die Akzeptanz des Kaisers bei den Eliten wurde ferner dadurch verstärkt, dass der Kaiser, sofern er sich normgemäß verhielt, seine Entscheidungen nicht einsam traf, sondern mit seinem Rat, dem sacrum consistorium, besprach. Dem consistorium gehörten die hohen Hofbeamte und die magistri militum praesentales an, aber auch andere hoch gestellte Persönlichkeiten, die der Kaiser berief. Manchmal ist von der Teilnahme der kaiserlichen Frauen oder der Eunuchen die Rede, das aber war verpönt. Gewiss war der Kaiser keineswegs an die Meinungen seines Rats gebunden; nichts und niemand konnte verhindern, dass er sich selbst dann darüber hinwegsetzte, wenn alle anderen einer Meinung waren. Aber der Kaiser durfte den Bogen nicht überspannen, wenn er die Loyalität seiner Umgebung wahren wollte.
Noch schwieriger war es für den Kaiser, in dem weiträumigen Reich eine Kontrolle auszuüben. Er war vornehmlich durch seine Präsenz mächtig. Doch da, wo er nicht war, in den vielen fernen Provinzen, an den langen Grenzen, musste er darauf setzen, dass loyale Beamte, Militärs oder Bischöfe seine Sache vertraten. Erneut ist die wiederholte Einschärfung bestimmter Gesetze ein Indiz der Schwäche der Zentrale. Wenn zudem Beamte ermahnt werden mussten, die Bestimmungen durchzusetzen oder sich auch nur selbst daran zu halten, zeigt sich, welche Schwierigkeiten dem kaiserlichen Machtanspruch entgegenstanden.
Das ist einer der Gründe für die Teilung der kaiserlichen Macht in der Spätantike. Entweder herrschten mehrere Kaiser (Augusti) nebeneinander, unter denen der Dienstältere als senior Augustus einen gewissen zeremoniellen Vorrang besaß, oder ein Augustus berief so genannte Caesares, die ihm klar unterstanden, in ihrem Machtbereich aber die kaiserliche Gewalt repräsentierten. Waren mehrere Brüder vorhanden, so konnte die Herrschaft unter ihnen geteilt werden: Kaiser Valentinian I. (364–375), der zunächst Alleinherrscher gewesen war, hatte alsbald, offenbar auf Druck seiner Umgebung, seinen Bruder Valens (364–378) zum Mitherrscher erhoben. Valentinian übernahm den Westen des Reiches, Valens den Osten.
Auch wenn in diesem Falle die Berater, die Soldaten und der Hofstaat formell getrennt wurden, darf man die Bedeutung derartiger Reichsteilungen nicht überschätzen. Sie waren nicht auf Dauer angelegt, sondern orientierten sich an jeweiligen persönlichen Konstellationen. Nach dem Tode Konstantins etwa erlebte das Reich eine Dreiteilung. Aufgegeben wurde der Gedanke der Reichseinheit jedoch niemals. Die Gesetze etwa erließen formell alle Kaiser gemeinsam, obgleich sie normalerweise lediglich von einem Kaiser verantwortet wurden und nur in einem Teil des Reiches angewandt wurden. Dass die Teilung in ein West- und ein Ostreich sich im 5. Jahrhundert verfestigen würde, war für die Zeitgenossen nicht abzusehen.
Die Schwäche kaiserlicher Gewalt in den Regionen erweist sich ebenso an der großen Zahl von Usurpationen, die immer wieder das Imperium erschütterten. Die Reichseinheit mochte dabei für eine gewisse Zeit aufgehoben werden, doch niemand stellte sie grundsätzlich in Frage. Die Usurpatoren strebten gewöhnlich danach, sich mit dem verbleibenden Herrscher zu arrangieren. Ein eigenes Reich rief keiner der Usurpatoren aus – die in ihrem eigenen Verständnis natürlich legitime Augusti waren.
Seit Konstantin dem Großen bekannten sich alle Herrscher mit Ausnahme Julians (361–363) zum christlichen Glauben zumindest in dem Sinne, dass sie im Christengott ihren machtvollsten Beschützer erblickten. Neben der militärischen und der administrativen gewann im 4. Jahrhundert daher eine dritte Elite an Bedeutung, der Klerus, der ähnlich wie die Verwaltungsangehörigen auf verschiedenen Ebenen agierte. Jede ernst zu nehmende Stadt besaß einen Bischof.10 Seine Macht war durchaus von dieser Welt, denn er war das Oberhaupt der Kirchen seiner Stadt, die mittlerweile als Empfängerinnen von Geschenken und als Erbinnen sehr reich sein konnten und durch milde Gaben die breite Masse der Bevölkerung an sich zu binden wussten. In den Gottesdiensten, bei denen üblicherweise allein dem Bischof zu predigen erlaubt war, hatte dieser Gelegenheit, seine Meinung über weltliche Angelegenheiten kundzutun, oft in einer Atmosphäre, die durch Kirchengesang und geheimnisvolle Zeremonien emotional aufgeladen war. Zudem vermochte der Bischof durch persönliche Kontakte mit den Honoratioren der Stadt und mit Angehörigen der Reichsverwaltung oder des Militärs, selbst mit dem Kaiser, seinen Einfluss geltend zu machen. Gegenüber den Angehörigen der Reichsverwaltung besaß der Bischof einen entscheidenden Vorteil: Er war sein Leben lang vor Ort, kannte die Verhältnisse ausgezeichnet und wusste, mit wem man über was zu reden hatte. In vielen Auseinandersetzungen erwies sich der Bischof daher dem Vertreter der weltlichen Macht überlegen, zumal es in den Städten kaum polizeiliche oder militärische Einheiten gab, mit denen Beamte ihren Wünschen hätten Nachdruck verleihen können.
Der Machtgewinn der Bischöfe geht mit einem Wandel ihrer sozialen Herkunft einher. Zunächst stammten sie typischerweise aus den kurialen Familien: Wer von ihnen zum Bischofsamt gelangte, war in jedem Fall mächtiger als seine früheren Standesgenossen – und brauchte zudem keine Steuern zu zahlen. Im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts ließen sich indes zunehmend Senatoren zu Bischöfen wählen, beginnend mit Ambrosius (seit 374 Bischof von Mailand). Bischöfe mit diesem Hintergrund wussten das Potential des Amtes besonders gut zu nutzen, wodurch das Bischofsamt weiter an Macht gewann. Zunehmend ersetzen die Bischöfe als Patrone und Förderer ihrer Städte die alten lokalen Eliten.
Doch nicht jedem war die neue Macht der Kirche geheuer. Entschiedene Christen zogen sich aus dem weltlichen Leben zurück, um als Asketen in der Wüste oder in den Bergen ein Leben der Hingabe an Gott zu führen. Oft erlegten sich diese Männer und in geringerer Zahl Frauen schwere Aufgaben auf, indem sie etwa lange fasteten, Eisenketten mit sich herumtrugen, konsequent schwiegen oder andere schwere Einschränkungen auf sich nahmen. Gerade die Lösung aus der Welt verhalf ihnen indes zu Ansehen und Macht, nicht allein, weil man ihnen die Kraft zuschrieb, Wunder zu wirken, sondern auch weil die Aura der Heiligkeit ihnen erlaubte, mit größter Unabhängigkeit zu reden. So konnten diese Männer, die oft niedrigster Herkunft waren und bisweilen keinerlei Bildung genossen hatten, zu Beschützern der Schwachen und zu Gesprächspartnern der Angehörigen der Eliten werden – noch ein eindringliches Zeichen für die soziale Mobilität in dieser Epoche. Die Bischöfe sahen die schwer kontrollierbaren Mönche nicht nur mit Wohlgefallen, weil sie ein Charisma eigenen Rechts besaßen und durch ihre schiere Präsenz das Ansehen der Kleriker erheblich schmälern konnten.11
Eingeschränkt wurde die Macht der Bischöfe und der Kirche überdies dadurch, dass die Bevölkerung des Römischen Reiches in religiöser Hinsicht weiterhin bunt gemischt war. An vielen Orten lebten zahlreiche Anhänger der alten Kulte und blieben einflussreich, da sie viele Angehörige der Eliten zu binden vermochten. Die verschiedenen Kulte wurden von den Christen allesamt als heidnisch betrachtet, waren ihrerseits jedoch sehr vielfältig: Neben den schlichten bäuerlichen Kulten gab es ausgefeilte philosophische Systeme, neben den altrömischen Göttern Mysterienkulte wie die für Mithras oder Isis. Die einen liebten die blutigen Opfer, den anderen genügte die einsame Kontemplation, und diese Unterscheidungen ließen sich beliebig vermehren. Zwar entwickelte sich unter den Heiden zunehmend ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, aber eine geschlossene heidnische Front, die sich gegen das Christentum zur Wehr setzte, entstand keineswegs.12
Die jüdische Religion, die im ganzen Römischen Reich überwiegend griechischsprachige Anhänger besaß, genoss eine Sonderstellung, welche die römische Verwaltung grundsätzlich respektierte. Die Juden hatten teils eine eigene Gerichtsbarkeit und leisteten spezifische Abgaben; mit ihrem Patriarchen stand der kaiserlichen Verwaltung ein Ansprechpartner zur Verfügung, der dem Rang nach einem Prätorianerpräfekten gleichgestellt war. Die Christianisierung des Reichs bedeutete zunächst keine unmittelbare Verschlechterung der Lage der Juden, doch sahen die Christen in ihnen viel stärker als die Heiden Rivalen; daher verstärkte sich im Alltag der soziale Druck auf sie. Zunehmend entluden sich die Spannungen in Gewaltakten. Diese wurden von der kaiserlichen Verwaltung, deren wichtigstes Anliegen stets die innere Ruhe war, missbilligt, doch keineswegs konsequent geahndet – da die Bestrafung von Christen ihrerseits Unruhen auslösen konnte.13 Je mehr die soziale Macht christlicher Personen und Instanzen zunahm, umso prekärer wurde die Lage der Juden.
Unklar in ihrem Status war die Religion der Manichäer, die von manchen als eine Spielart des christlichen Glaubens betrachtet wurde, weil in dieser Religion Jesus eine gewisse Rolle spielte. Der Manichäismus war im 3. Jahrhundert in Persien entstanden und lehrte einen strengen Dualismus zwischen Bösem und Gutem. Diesem konnte der Gläubige sich über verschiedene Stadien annähern. Ähnlich wie das Christentum orientierte der Manichäismus sich an heiligen Texten; er baute zudem kirchenähnliche Strukturen auf. Gerade wegen seines Erfolges gehörte der Manichäismus schon vor Konstantin dem Großen zu denjenigen Religionen, die die härtesten Verfolgungen zu erdulden hatten, da er auch politisch Argwohn erregte: Einige erblickten in den Manichäern eine fünfte Kolonne der Perser, mit denen Rom seit vielen Jahrhunderten verfeindet war.
Im Alltag für die christlichen Kleriker irritierend, vielleicht sogar gefährlich, war die Glaubenspraxis, die vielerorts gelebt wurde. Mancher selbst von denen, die häufiger zur Kirche gingen, hatte keine Scheu, auch andere Kultstätten zu besuchen. Solche Gläubige betrachteten die verschiedenen Religionen gleichsam als die Angebote eines Marktes, aus dem man je nach Bedürfnis seine Auswahl traf. Das aber widersprach der Forderung des Christentums nach Eindeutigkeit des Bekenntnisses, die von den konsequenten Theologen so auffällig oft eingeschärft wurde.
Als Schwachpunkt der Kirche erwies sich vor allem, dass innerhalb der Christenheit zahlreiche Spannungen aufbrachen, die zum Teil die Lehre, zum Teil die christliche Praxis betrafen.14 Da die Streitigkeiten mitunter bis heute eine theologische Bedeutung besitzen, wäre aus der Sicht des Historikers eine möglichst neutrale Terminologie wünschenswert. Diese ist jedoch angesichts der Komplexität der Auseinandersetzungen und den vielen Verschiebungen zwischen den Gruppen nicht erreichbar. Um eine gewisse Neutralität zu erreichen, verzichte ich für die Großkirche auf die beiden parteiisch gefärbten Begriffe ‚katholisch‘ (allumfassend) und ‚orthodox‘ (rechtgläubig) und ziehe ich es vor, stattdessen von Nizänern zu sprechen, weil die Berufung auf das Glaubensbekenntnis des Konzils von Nizäa (325) die gemeinsame Basis dieser Lehren bildet.
Nicht vermeiden kann ich den Begriff ‚Häretiker‘ für die Gegner der Nizäner. Selbstverständlich erhoben zwar auch diese Gruppen den Anspruch der Rechtgläubigkeit und nannten sich selbst in diesem Sinne ebenfalls orthodox, sodass jene Bezeichnung ihrem Selbstverständnis nicht gerecht wird, doch klingt sie weniger hölzern als eine Wendung wie nichtnizänisch. Auf jeden Fall ist sie dem Begriff ‚arianisch‘ vorzuziehen, denn die Vielfalt der Richtungen, die von Nizänern polemisch nach Arius, einem umstrittenen Theologen des beginnenden 4. Jahrhunderts, bezeichnet worden sind, ist unüberschaubar; viele hatten mit Arius gar nichts zu tun.
Der theologische Streit mag den modernen Betrachter befremden, war aber für viele Zeitgenossen von grundlegender Bedeutung: Er rankte sich zunächst um das Verhältnis Gott und Christus, vor allem darum, wie stark der menschliche Anteil in Christus zu bewerten sei, in dem ja, das war weitestgehend Konsens, Menschliches und Göttliches sich vereinten. Während die Nizäner den Begriff des Wesensgleichen/Wesensähnlichen (gr. homooúsios) gebrauchten und daher Homoousianer genannt werden können, lehnte die Gruppe der Homöer, die hier als Beispiel dienen möge, diesen Begriff ab, da er nicht in der Bibel auftaucht, und zog es vor, Gott und Christus für gleich (gr.: hómoios) zu erklären, was in der Sicht der Nizäner wiederum zu wenig prägnant war.
Als Kompromissformel schien jedoch die Lehre der Homöer am geeignetsten. Sie wurde daher von den – an einer Beruhigung der Kirche interessierten – Kaisern Constantius II. (337–361) und Valens (364–378) unterstützt, die beide im Osten regierten, während die Westkaiser Constantin II. (337–340), Constans (337–350) und – deutlich zurückhaltender – Valentinian I. (364–375) eher mit den Nizänern sympathisierten. Nur als Constantius II. das gesamte Reich regierte (350–361), gab es kurzlebige Versuche, das Homöertum auch im Wesen durchzusetzen.
Doch nicht einmal die energische kaiserliche Unterstützung für die Homöer vermochte die Nizäner auszumerzen. Zahlreiche machtbewusste und theologisch avancierte Bischöfe unterstützten diese Lehre und entwickelten eine ausgeprägte Sensibilität gegenüber kaiserlichen Eingriffen in kirchliche Angelegenheiten. Dass die Nizäner sich schließlich durchsetzten, ist gar nicht leicht zu erklären. Wichtig war ohne Zweifel das Scheitern von Constantius II., der von einem Usurpator aus der eigenen Verwandtschaft abgelöst wurde, noch wichtiger das des Valens, dessen Herrschaft mit einer schweren militärischen Niederlage endete, was nach den Begriffen der Zeit eine Zeichen dafür war, dass Gott ihm seine Gnade entzogen hatte. Bevor diese Niederlage geschildert wird, sei jedoch ein Blick auf die Jugend des Theodosius geworfen, der den Nizänern zum Durchbruch verhelfen sollte.