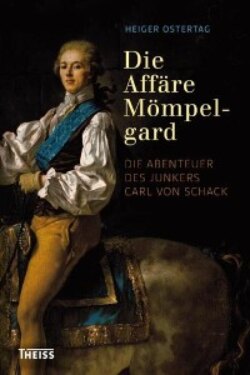Читать книгу Die Affäre Mömpelgard - Heiger Ostertag - Страница 11
Der geheime Auftrag
ОглавлениеEs mochte gegen eins sein, als die drei Reiter ins Schloss zurückkehrten. Sie banden die Pferde in der Nähe von Carls Wohnung an. Friedrich öffnete die Eingangspforte und entzündete drinnen die Kerzen. Dann nahm er seinem Herrn und Erlenburg die Mäntel und die beiden Pistols ab und eilte wieder hinaus, um abzusatteln und die Pferde zu versorgen. Der Junker und Erlenburg zogen sich in das Schreibkabinett zurück und setzten sich. Die Degen kamen zur Seite und die Herren lockerten die Gürtel.
„Lasst uns das Erlebte besprechen“, schlug Carl vor, „und überlegen, was weiter zu tun ist. Was haltet Ihr von dem Geschehen am See, werter Freund?“
„Wenn Caracanti hinter dem unheimlichen Mord steckte“, überlegte Erlenburg, „wäre das eine höchst seltsame Art der Kontaktaufnahme. Doch ich glaube, die schöne Tote stand im Dienste des Venezianers und sollte Euch von diesem eine Nachricht zukommen lassen. Eine dritte Seite suchte dies zu verhindern und schreckte dabei vor Gewalt und Totschlag nicht zurück.“
„Ich bin ganz Eurer Meinung, Erlenburg, dass jemand nicht wollte, dass der Kontakt zustande kam – und es ist ihm fürs Erste gelungen. Ich muss gestehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wer dahinter steckt. Wir sollten jedenfalls die Wache informieren und diese nach den beiden Toten sehen lassen. Morgen früh werde ich den Tatort genauer untersuchen.“
Friedrich trat ein und meldete, die Pferde seien versorgt.
„Gut, Friedrich“, lobte ihn Carl von Schack. „Eile jetzt zur Wache und überbringe dem wachhabenden Offizier Secondlieutenant von Neipperg eine Botschaft von mir.“ Carl griff zu Papier, Tinte und Feder, um eine Anweisung an den Wachhabenden zu schreiben, dass dieser sogleich einen Trupp Soldaten zur Insel schicken solle, um dort nach dem Rechten zu schauen.
„Es könnte sein“, schrieb Carl, „dass Ihr zwei Leichname findet. Ich bitte Euch, diese zu bergen und den Zugang zur Insel zu sichern.“
„Während Ihr schreibt, soll Friedrich eine oder besser zwei Bouteillen Eures vorzüglichen Roten bringen. Die Kehle ist mir bei all dem recht trocken geworden“, meinte Erlenburg.
Der Junker gab Friedrich einen kurzen Wink, und bald darauf brachte der Diener die gewünschten Flaschen nebst zwei fein geschliffenen Trinkpokalen. Er öffnete die erste Flasche und goss Carl und dem Gast ein.
Inzwischen hatte Carl das Billett fertiggestellt. Er siegelte es mit seinem Wappen und übergab die Nachricht Friedrich, damit dieser sie sofort bestelle. „Richte mir dem Secondlieutenant von Neipperg meinen vorzüglichen Gruß und Dank für die Mühen aus, um die ihn zu bitten ich zu dieser frühen Stunde gezwungen bin. Dann lege dich schlafen, ich bedarf deiner heute nicht mehr!“
Friedrich tat wie ihm geheißen und verließ den Raum, und die beiden Freunde hoben die Gläser.
„Auf Ihr Wohl, werter Freund, ich bin gespannt, wie sich die Affäre Mömpelgard entwickeln wird“, sagte Erlenburg.
„Ob es sich wirklich um eine Affäre Mömpelgard handelt, muss sich zeigen“, antwortete der Junker ernst. „Zurzeit kann ich nicht absehen, was sich hinter dem düsteren Geschehen auf der Insel verbirgt.“ Er stieß mit dem Freunde so kräftig an, dass die Pokale klirrten.
„Ein edler Tropfen“, meinte Erlenburg mit einem genussvollen Seufzer. „Genau der richtige Ausklang eines gefüllten Tages.“
In diesem Augenblick klopfte es an das Fenster des Zimmers, in dem sie saßen. Kammerherr von Erlenburg fuhr zusammen und verschluckte sich.
„Mon Dieu“, stieß er hustend hervor. „Wer klopft um diese Stunde an Euer Fenster?“
„Das werden wir gleich wissen“, rief Carl von Schack, stand auf und trat an das hintere Fenster, von dem das Klopfen gekommen war.
„Vorsicht, werter Freund, es könnte erneut ein Anschlag sein“, warnte der Kammerherr. „Geht nicht so nah ans Fenster! Man sieht Euch sonst von draußen!“
„Unsinn“, entgegnete Carl. „Ein Attentäter schießt ohne Anmeldung, er klopft nicht!“
Er öffnete die Flügel des Fensters und schaute hinaus. Draußen konnte er zunächst nichts erkennen. Der Mond war vor einer Weile untergegangen, und es herrschte nun stockfinstere Nacht.
Dann schälte sich ein Schemen aus den dunklen Schatten, und eine schwarz gekleidete Gestalt trat unter das Fenster. „Entschuldigt die Störung und die unkonventionelle Form meines Besuches, Junker von Schack“, war eine junge Stimme zu hören. „Ich müsste Euch dringend sprechen. Aber, wenn es geht, lasst uns drinnen reden.“ Er blickte sich forschend um. „Hier draußen ist mir nicht ganz geheuer.“
Carl von Schack, durch seine spezielle Tätigkeit an allerlei seltsame Begegnungen gewöhnt, lud den geheimnisvollen Fremden mit einer knappen Geste ein, hereinzukommen.
Gewandt zog sich der späte Gast am Fenstersims empor und sprang ins Zimmer.
Kammerherr von Erlenburg schüttelte missbilligend den Kopf, als die dunkle Gestalt durchs Fenster kam. „Ich hoffe, Ihr wisst, was Ihr da tut, werter Carl.“
Carl schloss das Fenster. „Seht Ihr eine andere Möglichkeit, die Dinge zu klären, bester Freund? Nennt mir diese oder lasst mich nach meiner Art vorgehen!“
Erlenburg winkte ab und schenkte sich erneut ein.
Der Fremde, ein schlanker, braun gelockter Jüngling mit klaren Gesichtszügen, der kaum zwanzig Lenze zählen mochte, hatte während des kurzen Wortwechsels unruhig gewartet. Er blickte zu Erlenburg und dann zu Carl von Schack und hob fragend eine seiner Augenbrauen. Carl verstand die stumme Frage und beantwortete diese zugleich.
„Ihr könnt offen reden. Kammerherr von Erlenburg und ich sind gute Freunde und haben keine Geheimnisse vor einander. Auch“, fügte Carl mit einem leichten Lächeln hinzu, „wenn wir da und dort anderer Meinung sein mögen.“ Er wies auf einen Stuhl. „Nehmt Platz und erzählt, was Euch zu dieser späten Stunde herführt und was Ihr so Eiliges zu berichten habt. Aber wartet, nehmt einen Becher dort von der Anrichte und schenkt Euch ein. Bei einem guten Wein lässt es sich freier reden!“
Der Fremde folgte seiner Aufforderung, holte sich den Becher, nahm Platz und schenkte sich ein. Er leerte den Becher mit einem durstigen Zuge. Dann hub er an zu sprechen. „Mein Name ist Alessandro, der Vatersname tut nichts zur Sache, und ich stehe im Dienste des venezianischen Gesandten Conte Caracanti. Der Conte schickt mich, da er unerwartet abreisen musste, um Euch persönlich eine Botschaft auszurichten.“ Alessandro stockte und warf einen Blick auf Erlenburg.
„Caracanti ist uns bestens bekannt“, beruhigte ihn der Junker daraufhin.
„Wenn auch nicht als Conte“, warf der Kammerherr von der Seite ein, verstummte aber gleich, als er Carls scharfen Blick auffing.
„Entschuldigt, Alessandro, Herr von Erlenburg beliebt mitunter zu scherzen“, erklärte der Junker. „Erzählt einfach weiter!“
„Conte Caracanti lässt Euch durch mich ausdrücklich warnen. Er fürchtet, dass jemand von dritter Seite an Euch herantreten werde und Euch vorzuspiegeln versuche, er handle im persönlichen Auftrage meines Herrn. Ziel sei es, Informationen hervorzulocken, die gegen Euch oder den Conte verwendet werden könnten. Kurzum, Herr Junker, Euch drohet große Gefahr!“ Alessandro schwieg. Er griff zur Flasche und füllte wieder seinen Becher.
„Ihr entschuldigt, Alessandro“, entgegnete Carl nach kurzem Überlegen, während dieser den Becher erneut leerte. „Wer garantiert mir, dass Ihr nicht selbst ein Jemand im Sinne der vorgetragenen Warnung seid und Euer Auftritt einzig allein dazu dient, Euch in mein Vertrauen zu begeben?“
Alessandro griff in das Innere seiner schwarzen Samtweste und zog ein gerolltes Schreiben hervor, das er mit einer Verbeugung Carl von Schack darbot. Dieser nahm die Rolle entgegen und wollte gerade anfangen zu lesen, da pochte es kurz an der Tür – diesmal war es Friedrich.
„Secondlieutenant von Neipperg“, meldete er und direkt hinter ihm trat der Offizier in das Lesekabinett.
Secondlieutenant von Neipperg war von mittelgroßer, schlanker Gestalt. Sein noch bartloses, glattes Gesicht machte einen offenen, freundlichen Eindruck. Auffällig an Neipperg waren vor allem die feingliedrigen Hände, die man eher bei einem Dichter, denn bei einem Sohn des Mars erwartet hätte. Er trug zur gelben Uniformhose und Weste den roten Waffenrock der Garde Noble nebst Dreispitz mit Federbusch.
Die Garde Noble war im letzten Jahr als adlige Garde-Formation unter dem General der Kavallerie und Capitain aller Garden Graf Johann Franz von Czabelinsky aufgestellt worden. Den eigentlichen Wachdienst des Schlosses bildete die 1. Compagnie der Garde zu Pferd.
„Seid mir willkommen, Lieutenant von Neipperg“, begrüßte ihn Carl von Schack, steckte die Papierrolle ein und stand auf. „Ich hätte so rasch nicht mit Euch gerechnet. Nehmt Platz, Friedrich soll Euch ein Glas und uns zwei neue Bouteillen bringen. Dann berichtet. Kammerherr von Erlenburg ist Euch bekannt und dieser Herr“, Carl zeigte auf Alessandro, „ist ein Bote des Contes Caracanti.“
Von Neipperg begrüßte die drei mit kurzem Nicken und nahm seinen Hut ab. Dann setzte sich der Offizier.
Alessandro, der den Eintreffenden mit prüfendem Blick gemustert hatte, erhob sich. „Ihr erlaubt, Herr Junker, dass ich mich verabschiede. Die Botschaft des Contes habe ich Euch überbracht. Mich drängt die Zeit, ich muss noch heute Nacht aufbrechen und meinem Herrn folgen, da wir in acht Tagen an der Burgundischen Pforte sein wollen.“
„Und Ihr Auftrag, Alessandro?“, rief Erlenburg. „Was wollt Ihr uns mitteilen?“
„Alles, was Ihr wissen müsst“, sprach der Bote weiter, ohne auf die Fragen des Kammerherrn einzugehen, „steht in jener Rolle, die ich Euch gab. Und jetzt entschuldigt mich, meine Herren.“ Und ohne auf eine Antwort zu warten, trat er ans Fenster, öffnete den Flügel und sprang hinaus in die Nacht. Der Kies knirschte, dann war Caracantis Bote in der Dunkelheit verschwunden.
Friedrich kehrte mit den Flaschen zurück. Auf einen Wink Carls schloss er die Flügel des Fensters. Anschließend füllte er die Gläser.
„Ein seltsamer Gast“, meinte der Kammerherr kopfschüttelnd.
„Mancher liebt es zu eilen“, meinte Carl nur und wandte sich dem Offizier zu.
Den Lieutenant schien der Vorfall nicht weiter zu stören. Er hatte ein kleines Oktavheft hervorgezogen und in diesem selbstvergessen geblättert und gelesen.
„Nun, Herr von Neipperg, was führt Euch zu uns?“, fragte Carl.
Neipperg blickte auf. Er errötete wie ein Schulbub, steckte rasch das Heft ein und zog ein zweites hervor. Das schlug er auf und schaute Carl von Schack an.
„Die Schlosswache erhielt am späten Abend eine Nachricht, dass sich auf der Seeinsel beim Schloss Monrepos um Mitternacht eine geheime Verschwörergruppe treffen wolle. Leider konnte der Empfänger der Botschaft, Wachtmeister Isele, nicht lesen. Erst als ich die Wache um eins kontrollierte, fiel mir der Zettel ins Auge. Ich ließ satteln und ritt sogleich mit einem Trupp Reiter los, um die Bande auszuheben. Allein vergeblich, von Verschwörern oder sonstigen Personen war keine Spur zu finden. Wir kehrten zurück und trafen unterwegs Friedrich, der mir Eure Botschaft übergab.“
„Lasst mich raten“, sagte Carl. „Ihr habt auf der Insel auch sonst nichts entdeckt.“
Secondlieutenant von Neipperg nickte. „Weder eine Spur der Verschwörer noch die von Euch beschriebenen beiden Toten – nichts! Doch ich schickte sofort nach Erhalt Eurer Nachricht drei Mann zur Insel zurück, um den Zugang zu sichern.“
„Keine Spuren?“, ließ sich der Kammerherr vernehmen. „Das war fast zu erwarten. Offenbar war das Ganze eine geschickt geplante Inszenierung, vielleicht gar eine Art von Falle.“
„Zu welchem Zweck?“, fragte von Neipperg verständnislos.
„Das, mein Bester, ist ein weites Feld“, antwortete Carl. „Ich danke Euch jedenfalls, dass Ihr mich umgehend informiert habt.“ Er hob sein Glas und die Männer tranken.
„Ein guter Tropfen, Herr von Schack“, lobte der Lieutenant den Wein. „Doch Ihr entschuldigt, ich muss zurück zur Wache und die Ablösung der Seewachen regeln.“
„Ich will Euch nicht aufhalten“, antwortete Carl. „Erlaubt mir aber die Frage nach dem, was Ihr eben laset, das Euch derart zu fesseln schien?“
Wieder errötete der junge Lieutenant. „Es ist nichts, nur ein paar Verse, die mir kürzlich zugetragen wurden.“
„Ei“, lachte Erlenburg. „Ihr werdet doch nicht auch dem Werther-Fieber verfallen sein. Eure Weste ist jedenfalls gelb genug!“
„Die Verse sind vom jungen Schiller, einem Eleven der Hohen Karlsschule und drüben in Marbach geboren“, bemerkte der Secondlieutenant von Neipperg kühl und erhob sich. „Herr von Schack, Herr Kammerherr, mein Kompliment!“ Der Offizier trat ab.
„Meine Güte, jetzt ist von Neipperg beleidigt, nur, weil ich ihm unterstellte, er lese dieses von Gefühlen überladene, unmoralische Büchlein des Herrn Goethe.“
„Ihr solltet Neipperg nicht aufziehen, werter Freund“, erwiderte Carl. „Er nimmt die Lektüre überaus ernst. Erst kürzlich sah ich ihn mit Jean-Jacques Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse.“
„Rousseau! Ein heilloser Schwärmer wie dieser Goethe. Ich halte von alledem nichts. Im blauen Frack mit Messingknöpfen, gelber Weste, braunen Stulpenstiefeln und rundem Filzhut umherrennen. Seinen Tee aus einer Werther-Tasse nehmen und sich in jede hübsche Larve, die Butterbrote schmiert, verlieben. Unfug! Und wie endet die ganze Liebelei? Im Selbstmord! Lessing hat völlig recht, wenn er schreibt, dass der Autor, wenn ein so warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll, eine kalte Schlussrede hätte schreiben müssen. Ein Paar Winke hinterher, wie Werther zu einem so abenteuerlichen Charakter gekommen sei, und jeder andre Jüngling, dem die Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich vor ähnlichem Schicksale bewahren könne.“
„Ach, Erlenburg, wenn Ihr Euch nicht ereifern könnt!“, meinte Carl. „Wollt Ihr einen Schriftsteller zur Rechenschaft ziehen und ein Werk verdammen, das, durch einige beschränkte Geister falsch aufgefasst, die Welt höchstens von einem Dutzend Dummköpfen und Taugenichtsen befreit hat, die gar nichts Besseres tun konnten, als den schwachen Rest ihres bisschen Lichtes vollends auszublasen?“
Beide Männer schwiegen einige Augenblicke.
Schließlich erhob sich der Kammerherr. „Wir wollen es genug sein lassen für heute, und morgen im hellen Licht des Tages über das nächtliche Geschehen auf der Insel und alles, was sich noch ereignet hat, ausführlich reden.“ Er gähnte dezent. „Für jetzt, mein Freund, gehabt Euch wohl. Ich bin rechtschaffen müde und wünsche Euch einen guten, erholsamen Schlaf.“
Erlenburg ging und Friedrich, der noch immer auf war, schloss hinter ihm die Pforte.
Es war spät, dennoch fühlte sich Carl in keiner Weise müde, zumal ihm die Ereignisse und Bilder des Abends und der Nacht keine Ruhe ließen. Er hatte das Gefühl, dass er eine Ordnung in die Abläufe bringen müsste, um zu verstehen, was sie en détail bedeuten mochten. Der Junker nahm ein weißes Blatt sowie Tinte und eine frische Feder und begann zu notieren: Die Ankunft Caracantis, die junge Frau auf dem Ball. Das Treffen um Mitternacht und die Schüsse auf ihn. Der Tod der unbekannten Schönen und das spätere Verschwinden ihres Leichnams. Alessandro, der angebliche Bote Caracantis und die Warnung sowie der Bericht des Secondlieutenants von Neipperg. Die Papierrolle, die ihm Alessandro gegeben und die er bislang noch nicht gelesen hatte.
Er zog sie hervor und legte sie auf den Tisch. Dabei gähnte Carl und fühlte, wie ihn eine Müdigkeit, die er zuvor nicht verspürt hatte, auf einmal erfasste und umhüllte. Er beugte sich vor, um für einen kurzen Moment den Kopf auf die Arme zu legen – und war in Sekundenschnelle eingeschlafen.
Carl von Schack erwachte durch ein Rütteln an seiner Schulter.
Es war Friedrich, der sich bemühte, seinen Herrn wach zu bekommen. „Junker von Schack. Wacht auf, eine Botschaft des Herzogs.“
Carl fuhr in die Höhe. Heller Sonnenschein fiel durch die Fenster in sein Zimmer. Es musste später Vormittag sein – er hatte den Morgen verschlafen. Er erhob sich und reckte sich. Schulter und Nacken schmerzten von der unbequemen Schlafstellung, die er innegehabt.
Sein Blick fiel auf Friedrich, der einen Schritt zurückgetreten war und ein Kuvert in der Rechten hielt, das er Carl von Schack entgegenstreckte. Dieser nahm das Kuvert und erbrach das herzogliche Siegel auf der Rückseite.
„Geht und bringt mir einen Eimer Wasser, Friedrich!“, befahl er und las das Schreiben. Sein Inhalt war kurz. Seine fürstliche Hoheit Herzog Karl Eugen erwarte Junker von Schack zur Mittagsstunde im Schloss Solitude. Die Mittagsschokolade pflegte der Herzog gegen zwei zu sich zu nehmen. Jetzt musste es nach dem Sonnenstand gegen zehn sein. Zur Solitude waren es zwei württembergische Meilen bergan zu reiten. Mit einem guten Ross eine Angelegenheit von etwas mehr als einer Stunde. So wäre also noch genug Zeit, um mit Friedrich den See aufzusuchen und eine erste Untersuchung des Ortes, wo die Unbekannte ermordet worden war, vorzunehmen. Aber er musste sich eilen. Der Herzog schätzte es nicht, wenn jemand, den er zu sich beordert, verspätet eintraf – ungeachtet aller nur möglichen Gründe konnte Karl Eugen sehr ungnädig werden. Lieber wäre es Carl gewesen, wenn er den Ort des nächtlichen Abenteuers in größerer Ruhe hätte untersuchen können, allein des Herzogs Wille war Gebot.
Friedrich kam mit dem Eimer, und Carl löste sein Hemd und die Oberbekleidung und wusch sich mit dem eiskalten Nass. In seiner näheren und weiteren Umgebung war man, so man Kenntnis hatte von Schacks morgendlicher Gepflogenheit, entsetzt über sein ungesundes Treiben. Wasser galt, äußerlich angewendet, als überaus schädlich und förderlich für Krankheiten aller Arten. Nach der Wäsche warf er sich in ein leichtes Reitgewand über, aß einen Teller Morgensuppe, die ihm Friedrich reichte, und begab sich anschließend zu den Ställen.
Friedrich und er bestiegen die Pferde, und sie ritten durch den Wildpark hinunter zum See. Wie in der Nacht lagen die Boote am Ufer. Nur dass heute ein Soldat dort Wache stand.
„Halt“, rief der Mann und hob das Gewehr. Dann erkannte er Carl von Schack, nahm Haltung an und machte Meldung. „Alles in Ordnung, Junker Kammerherr.“
„Sind die anderen Posten auf der Insel?“
„Ja, Herr. Ein Mann läuft Streife am Ufer. Der Zweite wacht an der Ruine.“
„Danke, Soldat. Rührt Euch!“
Carl bestieg ein Boot. Friedrich löste das Tau und sprang hinterher. Schweigend ruderten die beiden Männer zur Insel.
Sie landeten am ungefähr gleichen Ort wie in der Nacht zuvor. Sofort eilte Carl zur Ruine, wo er vor Stunden die schöne Fremde gefunden hatte. Der Posten an der Kirche salutierte. Carl wies ihn an, zur Seite zu treten und unterzog, zusammen mit Friedrich, den Tatort einer raschen Untersuchung. Doch außer den Stiefelspuren der Soldaten und einigen abgebrochenen Zweigen vermochte Carl auf die Schnelle nichts zu entdecken.
Er wollte die Suche schon abbrechen, denn die Zeit drängte, da sah er in den Zweigen eines Busches etwas blinken. Er trat näher und zwängte sich in das Dickicht, um den Gegenstand greifen zu können.
Es war ein schmales, herzförmig gearbeitetes Medaillon, das an einer goldenen Kette befestigt gewesen war. Diese musste gerissen sein, denn nur ein kleiner Rest davon fand sich am Schmuck. Carl klappte das Medaillon auf. Im Innern war ein feines Miniaturbild eingelassen. Es zeigte das Bild einer Frau, die der schönen Toten entfernt ähnelte, doch älter als diese schien. Hatte die Ermordete das Schmuckstück verloren oder ein anderer, der am Tatort gewesen war? Carl von Schack wusste es nicht. Vielleicht würde er später darauf eine Antwort finden. Er warf einen Blick zum Sonnenstand, es wurde Zeit, aufzubrechen. Carl steckte das Medaillon in seine Brusttasche und wies Friedrich an, allein weiter zu prüfen, was an Spuren noch vorhanden sein mochte.
Ein Soldat ruderte den Junker ans feste Ufer. Dort bestieg Carl sein Pferd und ritt im raschen Trabe in Richtung der Solitude davon.
Er passierte das Schloss und ritt weiter Richtung Süden. Es war ein angenehmes Reiten mitten durch die flache Hügellandschaft. In der Ferne ackerten Bauern, Schafshirten trieben ihre Herden vorüber. Die Sonne schien warm über die dampfende Erde, es musste am frühen Morgen geregnet haben. Frisch lockte das Grün der Bäume und des Grases, und überall waren Blumen zu sehen. Carl von Schacks Weg führte durch eine kühle Waldschlucht. Vor ihm ragte in nicht allzu weiter Entfernung hell der Bau der Solitude in die Höhe.
Da sah er etwas abseits des Weges unter einer hohen Eiche einen Jüngling sitzen, der mit einer Schreibarbeit beschäftigt schien und dabei laut rezitierte. Carl lenkte neugierig sein Pferd zur Seite und stieg ab. Er band das Ross an einen Baumtrieb und trat zu dem Jungen. Dieser bemerkte ihn nicht sogleich. Carl musterte ihn. Der Jüngling war schlank und gut gewachsen. Sein klar konturiertes Gesicht und die wachen Augen ließen auf einen hellen Geist schließen. Der Kleidung nach – blauer Rock, weiße Kniehose und weiße Gamaschen – musste es sich um einen Eleven der Karlsschule handeln, was Carl verwunderte. Im letzten Jahr hatte Herzog Karl Eugen die Anstalt nach Stuttgart verlegen lassen. Was mochte der Junge hier zu schaffen haben?
Der Eleve deklamierte gerade mit lauter, gefühlvoller Stimme:
Laß strömen sie, o Herr, aus höherem Gefühl,
Laß die Begeisterung die kühnen Flügel schwingen,
Zu dir, zu dir, des hohen Fluges Ziel,
Mich über Sphären himmelan gehoben,
Getragen sein vom herrlichen Gefühl,
Den Abend und des Abends Schöpfer loben,
Durchströmt vom paradiesischen Gefühl.
Doch da wurde er des Fremden ansichtig und brach mitten in der Rezitation ab. Eilig stand er auf und verbeugte sich vor Carl. „Ich grüße Euch, edler Herr, womit kann ich dienen?“
Carl neigte kurz den Kopf. „Warum sprecht Ihr nicht weiter?“, fragte er. „Die Worte klangen gut!“
„Meint Ihr wirklich?“, sagte der junge Mann und eine Röte überzog sein Gesicht. „Es ist nur ein schwacher Versuch, in Worte zu fassen, was mein Herz mit Gefühl und den Kopf mit Gedanken erfüllt.“
„Ah, Ihr spracht Eure eigenen Verse!“, erwiderte Carl voll Erstaunen. „Seid Ihr gar der junge Schiller, von dem mir der Secondlieutenant von Neipperg erzählte?“
„Des Johann Caspar Schillers Friedrich bin ich“, sagte der Jüngling mit stolzer Stimme. „Doch ich bitt Euch“, fügte er leiser hinzu, „erzählt nicht dem Herzog von meinem Hiersein und Dichten. Ich wollte die Eltern besuchen, aber …“
„Ihr durftet nicht?“, fragte Carl mitleidig. „Wo wohnen Eure Eltern?“
„Mein Vater ist seit Dezember letzten Jahres Leiter der Hofgärtnerei und hat deshalb eine Dienstwohnung in der Solitude. Aber vierzehn Tage vorher wurde die Karlsschule nach Stuttgart verlegt“, antwortete der junge Mann traurig und ließ den Kopf hängen.
„Nun, ich werde dem Herzog nichts berichten“, versprach Carl, dem die Erziehungstyrannei Karl Eugens und die harte Hand des Stuttgarter Intendanten der Akademie, Hauptmann Seeger, wohlbekannt waren. „Aber ich rate Euch, macht Euch schnell auf und kehrt nach Stuttgart zurück. Der Herzog weilt auf der Solitude, und wenn er entdeckt, dass Ihr Euch von der Schule heimlich entfernt habt …“
Doch schon war der Jüngling aufgesprungen und davongeeilt. Zurück blieb nur eine Spur im Gras und das Heft, in dem der Junge geschrieben hatte.
„Halt, Schiller!“, rief Carl. „Ihr habt Euer Büchlein verloren.“
Vergeblich, der junge Schiller war verschwunden. Carl bückte sich und steckte das Büchlein ein. Dann kehrte er zu seinem Pferd zurück und ritt das letzte Stück hoch zur Solitude.
Trotz seiner kleinen Pause war Carl derart zeitig vor Ort, dass er zu warten hatte. Er übergab sein Pferd einem Stallknecht und nutzte die Zeit, einen Blick von der Veranda des Schlosses in Richtung Ludwigsburg zu werfen. Ein Blick ins weite Land: Weil im Dorf mit dem Gasthaus „Zum Ritter Georg“, das Hofgut Korntal, das wohlhabende Kornwestheim und die Residenzstadt Ludwigsburg. Weit in der Ferne der Neckar, der sich kurvenreich durchs Land schlängelte.
Lautes Rufen ertönte, die Kutsche des Herzogs nebst Gefolge fuhr vor dem Schloss vor.
Kurze Zeit später wurde Carl von Schack von einem Lakaien in das Privatkabinett des Herzogs geführt. Der Diener meldete ihn und schloss die Tür. Herzog Karl Eugen und der Junker waren allein.
Carl setzte zur zeremoniellen Verbeugung an, aber der Herzog winkte ab. „Lass Er das, Schack, Er kennt mich. Wenn Er zu mir kommt, geht es um wichtigere Dinge als das Hofzeremoniell.“
Karl Eugen, der an einem schmalen Sekretär gesessen hatte, erhob sich und begann mit schnellen Schritten im Raum auf und ab zu schreiten. Gekleidet war der kräftige Mann in einen blauen, pelzverbrämten Samtrock, der an den Ärmeln mit goldener Stickerei verziert war. In seinem glatten, vollen Gesicht mit der langen Nase und den geschwungenen Brauen funkelten die Augen listig.
„Nun, erzählt mir, was Er zu Caracantis Nachricht sagt. Wie sollen Wir uns verhalten? Das Ganze ist eine ungeheure Provokation des Hofes von Versailles. Seit Ludwig XIV. versucht Frankreich, die Gebiete des Reichs zu okkupieren. Mit der Besetzung Straßburgs im September 1681 begann alles. Und jetzt will sein Ururenkel mir durch eine Intrige Mömpelgard rauben! Obwohl wir im Siebenjährigen Krieg Bündnispartner waren. Welch eine Infamie!“ Der Herzog schlug mit der Faust kräftig auf den Tisch. „Gut, dass mein Bruder Friedrich Eugen dort weilt, der Held von Reichenbach. Er wird es den Franzosen schon zeigen. Also, bester Junker, mach Er sich gleich morgen früh auf den Weg nach Étupes, wo meines Bruders Sommerresidenz liegt. Er weiß Bescheid, worum es geht. Ich vertraue Ihm, bei Ihm ist alles in guten Händen!“
Der Herzog klingelte, ein Lakai trat ein. Carl von Schack verbeugte sich tief – und war entlassen.
Carl atmete auf. Das war gerade noch gut gegangen. Warum hatte er auch nicht die Schriftrolle gelesen, die ihm in der Nacht gebracht worden war? Er hatte sie auf den Tisch gelegt und war dann plötzlich eingeschlafen. Ein Glück, dass der Herzog selten jemand zu Wort kommen ließ und sein Unwissen nicht bemerkt hatte. Über die herzogliche Argumentation, die Franzosen seien alte Bündnispartner, hatte Carl innerlich geschmunzelt. Die Württembergische Armee hatte sich im damaligen Krieg nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Beim schnellen Rückzug von Köthen 1760 war die württembergische Vorhut vom erwähnten Bruder des Herzogs, General Friedrich Eugen, der in preußischem Dienste stand, angegriffen und in die Flucht geschlagen worden. Württemberg gegen Württemberg – eine zumindest eigenartige Situation, die der Herzog offenbar verdrängt hatte.
Das Pferd wurde gebracht und Carl ritt zurück. Morgen sollte er auf Befehl des Herzogs nach Mömpelgard reisen. Der Name der Grafschaft stand auch auf dem Zettel, den er bei der schönen Toten gefunden hatte. Langsam nahm die Geschichte Konturen an. Also Prinz Friedrich Eugen sollte er aufsuchen.
Der Prinz war der dritte Sohn des verstorbenen Herzogs Karl Alexander von Württemberg und seiner Frau Marie-Auguste von Thurn und Taxis. Im Alter von neun Jahren war er zur Ausbildung nach Berlin geschickt worden. Ursprünglich sollte er die geistliche Laufbahn einschlagen, entschied sich dann aber fürs Militär. Bereits mit siebzehn war er Oberst. Im bald ausbrechenden Siebenjährigen Krieg zeichnete sich der Prinz durch besondere Tapferkeit aus. Unmittelbar vor der Schlacht von Leuthen wurde er mit fünfundzwanzig zum Generalleutnant der Kavallerie befördert. Als solcher erwarb sich Friedrich Eugen große Verdienste in der Schlacht bei Torgau, in der er die Reiterei auf dem rechten Flügel befehligte. Dabei wurde er durch einen Säbelhieb am Kopf schwer verwundet. Nach dem unglücklichen Ausgang des Kampfes um die Festung Kolberg beteiligte sich der herzogliche Bruder 1761 in Schlesien an der Belagerung von Schweidnitz. Die Schlacht bei Reichenbach ein Jahr später entschied der Prinz durch einen heldenmütigen Reiterangriff. 1769 quittierte Friedrich Eugen den Dienst und zog mit seiner Familie in die Grafschaft Mömpelgard.
Carl von Schack war gespannt, worum es in der vom Herzog angedeuteten Intrige wirklich ging. Er spornte sein Pferd an, dass er rasch nach Hause käme und die Botschaft Caracantis endlich lesen konnte.
Eine halbe Stunde später erreichte er das Ludwigsburger Schloss. Carl ritt zu den Ställen und übergab sein Pferd einem Knecht. Dann wandte sich Carl in Richtung seiner Wohnung. Er öffnete die Tür und rief nach Friedrich. Doch er erhielt keine Antwort, Friedrich schien unterwegs zu sein. Wahrscheinlich war er noch auf der Insel mit Untersuchungen beschäftigt. Friedrich konnte in diesen Dingen sehr genau sein, und normalerweise hätte Carl dessen Tun begrüßt. Nur, wenn er morgen aufbrechen musste, war einiges zu besorgen, und er hätte Friedrich hier notwendiger gebraucht. Nun, der Diener würde sicher bald kommen.
Zunächst wollte Carl die Schriftrolle Caracantis lesen. Die Situation beim Herzog war peinlich gewesen, und wenn er am nächsten Morgen abreiste, sollte er die Details seines Auftrags kennen und wissen, was von ihm erwartet wurde. Carl betrat sein Kabinett und ging zum Tisch, auf dem er gestern Nacht die Nachricht abgelegt hatte. Der Tisch war leer, offenbar von Friedrich aufgeräumt. Aber wo hatte er die Rolle hingelegt? Carl unterzog seinen Schreibsekretär und die Ablagen einer schnellen Musterung – keine Rolle. Dann durchsuchte er die Regale und schaute auf und zwischen den Büchern nach – immer noch nichts. Langsam wurde der Junker ärgerlich. Es wurde Zeit, dass Friedrich kam und die Nachricht herbeischaffte.
Mittlerweile war später Nachmittag, und Carl verspürte Hunger und Durst. Am besten, er legte eine Pause ein, aß ein Brot und trank ein Glas vom Lauffener. Das würde die Nerven beruhigen. Carl begab sich in den schmalen Nebenraum, wo die Vorräte lagerten und es eine Feuerstelle gab, auf der Friedrich die Morgensuppe kochte. Dort führte eine Steintreppe in ein weites Gewölbe, das dem Junker als Weinkeller diente. Als Carl die Küche betrat, hörte er einen dumpfen Laut, den er zunächst nicht einordnen konnte. Es klang wie ein Tier, nein, eher wie ein Ächzen oder Stöhnen. Das Geräusch kam von unten aus dem Keller.
Carl riss die Tür zum Gewölbe auf. Ein klagender, schmerzvoller Laut – keine Frage, das war ein Mensch, dem es schlecht ging. Der Keller war dunkel, so dass Carl nichts sehen konnte. Er eilte in die Küche zurück und griff nach einer Kerze, die er mit Hilfe der Zunderbüchse entzündete. Mit dem Licht in der Linken stieg Carl erneut in das Gewölbe hinab.
Das Geräusch war verstummt. Carl eilte in die Tiefe des Kellers und hielt die Kerze in die Höhe, um jede Ecke und jeden Winkel auszuleuchten. Da drüben lag ein dunkles Etwas, ein Mensch. Carl beugte sich vor und erkannte die zusammengekrümmte Gestalt seines Dieners Friedrich. Sein Gesicht war blutverkrustet und die Augen waren geschlossen. Carl befühlte den Brustkorb. Ein leichtes Heben und Senken zeigte, dass Friedrich lebte, auch wenn der Atem kaum noch feststellbar war. Kurz entschlossen hob Carl den Diener empor, schulterte ihn und stieg, unter dem Gewicht schwankend, mit ihm nach oben. Er trug Friedrich in sein eigenes Schlafgemach. Dann eilte er hinaus und zu den Ställen. Er befahl einem der Knechte, zum Medicus der Solitude, Doktor Stoer, zu reiten, dass dieser sogleich ihm folge und zum Verletzten komme. Mit einer der Mägde kehrte Carl in seine Wohnung zurück und wies diese an, sich bis zum Eintreffen des Arztes um Friedrich zu kümmern.
Er selbst stieg nochmals in den Keller hinab, um den Ort, an dem er Friedrich gefunden, näher zu betrachten. Doch obwohl er alles gründlich absuchte, konnte Carl keinen Hinweis auf den Täter finden, der Friedrich niedergeschlagen und wohl auch die Schriftrolle geraubt hatte. Er stieg wieder hoch in die Wohnung und schaute nach Friedrich. Der lag noch immer ohnmächtig auf dem Bett und war nicht ansprechbar. Carl von Schack verließ das Haus und begab sich zur Wache, um den Wachhabenden über das Geschehen zu informieren und ihn anzuweisen, dass dieser die Knechte und Mägde befragen ließ, ob jemand einen Fremden beim Betreten oder Verlassen der Schack’schen Wohnung gesehen habe.
Secondlieutenant von Neipperg, der diese Woche die Wache leitete, war von der Nachricht eines Überfalls auf Schacks Diener Friedrich sehr betroffen. „Ein Überfall am helllichten Tage und auf dem Gelände des Schlosses. Das nenne ich mehr als dreist!“, rief er aus.
„Ein solcher Überfall passt aber ins das Geschehen von gestern Nacht!“, entgegnete Carl. „Wobei der Mord auf der Insel mit dem Anschlag auf Friedrich in Verbindung stehen muss.“ Mit wenigen Worten erklärte er dem Lieutenant die Zusammenhänge.
„Ihr meint, die Tote, deren Leichnam verschwunden ist, war eine Botin im Auftrage Caracantis? Und die Täter wollten nicht, dass die Nachricht des Contes in Ihre Hände gelangt?“, fragte Neipperg. „Dann muss die Botschaft für bestimmte Kreise von großer Wichtigkeit sein.“
„Das sehe ich genauso“, bestätigte der Junker. „Sagt einmal“, er zog das Medaillon, welches er auf der Insel gefunden hatte, hervor. „Sagt, kennt Ihr vielleicht diese Dame? Sie ähnelt der Ermordeten.“
Secondlieutenant von Neipperg ergriff das Schmuckstück und schaute auf das Bild. „Das ist doch …“, stieß er überrascht hervor. „Nein, das kann nicht sein!“ Neipperg betrachtete nochmals das Bildnis und reichte es Carl zurück.
„Was ist?“, fragte Carl den jungen Offizier, dessen Wangen ganz bleich geworden waren.
„Ich, ich dachte, ich würde die Dame kennen, die das Bild zeigt. Doch es ist nicht möglich …“, erwiderte Neipperg. „Nein, sie kann es nicht sein, absolut nicht.“
„Wen glaubt Ihr erkannt zu haben?“, bohrte Carl nach.
Secondlieutenant von Neipperg stand auf und holte aus einem Schrank zwei Becher und eine Flasche Mundelsheimer. Er öffnete die Flasche, schenkte beiden ein und nahm selbst einen großen Schluck. Dann stellte er den Becher zur Seite und schaute Carl offen an. „Es handelt sich, Herr von Schack, um eine Angelegenheit von höchster Vertraulichkeit. Es geht um eine Dame und ich bitte Euch, bevor ich erzähle, um Euer Wort, dass Ihr die Ehre und den Ruf der Dame schont, was immer Ihr auch erfahren mögt. Wobei, ich sage es Euch gleich, jene Dame in keiner Weise mit dem heutigen oder gar gestrigen Verbrechen in Verbindung zu bringen ist. Es handelt sich um eine affaire de coeur, eine amour ardent – und ich ersuche Euch um äußerste Diskretion!“
Carl von Schack versicherte dem Lieutenant, die Ehre der Dame zu achten und Diskretion zu wahren – unter der Voraussetzung, dass wirklich keine Verbindung zu den Verbrechen bestünde.
Neipperg war mit der Versicherung zufrieden und akzeptierte auch Carls Einschränkung. Er sammelte kurz die Gedanken und begann dann seinen Bericht.
„Es war vor zwei Jahren bei der Redoute unseres Landesherrn Herzog Karl Eugen anlässlich der venezianischen Messe. Ihr erinnert Euch sicher des Geschehens. Händler aus ganz Europa boten kostbare Stoffe und Tuche, mannigfaltige Galanteriewaren, erlesene Weine und Speisen aller Arten an oder verkauften an den herzoglichen Ständen Produkte aus der herzoglichen Porzellan- und Spiegelfabrik. Den großen Marktplatz bedeckten zeltartige Tücher, alle, Verkäufer wie Käufer, waren verkleidet. Es gab ein buntes Getümmel von Maskierten, welche die tollsten Aufzüge und Spiele ausführten. Ich hatte eine Woche zuvor meinen siebzehnten Geburtstag begangen, und die Redoute war mein erster Ball. Wie alle Damen und Herren des Adels war ich auf venezianische Art maskiert, mit weißer Halbmaske, schwarzem Schulterkragen und trug einen Umhang mit Kapuze und schwarzem Dreispitz. Abends war Tanz im Festsaal. Tausende von Wachslichtern sorgten für eine märchenhaft wirkende Beleuchtung. Neben dem Adel waren auch Bürgerliche zugelassen, natürlich nur in Maske. Sicher waren die Kleider und Stoffe der Bürger bescheidener. Doch gab der Herzog selbst Beispiel, wie auf dem Fest umzugehen war. Das Zeremoniell tat der Freiheit keinen Zwang. Der Fürst zeigte seine Achtung gegen alle Masken ohne Unterschied und sorgte so dafür, dass Ergötzlichkeit unter allen Anwesenden gleich sein konnte. Denn wer hinter den Masken steckte, ob Gräfin oder schöne Müllerstochter, Adliger oder junger Bürgersmann, das war zumeist unbekannt und schuf einen ganz eigenen Reiz. Zur späten Stunde, wohl gegen Mitternacht, fielen mir unter all diesen Larven und Figuren zwei Gestalten auf, die ein wenig abseits des bunten Getümmels standen. Es war ein bunter Arlecchino, seiner Form nach weiblich, mit einer schön gekleideten, neckisch holden Colombina, die zu ihrem kostbar bestickten Kleide lediglich eine Handmaske trug. Beide Frauen schienen ganz in Betrachtung des Balles versunken und achteten kaum auf ihre unmittelbare Umgebung. Da näherten sich ein Pantalone und ein Brighella dem Paar, um beiden einen Kuss zu rauben. Mir schien, als gefiele den Damen weder der ältliche Pantalone mit seiner gebuckelten Nase, dem Ziegenbart und der sehr straff anliegenden roten Hose noch der hinterhältige, verschlagene und skrupellose Brighella in seiner schwarzen Maske. Da die Kerle nicht aufhörten, die beiden Schönheiten zu bedrängen, sprang ich hinzu und stieß den Brighella, der sich besonders um den Arlecchino bemühte, zur Seite. Nun ...“, Neipperg unterbrach seine Erzählung und blickte Carl nachdenklich an.
„Ihr könnt Euch denken, wohin die Begegnung führte. Beide, sowohl der Brighella als auch der Pantalone, forderten mich für den nächsten Morgen um fünf unten in der Neckaraue. Auf Degen der eine, der andere auf Pistol. Bis zum Rencontre waren es nur wenige Stunden. Etwas verstört, denn ich hatte mich noch nie duelliert, eilte ich in meine Wohnung, um durch den Diener meine Waffen, den Degen sowie die Reiterpistole, rüsten zu lassen und mich selbst innerlich auf den Kampf vorzubereiten.
Angekommen weckte ich den treuen Johann, der alles zu richten versprach, und ging in mein Zimmer. Wie erstaunt war ich, als ich den Raum betrat und den Arlecchino, besser die Arlecchina auf meinem Lager sitzend erblickte. Ohne Maske erkannte ich erst, wie schön die Unbekannte war. Sie war eine schlanke Frau in den besten Jahren mit herrlichen Formen, nachtdunklem Haar, blitzenden Augen und samtroten Lippen. ‚Ich will unserem Retter danken‘, sagte sie leise und reichte mir einen goldenen Becher, den sie mitgebracht. ‚Trinkt von diesem Weine‘, sprach sie. ‚Er wird Euch munden. ‘ Ich trank, und dann zog sie mich an sich.“
Errötend unterbrach Neipperg seine Geschichte. Er blickte einen Moment sinnend in die Ferne, dann drehte er sich wieder zu Carl und sprach mit heiserer Stimme weiter. „Nun, es wurde die schönste Nacht meines Lebens. Der Wein überwand meine von Natur gegebene Schüchternheit. Ich drückte das schöne Weib an mich. Wir küssten uns mit zärtlicher Leidenschaft und betrieben mit unglaublicher Abwechslung das alte neue Spiel der Liebe. Später muss ich, matt vom Wein und von der genossenen Liebe, eingeschlafen sein. Als ich erwachte, war es heller Tag und längst gegen Mittag. Johann klopfte und reichte mir zwei Briefe. Ich mache es kurz. Der erste war von meinen Duellgegnern, die mir im spöttischen Ton versicherten, sie hätten Verständnis für mein Versäumnis und Zaudern; allein, es gäbe sicher Gelegenheit, in naher oder weiter Zukunft ihnen meinen Mut zu beweisen. Jedoch nicht heute oder morgen – sie müssten abreisen und würden später auf unser Geschäft zurückkommen.
Der andere Brief stammte von der Arlecchina. Sie schrieb, wie froh sie und Colombina seien, dass sie mich derart von dem gefährlichen und tödlichen Zweikampfe habe abhalten können. Sie bäte mich um Verzeihung, doch sie müsse gleich am Morgen aufbrechen und weiterreisen und könne nicht sagen, wann und ob wir uns wiedersehen würden.“
„Habt Ihr die Dame denn wiedergetroffen?“, fragte Carl, als der Lieutenant schwieg.
„Nein, seit damals habe ich nichts mehr von ihr gesehen oder gehört. Nur einmal erzählte ein Reisender von einer schönen baltischen Gräfin und ihrer Tochter, die am Hofe des schwedischen Königs Gustav III. großen Erfolg hätten. Die Gräfin, eine Frau von Mitte dreißig, habe dem jungen König während eines Maskenballs im Kungliga Teatern derart den Kopf verdreht, dass er sie bat, ihn auf der Stelle zu ehelichen, obwohl er bereits mit Sophie Magdalena von Dänemark verheiratet war. Doch am nächsten Tag seien sie und ihre Begleiterin verschwunden gewesen. Da fiel mir die schöne Unbekannte ein“, sagte Neipperg und in seiner Stimme klang Melancholie auf, „wobei ich dies nur mit dem Verschwinden begründen könnte. Vorhin, als Ihr mir das Medaillon zeigtet, meinte ich, die Dame zu erkennen. Doch ich bin unsicher und glaube auch nicht, dass meine Arlecchina, wie ich sie nenne, trotz aller Ähnlichkeit, die Tote am See ist.“
„Wenn nicht sie, dann vielleicht die Dame, welche Ihr als Colombina kennengelernt? Womöglich war diese gar ihre Tochter?“, fragte Carl.
Aber der Lieutenant zuckte nur mit den Schultern. Er erhob sich und ging in die Wachstube. Dort befahl er einem Sergeanten die von Carl von Schack gewünschten Nachforschungen anzustellen. Der Junker dankte und verabschiedete sich.
Als er in seine Wohnung zurückkehrte, traf er dort den Medicus Doktor Stoer bei Friedrich an.
„Gut, dass Ihr kommt, Herr von Schack“, rief Stoer. „Euer Diener ist ohne Bewusstsein. Er muss so rasch wie möglich ins Hospital gebracht werden. Neben den Wunden am Kopf hat er innere Verletzungen erlitten, die ich hier nicht zu behandeln vermag.“
„Dann bringt Friedrich ins Hospital“, sagte Carl. „Ich will, dass er bestens gepflegt und versorgt wird und komme selbstverständlich für alle Kosten auf.“
Mit aller Vorsicht wurde Friedrich abtransportiert. Carl gab dem Doktor einen Beutel voll Münzen für Friedrichs Pflege und verabschiedete den Medicus. Dann schloss er die Tür und begab sich in sein Arbeitskabinett. Dort ließ er sich in einen Sessel fallen. Der Tag hatte es in sich. Die Nachtaktionen, der Ritt zum Herzog, der Einbruch und Raub der Nachricht, dazu Friedrichs schwere Verwundung. Morgen sollte er nach Mömpelgard aufbrechen, ohne genaue Kenntnis seines Auftrags zu haben – und ohne gepackt zu haben. Carl seufzte. Er streckte die Beine aus, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Neippergs erstaunliche Geschichte hatte ihn tief berührt. Vor zwei Jahren war es gewesen, dass er Aurelie zuletzt anlässlich der venezianischen Maske gesehen hatte. Auch Carl war auf dem Ball gewesen, von dem Neipperg erzählte, und hatte sie dann im Rosengarten getroffen. Wie ein Stich traf es ihn, wenn er an den kurzen Moment ihres Glückes dachte. Ob er sie je wiedersehen würde? Vielleicht, dass ihr Vater, der Graf von Weilingen, Aurelie längst verheiratet hatte. Zwanzig Jahre war sie jetzt, andere Frauen dieses Alters waren längst verehelicht und Mutter einiger Kinder. Vielleicht war all sein Hoffen vergeblich. Ein plötzliches Klopfen an der Haustür riss Carl aus seinen trüben Betrachtungen. Er erhob sich, um zu öffnen, ohne Friedrich war er gezwungen, alles selbst zu tun.
Draußen stand mit sorgenvoller Miene Kammerherr von Erlenburg und begrüßte Carl. „Bester Freund, ich hörte von dem Überfall auf Friedrich und bin gleich zu Euch geeilt, um Euch meine Hilfe anzubieten. Erzählt, was ist geschehen?“
Sie setzten sich in das Kabinettzimmer und Carl berichtete dem Freund von den Ereignissen des Tages.
Erlenburg schüttelte den Kopf. „Werter Carl, das ist etwas viel auf einmal, findet Ihr nicht? Der nächtliche Überfall und jetzt ein Raub am hellen Tage. Aber die Nachricht ist fort und Euch bleibt nichts weiter, als ohne direktes Wissen nach Mömpelgard abzureisen. Was ist eigentlich mit diesem Alessandro?“
„Der ist doch schon Caracanti nachgereist“, erwiderte Carl.
„Das sagte er. Aber mir war heute Mittag, als hätte ich den Mann im Park stehen sehen.“
„Vielleicht eine Täuschung.“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht“, meinte Erlenburg skeptisch. Er stand auf und stellte sich vor die an der Wand hängende Karte des Herzogtums. „Habt Ihr schon Euren Reiseweg geplant?“
„Ich werde zunächst am Neckar entlang nach Tübingen reiten“, antwortete Carl. „Von dort weiter am Fluss bis Balingen oder Oberndorf.“
„Dann gelangt Ihr in das Oberamt Rottenburg und auf österreichisches Gebiet“, sagte der Kammerherr, der die Route auf der Karte verfolgte.
„Genauer in die Grafschaft Hohenberg, die seit fast vierhundert Jahren den Habsburgern gehört“, erklärte Carl. „Da ich nach Freiburg will, komme ich um vorderösterreichisches Territorium nicht herum. Entsprechende Pässe sind in meinem Besitz. Aber entschuldigt, Erlenburg, ich sollte noch packen.“
„Ich schicke Euch meinen Franz, der wird Euch dabei helfen“, sagte Erlenburg. „Und Ihr müsst etwas speisen. Heute Abend gibt Ritter von Talheim ein Festmahl. Wir sind geladen, Ihr habt es hoffentlich nicht vergessen?“
Im ganzen Trubel war Friedrich die Einladung wirklich entfallen. Doch kam sie ihm recht, ein wenig Ablenkung mochte ihm gut tun. Erlenburg verabschiedete sich, und Carl zog sich rasch um.
Dabei fiel ihm das Heft in die Hände, das der junge Schiller am Mittag im Walde vergessen hatte. Er schlug es auf. Der verlorene Sohn, ganz nach Schubarts Geschichte des menschlichen Herzens, lautete der erste Eintrag Schillers. Neugierig las der Junker weiter, was der Jüngling im Folgenden geschrieben hatte:
Mich ekelt es vor diesem tintigen Jahrhundert. Der Feuerfunke Prometheus‘ ist erloschen. Wie Fliegen krabbeln sie auf die Keule des Herakles, und studieren sich das Hirn Mark aus dem Schädel. Die schwachsinnigen schwindsüchtigen Professores halten sich bei jedem Wort ein Fläschchen Salmiakgeist vor die Nase und lesen dabei ein Kollegium über die Kraft und weinen greinen über die Siege Caesars. Welch Preis für euren Schweiß in der Feldschlacht, daß ihr jetzt in den Scolas lebet und eure Unsterblichkeit in einem Büchersackriemen mühsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersatz eures vertanenen verpraßten Blutes, von einem Lübecker Nürnberger Krämer um Lebkuchen gewickelt – oder von einem französischen Komödienschreiber auf Stelzen geschraubt zu werden! Pfui! Pfui über die Zeit die schlappe Zeit Jahrhundert das schlappe Kastratenjahrhundert …
Schiller befleißigte sich einer kräftigen Sprache, das war schon starker Tobak, was der Sechzehnjährige da schrieb. Kopfschüttelnd blätterte Carl weiter in dem schmalen Heft. Die nächste Stelle, die er las, schien eine Art von Dialog zu zeichnen:
Der Alte schrie, während er mit der Linken sein Gesicht zerfleischte: „Wehe, wehe! Mein Fluch jagte ihn in den Tod – Er fiel in Verzweiflung!“
„Was“, sagte Franz, „er dachte an mich in der letzten schweren Stunde seines Scheidens, an mich? Welch eine Seelengröße – da schon das schwarze Tuch des Todes über ihm schwebte.“
Der Alte unterbrach ihn zornig. „Hörtest du nicht? Mein Fluch jagte ihn in den Tod, Karl ist gefallen!“
Der fremde Bote wandte sich ab, um zu gehen.
„Bleibt, bleibt!“, rief die junge Frau. „Sagt mir, was waren seine letzten Worte?“
„Sein letzter Seufzer war ‚Emilia’!“
Carl von Schack klappte das Heft zu. Begabt war er, der Schiller, das stand außer Frage. Auch wenn er wohl noch die eine oder andere Formulierung seines Textes sicher würde überarbeiten müssen. Aber ob dem Herzog die Sprache und vor allem das Schreiben selbst gefielen, das schien Carl fraglich. Herzog Karl Eugen hatte seine festen Vorstellungen, was die Lebens- und Berufslaufbahn der von ihm ausgewählten und protegierten Landeskinder betraf. Er fühlte sich wie ihr aller Vater, liebte und strafte sie nach seinem Gutdünken gleichermaßen – worin der Herzog seinem großen Vorbild und Erzieher, dem König Friedrich von Preußen, stark ähnelte. Das Heft jedenfalls würde er dem Jüngling auf geheimem Wege zurückgeben, nicht dass der begabte Eleve seinetwegen in Schwierigkeiten geriete.
Nachdem Carl von Schack mit dem Ankleiden fertig war, wollte er schon aufbrechen, als Erlenburgs Franz klopfte. Kurz zeigte er dem Mann, was zu tun war, und verließ dann die Wohnung.
Draußen ging soeben die Sonne unter. Carl lenkte seine Schritte in Richtung der inneren Stadt. Eine Kutsche zu nehmen war bei dieser Entfernung wenig sinnvoll. Bald war der Kaffeeberg erreicht. Melchior von Talheim hatte hier direkt am Berg ein artiges Haus erworben.
Melchior, von schlanker, jedoch eher kleiner Gestalt, aber kräftig gebaut und ein wohl geübter Reiter und Fechter, war eine fast geheimnisvolle Persönlichkeit. Vor zwei Jahren erst war der Ritter in die Residenz gezogen und gleich zum Hofe geladen worden. Allerdings gab es bald Zweifel über des Ritters Herkunft. Die von Talheim hatten seit etwa 1200 ihren Sitz im Dorfe Talheim nahe Heilbronn gehabt. Gerhard der Alte von Talheim war Obervogt in Lauffen am Neckar gewesen. Sein Sohn Rafan wurde württembergischer Rat und sogar Erzieher des jungen Herzogs Ulrich. Ein weiterer Nachkomme war 1534 Heerführer Ulrichs in der Schlacht bei Lauffen, Hauptmann im Schmalkaldischen Krieg und schließlich Obervogt zu Beilstein und Bottwar. Der letzte im Ort ansässige Herr von Talheim war Hans Ulrich, mit dessen Tode 1605 die Linie erlosch.
Ein Philipp Melchior von Talheim aus Rauenberg bewarb sich um das freigewordene Talheimer Lehen, konnte seine Verwandtschaft jedoch nicht nachweisen. Er verstarb 1630. Zwischen ihm und Melchior von Talheim, der etwas älter als Carl war, klaffte eine Lücke von nahezu hundert Jahren. Worauf bezog sich also die Verwandtschaft? Wenn Melchior kein von Talheim war, wer war er dann? Diese und ähnliche Fragen sowie Gerüchte machten die Runde.
Doch Melchiors offenes Wesen und vor allem sein immenser Reichtum und seine große Freigiebigkeit trugen bald dazu bei, dass etwaige Zweifel, die seine Herkunft betrafen, verflogen oder jedenfalls nicht mehr offen geäußert wurden. Melchior führte dazu eine flinke Klinge und war jederzeit bereit, seine Herkunft mit der Spitze seines Degens nachdrücklich zu beweisen. Nach einigen erfolgreichen Duellen wuchs auch in dieser Hinsicht rasch der Respekt vor dem jungen Talheim.
Melchior pflegte dazu die Familiengeschichte und -tradition und nutzte jede Gelegenheit, diese positiv hervorzuheben. Erst im Mai hatte Melchior genau am 13. mit einem opulenten Bankett die siegreiche Schlacht von Lauffen gefeiert. In dieser hatte 1534 sein Vorfahr Bernhard von Talheim unter den Fahnen des hessischen Landgrafen Philipp die österreichische Besatzung verjagt und somit für die Restitution der bisherigen Herrschaftsverhältnisse unter Herzog Ulrich gesorgt. „Ohne Bernhard kein Ulrich und keine Reformation“, hatte Melchior zu vorgerückter Stunde gerufen.
Der Spruch wurde umgehend Herzog Karl Eugen hinterbracht. Der Fürst war gnädiger Stimmung und gab dem Ritter lachend Recht. Melchior, der wohl ahnte, dass er die Sache gefährlich überdehnt hatte, beeilte sich, zur nächsten Jagd Karl Eugens einen gewichtigen Teil auszurichten. Er sorgte für die Weine und andere Verköstigungen in den Jagdpavillons und für einen Gutteil der zusammengetriebenen hundert Rothirsche, zwanzig Damhirsche, hundertzehn Rehböcke, zweihundert Wildschweine und Frischlinge, ungerechnet einer großen Zahl Dachse, Füchse, Hasen, Fasanen, Feldhühner und Wildenten. Woher Melchior von Talheim das ungeheure Vermögen nahm, mit dem er die herzoglichen Extravaganzen finanziert hatte, wusste niemand. Gerüchten von Goldmacherei und Hexenwerk, die da und dort kursierten, traten die aufgeklärten Kreise des Hofes mit Vehemenz entgegen, und so verstummten sie schließlich. Dennoch hätte Carl gern gewusst, woher Melchior seine schier unbegrenzten Mittel nahm. Ob nun aufgeklärt oder nicht, erschien ihm die Sache ein wenig unheimlich.
Heute Abend jedoch ruhten diese Fragen und Carl betrat das hell erleuchtete Stadthaus. Ein Diener nahm Mantel und Hut in Empfang. Ein anderer führte Carl in den Empfangsraum, wo bereits eine fröhliche Runde junger Adliger versammelt war. Es waren dies alles Söhne aus bestem altwürttembergischem Adel, was Melchior von Talheims gefestigte Stellung bewies. Auf den Sesseln und Stühlen saßen lärmend die verschiedensten Persönlichkeiten. Rechts der etwas rund geratene Hermann von Bilfinger, dessen Schwester unglücklich mit dem preußischen Adligen Karl von Maltzahn verheiratet war. Neben ihm Alois von Waldburg-Zeil-Hohenems. Ein stattlicher Jüngling, bereits mit Maria Walpurga von Harrach-Hohenems-Rohrau verlobt und auf dem Weg, am Hofe eine Karriere zu machen. Ihm zur Seite der schon ziemlich angetrunkene Hans Seutter von Lötzen, Secondlieutenant, dem es in der herzoglichen Armee zu eng war und den es stark ins Bayerische zog. Erste geheime Kontakte, wusste Carl, waren bereits geknüpft.
Ruhiger und fast melancholisch in sich gekehrt saß daneben der kaum siebzehnjährige Wilhelm von Gültlingen. Seine Familie hatte vor 250 Jahren das Erbkämmereramt von Württemberg erlangt und somit auch einen Anteil am Schloss Hohenentringen. Es war ein reiche Familie, zu den gültlingschen Besitzungen gehörten Neuenburg, Sindlingen, Poltringen, Oberndorf, Deufringen, Pflummern, Pfäffingen, Zavelstein, Vollmaringen sowie Güter in der Eifel. Herzog Karl Eugen hatte den Jüngling gern an seinen Hof geholt. Doch dieser, stark pietistisch erzogen, konnte mit dem Ludwigsburger Treiben wenig anfangen. Daher hatte er sich dem ebenso alten Franz von Linden angeschlossen. Dieser wollte demnächst ein Jurastudium in Tübingen beginnen und galt als hochbegabter Planer.
Ganz anders als die beiden Jünglinge gebärdeten sich der blonde, hoch gewachsene Hermann Schott von Schottenstein und sein enger Freund Maximilian von Woellwarth. Schotts Vetter, Johann Friedrich Karl Schott von Schottenstein, war fürstlich nassauischer Oberjägermeister und hatte 1770 das Rittergut Bläsiberg erheiratet. Schott war überaus selbstbewusst und stets bereit zu einem kühnen Streich oder Ulk und ein wahrer Schürzenjäger vor dem Herrn. Sein Mitstreiter Maximilian von Woellwarth platzte fast vor Adelsdünkel. Seine Familie hatte unter Kaiser Karl V. die Blutgerichtsbarkeit verliehen bekommen, war aber sonst hoch verschuldet.
Der letzte in der Runde war der meist abseitsstehende Ferdinand von Montmartin. Sein Vater war drei Jahre lang Herzog Karl Eugens Premierminister und Geheimratspräsident gewesen. Seine rigide Steuerpolitik hatte ihn nach einer Klage der Landstände aus dem Dienst scheiden lassen. Vor einigen Jahren war Friedrich Samuel Graf von Montmartin aus dem Herzogtum fortgezogen und zum Ritterhauptmann des Kantons Altmühl geworden. Seinen Sohn Friedrich hatte er bei seiner Schwester in Ludwigsburg zurückgelassen, da die leibliche Mutter schon früh verstorben war. Ferdinand von Montmartin war drei Jahre jünger als Carl von Schack. Er wirkte mit seinem Tituskopf und den strengen Gesichtszügen wie eine Gestalt aus dem antiken Rom. Wie sein Vater war er ein heller Kopf, hatte sich aber bislang nicht entscheiden können, welcher Art seine künftige Laufbahn sein sollte.
„Wie geht es unserem nächtlichen Helden? Habt Ihr noch weitere Frauenleichen aufgefunden?“, fragte Hermann Schott von Schottenstein lautstark.
„Erzählt, was ist passiert?“, ließ sich auch der Gastgeber vernehmen.
Carl ärgerte sich. Erlenburg musste geplaudert haben, was ihm nicht recht war. Wer wusste schon, an wen alles die Geschichte weitergetragen wurde. Hoffentlich hatte der Freund wenigstens über den Auftrag geschwiegen.
„Neipperg hat uns berichtet, was Ihr in der Nacht beim Schloss Monrepos erlebt habt“, rief Maximilian von Woellwarth. „Eine schöne Geschichte. Ihr freut Euch auf ein Stelldichein und die Dame fällt Euch tot zu Füßen!“ Von Woellwarth lachte laut über seinen makaberen Witz.
„In der Tat, eine peinliche Situation“, bestätigte Carl lässig. Erlenburg hatte zum Glück doch geschwiegen. Nur Neipperg war geschwätzig gewesen.
„Lasst Schack“, mischte sich Erlenburg ein. „Der Junker hat sich heute genug mit Mord und Totschlag beschäftigt. Wie wäre es mit einem Kartenspiel?“
„Eine gute Idee“, rief Seutter von Lötzen und erhob sich schwankend.
„Aber erst darf ich die Herren zur Tafel bitten“, ließ sich da der Gastgeber vernehmen.
Zwei Lakaien öffneten auf seinen Wink die große Flügeltür zum Speisesaal, in dem eine lange Tafel mit Köstlichkeiten und besten Weinen, von Dutzenden weißer Kerzen hell erleuchtet, auf die elf jungen Leute wartete.