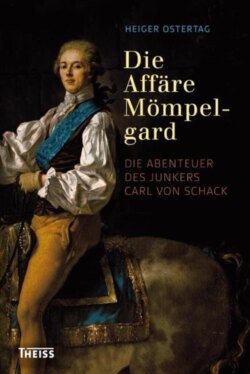Читать книгу Die Affäre Mömpelgard - Heiger Ostertag - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hofgespräche und andere Intrigen
ОглавлениеDer Juni des Jahres 1776 war im Lande Württemberg überaus gut geraten; die Tagestemperaturen lagen bei warmen, aber nicht zu heißen zwanzig bis zweiundzwanzig Grad. Die Nächte waren angenehm frisch, und es fiel mitunter ein kräftiger Regen. Die Bauern freute es, sie hofften auf reiche Ernte im Herbst, und auch die landesherrlichen Gärten blühten und gediehen kräftig. Die Beete an den großen Prachtalleen der Schlösser Solitude, Monrepos und Hohenheim prunkten in allen Blumenfarben und zeigten die vielfältigsten Formen. Ein besonderes Schmuckstück aber war im neuen Ludwigsburg das frühere Jagdschloss Eberhard Ludwigs, das seit dem Dazukommen der Kavaliersbauten und der hochbarocken Schlosskirche längst sein altes Dasein hinter sich gelassen hatte und vom jetzigen Herzog Karl Eugen vor fünfzehn Jahren zur Residenz erkoren worden war: Rosenfelder legten ihren schweren Duft über die bekiesten Wege, zahlreiche große und kleine Brunnen plätscherten oder ließen Fontänen springen. Vielerlei Bäume säumten die Symmetrie der Wege, und das satte Grün der französischen Taxushecken lenkte die Blicke zum Zentrum, dem Südflügel des Schlosses.
Durch eben diesen Park schritten an einem warmen Juninachmittag zwei adlige Herren, die, ganz ins Gespräch vertieft, mit keinem Blick die sie umgebende Natur wahrnahmen. Beide zeigten sich leger gekleidet, ohne die üblichen Hofspitzen und ohne die Pflichtperücken. Der eine der Spaziergänger, ein Mann in den Dreißigern, sozusagen in den besten Jahren, war von recht hagerer, fast düster wirkender Gestalt. Das Gesicht mit den scharf blickenden Augen wirkte blass, was durch die samtblaue Kleidung verstärkt wurde. Um seinen Mund lag ein mattes Lächeln, das wie eingegraben schien.
Der andere Herr, dunkelblond, mit einem leicht kantigen Gesicht, deutlich jünger als der Erstere, war in hellen Farben gewandet. Seine offene, heitere Stirn war hochgewölbt; die Nase trat scharf aus dem Gesicht hervor. Die Lippen bildeten feine Linien, und in den Mundwinkeln lag ein kaum bemerkbares launiges Lächeln verborgen. Die braunen Augen blickten wach umher und betrachteten aufmerksam und freundlich Menschen und Dinge. Sie sahen aber, die starken Brauen unwillig zusammengezogen, durchdringend auf alles, was einen aufrechten Mann beleidigen mochte. Von mittlerer Statur, kräftig und regelmäßig gebaut, wirkte der Herr vom Auftreten sehr militärisch.
Gerade ergriff er das Wort: „Hört, werter Herr von Erlenburg“, er richtete seinen schlanken Körper in die Höhe, „wir wollen einmal nicht von diesen geheimen Bündnissen und Artikeln plaudern. Ich will heute nichts davon wissen. Ständig seid Ihr am Pläneschmieden und Ränkeschlingen. Das ist doch alles nichts, jeder weiß doch, was im Lande los ist. Und der Herzog … aber ich will mich nicht an Karl Eugen versündigen: Bewahrt die Contenance, die Ruhe. Lassen wir derlei Themen, wenn Ihr derzeit davon nicht sprechen wollt – wobei es mich doch interessiert hätte, wie Ihr unsere aktuelle Lage im europäischen Kräftefeld beurteilt.“
Erlenburg blickte ihn von der Seite an. „Werter Kollege von Schack, wir sind uns doch beide einig, auch nach dem Thronwechsel in Frankreich von dem fünfzehnten Ludwig zum sechzehnten wird sich unsere Haltung gegenüber diesem übermächtigen Nachbarn kaum ändern.“
Der Angesprochene hob leicht eine Braue. „Ich teile Eure Ansicht, doch wenn Ihr an die aktuelle Finanzschwäche des Hofes zu Versailles denkt, da ist einiges möglich. Aber Geld ist auch hierzulande ein knappes Gut, die herzoglichen Eskapaden …“ Er hielt mitten im Satz inne. „Nun ja, Ihr wisst Bescheid.“
Der Jüngere schwieg, fuhr dann aber nach einer kurzen Pause, vom Gegenstand seiner Rede mitgerissen, fort: „Wenn wir gerade beim Thema sind, dürfen wir nicht die derzeitigen Unruhen in den amerikanischen Kolonien Englands übersehen. In den Staaten Neuenglands gärt es allenthalben und London verfährt recht ungeschickt mit dem Ansinnen seiner Bürger. Es sollte mich wundern, wenn König Georg mit der dortigen Revolte nicht noch größere Probleme militärischer wie wirtschaftlicher Art bekäme.“
„Ihr meint“, warf Erlenburg ein, „dass das englische Engagement auf dem Kontinent zwangsläufig zurückgehen wird?“
Schack führte eine Hand zum Kinn und überlegte kurz. „Tja, die Zeiten des Siebenjährigen Krieges sind dreizehn Jahre her, als englisches Geld Preußen gegen das übermächtige Bündnis gleichsam Resteuropas am Leben hielt. Das zähe Preußen behielt Schlesien, England dagegen gewann ganz Nordamerika und Indien. Ein guter Preis, gewiss. Aber, wie gesagt, Albions Einfluss geht stark zurück. Die Amerikaner scheinen unabhängig werden zu wollen. Und Englands Festlandsdegen Preußen ist ruhiger geworden, teilt sich heute sogar mit seinen damaligen Gegnern Russland und Österreich die fette polnische Beute.“
„Maria Theresia und Friedrich“, ergänzte der andere, „warten gemeinsam darauf, auch noch Bayern zu zerfleddern, wenn der alte Maximilian ohne Erben stirbt.“
Beide schwiegen gedankenvoll. Sie standen an einem der Springbrunnen, betrachteten die fallenden Wasserstrahlen, die glitzerten und funkelten. An einer Stelle bildete sich ein schmaler Regenbogen.
Mit einem maliziösen Lächeln nahm Erlenburg das Gespräch wieder auf: „Wenigstens kann Letzteres unserem Herzog nicht passieren, ist es doch bereits die zehnte Verbindung, wenn man das so nennen will, die Karl Eugen eingeht.“
Herr von Schack nickte zustimmend, ging aber nicht weiter auf das Gesagte ein.
„Der gute Leutrum hätte es sich kaum träumen lassen, dass seine Franziska einmal eine Gräfin von Hohenheim würde“, sprach Erlenburg weiter. „Zunächst hat seine Durchlaucht ja beide an den Hof gezogen. Nachher wurde er deutlicher, und es war letztlich nur noch Frau von Leutrum selbst, die kommen durfte.“
„Nun ja, sie war aber eher zurückhaltend und erst einmal nicht im Geringsten bereit, dem stürmischen Werben ihres allergnädigsten Herzogs ohne Widerstand einfach so nachzugeben“, erwiderte Schack. „Und dem Hofzeremoniell gegenüber, Ihr wisst, welches ich meine, hat sich Franziska bis heute strikt verweigert!“
Erlenburg, der in formalen Dingen und im Hinblick auf die Hofetikette ein fast gutes Gedächtnis hatte, nickte und zitierte genüsslich: „Vermöge des neuen Hofceremoniels unseres allergnädigsten Herzogs, seiner Durchlaucht Karl Eugen, wird hiermit allen Frauenzimmern, die nicht zu der Fahne des Herzogs geschworen haben, auf das Strengste untersagt, am Hofe blaue Schuhe zu tragen, und im Gegentheil allen denen, die sowol jetzo als auch künftig gewürdigt werden, ihrem gnädigsten Landesherrn ihre Gunst und Neigung aufopfern zu dürfen, bei der höchsten Ungnade anbefohlen, niemals ohne dieses Unterscheidungszeichen der blauen Schuhe am Hofe zu erscheinen.“
Erlenburg lachte laut auf. „Wie sich die Landesstände darüber wieder einmal das Maul verrissen. Die Franziska ist keine große Schönheit, wie ich finde“, fuhr er fort, „trotzdem wurde sie die offizielle Mätresse des Herzogs. Sie kennt ihren Preis, erst wird sie Gräfin von Hohenheim, und wenn die Ehe Karls mit Friederike Elisabeth Sophie dann doch geschieden wird, möglicherweise Herzogin und damit neue Landesherrin!“
„Eine gewisse Natürlichkeit ist Frau von Leutrum nicht abzusprechen“, erwiderte Schack. „Wenn sie auch keine Beauté nach dem Geschmack der Zeit ist, sprühen ihre Augen doch von Geist; vor allem scheint Franziska einen guten Einfluss auf Karl Eugen zu haben. Der Herzog ist längst nicht mehr so cholerisch und unüberlegt in seinem Tun und Lassen. Vielleicht schafft sie es ja noch, unseren wilden, unberechenbaren und verschwendungssüchtigen Landesherrn zu einem fürsorglichen Landesvater umzuerziehen.“
„Still, still, Bester von Schack, hier haben selbst die grünen Büsche Ohren! Auch wenn wir in unseren Positionen vieles wissen, es muss ja nicht gleich alles ausgebreitet und erläutert werden“, wehrte sein Gesprächspartner erschrocken ab. „Es geht mir übrigens nicht nur um ‚Ohren‘, ich mache mir derzeit grundsätzlich über die Sicherheit im Park einige Gedanken.“
Erlenburg schaute sich aufmerksam um und fuhr dann in einem etwas leiseren Ton fort: „Ihr erinnert Euch noch des armen Tagelöhners aus Ludwigsburg, welcher, sonst verständig und fleißig, sich steif und fest einbildete, im Park lägen Granaten, und der zu jeder Freistunde hier eindrang, in den Alleen danach suchte, Kiesel und Quarz aufhob und betrachtete? Die Leute hielten ihn für harmlos verrückt, man ließ ihn daher, wenn nicht der Herzog im Schloss weilte, gewähren. Und eines Abends fand er in einem der dunkelsten Gänge, eifrigst auf Granaten erpicht, einen Sack mit Musketen, alle wohl geladen. Das Sonderbarste war, dass keiner wusste, wie diese dorthin geraten und was die Absicht der Lagerung gewesen war. Weder in der Waffenkammer des Schlosses noch im Zeughaus wurden Musketen vermisst, ein seltsamer Vorfall. Ihr seid doch mit derlei Dingen vertraut und beschäftigt, haben Sie eine Erklärung?“, wandte er sich fragend an von Schack.
Schack schüttelte den Kopf. „Wisst Ihr, Verehrtester, ich glaube nicht an irgendwelche Verschwörungen. Unsere braven Schwaben ersterben alleruntertänigst vor den durchlauchtigsten Herrschaften und rufen Vivat, wenn diese in ihren Staatskarossen nach Monrepos, nach Ludwigsburg, Hohenheim oder sonst wohin zur Erholung von ihren anstrengenden Staatsgeschäften fahren. Die Bürger machen ihr tiefes Kompliment vor dem Wagen der schönen Hof-, Haupt- und Leibmätresse; der heidnische Mohr, welchen Serenissimus aus der sündhaften Wasserstadt Venedig mitbrachte, erregt ihr respektvolles Staunen. Nur, wie sie sich gegen uns Hofleute zu verhalten haben, wissen sie so recht nicht. Aber wir könnten unter Umständen sehr gefährliche Persönlichkeiten werden, also tut man am besten, auch vor uns tief den Hut abzuziehen. Welch seltsames Leben und Treiben in den Straßen und auf den Gassen! Welch treue Bürger, welch gelehrte Hofpoeten, stolze Hofmarschälle und kühne Heiducken.“
„Bester Schack, Ihr beliebt, wieder einmal zu spotten. Unterschätzt unsere braven Schwaben nicht. Wenn wirklich einmal die Volksseele überkochen würde, nicht auszudenken.“
„Ach, die Schwaben!“ Schack lachte laut. „Die Schwaben sind doch ein biederes, putziges Völkchen.“ Er blieb kurz stehen. „Mein lieber Herr von Erlenburg, nirgends ist es ruhiger als bei uns in Ludwigsburg, Tübingen und Stuttgart. Mögen die Landesstände auch Klage führen, ja Klagen gewinnen. Die schwäbische Bürgerpflicht ist Sparsamkeit und Ruhe.“
Die beiden Männer waren inzwischen nach Süden abgebogen und bewegten sich auf die Kavaliersbauten zu. Schack hielt inne. Auf der langen Chaussee, die hoch zur Solitude und der dortigen Jagd führte, kam langsam eine Kutsche in Sicht.
„Schaut, der Dannecker kommt, ohne Herzog offenbar, wen mag er bringen?“
Erlenburg blickte kurz hin, schien aber nicht weiter interessiert. „Keine Ahnung, wird schon jemand Rechtes sein, bändigt Eure Neugier. Heute Abend wisst Ihr sicher mehr. Wir sehen uns doch an der Tafel?“ Und ohne die Antwort, die er zu kennen meinte, abzuwarten, verabschiedete sich der Kammerherr von Erlenburg, „Bis dann, lieber Freund“, und schritt die Stufen zum Bau empor, in dem er sein Logis hatte.
Junker von Schack wartete indes noch ab. Er schaute zu, wie die Kutsche vorm Südportal vorfuhr und anhielt.
Dannecker sprang ab und öffnete behände den Kutschschlag. Eine dunkel gekleidete Gestalt stieg eilig aus der Kutsche, den Hut tief über das Haupt und die graue Perücke gezogen, mit der Hand wie unabsichtlich ein Schnupftuch vor das Gesicht haltend, und verschwand rasch in der Pforte.
„Wer mag das nur sein?“, wiederholte Schack für sich.
Dannecker war für den Herzog, wie Schack wusste, fast eine Vertrauensperson. Karl Eugen protegierte sogar Danneckers Sohn Johann Heinrich. Vor fünf Jahren, im Alter von dreizehn, war dieser persönlich beim Herzog vorstellig geworden und hatte um die Aufnahme in die Pflanzschule auf der Solitude gebeten. Seinem Gesuch wurde stattgegeben. Bald erkannten die Ausbilder das künstlerische Talent Danneckers und er wurde in eine Bildhauerausbildung zu Adam Bauer und Johann Valentin Sonnenschein gegeben.
Sinnend stand Schack da, schüttelte dann den Kopf. Wohin manchmal die Gedanken eilten? Er stieg gleichfalls die Stufen zu der Tür empor, durch die sein Begleiter verschwunden war.
Carl von Schack saß an seinem Sekretär vor einem der Fenster seiner Privatgemächer. Er las konzentriert in verschiedenen Papieren und studierte intensiv eine vor ihm aufgerollte Karte, die das Herzogtum Württemberg mit all seinen Amtsbezirken zeigte.
Verglichen mit den Wohnungen der anderen Herren des Hofes war seine von geradezu luxuriöser Größe. Vier Räume, im Hochparterre gelegen, wurden von ihm bewohnt und genutzt. Wer die Tür zu seinen Gemächern öffnete, gelangte zunächst in einen schmalen Vorraum, welcher zur Ablage der Mäntel und Hüte diente und in dem meist der Bedienstete ruhte. Links führte eine Tür in ein kleines Schlaf- und Ankleidezimmer, dessen Fenster auf den Innenhof hinausging. Ein schmales Bett, ein großer Schrank und eine Truhe, an den Wänden ein paar Jagdstiche, mehr war darin nicht zu finden. Rechts gelangte der Besucher in eben den Raum, in welchem von Schack sich im Augenblick befand. Er war Arbeitszimmer und Bibliothek in einem.
Auf dem Boden und auf Hockern verteilt waren verschnürte, teils auch geöffnete Aktenbündel aufgeschichtet. Etliche juristische Codices und gelehrte Fachbücher lagerten am Fenster. Auch gab es in der einen Ecke ein Behältnis mit weiteren Kartenrollen des Heiligen Römischen Reiches und anderer europäischer Territorien. In der Hauptsache aber enthielt der Raum Bücher, jedes Plätzchen war mit ihnen angefüllt. Wenn durch die Fenster die Mittagssonne drang, war es angenehm hell, sonst herrschte eher Dämmerlicht, das schon nachmittags das Entzünden verschiedener Kerzenkandelaber notwendig machte.
Am hinteren Ende der Wohnung lag ein weiteres Zimmer. Auch hier bedeckten Bücher in mächtigen Regalen alle Wände vom Boden bis zur Decke, es war in der Tat eine weitere, riesige Bibliothek. In der Dunkelheit, und weil eine Staubdecke sie gleichmäßig überzog, konnte man die endlos aufgetürmten Reihen selbst für Wände halten. In der Mitte des Raumes standen ein mächtiger Tisch und ein Sessel. Ein Schreibzeug stand auf dem Tisch, Federn, Löschsand, Papier und Tinte waren reichlich vorhanden, etliche Briefe lagen wie willkürlich verstreut.
Schack stand auf, durchmaß beide Räume mit großen Schritten. Am Tisch in der hinteren Bibliothek hielt er inne und griff dort nach einem der Schreiben, einem mehrseitigen Brief.
Er kehrte um und lief zu seinem Sessel am Schreibtisch, wo das Licht zum Lesen besser war, und setzte sich nieder. Herr von Schack drehte die Seiten in der Hand, er kannte den Inhalt, begann aber trotzdem erneut zu lesen:
Mein bester Carl!
Ich habe eine ganze Reihe von Briefen von dir erhalten, und wenn ich sie alle beantworten wollte, was hätte ich alles zu schreiben? Gerne wäre ich zum einen dir zu Diensten und gäbe dir mit Freuden die Information, nach der du in deinem Schreiben dringlich verlangtest.
Allein, ich habe keine Kenntnis von dem, was dir so sehr am Herzen liegt. Wo immer ich fragte und forschte, war es vergeblich, und so kann ich dir nicht geben, was dir fehlet. Zum zweiten ist allenthalben in den Köpfen viel Verwirrung und Unsicherheit über die Lage in deutschen Landen. Doch will ich versuchen, dir das zur Kenntnis zu bringen, was dich womöglich zu interessieren vermag. Denn du bist seit einiger Zeit im Herzogtum Württemberg im Dienste des Herzogs Karl Eugen tätig. Von dem Landhause eines Hagestolzes in das Schloss eines Landesherren, ein recht eigenartiger Lauf der Zeit, wie ich meine.
Nun, das Tun deines Landesherrn wird hier sehr wach betrachtet und vielfältig kommentiert; insbesondere sein Verhalten im Hinblick auf die Verlobung seiner Nichte. Ich hoffe nur, dass du dich nicht zu sehr mit seinem Geschicke verbunden hast. Du weißt, auch wenn du bestens über die Dinge im Land Bescheid bekommst, eine Lenkung der Ereignisse ist fast ausgeschlossen. Aber, muss ich dir wirklich Vorsicht anraten?
Ich will den Blick auf mich selbst hinwenden. Hier im preußischen Sanssouci ist alles beim Alten – und dies ist gewiss wörtlich zu nehmen. Nach den langen Jahren des Krieges scheint König Friedrich jetzt doch schon länger geneigt, die Friedenstaube zu hegen und dem Lande Ruhe und neue Kraft zu schenken.
Der König hat endlich entdecket, was einem jeglichen Herrscher überhaupt gut ansteht, zu entdecken und folgerichtig umzusetzen: neues Land auf eine friedliche Art und Weise zu erobern!
Da ist die Odermelioration, die Urbarmachung und Eindämmung des Oderbruchs. Wenn sie gelinget, wird für über zweihundert Jahre Neuland gesichert sein. Siedler lockt Friedrich dazu aus allen Ländern, vor allem aus Holland und der Schweiz. Freie Bauern, eigentlich ein Unding in Preußen, wo der Grundherr seine alten Rechte fest bewahrt. Was daraus wohl werden wird?
Zum anderen scheint der „Alte Fritz“, wie ihn das Volk zu nennen pfleget, auch die polnische Frage geschickt zu lösen gewillt. Die Teilung, über die du dich kürzlich mokiertest, hat durchaus ihren Sinn. Weg mit dem jahrhundertlangen Schlendrian und der ganzen polnischen Wirtschaft und her mit preußischer Zucht und Ordnung – du wirst sehen, wie das Land wieder aufblühen wird! Nur österreichische Schlamperei und die russische Knute – beide Staaten sind natürlich dabei und bedienen sich fröhlich mit – wollen mir in das Bild nicht passen.
Doch lassen wir die Tagesgeschäfte, ich schreibe dir zum Schluss noch eine verlässliche und wichtige Nachricht: Im späten Juni wird ein gewisser Caracanti mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Offiziell reist er im Auftrage deines Herzogs, der Caracanti seit zehn Jahren, aus seiner Zeit in Venedig, kennt, durch die Lande als Konsistorialer umher, im Eigentlichen aber – doch erfahre es von Caracanti selbst, was ihm in Wahrheit zu tun obliegt.
Ich rate dir, nimm seinen Auftrag an, möglicherweise kommst du dann auch in eigener Sache weiter. Ein Treffen wird sich von selbst ergeben, sei nicht ungeduldig. Caracanti hat seine eigenen, oft eigenartigen Methoden, Kontakt herzustellen.
Ach, Carl! Uns beide treibt eine seltsame Laune des Geschicks; wohl uns, dass ein Punkt in unserm Denken ist, wo wir uns beide wiederfinden, die Arbeit, denn im Äußeren sind wir für längere Zeit nicht in der Lage, zusammenzukommen.
Dein letzter Brief aus Ludwigsburg hat mir gezeigt, wie sehr du in die ganze Angelegenheit verstrickt bist, in dem du gar nicht aus dir selbst kömmst; du tappst mit deinen Überlegungen sehr im Dunkelen herum.
Es ist mir umso sonderbarer, da du meistens vergangene Dinge erzählst, die dich bewegten, als sie geschahen. Glaubst du wirklich an die Realität der Gefahren, die du anführst; oder ist es die Illusion der Darstellung, die mir manchmal für deine Nerven ein wenig bange macht?
Doch lass das gut sein; ich weiß nicht warum, aber ich hoffe das Beste für dich. Die Folge deiner Bekanntschaften und deiner geheimen Aktivitäten machen mir eine vollkommene Krise wahrscheinlich. Also, nutze das Treffen und ziehe aus dem, was Caracanti dir berichten wird, deine eigenen Schlüsse.
Ich grüße, oh trefflicher Freund,
Dein Vetter
Otto Friedrich Ludwig von Schack,
Leutnant wie Malteserritter
Allhier
Carl von Schack legte das seltsame Schreiben langsam beiseite. Otto Friedrich hatte schon Recht, seine Situation war eigen. Seit fünf Jahren war er nun im offiziellen Dienste des Herzogs, erst als Kammerjunker, dann als richtiger Kammerherr. Aber mit den eigentlichen Hofgeschäften, den ganzen Schranzendiensten und Liebhudeleien hatte er nichts zu tun. Denn die Aufgabe, die er wirklich zu erfüllen hatte, beschäftigte sich mit ganz anderen Dingen, als zu wissen, welche Strumpf- beziehungsweise Schuhfarbe am Hofe der offiziellen Verlautbarung des Herzogs entsprach oder welche seinen geheimen, ihm selbst oft nicht ganz deutlichen Wünschen am nächsten kam. Oder welches Bonmot, welche Petitesse der wirkliche Kammerherr Baron von Elritz beim letzten Cour des Dames seiner Begleitdame in das hübsche rosa Öhrchen flüsterte, nebst Duellfolgen am kommenden Freitagmorgen.
Obwohl, diese Dinge zu wissen, war ebenfalls recht nützlich – neben den genauen Kenntnissen über das öffentliche und private Geschehen im Lande; das Wissen über die zahlreichen Klüngeleien, Pläne und Plänchen der Landschaften – der Vertretung der Bürger –, der Ständegruppen, der Innungen und Zünfte, des Oberkonsortiums, der Pastoralbehörde und wie sie alle hießen. Denn Carl von Schack, wiewohl erst fünfundzwanzig Jahre alt, aber von bester württembergischer Familie, war so etwas wie der zentrale Kopf der herzoglichen geheimen Polizei – intern auch als Landesgeheimpolizei bezeichnet –, der Fachmann für politische Umtriebe im Inneren und für Ranküne und Geheimdiplomatie im Äußeren.
Carls Eltern waren früh verstorben, und er hatte die Jugendjahre bei entfernteren Verwandten in Mecklenburg verbracht – Abkömmlinge schwedischer Reiterführer, in deren Haus das Geschäft des Krieges in fast altritterlicher Manier hochgehalten wurde. So wurde Carl zum exzellenten Degenfechter, dem die spanischen und französischen sowie vor allem die berühmten Finten der Gascogne bestens geläufig waren. Leicht erlernte er Stoß, Parade, Finte, und bald führte Carl die ganze Schule richtig, und mit seiner blitzschnell zuckenden Klinge fast spielerisch, zur Befriedigung seines Lehrers durch.
Auch andere Künste lernte er rasch. Dem Oheim, der Baron hieß ebenfalls Carl, gehörte nebst anderen stattlichen Gütern ein größeres Gestüt. Carl saß daher seit frühester Jugend den ganzen Tag im Sattel und konnte seine natürliche Begabung für die Reitkunst voll entwickeln und ein kühner, ausdauernder Reiter werden. In Mecklenburg gab es zahlreiche Gewässer, Seen, Tümpel, kleine Flüsse, sodass Carl sogar in der wenig bekannten Kunst des Schwimmens bald zuhause war.
Der Major war ein Hagestolz gewesen. Die Stelle der Frau des Hauses hatte eine Tochter seiner älteren Schwester, eine verwitwete Freiin zu Baringdorf eingenommen. Tante Gritta, weit über vierzig und sehr fromm, hatte nachdrücklich, zwar mütterlich liebevoll, aber unerbittlich in den Forderungen dafür gesorgt, dass der junge Carl von Schack mithilfe von Privatlehrern in strenger protestantischer Religiosität erzogen, aber auch in der Kunst der Hofetikette unterwiesen wurde. Darüber hinaus lernte Carl von seinen Hofmeistern Französisch und Latein sowie etwas Englisch von einem alten Seemann, der bei dem Onkel sozusagen das Gnadenbrot genoss.
Sieben Jahre gingen ins Land. Der junge Herr, wie ihn die Bediensteten nannten, war ständig unterwegs, verfolgte aber auch mit Interesse die gutsherrliche Landwirtschaft – und las, ja verschlang Massen neuerer und älterer Bücher, was für einen Landjunker wahrlich erstaunlich schien. Er hatte sogar einmal die Messe in Leipzig besucht und stand seitdem in Kontakt mit der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung.
Eines Tages verkündete der Oheim, er sei als Vertreter der mecklenburgischen Ritterschaft zum Hoffest nach Potsdam geladen. Anlass sei der siebte Jahrestag des Endes des Siebenjährigen Krieges, und Carl solle ihn begleiten. Nach einer einwöchigen Fahrt kamen sie in Potsdam an. Die Residenz war eine einzige Baustelle, zum Teil sah man noch immer die Schäden, die russische und französische Aufklärungskavallerie der Stadt zugefügt hatten. Überall zeigten sich in ihren blauen, recht abgerissenen Uniformen Soldaten und Invaliden. Die Bevölkerung war eher zurückhaltend als freudig oder im Siegestaumel. Zu lange hatte der Krieg gedauert und zu schwer fühlte man noch immer die Wunden.
Auf dem Empfang in Sanssouci, der Carl in seiner Einfachheit und Kargheit eher enttäuschte, war er in ein Gespräch mit den württembergischen Gesandten Graf zu Weilingen geraten. Dieser riet ihm, seine Talente doch dem Herzog von Württemberg, Karl Eugen, zur Verfügung zu stellen. Der baue gerade seine Armee auf und habe seine Residenz verlegt. Neuer Hof, neues Glück, dort könnte ein junger, begabter Sohn aus bestem Adel, denn der Name Schack habe in Württemberg einen guten Klang, seinen Weg nach oben gehen. In Preußen sei alles eher recht karg und – der Gesandte flüsterte – spartanisch!
Carl hatten weniger die Aussichten auf eine „Karriere“ gereizt; er fühlte sich wohl mit seinem Stand, Land hatten seine Eltern ihm zur Genüge hinterlassen, und der Oheim war stets bereit, ihm finanziell beiseitezustehen. Nein, es war etwas wie Abenteuerlust gewesen, was den Junker berührt hatte und der Blick in die braunen Augen der noch sehr jungen, kaum vierzehnjährigen Tochter des Gesandten, deren schlanker Wuchs, die bereits hohe Gestalt und knospende Schönheit ihn mit einem neuen, berauschenden Gefühl erfüllte. „Kommt zu uns nach Württemberg! Bitte, ich würde mich freuen, Euch in meiner Nähe zu wissen“, hatte sie ihm zugelispelt, als er ihr mit einer Verbeugung das Tuch überreichte, welches Aurelie, so hieß sie, entfallen war. Dann war sie mit ihrem Vater weitergeschritten; er hatte ihr verwirrt nachgestarrt, bis ihn der Oheim fragte, was ihm denn fehle.
Die nächsten Wochen überlegte Carl, was Aurelie von Weilingen wohl gemeint habe; dann entschloss er sich zum Handeln: Er wollte sein Glück im heimischen Württemberg suchen! Er sprach mit dem Oheim, doch es dauerte, bis dieser überzeugt und alles geregelt war. Ein gutes halbes Jahr nach dem Ball reiste Carl von Schack im Februar des Jahres 1771 endlich ins Herzogtum Württemberg ab.
Seine guten Empfehlungen und sein vorbildliches und offenes Auftreten nahmen den Herzog sofort für ihn ein. Er wurde in die Hofsuite eingereiht. Die nächsten zwei Jahre lebte Carl als einfacher Hofjunker, war sozusagen ein besserer Page und wurde rasch vertraut mit den Besonderheiten des württembergischen Hoflebens. Seine schnelle Auffassungsgabe und seine Wachheit ließen ihn vieles, was andere übersahen, wahrnehmen. Man erzählte dem stillen, ernsten Jüngling manches, was anderen verschwiegen wurde. Die eine oder andere Hofdame machte ihm dazu ernsthafte Avancen, aber Carl hielt sich zurück, vor seinem inneren Auge wachte stets das Bild Aureliens. Ab und zu sah er die junge Schöne und ihren Vater, doch meist von der Ferne, und es gelang ihm nicht, mit ihr allein ins Gespräch zu kommen und seine Gefühle für sie zu gestehen. Zwei Jahre vergingen auf diese Weise.
Eines späten Abends ritt Junker von Schack durch den Forst zwischen Stuttgart und der Solitude. Zu dieser späten Stunde waren die Wege einsam, bislang war ihm noch niemand begegnet. Da hörte er an einer Weggabelung plötzlich ein Lärmen und sah vor sich einen Menschenhaufen: Es mochten sechs oder sieben ziemlich verwahrloste Kerle sein, die mit Messern und Knüppeln auf eine haltende Kutsche eindrangen. Schack, die Übermacht nicht fürchtend, gab seinem Pferd die Sporen und sprengte auf die Gruppe zu.
Mit gezogener Klinge hieb er auf die Burschen ein. Plötzlich zog ein hagerer Kerl im schmutzig grauen Mantel ein Pistol. Der Schuss krachte, Schack blies es den Hut vom Kopfe. Das Überraschungsmoment war vorüber, der junge Held kam selbst in Bedrängnis und wäre in noch ärgere Not geraten, wenn nicht im letzten Augenblick ein Detachement herzoglicher Jäger erschienen und dem Retter zur Rettung gekommen wäre. Carl selbst fiel, als er eben sein Pferd wenden wollte, durch den Dolchstoß eines Räubers. Seine Wunde war indes nicht weiter bedrohlich, die Folgen des Geschehens zeigten sich allerdings recht vorteilhaft.
Der Lärm, den man im Lande von einem derartigen Überfall in der Nähe der Solitude erwartet hätte, unterblieb überraschender Weise. Dafür sorgte der eigentlich Überfallene, Graf von Gersdorf persönlich, dem als Leiter der herzoglichen Geheimpolizei an wenig Aufsehen gelegen war. Gersdorf ließ seine Verbindungen spielen, um Näheres über den jungen Mann zu erfahren. Die Informationen, die er bald erhielt, fanden sein Wohlgefallen. Schon eine Woche später wurde Carl von seinem Pagendienst abgezogen und der seltsamen Welt des Geheimdienstes zugeteilt.
Was er dort erlebte, wäre weitläufig zu erzählen und soll an anderer Stelle dargelegt werden. Nur so viel: In vielen kleineren und größeren Affären stand der junge Schack dem Grafen geschickt und ideenreich zur Seite. Der viel Ältere gewöhnte sich allmählich daran, alles, was anlag, was sich ereignete und an Problemen auftrat, dem Jüngeren, seinem Lehrling sozusagen, zu erzählen, mit diesem gemeinsam Lösungswege durchzugehen und zu besprechen. Carl von Schack zeigte hierbei einen messerscharfen Verstand, eine Klarheit im Überlegen und einen schier unbändigen Mut wie starkes Gerechtigkeitsgefühl. Bald wurde er dem Grafen unentbehrlich.
In der Zeit geschah es, man schrieb bereits das Jahr 1774, dass es ihm endlich gelang, Aurelie allein zu sehen und zu sprechen. An einem schönen Sonnentag – in der Stadt feierten Adel und Volk den Venezianischen Markt – begegnete er der mittlerweile zur voll erblühten Schönheit herangewachsenen Jungfrau im Ludwigsburger Park. Carl bog um eine Rosenhecke – da stand Aurelie plötzlich vor ihm. Sie trug ein helles, oberhalb des Rockes leicht anliegendes Kleid, das lange, dunkle Haar war in sorgsame Flechten gelegt. Ihre braunen Augen, die kirschroten Lippen, der sanft gewölbte Nacken, der sich unter dem Tuche ihres Kleides abzeichnende Lilienbusen und ihre zarten Alabasterarme ließen alles in ihm aufbrechen, was so lange verborgen geblieben war. Er griff ihre Hand und gestand der Schönen seine Liebe. Mit niedergeschlagenen Augen erwiderte sie, dass er ihr gleichsam nicht gleichgültig sei. Carl zog sie an sich, da rief eine Stimme in der Ferne ihren Namen. Nach einem gehauchten Kuss entfloh Aurelie.
Seitdem hatte Carl Aurelie wieder nur von Weitem gesehen und keine Gelegenheit gefunden, auch nur ein einziges Wort mit der Angebeteten zu wechseln. Dann, gut ein halbes Jahr später, verschwanden sie und ihr Vater gleichsam über Nacht. Der Graf sei in England, sei in Paris, sei in Petersburg, hieß es, wenn er die Diplomaten vorsichtig befragte. Er schickte sich schweren Herzens drein. Der Tag, so hoffte Carl, würde bald kommen, wo er, nach Rückkehr des Grafen, im Hause Weilingen seine Aufwartung machen konnte. Doch die Rückkehr ließ auf sich warten und Schack konzentrierte sich ganz auf sein Tun. Bald sollte er Gelegenheit haben, dank seiner Fähigkeiten und entschlossener Tatkraft, einen Mordfall aufzuklären und den Täter festzunehmen.
Ein Böhme, der sich vor einiger Zeit in Stuttgart als Fechtmeister niedergelassen, sollte sein Weib, eine geborne Häferlin, aus Eifersucht meuchlerisch erstochen haben. Die Tat selbst war unbeobachtet geblieben, man wollte jedoch in Erfahrung gebracht haben, der Böhme, in dem man wegen vieler, durchaus schwerwiegender Indizien allen Grund hatte, den Täter zu sehen, jener also habe sich nach der Schweiz geschlagen. Andere wollten ihn, oder jemanden, der ihm zum Verwechseln gleiche, im Dienste eines Herrn von Chaumont gesehen haben. Man forderte nun Herrn von Chaumont auf, den Verdächtigen zu verhaften, den herzoglichen Bevollmächtigten ein erstes Verhör vornehmen und bei bestätigtem Verdachte den Schuldigen über die Grenze liefern zu lassen. Ein solches Schreiben, unterzeichnet und besiegelt von dem herzoglichen Amte in Stuttgart, ging mit von Schack als polizeilichem Amtsträger in die Schweiz ab.
In der Schweiz nun, in der Nähe von Basel unweit des Gutes des Herrn von Chaumont kehrte von Schack, da es Abend war und zu spät für einen Besuch im Schloss, mit seinem Diener Friedrich in einem Gasthofe ein. Er saß an einem Tisch in einer Fensternische, las in einem Aktenstück und blickte darüber nachdenkend aus dem Fenster zum Giebel des gegenübergelegenen Schlosses. Der Mond schien und in seinem Lichte sah er eine Gestalt, mit dem Auge leicht zu erfassen, die am Fenster eines Turmes beschäftigt war, ein Seil hinabzulassen. Es musste der Böhme sein – und entschlossen, den Übeltäter festzunehmen und der Gerechtigkeit auszuliefern, rief er Friedrich und eilte mit dem Bediensteten, jeder ein Pistol in der Hand, zum Abschluss der Giebelmauer unter die Kammer des Böhmen.
Zu spät, das Seil hing hinab, der Mann war bereits fort. Über die Bäume des Hofes weg – weit in der Ferne, wo sich der Weg um den Hügel wendete –, sahen sie einen Reiter galoppieren. Bei der Rückkehr zum Gasthof trat ihm ein Mann jammernd entgegen, er suche vergeblich sein Ross, welches er am hinteren Hoftor angebunden, während ihm selbst in der Küche ein Trunk gereicht wurde. Carl überlegte kurz und griff dann behände zu. Er hatte sich nicht geirrt, der Jammernde war in Wirklichkeit der gesuchte Böhme.
Ein Bote in völlig anderer Angelegenheit war vom Schlosse losgeritten und der Verbrecher, der von Carls Ankunft erfahren hatte, begab sich eilig durch einen Nebenausgang zum Gasthofe, um dort als angebliches Opfer des Pferdediebs im allgemeinen Durcheinander zu entkommen. Allein Carl hatte auf die Zeit geachtet und die verschiedenen Entfernungen mit eingerechnet; die Geschichte fiel in sich zusammen, der Böhme ward arretiert, und Carls Erfolg ebnete seine weitere Laufbahn.
Graf von Gersdorf empfahl dem Herzog den Junker von Schack als seinen Nachfolger. Der Herzog stimmte zu, doch Gersdorf ahnte nicht, wie bald dies sein sollte. Denn kein Jahr später wurde der Graf eines Morgens in seinem Haus erdolcht aufgefunden. Von dem Täter gab es keine Spur. Ein Diener behauptete zwar, einen Fremden in den Tagen zuvor im Hause des Grafen gesehen zu haben. Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters war aber eher vage. Es sei ein Mann von Anfang zwanzig gewesen, von blasser Gesichtsfarbe und mit einem schwarzen Schnurrbart, gab der Diener zu Protokoll. Ein derartiges Aussehen entsprach freilich dem vieler Männer.
Nun, Carl trat wie gewünscht die Nachfolge des Grafen an. Rasch arbeitete er sich ein, nächtelang saß er über Berichten, Akten und Dokumenten. Was er nicht wusste, machte er durch Einsatz wett. Der gesamte Dienst wurde gestrafft, die Abteilungen unmerklich vom Inneren weg auf das Äußere ausgerichtet. Carl hielt nichts von Denunziantentum; er sah seine Aufgabe hauptsächlich im diplomatischen Geheimspiel und in der Kriminalistik. Aus allen Schichten wurden fähige Helfer angeworben. Aufgrund seiner vielfältigen Informationen und seines Nachrichtennetzes – und nicht zuletzt seines Könnens – erzielte der Junker mehrfach außergewöhnliche Aufklärungsergebnisse und stärkte seine Position beim Herzog.
Nur eines war ihm bisher zu seinem großen Kummer nicht gelungen: den oder die Täter aufzuspüren, die seinen Mentor auf dem Gewissen hatten. Und es war ihm schier unmöglich, eine Spur vom Gesandten von Weilingen und seiner Tochter zu finden; von diesen beiden war seit der Zeit ihrer Abreise keine verlässliche Nachricht mehr in die Residenz gelangt. Auch die Akten gaben merkwürdig wenig her, zuletzt sollte Weilingen in Paris gewesen sein – oder eben auch nicht!
All dieses Geschehen war von Schack wieder in Bildern deutlich geworden, als er den Brief seines Vetters gelesen hatte. Über diese Angelegenheiten hatten sie einen breiten, teils sorgfältig kodierten Briefverkehr geführt. Sein Vetter war in einer ähnlichen Funktion bei den Malteserrittern beziehungsweise für die Schweden tätig. Vielleicht stimmte das, was Otto Friedrich ihm geschrieben hatte. Wobei er sich von Caracantis Auftreten wenig versprach. Der Herr war in Venedig eher ein Maître de Plaisir gewesen, ein sogenannter Schaumschläger. Doch man konnte nie wissen, vielleicht würde er heute Abend etwas Neues erfahren. Aber jetzt war es erst einmal an der Zeit, sich für den Abendempfang an der Tafel des Herzogs umzukleiden.
Im herzoglichen Festsaal war an diesem Abend nur für ein kleines Abenddiner gedeckt; seit der Hof im letzten Jahr nach Stuttgart zurückgekehrt war, schienen die Lichter des schwäbischen Versailles nur noch gedämpft. Dennoch, Karl Eugen legte unbedingten Wert auf eine stete Repräsentation seiner herzoglichen Würde. Für den heutigen Empfang hatte er sich auf die Jagdtradition des Schlosses besonnen und entsprechende Anweisungen erteilen lassen. Es gab vorwiegend Wildspeisen, wie immer vielfältig und opulent. Wildschweinragout, Fasanenbrust, Hirschlende, Hasenpfeffer, diverse Pasten, Pilzsaucen und exotische Früchte wurden geboten.
Die Tafel war Abbild eines mehr als dreißig Schuh hohen Tempels der Jagdgöttin Diana. Diesen bildeten vier Säulen mit darauf befindlichen künstlichen Statuen. Auf den gleichen Säulen ruhten vier Schwibbögen, deren jeder mit grünem Bindwerk, Festonen, Vasen, und Jagdtrophäen, auch mit Waldhörnern, an denen man den Württembergischen Jagdorden befestigt hatte, verziert war. Oberhalb des Tempels sah man die Göttin in Lebensgröße und in einer durchscheinenden Glorie gemalt. Noch weiter oben hing ein großer silberner Kronleuchter, in dem eine Vielzahl von Wachslichtern brannte. So war der ganze Aufbau durch eine Unmenge von gefärbten Kugeln und brennenden weißen Wachsampeln beleuchtet. Das helle Licht ließ die kostbare Kleidung der versammelten Damen wie Herren besonders zur Geltung kommen.
Die Dame von Stand trug anlässlich der Einladung das dreiteilige Grand Habit, welches aus einem schweren Mieder mit Walgräten, einem weiten, ovalen Reifrock sowie einer Schleppe bestand, deren Länge den Rang der Trägerin verdeutlichte. Dazu präsentierte die holde Weiblichkeit prächtig funkelnden Schmuck – Armreifen, schwere Ketten und eine Vielzahl von Ringen und Broschen. Ärmel und Mieder der Kleider waren mit mehreren Schichten aus Manschetten, Borten, Spitzen und Schleifen geschmückt.
Die eigentliche Kleidung der adligen Dame bestand aus einem Reifrock mit Unterrock und Überrock sowie einem Mieder und darunter, im Geheimen verborgen, einem Korsett. Zu dem offenen Kleid, welches im Alltag außerhalb repräsentativer Veranstaltungen und von jüngeren Damen gerne getragen wurde, gehörte lediglich das Mieder und ein vorne offener, angehängter Rock, der den Unterrock sehen ließ. Typisch für ein Hoffest war dagegen das Tragen des Panier genannten Reifrocks. Er hatte den Moden gemäß mehrfach seine Gestalt verändert und sich von einer ersten Kegel- zu einer Tonnenform entwickelt. Zur Zeit Ludwigs XV. setzte sich eine ovale Form durch – die Ausdehnung an den Seiten wurde durch zusätzliche Polster an den Hüften bewirkt. Mitunter erlangte das Kleid derartige Ausmaße, dass die Damen seitlich durch die Türen gehen mussten.
Der Anzug der Herren war einfacher und bestand aus der Kniehose, der Culotte, meist in dunklem Rot oder Blau. Dazu trug man eine ebenfalls dunkelrote oder -blaue Weste sowie einen Rock, das Justaucorps. Beine und Füße bedeckten natürlich weißseidene Strümpfe. Eine Halsbinde, eine Perücke mit Zopf und ein Dreispitz gehörten zum standesgemäßen Auftritt dazu. An der Seite des adligen Herrn durfte außerdem der Degen nicht fehlen, ein Utensil, welches dem Bürger selbstverständlich nicht erlaubt war. Das genannte Justaucorps, der Rock also, besaß kurze offene Ärmel mit aufwendigen Umschlägen. Durch Einlagen wurde ein weiter Umfang vorgetäuscht. Die Rockschöße wurden in der Taille zusammengenommen, und das Justaucorps reichte insgesamt bis an die Knie.
Über sechzig Jahre waren seit den Tagen des Sonnenkönigs, der in jeder Hinsicht die Mode der Fürstenhöfe und der Adelswelt bestimmte, vergangen, und es hatte sich ein gewisser Wandel der Kleidung vollzogen. Jetzt traten verstärkt Blumenmuster auf, die mitunter sogar dreidimensional dargestellt waren. Verschiedene Formen zierlicher Ranken und Blüten wurden auch direkt auf die Stoffe gemalt oder gedruckt. Neben weiteren Verzierungen, Schlangenlinien, Schnörkeln und Ornamenten waren auch schlichte Muster, Moiré oder einfache Streifen modern. Am Hofe Ludwig XIV. trug man meist leuchtende Farben. Zur Zeit der Handlung waren eher Pastelltöne an der Tagesordnung. Charakteristisch für die Zeit des jüngst verstorbenen Ludwig XV. war vor allem die Farbe Rosa gewesen, die Lieblingsfarbe seiner Mätresse, der Madame de Pompadour.
Im nichtssagenden Geplauder verging das Diner. Man aß und trank reichlich, lobte die Speise und warf Kennerblicke auf die anwesenden Damen. Schließlich ward die Tafel beendet und aufgehoben. Ein munteres Flanieren begann, welches reichlich Raum und Zeit zu weiterem offenen oder heimlichen Gesprächsaustausch bot. Im blauen Saal spielte die Hofkapelle ein Stück von Haydn, einen symphonischen Satz zum Tanzen, das sogenannte Menuett.
Auch hier hatte sich die französische Mode durchgesetzt, nach der Courante und der Gavotte war das Menuett der Hauptbestandteil der ständigen Tanzfolgen geworden. Es erfreute sich als Paartanz großer Beliebtheit und hatte sich rasch verbreitet und weiten Anklang gefunden. Das hing unter anderem mit der derzeitigen Rockmode zusammen. Durch das tänzelnde Wippen wurden die Füße und die Waden sichtbar, was als ungemein erotisch galt, und weshalb auch das Aussehen der Strümpfe eine wichtige Rolle spielte. Auch hier in Ludwigsburg gaben sich die Damen und Herren des Hofes fröhlich den Wonnen dieser tänzerischen „Freizügigkeiten“ hin.
Von Schack stand am Rande des Tanzgeschehens mit seinem Freund Erlenburg, der das „Wippen“ und die weißen Waden sichtlich genoss.
„Nun, mein Bester, wisst Ihr endlich, wer unser geheimnisvoller Gast von heute Nachmittag war?“, fragte Erlenburg ihn gerade, während er seinen Blick über die tanzenden Paare gleiten ließ.
Carl hatte nicht mehr weiter darüber nachgedacht und schüttelte als Antwort leicht den Kopf.
„Ach, Ihr wisst einmal nicht alles, wie überaus erfreulich für uns Normalsterbliche“, spöttelte Erlenburg. „Doch ich will Euch nicht länger auf die Folter spannen, schaut nach hinten, dort rechts das Paar. Drüben, der etwas düster scheinende Tituskopf mit grauer Perücke. Und sie, die grazile Nymphe mit dem Schönheitspflästerchen rechts neben dem Kinn mit dem allerliebsten Grübchen.“ Er hielt inne, musterte besorgt seinen Freund. „Aber, was ist Ihnen, Ihr werdet ganz blass, sollte die Hitze, der Lärm …?“ Kammerherr von Erlenburg brach überrascht ab, denn sein Freund hatte sich mit einer fast springenden Bewegung in die von ihm gezeigte Richtung auf das tanzende Paar zu bewegt.
Seine Eile war auffällig. Fast rannte er, kam aber bald ins Stocken, die Tanzenden und die diese umgebenden Zuschauer sperrten sein Durchkommen. Der eine oder andere bemerkte seine unziemliche, ja außergewöhnliche Hast und nahm diese kopfschüttelnd und tuschelnd zur Kenntnis oder vermittelte sie weiter.
Carl musste stehen bleiben, das Paar war ihm aus den Augen geraten, er steckte im Trubel fest – und jetzt näherte sich ihm auch noch der Herzog. Nichts zu machen, er konnte nicht einfach weitereilen, er musste den Herzog gemäß des Hofzeremoniells begrüßen.
Seine Durchlaucht Herzog Karl Eugen war heute in besonders gnädiger Stimmung. Er hatte gut, aber nicht übermäßig gespeist, sodass der Leib ihm nicht rumorte. Seine Franziska hatte seinen jüngsten Erlass zur Förderung der Karlsschüler aus mäßig begütertem Hause sehr positiv gewürdigt und ihm versprochen, den Herzog bei seiner nächsten Venedigreise zu begleiten. Und es schien, als ob die Landschaft unter Umständen zu gewissen finanziellen Stützen bereit sei.
Solcherart wohlgestimmt sprach er Carl direkt an: „Ah, mein werter Kammerherr, Bester von Schack. Von Ihm hört man wie immer nur Rühmliches, weiter so, weiter so. Und die neuen Aufgaben wird Er sicher glänzend meistern. Ah, der Junker ist erstaunt? Wohl, wohl, warte Er ab, von Schack, Er wird bald Näheres erfahren. Und hör Er, dass Er mir rasch gute Ergebnisse bringt, Er weiß, ich schätze Ihn, auf Ihn ist Verlass, enttäusche Er mich nicht! Also, mein Bester, Ergebnisse, ich sehe, Er ist in Eile, geh Er nur zu. Diese wilde Jugend!“
Lachend wandte sich Serenissimus an sein Hofgefolge. Er war sicher, er hatte sich sehr gnädig gezeigt und wohlwollend gescherzt. Gut gescherzt, was das fröhliche Lachen seiner näheren Umgebung zu bestätigen schien. Der Herzog schritt munter plaudernd weiter.
Mit einer tiefen Verneigung entfernte sich Carl, etwas verwirrt von den Worten des Herzogs. Was redete dieser von neuen Aufgaben, von raschen Ergebnissen? Was für Merkwürdigkeiten erwarteten ihn? Der Herzog und seine Launen, ein Kapitel für sich.
Doch anderes beschäftigte Carl von Schack im Augenblick mehr. Die junge Frau, die mit dem Hageren getanzt hatte, war sie gewesen – Aurelie, die Tochter des verschwundenen Botschafters! Er war völlig überrascht, geradezu bestürzt, über das, was er gesehen oder zu sehen gemeint hatte. Aurelie! Ob ihn seine Augen getäuscht hatten? Sah er in jeder hübschen jungen Larve Aureliens Bild?
Es gab in dem Zirkel des Hofes Frauen, die für vollendet schön geachtet werden konnten, aber vor dem Bilde Aureliens in seinem Gemüte, vor ihrem tief ergreifendem Liebreiz verblasste alles zu unscheinbarer Farblosigkeit. Doch wusste er überhaupt, wie Aurelie heute nach dieser langen Zeit der Trennung aussah? Und das Fräulein eben? Was hatte er von dem Fräulein, das er für Aurelie hielt, wirklich wahrgenommen? Ihr Gesicht, ihre Augen, das Lächeln ihrer Lippen? Wie sehr sich Carl von Schack auch mühte, er konnte sich an all dies nicht recht erinnern. Einzig ihr Kleid war ihm im Gedächtnis. Ein Kleid von raffinierter Schlichtheit, dabei berückend und fesselnd, als sei es eine Kreation im Stile bester Pariser Mode. Der Putz der Frauen, wusste Carl, übte einen geheimnisvollen Zauber aus, dem ein Mann nicht leicht widerstehen konnte.
In der tiefsten Natur der Weiblichkeit mochte es liegen, dass im Putz sich alles schimmernder und schöner entfaltete, so wie Blumen nur dann vollendet sich darstellen, wenn sie in üppiger Fülle in bunten glänzenden Farben aufgebrochen sind. War es also nur ein Kleid gewesen, das seine Sinne eingefangen hatte? Er musste sich zusammenreißen, ein einfaches Bild, ein Kleid – und er, der Kammerherr von Schack, heimlicher Herr über das Polizei- und Erkundungswesen des Herzogtums Württemberg, glaubte an Zauber!
Wenn sie es nun aber doch gewesen war? Er konzentrierte sich, besann sich auf den anderen Teil des Tanzpaares, den Herrn mit der grauen Perücke. War dieser jener Fremde aus der Kutsche? Verflixt, wo war sein Freund Erlenburg, der ihn erst auf diese Spur gebracht hatte? Der schien mehr zu wissen, er sollte ihm endlich Rede und Antwort stehen. Carl musste ihn unbedingt gleich befragen.
Er verließ den Saal und ging hinaus auf den Gang. Draußen trat ihm ein Herr entgegen. Dieser trug einen dunkelgrünen Rock ohne alles Tressenwerk, helle Reithandschuhe und in den hohen Stiefeln weiße Stiefelmanschetten. Ein starker Degen hing an seiner Seite; der Hut war nach Art der Offiziershüte aufgeschlagen.
„Mein Herr, ich darf Sie ersuchen, folgendes Billett zu lesen. Wenn es Ihnen genehm ist, ich warte auf Antwort.“ Der Offizier, es handelte sich zweifelsohne um einen solchen, salutierte mit dem Hut und trat in eine Nische zurück.
Carl von Schack nahm mit Ruhe das Blatt entgegen und öffnete rasch das Handschreiben: Seid heute um Mitternacht auf der kleinen Insel Monrepos. C.
Das war alles – kein Siegel, kein Hinweis, nichts. Merkwürdig, dachte von Schack, wer schreibt mir auf diese Weise und in dieser Form?
„Ihr kennt den Absender dieses Schreibens, mein Herr?“, wandte er sich an den Offizier. „Aber halt, bevor Ihr antwortet, Ihr seid sicher zum Schweigen verpflichtet und dürft bei Eurer Ehre keine Antwort geben?“
Der Offizier nickte schweigend.
„Sehr geheimnisvoll, findet Ihr nicht? Nun gut, ich werde Euren Auftraggeber nicht enttäuschen. Bitte vermeldet, dass ich pünktlich erscheinen werde. Ich danke, mein Herr!“
Der Offizier verbeugte sich erneut, grüßte und verschwand so rasch, wie er gekommen war.
Carl von Schack stieg langsam die große Schlossinnentreppe hinab und wandte sich dem Garten zu. Draußen war die Dämmerung hereingebrochen, die Nacht zog über den Hügel des nahen Wildparks auf. Carl versank in tiefe Gedanken. Was war das für ein geheimnisvolles Treffen? Um welche Angelegenheiten mochte es gehen? Konnte das Ganze womöglich eine Falle sein? Doch von wem gestellt und aus welchem Grunde? Und wenn es sich nicht um eine Falle handelte, was sollte diese Geheimniskrämerei? Ein Geheimauftrag, eine Anfrage, eine Bitte? Was auch immer, Genaueres würde er nur erfahren, wenn er sich um Mitternacht zum genannten Treffpunkt begab. Carl schaute hoch zum Himmel. Heute war Vollmond und der Mond stand längst nicht im Süden. Es mochte gegen elf sein, schätzte Carl, genügend Zeit bis Mitternacht. Eine ungenaue Schätzung, er wusste, wie oft es auf exakte Zeitangaben ankam. Da sollte doch dieser Geistliche, dem der Herzog die Pfarrei in Kornwestheim übertragen hatte, Hahn hieß er, eine Art von tragbarer Uhr erfunden haben. Diese Erfindung musste er sich bei Gelegenheit unbedingt einmal anschauen.
Mit dieser Überlegung ging Carl zurück in sein Domizil. Dort erwartete ihn sein Diener Friedrich. Friedrich stand bereits im fünften Jahr im Dienste Schacks und hatte seinen Herrn mehrfach in vielfältigsten Gefahren hilfreich zur Seite gestanden. Besonders die Schießkunst verstand Friedrich wie kaum sonst ein anderer. Carl gab dem Diener einige Anweisungen bezüglich der mitternächtlichen Situation. Friedrich sollte ihn zum Treffen begleiten und – wenn nötig – ihm zur Seite stehen.
Zunächst half Friedrich seinem Herrn beim eiligen Umziehen. Carl zog einfache, graue Beinkleider wie ein Bürgersmann an und wählte schwarze Handschuhe. Friedrich trug ohnehin seine schlichte, dunkelgrüne Arbeitskleidung. In der Nacht, zumal ohne Perücke und mit dunklen Hüten, würden sie derart gekleidet für spähende Beobachter schlecht zu erkennen sein. Beide Männer steckten ein Pistol zu sich. Carl trug seinen Degen, Friedrich zusätzlich einen breiten Hirschfänger. Während dieser Vorbereitungen klopfte es.
Die Tür wurde von Friedrich geöffnet. „Der Kammerherr von Erlenburg“, meldete er.
Schon trat dieser in die Wohnung. „Bester Freund, Ihr seid so plötzlich verschwunden. Was war Euch?“
Ohne zu zögern erzählte Carl rasch von den Ereignissen und fragte Erlenburg, wer denn nun dieser Mann gewesen sei und ob er gleichfalls Aurelie von Weilingen erkannt habe.
Erlenburg verneinte letztere Frage. Er kenne die junge Grafentochter kaum, habe sie auch über Jahre, ähnlich wie Carl, nicht gesehen. Nein, er könne von Schacks Vermutungen kaum bestätigen. Ihm sei es vielmehr um den Tänzer der Dame gegangen. „Wisst Ihr nicht, bester Freund, das war Ihr Caracanti! Der Mann, den Ihr so heiß und innig erwartet! Der Mann, der Ihnen bestimmte Aufträge überreichen soll.“
Carl entgegnete, dies könne er kaum glauben und von „Erwartung“ könne gleichfalls keine Rede sein. Auch wisse er von keinen Aufträgen, wenn auch alle Welt, der Herzog inbegriffen, davon rede und sich in dunklen Anspielungen verlöre. Aber jetzt müsse er los, hin zu dem ominösen Treffen, von dem er erzählt habe.
„Dann begleite ich Euch, werter Kollega Kammerherr, ich denke, drei Männer vor Ort sind besser als zwei!“
Carl nahm Erlenburgs Angebot dankend an, wusste er doch, der Freund war ihm in der Degenkunst nahezu ebenbürtig und gleichfalls ein guter Schütze. Also ließ er ihm durch Friedrich eine weitere Waffe reichen. Die Herren hüllten sich in dunkle Mäntel und verließen das Schloss durch eine Seitenpforte.
Friedrich hatte bereits für die Pferde gesorgt. Sie folgten dem bekiesten Weg in Richtung Favoriteschlösschen, die Lichter des Hauptschlosses fingen indes an zu verlöschen, letzte Musik verklang, und es wurde nach und nach immer stiller. Die Nacht überdeckte schon die stillen Wälder, der Mond stand jetzt über den Hügeln auf der anderen Seite des Neckars.
Ihr Ritt ging schnurstracks nach Norden quer durch den Wald über eine Felsgruppe und an einigen Abhängen vorüber einen langen Seepfad hinab. Sie sprachen kaum ein Wort miteinander; ein Raunen und Flüstern oben in den Zweigen, ein Rascheln und Knistern in dem trocknen Laub am Boden – das dumpfe Gebell eines Hundes aus einem fernen Dorfe. Ein Nachtvogel kam auf seinem wirren Fluge bis dicht an Carls Gesicht geflattert und schoss dann wieder davon. Sonst herrschte rings umher tiefe drückende Stille.
Keine Viertelstunde später erreichten sie Schloss Monrepos. Auch hier herrschte nächtliche Ruhe. Friedrich band die Pferde beim Seitentrakt an. Die drei Männer stiegen vorsichtig hinab zum See, wo am Uferrand Boote angebunden waren.
„Ich weiß nicht“, raunte Erlenburg, „mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir so offen über das Wasser rudern. Wir könnten gleich Friedrich mit unseren Karten vorausschwimmen lassen!“
„Wie kommen wir sonst hinüber?“, flüsterte Carl zurück.
„Am besten, wir lassen das Boot am Rand treideln und steigen hinten bei den Büschen ein. Dort sind wir mehr im Sichtschatten und kommen vielleicht mit weniger Aufmerksamkeit übers Wasser“, schlug Erlenburg vor.
Mit Friedrichs Hilfe schleppten sie das Boot am Ufer entlang, bis der Schatten erreicht war. Sie stiegen ein und stießen sacht vom Ufer ab. Mit nur wenigen Schlägen und ohne das Wasser beim Eintauchen der Ruder aufzuwirbeln, bewegte Friedrich den Kahn im Schatten der Bäume beinahe lautlos und sachte vorwärts. Etwa fünf Minuten später erreichten sie die Insel im See, auf der einst eine kleine Kirche errichtet worden war, von der es jetzt nur noch eine verfallene Ruine gab.
Es mochte bald Mitternacht sein, alles schien still und ohne Leben.
„Ihr bleibt hier, ich werde allein erwartet und ich werde allein gehen“, befahl Carl flüsternd seinen Begleitern und stieg gewandt an Land.
Nichts war zu hören, über der Insel lastete ein düsteres Schweigen. Als er über den kalten Boden schritt, kam ein leichter Wind auf, und um ihn war nichts als die öde dunkle Nacht. Dann flogen zwei dicke Wolken auseinander – der helle Mond lag wie eine Silberkugel in einem weißen Wolkengebirge, und der Schein fiel in die Tiefe wie ein langer Strom und fand seinen Widerschein im Wasser.
Carl war wie vom Mondlicht übergossen und seine Silhouette hob sich deutlich von seiner Umgebung ab. Der Junker sprang rasch auf eine Baumreihe zu, um den Lichtbündeln und einer möglichen Beobachtung zu entgehen.
Sein Sprung gelang ihm keinen Augenblick zu früh. Der grelle Blitz eines Mündungsfeuers leuchtete in den Büschen auf, ein lauter Schuss krachte und eine Kugel pfiff knapp an Schacks rechter Seite vorbei. Wie zur Antwort waren zwei weitere Schussexplosionen zu hören, dann schrie jemand laut auf. Etwas – ein Tier, ein Mensch – hastete durch das dichte Buschwerk links vor Carl und verschwand.
Aus der Richtung des Bootes hinter ihm ertönten Kampfgeräusche. Carl zögerte nur kurz, er war sich sicher, seine Begleiter würden allein mit allem fertig werden. Der Junker eilte weiter, drängte sich mit gezogenem Degen furchtlos durch das Buschwerk und hatte bald die Kirchenruine erreicht.
Dort hielt er überrascht inne. Auf den zerbrochenen Eingangsstufen des Baus lag, den Kopf in den Nacken geworfen, eine gekrümmte Gestalt. Die Arme des Liegenden hingen schlaff über die Stufen herab. Carl von Schack trat vorsichtig heran, es mochte eine List sein, und spähte wachsam nach allen Seiten. Ein Geräusch ließ ihn herumfahren.
„Keine Sorge, ich bin es, in Begleitung von Friedrich.“ Erlenburgs schnarrende Stimme war unverkennbar. Er trat mit Friedrich auf Carl von Schack zu. „Bei uns haben zwei Männer versucht, das Boot zu kapern. Das ist dem einen nicht besonders gut bekommen! Der andere konnte leider entfliehen.“
Erlenburg stutzte, als er den leblosen Körper auf den Stufen sah. „Wart Ihr das, Carl?“
Carl verneinte. Er wies Friedrich an, die Waffen neu zu laden und gut auf die Umgebung zu achten. Dann beugte er sich zu der Gestalt nieder. Er drehte den Kopf zur Seite und fuhr überrascht zurück. Aus dem Mund des Toten quoll Blut hervor – und, da war er sicher, es handelte sich bei dem Opfer um eine Frau!
„Du lieber Himmel, seht nur, ist das nicht die Frau, die Ihr für Aurelie hieltet?“, rief Erlenburg.
Von Schack zwang sich, genauer hinzuschauen. Er betrachtete das zarte, durch Blut entstellte Gesicht der Toten. Als Lebende musste sie sehr schön gewesen sein. Ein Schönheitspflästerchen prangte rechts am Kinn. Es war in der Tat die junge Frau vom Abend und – Carl seufzte unwillkürlich auf – Aurelie war es nicht. „Ihr habt recht, das ist die Tänzerin, die ich vorhin für Aurelie hielt. Sie trägt das gleiche Kleid wie einstmals die Gräfin. Aber zum Glück ist sie es nicht. Die arme Frau. Wer hat ihr das angetan?“
Da sah Carl etwas Weißes aus der linken Ärmelspitze der Toten blinken. Er beugte sich vor und ergriff das weiße Teil.
Es handelte sich um eine Papierrolle. Eine Botschaft? Er zog das Papier aus dem Ärmel und rollte es auf, doch trotz des Vollmondes war es zu dunkel zum Lesen.
„Friedrich, schlag’ ein Feuer an, ich sehe nichts!“, befahl von Schack.
Friedrich entzündete rasch ein Talglicht, schützte das unstete Flackern der Flamme mit der Linken vorm Nachtwind und streckte es seinem Herrn entgegen.
Carl beugte sich vor und hielt den Zettel nahe an die Flamme. Auf dem Papier stand ein einziges Wort: Montbéliard …
Montbéliard, das war der französische Name für die Grafschaft Mömpelgard. Von Schack steckte das Blatt ein. Er hielt es für besser, jetzt zu verschwinden. Unter Umständen kam der Entflohene mit großer Verstärkung zurück, und es konnte schwierig werden, sich im Dunkeln gegen eine Übermacht zu behaupten.
Die drei Männer eilten zum Boot, das zum Glück noch an der gleichen Stelle lag, und ruderten mit schnellen Schlägen quer über den See zum Anlegeplatz unterhalb des Schlosses. Auch ihre Pferde fanden sich am gleichen Ort, wo Friedrich diese festgebunden hatte. Sie bestiegen die Rosse und trabten zurück zum Ludwigsburger Hauptschloss.
Montbéliard, was mochte das bedeuten? Montbéliard, besser Mömpelgard, bildete das Herrschaftszentrum der linksrheinischen Besitzungen des Landes, zu denen auch Reichenweier und Horburg zählten. 1397 war das Gebiet durch die Heirat des noch minderjährigen Grafen Eberhard mit der ebenfalls minderjährigen Henriette von Mömpelgard unter württembergische Verwaltung gelangt und nach Henriettes Tod 1444 endgültig an Württemberg gefallen. Nachdem im 16. und 17. Jahrhundert Seitenlinien die Grafschaft regierten, wurde das Gebiet im Wildbader Vertrag 1715 an die Stuttgarter Hauptlinie abgetreten. Welche Rolle im Geschehen spielte die ferne, an der Lisaine gelegene Grafschaft südlich von Belfort?