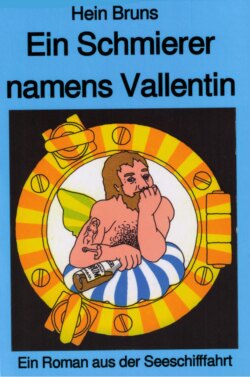Читать книгу Ein Schmierer namens Vallentin - Hein Bruns - Страница 5
Gran Canaria
ОглавлениеTage um Tage und Nächte um Nächte vergehen im Gleichmaß der Seewachen. Es hat sich alles eingespielt, die Arbeit, der Schlaf, die Fresserei; nur, ich bin immer noch der Neue und bin darum auch meistens allein. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht sind es die Gummifäden. An Steuerbordseite liegen im Blau und in der Sonne die Kanarischen Inseln. Die Spitzen der Berge in weißer Watte verpackt. Ich liege auf der Back in der Sonne und döse. Freiwache. Gran Canaria … Gran Canaria und diese Narbe auf meinem Bauch, dick; wie eine Kordel, gehören zusammen. Da nahmen sie mir, die „Weißbekittelten“ im Krankenhaus Puerto de la Lus in Las Palmas den Blinddarm raus. Und das war höchste Gefahr. Sie schnitten mir den halben Leib auf und kratzten mir den Eiter aus dem Bauch. Das musste ja wohl so sein. Die Narbe werde ich nie mehr los. Ich gebe ja zu, dass ich schuld daran habe, dass die Narbe wie ein Strick aussieht, denn jedes Verheilen verhinderte ich mit den Fingernägeln. Ja, verdammt noch mal, was sollte ich denn aber auch machen, wo sollte ich denn hin? In Antwerpen war ich eingestiegen, in Las Palmas musste ich dieses verdammten Blinddarms wegen wieder aussteigen. Verdiente Heuer war für die Katz. Der Dampfer fuhr ohne mich nach Südamerika. Es gab nichts, was ich nicht unternahm, um den Aufenthalt im Krankenhaus zu verlängern. Ich kratzte die kaum verheilte Wunde wieder auf, ich soff hochkonzentrierten Kaffee, damit die Pumpe tausend Touren machte, ich fraß Kautabak, um das Fieber hochzutreiben, ich bearbeitete meine Fußsohlen mit einer Schuhbürste und rieb die Sohlen dann mit Petroleum ein, um gehbehindert zu werden. Aber die „Weißbekittelten“ kamen bald hinter meine Masche und setzten mich nach vier Wochen auf die Straße. Schwester Magdalena segnete mich und stellte mich unter Gottes Schutz ... sie hätte mir lieber ein Fresspaket mitgeben sollen. So schlich ich wie ein angeschlagener Boxer durch die winkeligen, verkommenen Straßen von Puerto de la Lus. Keine Peseta auf der Naht und Kohldampf bis unter beide Arme. Was sollte ich machen? Ich musste mir irgendwo, und das sofort, einen Job suchen. Und so verdingte ich mich für vier Wochen als Kalb. Im Armeleuteviertel von Las Palmas, wo sollte ich mich sonst auch wohl aufhalten, gibt es keine Milchwagen. Hatte eine Kuh gekalbt, zog man mit ihr von Haus zu Haus und melkte sie nach Bedarf. Da ein Kalbfell immer ein Kalbfell bleiben wird, murkste man das Kalb ab, wenn es eine gewisse Größe erreicht hatte, und irgendein armer Deubel rennt dann mit dem Kalbsbalg der Kuh vorneweg. So zog man mir das Fell über die Ohren, und ich walzte auf allen Vieren und für magere Peseten vor dem vierbeinigen Milchwagen einher. Aufrichten tat ich mich nur, so Mutter gemolken wurde. Ja, das klingt witzig, und doch war es eine harte Arbeit. Die Steine, die Sonne, der Staub und meine Hände. Aber der Wein in den Bodegas war billig. Das Nähmädchen Manuela Lorenzo, ein hübsches Kind, das jeden Morgen mit trippelnden Schritten im Nebenhaus verschwand und nie vergaß, mir
einen heißen Blick zuzuwerfen, hatte es mir angetan. Mehr ist auch nicht daraus geworden. Von meiner Bude aus konnte ich über die See und das Pik von Teneriffa sehen. Zwölf Peseten Miete musste ich für das Loch bezahlen, und die wollten erst einmal verdient sein. Als meine Handflächen ohne Haut waren, und die Gefahr bestand, dass ich einen Kamelhocker kriegen würde, schmiss ich dem Milchseñor das Scheißfell vor die Füße und legte ihm nahe, den Betrug der Kuh ohne mich weiterzumachen. – In der Bar „Zur grünen Olive“, so nannte ich sie, die sich zwischen die baufälligen Giebelhäuser einer Seitengasse von Puerto de la Lus klemmte, ging es allabendlich bunt zu, weil der Wein so billig war, die Windlichter flackerten und Inez so einen weißen, sichtbaren Busen hatte. Außerdem nahm Inez mir die geschmuggelten Chesterfields und Camels und Lucky Strikes ab. Dass sie mich immer gehörig beschiss, lag wohl an ihrem Beruf. Dass sie mir hin und wieder einen gewagten Griff an ihre Brust erlaubte oder dass ich ihren Mund zwischen Tür und Angel mal küssen durfte, sie mich aber nie bei sich schlafen ließ, lag auch an ihrem Beruf. Sie wollte mich an der Stange halten. Ich krabbelte auf den großen Steamern umher und kaufte Zigaretten, stangenweise. Verstaute sie am Bauch, zwischen den Beinen, in den Strümpfen. Die Zöllner waren wie Spürhunde. Der karge Verdienst stand in keinem Verhältnis zu dem Risiko, eben weil Inez mich beschiss, und erwischte man mich, war ich geliefert, und wer je in spanischen Kalabussen saß, kann davon ein Lied singen. Für Wein, Brot und Miete aber langte es. Meinen Seesack gab ich ins Pfandhaus zur Aufbewahrung, dort wird er auch nicht geklaut. Seeleute aller Nationen, Farben und Rassen wollen was erleben. Seeleute aller Herren Länder wollen Weiber und Wein. Ich kenne das von mir. Und ich brachte sie hin zu den Puffs und Lasterhöhlen, Nahkampfdielen und Nachtclubs. Ich befreundete mich mit einem Taxifahrer und nahm immer denselben, bekam für jede Fuhre drei jämmerliche Peseten, aber immerhin. Wenn aus den Puffs die Musikboxen plärrten und quäkten und laut geskålt und geprostet und gecheeriot und gesalutet und genasdrowjet wurde, stand ich im Schatten einer Mauer und stand mir die Beine in den Leib. Ich musste doch wieder mit zurück nach Puerto de la Lus, meinen Schuhen konnte ich den langen Weg sowieso nicht zumuten. Außerdem, Treue wird belohnt, und liebessatte und weinvolle Seeleute sind gar nicht so knauserig. Der Job war besser, als Kalb zu spielen. Das Pik von Teneriffa konnte ich von meinem Fenster aus sehen und auch Manuela Lorenzo, das Nähmädchen. Morgens stand ich auf der niedrigen Mole und wartete auf die heimkehrenden Fischlogger. Und griff mit hinein in die silbern schillernden, zappelnden Leiber. Große hier, kleine dort in die Kiste. Ich schuftete und wählte und schleppte ächzend die Kiste, schob den zweirädrigen Wagen über das holperige Pflaster, baute in den Fischhallen die Stände mit auf, schnitt den Fischen die Köpfe ab und riss ihnen die Gedärme aus dem Leib und stank mittags wie ein Waldesel. Gegen Hunger aber ist eine Mütze voller Sardinen wertvoller als ein nacktes Mädchen in der Koje. Auf dem Obst- und Gemüsemarkt versuchte ich mich auch, um den Señoritas oder deren Dienstboten die Einkaufskörbe nach Hause zu tragen. Wie gesagt, ich versuchte mich und bekam dafür meistens ein wirklich freundliches „Mucho gracia“, aber dass man davon satt wird, kann doch wirklich keiner behaupten. Meine Wünsche waren nicht hochtrabend, aber ich wünschte mir wieder einen entzündeten Blinddarm. Ich lag am Strand zwischen den Las Palmanesen, war braun wie sie, angezogen oder ausgezogen wie sie, und stank wie sie. Ging auch mal ins Kino und saß auf den Holzbänken der Tribüne. Grölte mit bei Cowboykunststücken und Schießereien. Stöhnte mit bei ellenlangen Küssen und Liebesszenen. Und wieherte mit bei Aussichten auf Busen und Ärsche. Kinogehen war wohl mein einziges Vergnügen, das ich genoss. Wohl zeigte ich einem amerikanischen Touristen, der mich für einen Eingeborenen hielt und ein alter Lustmolch war, die Puffs, wo die Mädchen jung und teuer waren, und heimste dafür drei Dollar ein. Dass er nebenbei auch noch schwul war, sah man ihm nicht an, passte aber gar nicht in meine Rechnung. Einige Leute können den Hals einfach nicht voll kriegen. Auch führte ich eines Tages eine deutsche Reisegesellschaft, aber nicht in die Puffs. Klaubte mir aus Reiseprospekten die Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer nahen Umgebung heraus, und gab das von mir, soweit ich es selbst verstand. Bekam auch da viele Dankeschön und wenig Peseten. Dass ich als „Eingeborenen soviel und so gut Deutsch sprach, konnten sie gar nicht fassen, und es entlockte ihnen viele Ahs und Ohs. Dass die Touristin Margot Thormählen aus Düsseldorf meine Bude nachts einer Besichtigung unterzog und dabei auch nicht vergaß, das Bett zu zerwühlen, war eine kleine Freude des an Land gebliebenen Seemannes. Beinahe wäre es mir auch gelungen, dieses reizende Eiland mit einer deutschen Jacht zu verlassen; die wollte über den großen Teich segeln. Der Besitzer hatte mich schon angenommen. Vorschuss, schöne, blanke amerikanische Dollars wurden mir auf die Back gezählt, und dafür quittierte ich. Musste doch meinen Seesack aus dem Pfandhaus holen. Abschied feierte ich in der „Grünen Olive“ ... drei Tage lang. Die Jacht segelte ohne mich. Eben, weil der Wein so billig war, die Windlichter so flackerten, und weil mir der weiße Busen der Inez verdammt nahe lag. So kam es, dass die Jacht ohne mich segelte, ... und ich hatte doch schon für die schönen, blanken Dollars quíttiert. Dass die Jacht auf der Überfahrt verloren ging, erfuhr ich erst viel später, als ich schon längst wieder auf einem alten Eimer gemustert war. Ja, was so ein weißer Busen wert sein kann, … wenn auch mit mir nicht viel verloren gegangen wäre. – Ich liege an Deck und döse. Freiwache. Meine Hand streicht über die Kordelnarbe, und an der Kimm und im Blau des Tages versinkt Gran Canaria.
Der andere im Logis wohnende Deutsche heißt Emil. Er ist auch der Mann, mit dem ich am ersten Abend die Korbflasche Wein geleert habe. Emil hat aber nicht zu mir gesagt, dass er Deutscher ist, wir haben englisch miteinander gesprochen. Emil gefällt mir nicht, er hat ein ausgesprochenes Gaunergesicht, verschlagen, und hinterlistige Augen. Frau und Kinder hat er irgendwo in Deutschland sitzen lassen, und der Spruch „Was schert mich Frau, was schert mich Kind, lass sie betteln geh'n, wenn sie hungrig sind“, ist treffend für ihn. Emil hat keine Zähne. Doch Kuchenzähne hat er. Emil ist immer ohne Geld, versäuft jeden Cent. Ist impotent bis in die Zehenspitzen. Kommt durch das Saufen. Es gibt auch keine Geschlechtskrankheit, die Emil nicht gehabt hat, und er macht auch kein Hehl daraus. Und er spricht gern davon. Schanker, hart und weich, spanischer Kragen und Tripper, Emils Wortschatz darin ist unerschöpflich. Er meint auch, dass jeder Tripper heilbar sei, nur der erste nicht. Emil ist auch ein Wetzer und Radfahrer und Arschlecker. Aber nur ruhig Blut, ich komme schon noch hinter seine Schliche, lass mich nur erst einmal richtig warm sein. Einen Rat hat er mir aber gegeben, und der ist Gold wert, nur er selbst hat ihn nicht befolgt. „In einem Lokal, ganz gleich, ob in Hamburg, Marseille, in Rio oder sonst wo, musst du dir die hässlichste und älteste Hure zum Schlafen aussuchen, da holste dir so leicht nichts an 'nen Arsch. Eher bei einer Hübschen, denn da geh'n se alle ran“. Ein Spanier, ein Portugiese, ein Finne und ein Schwede teilen noch mit mir die Luft im Logis. Der Portugiese kommt aus Viano de Castelo und José, der Spanier, aus Avila. Ich glaube, die beiden lieben sich, aber das ist nicht meine Sache. Der Finne Elmar wurde im Elendsviertel von Helsinki groß. Sein Vater soff und ist in einer Säuferheilanstalt verreckt, seine Mutter säuft noch heute, und Elmar hat dieses prachtvolle Erbe angetreten. Aber wiederum nicht meine Sache. Elmar säuft alles, dessen er habhaft werden kann und was Alkohol enthält. Den billigsten Fusel, den schäbigsten Wein, vom Haarwasser denkt er sich den Geruch weg, und schon läuft das. Der Schwede Vänne säuft wohl auch; aber in Maßen und schläft dann bald, wogegen Elmar noch immer ein bisschen mit dem Käsemesser hantieren soll, sezieren an lebenden Körpern. Gar nicht andere, sondern seine eigene Kehle will er immer kitzeln. Er meint auch, man müsste mit einer rasiermesserscharfen Machete die Gehirnschale eines ausgewachsenen fetten Katers mit einem raschen Hieb seitlich abkippen und in das noch zuckende Gehirn eine Prise Salz geben, dann schnell auslöffeln ... das würde gar nicht so herbe schmecken. Der Finne Elmar pisst oft ins Bett ... und das ist scheußlich, besonders für Emil, der die untere Koje beschläft. Im Hafen ist es besonders schlimm, wenn Elmar einen gesoffen hat, dann schwimmt der Strohsack, wird durchnässt und stinkt. Die Bettlaken haben nach dem Trocknen, sie trocknen von selbst, große Flecken mit braunen Rändern, immer mehr braune Ränder, die sich ineinander verschlingen wie die Grenzen einer Provinzlandkarte. Emil kann weiter nichts tun als schimpfen und fluchen, denn an den hünenhaften Finnen wagt er sich nicht heran. Auf ernsthafte Drohungen von mir und Ernesto hin hat sich Elmar jetzt endlich bequemt, die untere Koje zu beziehen. Er pisst zwar weiter, aber nun kann der Moses doch unter der Koje die Pfützen auffeudeln. Er pisst zwar weiter, aber nun kann Emil wenigstens schlafen und wir auch, weil die nächtliche Pöbelei aufgehört hat. Der Finne hat einen Geschlechtstrieb wie ein Ostasiate und onaniert wie ein gefangener Pavian. Die Kojenwand ist ausstaffiert mit Bildern nackter Weiber.
Die gelben Fluten des Gambias rollen reißend seewärts. Gestrüpp, nackt, sperrig und blattlos, sticht aus dem Strom. Lianen, verschlungen wie Kinderhände beim Reigen, schwimmen mit. Tierkadaver, aufgedunsen, stinkend, gespickt mit nachtschwarzen Vögeln wirbelt der Gambia seewärts. Ein noch zappelnder Affe, mit todesnahen Augen und hilflosen Beinen, segelt durch Stromschnellen und versäuft. Weißnackte Baumstämme, ihrer Rinde entschält von Felsenmessern, trudeln quer oder schießen spitz in der Strömung. Baumstämme, blattlos, mit wirrigen Ästen, stehen sekundenlang aufwärts, als wüchsen sie im Strom. Zu beiden Seiten steht der Urwald, dunkel und drohend. In einer, Lichtung flegelt sich ein elendes Kanakernest. Entstehungsgeschichte: Als der liebe Gott mit der Erschaffung der Erde fertig war, behielt er noch ein paar Palmen, einige Quadratmeter Wellblech, einen Schock Neger und sonstigen Kleinkram übrig. Das alles schmiss er wahllos in die Gegend, setzte die männlichen und weiblichen Negerpipels mitten hinein, auf dass sie Früchte tragen ... und Kanakertown existiert von nun an und wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. Die Häupter der Palmen wiegen sich müde im stickig heißen Tropenwind. Das Zinkblech der Welldächer fängt an zu vergammeln. Die stinkende Jauche des Gambias spielt am Ufer mit verrosteten Konservendosen. Köter, mistig, struppig. Negernachwuchs wälzt sich im Dreck. Ein alter Ford ächzt durch morastige Pfade. Und der Urwald steht drohend und dunkel. Wir liegen schon sechs Tage auf dem Fluss vor Anker. Die Nacht fällt jäh und schwarz herunter. Die Nacht verschluckt hastig Urwald und Ufer. Der Mond sichelt sich durch das dunkle Himmelstuch. Der heiße, stickige Atem des Urwalds und der Verwesung steht über dem Fluss. In Scharen und Schwärmen kommen die Moskitos, getragen vom Atem, ausgedürstet nach Blut. Wir liegen auf unseren Strohsäcken mit schweißnassen Leibern und hundemüden Augen und morden Moskitos. Zerdrücken sie auf unseren Körpern. Zerreißen sie zwischen den Fingern. Schleichen sie an. Belauern sie. Zertrampeln, verbrennen, zerreißen, zerpflücken sie. Der heiße Atem bringt neue Legionen, der heiße Atem jagt sie in unsere Logis, der heiße Atem hetzt sie auf unsere Körper, der heiße Atem lässt sie sich in uns verbeißen, der heiße Atem trägt sie blutgefüllt wieder davon. Die Beulen an unseren Körpern kratzen wir blutig. Wir reiben uns mit Urin ein, dass wir stinken wie die Pissanstalten von Hongkong, ziehen unsere Baumwolldecken über die Ohren und versaufen im eigenen Schweiß. Der Schlaf kommt nur zögernd und bleibt an der Oberfläche. Am Tage wird uns auch nichts geschenkt, bei Gott nicht. Wir ziehen den Hochdruckkolben, wanken mittags nach oben, durchlaufen die Glut des Tages von mittschiffs nach vom und fallen an die Back. Natürlich gibt es heiße Bouillonsuppe. Diese verdammten weißen Köche sind auf allen Schiffen der Meere gleich im Zubereiten der Fresserei. In den Tropen heiße Suppe, im Eismeer Kaltschale. Heute Mittag war es wieder so. Die Suppe steht heiß und dampfend auf der Back, so heiß und dampfend wie die Stimmung. An der Oberfläche schwimmt gelbweißes Hammelfett. „Lasst ihr euch das gefallen?“ frage ich. „Du ja auch, Neuer“, höhnt einer. Mir steigt der Zorn hoch. „Wer geht mit mir nach mittschiffs?“ frage ich schneidend. Sie sehen sich an, sie sehen mich an, und der Spanier und der Portugiese sehen zuerst nach unten. „Na, wer kommt mit?“ „Ich“, sagt Ernesto. Wir fragen den Koch gefährlich leise, was es in der Offiziersmesse und im Kapitänssalon für eine Suppe gäbe. „Kaltschale natürlich, wie es sich für die Hitze und für die Herren gehört.“ „So, so, Kaltschale, so so. Und uns willst du mit deinem Heißgetränk den Schlund verbrennen, du verfluchter Hund, du ... Da, nimm und bade und verbrenne dir deine schmierigen Füße in dem Fraß!“ Ernesto und ich gießen mit einem Schwung dem Koch die heiße Brühe über die nackten Füße. Er springt wie ein Feuertänzer und schreit wie eine Straßenbahn in der Kurve. Das gelbweiße Hammelfett schwappt über die Fliesen der Kombüse, und der Steward geht mit einer weißen Terrine vorbei, einer Terrine mit Apfelsinenkaltschale, und an der Oberfläche schwimmen weißglasige Eisstückchen. Der Koch schreit, und Ernesto und ich gehen nach vorne. Erwartungsvolle Augen stehen fragend im Logis. Ernesto sagt: „Die Suppe kann teuer, aber auch besser werden.“ Wir beenden den Tag mit harter Arbeit, mit Schweiß und Fluchen und Stöhnen und Blasen an den Händen. Wohl werden Ernesto und ich von den „Ärmelstreífen“ seltsam angesehen, aber gesagt hat uns niemand etwas. Die Suppe scheint also nicht teuer zu werden, wenn auch der Koch mit verbrühten und verbundenen Füßen in der Koje liegt. Ja, heißes Hammelfett, weißgelb, hat es in sich. Was sich in den Köpfen von „denen“ da mittschiffs abspielt, ist schwerlich zu ergründen. Als Ersatz für die heiße Suppe schleppt der Moses an diesem Abend ein Viertelfass Rotwein nach vorn. Rotwein, woher kommt der? Hat die Schiffsleitung spendiert. Soll der Malaria vorbeugen. Ernesto und ich haben Bedenken: Wollen „die“ uns auf die Palme bringen, uns besoffen machen, uns herausfordern, um uns dann in Eisen zu legen? Das Fass hockt wie eine Kröte am Ankerspill. Die Afrikasonne hat den ganzen Tag ihre heißen Pfeile an Denk geschossen, spitz, grell, brennend. Die Luft zittert wie Gelee. Wir saufen den pisswarmen Wein aus Blechtassen. Die afrikanische Nacht ist da, und der Gambia rauscht weiter seewärts. Funzliges Licht einer Glühlampe pendelt herablassend von der Sonnensegellatte. Müder Glanz auf Glatzen verirrt sich in struppigen Bärten. Rotwein, pisswarm, trinkt sich gut aus Blechtassen. Und dann singen wir. Und dann grölen wir. Und dann schreien wir. Armes Afrika, deine Niggersongs und das Dommeln deiner Gebetstrommeln ist in meinen Ohren nur ein armseliges Geräusch gegen unser Singen, Grölen und Schreien. Vom Vorschiff eines „Panamesen“ über den dunklen, rauschenden Gambia bis an die drohende Wand des Urwalds wandern die Songs, wälzt sich Gegröle, verliert sich das Schreien. Und dann umarmen wir uns, und sie sagen zu mir Valentino, und der Koch liegt mit verbrühten Füßen in der Koje, verbrüht vom Hammelfett, und die Gummibänder sind fast gerissen. Am nächsten Tag tragen wir allhands eine Dornenkrone um den Kopf. Eine Dornenkrone, die verdammt sticht. Kommt von dem verfluchen Rotwein. Die Dornenkrone quetscht uns den Schwur ab, niemals wieder etwas von der Schiffsleitung Geschenktes zu saufen. Am nächsten Tag wird uns eine Sauarbeit verpasst ... wir müssen die Schmutzöltanks reinigen. Schmutzöltanks sind Folterkammern. Schmutzöltanks sind wie Bienenwaben mit Zellen, aus Eisen und ohne Honig. Schmutzöltanks sind oben und unten und seitlich schwarz und schmierig und glitschig wie Asphaltkocher. In den Schmutzöltanks ist es heiß wie in einer Gießerei und Öldämpfe stehen hartnäckig und bläulich. Wir schrauben die Mannlochdeckel auf, vierzig Muttern, die der Rost festgefressen hat. Wir können nur im Liegen arbeiten und nur abwechselnd, und manche Mutter muss mit Hammer und Meißel seitlich abgeschält werden. Eine Hundearbeit. Dann hieven wir den zentnerschweren Eisendeckel nach oben und lassen eine Kabellampe in das schwarze Loch. Langsam, wie Zigarrenrauch, steigen die Öldünste. Wir ziehen uns aus, tragen nur um den Kopf einen weißen Putzlappen, wie einen angegossenen Helm. Und wir steigen hinein in den Tank. Er ist nur eine halbe Mannslänge hoch und ist nur kriechend zu reinigen. Wir arbeiten Hand in Hand mit zwei Mann. Hecken in den Zellen und waschen mit Gasöl und Putzlappen die Decken und Seitenwände ab und zuletzt den Boden. Und einer leuchtet. Und beide sind wir verschmiert und glitschig und schwarz, und beide schwitzen wir und keuchen. Und stoßen uns die Schultern und Beckenknochen blutig und atmen schwer und schieben die Gasöleimer vor uns her, von Zelle zu Zelle, und ziehen das Kabel der Lampe hinter uns her, von Zelle zu Zelle. Lösen uns ab im Waschen und Leuchten. Schweißnass die Augen, und der angegossene Helm hat keine weiße Stelle mehr. Der Öldunst legt sich auf die Lungen, und der Atem wird kurz, wie bei einem kranken Kind. „Was hast du, Ernesto?“ frage ich. „Mensch, ich kriege kaum noch Luft“ sagt er. „Kommt vom Saufen“, sage ich und wasche weiter. Und Ernesto hält die Lampe, und das Kabel windet sich ölglänzend wie eine dünne Viper durch die Zellen und verschwindet im Einsteigloch. Ernesto hält die Lampe und die Lampe leuchtet. Dann hält Ernesto die Lampe nicht mehr. Die Lampe leuchtet nicht mehr, die lange Viper ist vom Dunkel und Dunst verschluckt. Das Atmen des kranken Kindes hat sich verstärkt, die Kabellampe mit Schutzglas und Glühbirne ist klirrend und jäh verreckt. Um mich steht Dunst und Dunkel, hastiger Atem, Stille, vor mir ein Eimer mit Gasöl. Ernesto kann ich nicht sehen. Ernestos Atem kann ich nur hören. „Ernesto“, schrei ich. Die Stille wirft mir nur den keuchenden Atem entgegen. „Ernesto“, brülle ich. Ich krabbele mich in die nächste Zelle. Nichts kann ich fassen, keine Hose keinen Leibriemen, keine Jacke, kein Hemd. Die Hände gleiten am glitschigen, ölverschmierten Körper von oben nach unten. Einen ölgetränkten Stofffetzen den angegossenen Helm halte ich in meinen Händen. An den Füßen haltend und ziehend und schleifend, von Zelle zu Zelle zerrend, bringe ich ihn zur Einsteigluke, immer der unsichtbaren, nur fühlbaren Viper mach. Ernesto ist nicht gestorben. „Kommt vom Saufen”, sagen die „Ärmelstreifen“.
Mit Petroleum wir unsere verschmierten Körper ab, einer dem anderen. Das beißt wie Hund. Und wir schrubben uns tüchtig mit Soda, Sand und Seife. Wir sehen aus wie gekochte Krebse. Die Tropennacht fällt hastig und schwarz aufs Schiff. Der Urwald wird von der Nacht gefressen. In Kanakertown funzeln die ersten Lichter. Die Blutsauger kommen und das Dommeln dröhnt. Wir liegen auf unseren Strohsäcken, schlafen, lesen, dösen. Die Luft im Logis ist stickig und heiß. Die geöffneten Bullaugen schneiden schwarze Scheiben aus der Nacht. Ernesto hat sich wieder erholt, er liegt unter mir in der Koje. Ich liege auf der Seite und stecke meinen Kopf über den Kojenrand. Ich frage: „Sag mal, Ernesto, glaubst du eigentlich an Gott?“ „Wie kommst du denn darauf?“ „Das will ich dir sagen. Als du wieder oben an Deck lagst und wieder Luft hattest und wieder lebtest, hab' ich mir gedacht, das muss doch irgendwer gemacht haben, der daran interessiert ist, dass du noch nicht krepieren solltest.“ Ernesto versucht sich vor der Frage zu drücken und sagt: „Es säuft keiner ab, der gehängt werden soll.“ Ich frage nochmals: „Glaubst du an Gott, Ernesto?“ Er antwortet: „Nein. Jedenfalls nicht an den alten Knaben mit dem Bart. Jedenfalls nicht an seine komische Gerechtigkeit und Güte und Liebe, die man ihm nachsagt, und die auch irgendwo geschrieben stehen soll. Das musst du doch zugeben, Valentin, wenn alle Gebete, die die Menschen aller Rassen und Farben und Nationen zu diesem Gott schicken, erhört würden, wo käme der 'arme liebe Gott' dann wohl bin?“ „Ja, es muss aber doch irgendwas geben, das uns leben lässt, oder uns das Leben gegeben hat. Dem Menschen, dem Tier, der Pflanze. Oder meinst du, das käme alles von selbst?“ „Gewiss ist irgendwas da, eine Kraft oder ein Geist. Ein unfassbares, unbegreifliches Wesen wird wohl da sein. Nur glaube ich nicht, dass dieses Wesen gerecht ist ... aber auch nicht ungerecht. Denn wir wissen ja nicht einmal, was Recht oder Unrecht ist. Weiter glaube ich nicht, dass man dieses Wesen mit Gebeten und Gesängen, mit Brand und Sühneopfern, mit Geschenken und Kasteiungen oder was weiß ich, beeinflussen kann, damit es für den jeweilig Opfernden alles zum Guten und zu seinem Nutzen wendet. Nee, daran glaube ich niemals. Und dann bezeichne ich jede Religion als ausgemachten Schwindel und als Geldschneiderei. Und ich behaupte, dass man mit der Religion gut, auf jeden Fall besser regieren kann, eben, weil die Menschen verdummt werden. Die sogenannten Vertreter der Gottheit auf Erden sind nicht bekloppt, das sind ganz abgefeimte Burschen, sage ich dir. Sie drohen mit Strafen, sie machen Versprechungen, sie sprechen von Himmel und Hölle.“ „Aber die Menschen sind doch glücklich dabei, Ernesto, und das sollte doch wohl im menschlichen Leben die Hauptsache sein. Es ist doch scheißegal, auf welche Art man glücklich wird, denn über die Höhe und Tiefe des Glücks kann man doch nicht streiten. Es kann doch niemand von sich behaupten, er sei glücklicher als der andere. Einen Messapparat für Glücksempfindungen gibt es doch bis zum heutigen Tage nicht. Sieh mal, wenn ich eine Hure belatschert habe, dass sie mit mir, ohne Geld dafür zu nehmen, schlafen geht – Geld gebe ich ihr nachher ja doch – dann bin ich glücklich. Und wenn sich Emil den Arsch so richtig vollgesoffen hat, dass er Knoten in der Zunge hat, dann ist er doch auch wohl glücklich. Ist denn nun mein Glück besser oder tiefer als seines? Und wenn Menschen in der Religion und im Gebet und in der Andacht glücklich sind ... dann ist es doch eben ihr Glück.“ „Hm“, macht Ernesto und legt sich in seine Koje zurück. „Sieh, und wenn der eine das Glück bei einer Hure findet, der andere im Schnaps und der letzte in seinem Glauben, dann ist das doch seine Sache. Die Hauptsache ist, er ist glücklich. Was siehst du denn zum Beispiel als Glück an, Ernesto?“ Ernesto richtet sich wieder auf, stützt sich auf den Ellenbogen und sieht zu mir herauf. „Nun will ich dir mal was sagen, Valentin. Glück ist Quatsch. Glück ist genau so ein Quatsch wie Liebe. Ist der Gesunde glücklich? Doch sicherlich. Wie man 's nimmt natürlich, er weiß nur nichts von seinem Glück. Aber der Kranke ist unglücklich, das weiß er, weil er Schmerzen hat. Der Gesunde müsste glücklich sein, weil er keine Schmerzen hat. Dann müsste es folglich mehr Glückliche als Unglückliche geben, weil es mehr Gesunde als Kranke gibt. Und doch ist es nicht so, die meisten Menschen sind nämlich nicht glücklich. Um auf deine Frage zu kommen, was ich unter Glück verstehe, so will ich dir sagen, dass ich überhaupt kein Glücksempfinden habe. Ich fühle mich wohl, wenn ich ein paar Flaschen Bier getrunken habe. Ich fühle mich wohl, wenn der Scheißarbeitstag vorbei ist, und ich mich auf den Sack legen kann. Soll mir nur keiner kommen und sagen, in der Arbeit findet man das Glück. Den jage ich nur für eine Stunde in den Schmutzöltank oder im Persischen Golf vor die Kessel. Ich fühle mich wohl, wenn meine Heuer in der Tasche klimpert. Aber ist das das Glück? Glück, von dem so viel geredet und gefaselt und gesungen und geschrieben wird? Ja, alle Empfindungen, wie Glück und Liebe und noch andere sind ganz große Scheiße, wie überhaupt das Leben.“ Ich lege mich zurück, ich weiß nicht, was richtig ist. - Plötzlich hören wir ein Schnurren und Knirschen an der Bordwand. Wir vernehmen Klopfen und Stimmen. Emil springt auf und läuft an Deck, kommt wenige Minuten später mit einem alten Neger und drei jungen Negerinnen in das Logis zurück. Ein Vater verkuppelt seine Töchter, ein Vater verkauft seine Töchter für eine Nacht. Ein Vater macht seine Töchter zu Huren. Und wie oft wohl schon. Drei Urwaldgewächse, jung, gut gewachsen und stinkend. Ein Pfund will der alte Gauner haben und seine Töchter morgen früh vor Tag mit dem Boot wieder abholen. Ein englisches Pfund, Gentlemen. Er kriegt sein Pfund. Über die Verteilung der Huren müssen wir uns selbst einigen und über die Reihenfolge auch. Es schläft keiner mehr, es liest keiner mehr. Drei Urwaldgewächse, für uns da, die ganze Nacht. Weiße Zähne blinken aus dunklen Gesichtern. Ich sehe nur Augen und Zähne und weiße Leinenblusen. Die Leinenblusen sind knapp und eng, und die spitzen Brüste wollen sie durchstechen. Wir atmen schwer. Wir sehen sie schon nackt. Wir sind normale Männer. Und die Mädchen kennen ihr Handwerk. Nummer eins setzt sich bei Ernesto auf den Kojenrand. Nummer zwei wird von Emil an den Tisch gezogen. Wir haben noch Rotwein und kippen ihn in die Tassen und lassen sie trinken. Emil macht das alles. Und sie zwitschern und lachen, sind freigiebig mit ihren Reizen und gar nicht prüde. Wir haben ja schon bezahlt. Ein gutes englisches Pfund ... billiger als im Puff, und frei Schiff geliefert. Ein gutes englisches Pfund, dafür können wir alles haben. Wir müssen uns nur einig sein. Billig, ein englisches Pfund, drei Mädchen und sieben Mann. Drei Mädchen, mit Brüsten und Beinen und Lenden die ganze Nacht. Die Luft im Logis ist heiß und stickig. Die Körper schwitzen, und die Mädchen stinken. Wir müssen sie unterhalten. Emil, der Impotente weiß, wie es gemacht wird. „Los, Emil, tanze!“ Emil kennt keine Hemmungen. Emil reißt sich sein schweißnasses Hemd vom Leib, steigt aus der Nietenhose und tanzt. Nackt. Wir sehen uns beim Duschen und Waschen immer nackt, wir sind unter uns, unter uns Nackten. Wir kennen keine Scham und keine Prüderie, aber jetzt ist das doch etwas anderes, jetzt badet Emil nicht, jetzt tanzt er ... tanzt nackt. Emil ist dürr und knochig und hat keine Zähne und tanzt nackt. Emil tanzt, und wir brüllen uns heiser. Die Mädchen lachen, die Urwaldgewächse, die jung und schwarz sind und stinken, und für die wir ein englisches, ein gutes englisches Pfund bezahlt haben. Emil tanzt, verrenkt die Glieder, wirbelt mit den dünnen, spinnigen, knochigen Armen, schmeißt die stakigen, mageren Beine. Die Krampfadern an seinen Beinen sehen aus wie kriechende, knorpelige hässliche Raupen und sind glasig blau. Seine Knie sind spitz wie Kegel. Bei den grotesken Verrenkungen bammelt und rotiert sein Glied wie der Klöppel einer Kuhglocke. Wir brüllen uns heiser. Die Negerweiber lachen. Emil hat keine Zähne, aber die Mädchen. Und wir saufen Rotwein, und Emil tanzt. Tanzt nach unserem Gebrüll. Ernestos Hürchen hat sich schon längst an ihn geschmiegt. Es sitzt noch auf dem Kojenrand, die Beine baumeln. Die verwaschene Leinenbluse hat Ernesto der Negerin schon ausgezogen. Ich kann das von hier oben alles gut sehen. Er hat die Bluse einfach vorne aufgeknöpft und sie nach hinten abgezogen. Die spitzen, festen jungen Brüste liegen frei, und zwischen den schwarzen Fleischkegeln glitzern Schweißperlen wie Brillantensplitter. Ernesto schiebt das Mädchen vom Kojenrand und takelt ihm den Rock ab. Das Negermädchen steht da in seiner tief dunklen Nacktheit in einem schmutzig dunklen Schmiererlogis ... und lacht. Dann kippt Ernesto das Mädchen einfach über den Kojenrand und deckt es brünstig zu. Ich kann das von hier oben ganz genau sehen. Meine Koje schwankt leicht, und Ernesto hat Schwung. Nun zieht auch Vänne ein Mädchen aus. Er mach: es mit genießenden Augen. Er macht es mit geilen Augen. Er macht es mit den Augen eines alten Lustmolches, der einer Striptease-Schau zusieht. Vänne macht es langsam und mit Bedacht. Lüstern wird Knopf für Knopf der Bluse geöffnet. Knopf für Knopf. Greift zwischendurch an die Brüste und knetet und walkt sie mit seiner schwieligen Hand. Das Negermädchen lacht, und die Bluse landet auf der Holzbank. Vännes Hand fährt nun unter den billig bunten Kattunrock, und mit der anderen Hand schiebt er den Rock nach unten. Das Mädchen hat keine Schamhaare. Das Negermädchen lacht. Nun knöpft Vänne seine Hose auf und legt seinen steifen Knüppel in die kleine, dunkle Hand des Negermädchens. Das Mädchen lacht und rollt mit den Augen und mit der Hand. Afrika steht draußen. - Afrika geht ums Schiff. Afrika umhüllt das Schiff mit seiner Hitze, mit seiner Nacht, mit seinem Atem und seiner Brunst. Afrika dringt in das Schiff, durch Eisenplatten und Schotten, durch Türen und Bullaugen. Afrika dringt in das Schiff, mit Mädchen und Moskitos, mit Gestank und Geschäft. Und das Mädchen legt sich wie selbstverständlich in Vännes Koje. Und Vänne lässt seine Nietenhose fallen und wirft sich mit einem Stöhnen auf das nackte Mädchen. Ich sage zu der Letzten: „Komm her, Mädchen!“ Und sie kommt lachend und klettert gewandt und flink wie ein Affe in meine Koje. Sie sind stur und träge, diese Negermädchen. Sie sind keine Liebeskünstlerinnen. Oder sind sie es nur bei uns nicht? Sollten sie mehr tun bei Ihresgleichen? Sollten sie unsere weiße Hautfarbe nicht mögen, oder unseren Körpergeruch nicht? Sollte in ihnen der jahrhundertlange alte Hass gegen die weißen Unterdrücker schlummern? Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal, ich werde schon fertig werden. Ich muss fertig werden. Schwer wird es werden, weil die Gummibänder noch da sind, die verdammten Gummibänder. Wohl dünn, aber noch nicht zerrissen. Ernesto ruht sich aus. Vänne fickt, und Elmar wartet mit glühendem Pfeil! Ja, sie lassen sich alles gefallen, mit ihnen kann man machen, was man will, aber aktiv sind die Negermädchen nicht. Sie ziehen sich nicht einmal aus, das muss man schon selbst besorgen. „Meine“ schob sich einfach den Rock hoch und sagte: „Come on, Mister!“ Wohl die einzigen englischen Brocken, die sie kennt ... sie genügen ja auch schließlich fürs Handwerk. „Nee nee,“ sage ich „so nicht, Mädchen, ich will dich erst einmal ausziehen!“ Die Gummibänder waren wohl dünn, aber noch nicht gerissen. Des Mädchens Brüste lege ich frei, Anschauungsunterricht habe ich ja gehabt. Den Rock strampele ich nach unten, über die Beine hinweg. Und der billige Kattunrock liegt wie eine Wurstpelle bündelig und zusammengeknautscht am Kojenfußende. Ich küsse ihre spitzen Brüste, ich sauge daran, sie schmecken nach Terpentin oder so. Die Brüste verändern sich nicht, die Warzen treten nicht aus ihren Etuis. Das Mädchen lacht. Verflucht noch mal, wenn die Weiber doch bloß mit ihrem verdammten Grinsen aufhören wollten. Das Lachen kann ich nicht mehr hören. Sie soll stöhnen, sie soll schreien und soll die Augen schließen. Ich küsse mich in Erregung. Küsse auch den Mund, so schwer es mir auch fällt. Die Haut der Negerin ist glitschig und strömt einen beißenden, ätzenden Geruch aus, nach ranzigem Fett, nach Fäulnis. Ja, den Geruch muss ich ertragen, bin ich doch an dem bezahlten englischen Pfund beteiligt. Der Spanier und der Portugiese schlafen, sie sind doch wohl schwul. Wie gesagt, nicht meine Sache. Jetzt liegt Elmar, der Pavian, auf Vännes Ableger, jetzt ist Elmar dran. Elmar hat ja auch bezahlt. Er brüllt wie ein Stier, als es bei ihm kommt. Und ich muss auch ... muss ... muss mich mit der Urwaldpflanze verkoppeln, muss sie besteigen, ... auch, damit die Gummibänder endgültig reißen. Fahre mit meiner rechten Hand, die linke presst einen Brustkegel, über den schwarzen, schlanken Körper. Streichele den Leib. Befingere ihn. Mit Verlaub gesagt, ich tue es nicht gerne, aber warum tue ich es überhaupt? Vielleicht kann ich mich von der Illusion nicht freimachen, dass auch eine Hure „reif“ und bereit sein soll. Warum eigentlich? Ich könnte doch zufrieden sein, so ich fertig geworden bin, oder nicht? Ich brauche doch das Fertigsein der Hure gar nicht, oder doch? Ich bezahle doch schließlich dafür. Scheiße, ich kann das Mädchen doch nicht geil machen, was soll ich mich da groß anstrengen ... aber ich will scharf werden. Das ist mein gutes Recht, das ist, das ist, jawohl das ist mein gutes Recht. Das Mädchen lacht. Jetzt ziehe ich meine Unterhose aus und nehme mein Glied und lege es in des Mädchens Hand, so wie ich es bei Vänne sah. Ich spüre mein Blut steigen. Steigen. Steigen. Die Beine reiße ich dem Mädchen auseinander und presse es hinein, presse es in die warme, große, trockene Öffnung. Ich stoße und stoße, stoße mit Wut... da hätte auch ein Stück Holz liegen können. Kein Widerhall. Nichts. Geschäft. Aber dampfende Körper. Ätzender Geruch. Schwirrende, blutrünstige Moskitos. Ächzende Kojen. Brünstiges Gestöhne. Und draußen steht Afrika, steht der dunkle Urwald, ist Zeugung, Kommen und Vergehen. Dacht ein tintenschwarzer Himmel, und gluckert das Wasser des Gambias am rostigen Bug der „BABITONGA“. Die Gummibänder sind gerissen, endgültig jetzt. In dieser Nacht stirbt Pepita nochmals. – Ein gutes Pfund, ein englisches, ist doch zu viel. Verdammt.
Der Morgen flimmert fahl durch die dunklen Palmen. Dorfköter kläffen heiser. Im Osten zeigt sich das erste Rot. Die Moskitos sind abgeflogen. Wir sind erst gegen Morgen eingeschlafen, da weckt uns dieses verdammte Schnurren und Klopfen. Die Mädchen werden ins Boot bugsíert. Ihre Gesichtsfarbe ist fahl, fahl von den Anstrengungen der Nacht, fahl vom grauen Schimmer des Morgens. Der Abschied ist unfreundlich, nur Ernesto wird noch mit einem langen Kuss von wulstigen Lippen bedacht. Ja, Ernesto hat einen dicken Schlag bei den Huren. Wir sind hundemüde. Der Spanier und der Portugiese haben ausgeschlafen, sie hat das Weibervolk nicht weiter berührt. Wir schlürfen den dünnen Kaffee, den der Moses eben von der Kombüse geholt hat, und sind mürrisch. Gehen bis zum Arbeitsbeginn an Deck. Der Morgen ist heller und etwas kühler, auf dem Gambia liegt leichter Nebeldunst. Es ist windstill, und aus den Elendshütten des Dorfes steigt schmutziger Rauch in den Morgen. Die grüne Mauer des Urwalds schweigt. Vom Ufer lösen sich flache Boote. Die Ladung kommt. Mit hastigen Ruderschlägen kämpfen sie gegen die Strömung. In graue Lumpen sind sie gehüllt, die Ruderer. Sie schnalzen mit der Zunge, und die Riemen ächzen. Die Ladung kommt. Endlich ist diese verdammte Liegezeit in diesem gottverdammten Nest vorbei. Die Winden rattern und rumoren wieder. Die Ladebäume schwenken und zerren in den Geien. Die schwarzen Ladungsarbeiter palavern und singen bei der Arbeit. Hiew auf Hiew wird vom Bauch des Schiffes gefressen. Hiew auf Hiew. So geht das zwei Tage und zwei Nächte. Maststrahler und Sonnenbrenner erhellen das das Schiff. Die Ladungsboote finden ihren Weg leicht. Rudern hin und her. Leer ans Ufer, voll zurück zum Schiff, und Hiew auf Hiew wird gefressen. So geht das zwei Tage und zwei Nächte. –
Die Anker lösen sich aus dem Schlick des Gambia. Das Rummeln und Poltern der Ankerkette ist an diesem Morgen ein unbarmherziger Wecker. Wir dampfen den Gambia hinab, und der blaue Südatlantik nimmt uns auf. Die Tage sind heiß, und die Wachen im Maschinenraum heißer. Aber keine Moskitos mehr. Sonnenheiße Tage und glatte See. Sternenhelle Nächte und phosphoreszierendes Bug- und Schraubenwasser. Jeden Morgen um vier Uhr, nach Wachschluss, stehen Ernesto und ich auf dem Vorschiff. Lehnen auf der Verschanzung, lassen den Schweiß aus unseren Wachklamotten vom warmen Fahrtwind trinken. Rauchen, sprechen und lassen den Morgen kommen. Die afrikanische Küste liegt in den Wehen des beginnenden Tages. „Du, Ernesto, was wissen wir Seeleute eigentlich von den Ländern, die wir besuchen, oder von den Städten in diesen Ländern?“ Ernesto sagte: „Nichts, mein lieber Freund. Absolut nichts. Aber wozu auch? Was weiß denn ein Taxifahrer von den Sehenswürdigkeiten seiner Stadt? Nichts. Ja, er kennt wohl das Rathaus und die Kirchen und sonstige Gebäude, kennt jede Straße - das ist berufsbedingt - aber die Bedeutung und die Herkunft der Namen bestimmt nicht. Interessiert ihn auch gar nicht. Was weiß denn das Zugpersonal eines Fernzuges von den Sehenswürdigkeiten der Städte, wo ihre Züge enden? Nichts, von Ausnahmen abgesehen. Kennen Artisten die Städte und Landschaften, in denen sie auftreten? Nein. Und wir, was kennen wir? Auch nichts. Den Namen der Stadt oder des Landes wissen wir. Wir kennen dafür aber die Puffs und die Kneipen, wo die Huren sind. Oder hast du schon mal einen Seefahrer kennengelernt, oder bist du mit einem gefahren, der Museen besuchte oder Kirchen besichtigte, in den Zoo oder botanischen Garten ging? Ich jedenfalls noch nicht. Aber was sollen wir auch da? Du, ich sage dir, es gibt Seefahrer, die wissen nicht einmal, in welchem Lande sie sich befinden, können es dir nicht einmal auf der Karte zeigen. Die meinen, Rotterdam läge in Belgien und Monrovia in Tunesien. Aber die Preise in den Puffs und in den Kneipen wissen sie, und die Nutten kennen sie mit Namen. Und in den Hafenstädten wissen die Taxifahrer über die Nutten und Kneipen auch Bescheid. Bist du schon mal über die Grenzen einer Hafenstadt hinaus gekommen?“ „Ich muss gestehen, dass es selten genug war.“ „Siehste. Meistens bist du in der ersten Kneipe an der Küste, wo Tingeltangel war, eine Box plärrte, oder eine Band wieherte, hängengeblieben. Oder wenn du dich in eine Taxe gesetzt hast, um nicht an der Küste hängen zu bleiben, brauchtest du dem Taxifahrer gar nicht dein Reiseziel zu sagen, er fuhr dich sowieso in den Puff. Das passiert dir in der ganzen Welt.“ Ich sage: „Das stimmt schon alles, Ernesto, aber es ist doch nicht richtig.“ „Wieso nicht richtig? Aus welchem Grund wolltest du wohl in alten Gemäuern herum krauchen, wo dir der Putz auf den Kopf fällt? Was interessieren dich Kirchen oder Tempel, wo du Gold siehst, das man den verbohrten Gläubigen aus der Nase gezogen hat? Was hast du von Museen, wo du alten, vergammelten, ausgegrabenen Plunder sehen kannst, wenn 's hoch kommt, ein paar vertrocknete Mumien, von denen du nicht weißt, ob sie echt sind? Oder denke an Gemäldeausstellungen, wo das Publikum durch rast. Irgendwann, vor zweihundert oder mehr Jahren, hat ein geiler Maler vollbusige und vollärschige Weiber gemalt, Weiber, die heute im Puff kein Mensch auch nur mit dem Arsch ansieht - jedenfalls ich nicht. Was haste von so einer Gemäldeausstellung, hm? Da gehen die feinen Leute auf die Fuchsjagd. Da steht irgendwo so 'n schwuler Lord in Positur. Da flattern goldene Engel um einen heiligen Kopf, oder ein heiliger Knabe wird von Pfeilen durchbohrt. Du siehst einen angeschnittenen roten Schinken, einen gekochten Hummer und einen toten Hasen, der seinen Rüssel über die Tischplatte hängt … und der Hintergrund ist dunkel. Du siehst in einer alten Bauernstube Leute beim Fressen oder Landsknechte beim Saufen.“ „Und wie ist es mit dem Theater?“ werfe ich ein. „Theater“, sagt Ernesto verächtlich, „das ist genau so 'n fauler Zauber. Da hopsen so ein paar Leutchen in einer Scheinwelt herum, verzapfen irgendwelchen Mist aus dem vorigen Jahrhundert oder singen sich stundenlang an.“ „Aber trotzdem. Andere Leute geben viel Geld aus, um in der Welt herumzukommen. Und ich will gar nicht mal sagen, dass es immer nur die Reichen sind. Mancher spart sich für eine Seereise das Geld mühsam zusammen, spart es sich wohl auch am Munde ab. Andere wieder haben eine Schwäche für alte Gebäude, für mittelalterliche Städte und so weiter, das kannst du doch nicht einfach als Nonsens bezeichnen. Nein, Ernesto, das kannst du nicht.“ Ernesto schnippt seine Camelkippe lässig über Bord und sagt: „Du Idiot. Hast du dir die Leute eigentlich schon einmal näher angeguckt, die da so durch die Welt reisen? So! Erstmal fragen sie den Seeleuten an Bord das Hemd vom Arsch, und wenn sie irgendwo an Land gehen, stehen sie da mit den Reiseführern vor einem Bauwerk, Prospekte in der Hand und reißen das Maul auf und mimen Erstaunen und Verstehen, manchmal auch Andacht. Mensch, dann könnt' ich ihnen in die Fresse schlagen. Abends aber sitzen sie in der Kneipe und peilen hinter dem Rücken ihrer Ehefrauen doch nach den Schönen des Landes, oder sie sind in den Puffs die Kunden, die die Preise versauen. Und ihre Erinnerungen, die sie zu Hause am Stammtisch preisgeben, drehen sich um die Weiber, um das Wetter und um den ausgezeichneten Wein oder Cognac oder was weiß ich für 'n Gesöff. Vielleicht sind nicht alle so, aber die meisten doch.“ „Ja, das ist alles schon richtig, aber was uns Seeleute angeht, da darfst du auch nicht vergessen, Ernesto, dass uns meistens die Zeit fehlt. In unseren Hafenliegezeiten arbeiten wir von morgens bis abends in Scheiß und Dreck und arbeiten schwer, das weißt du. Da hat kein Deubel mehr Lust, noch Museen oder Kirchen zu besichtigen oder ins Theater zu gehen. Dann ist man abends doch froh, dass man sich auf den Sack legen und filzen kann.“ „Faule Ausreden, stinkfaule Ausreden. Gib doch ruhig zu, dass uns das alles nicht interessiert. Wieso? Du bist ja nicht zu müde, um abends noch in eine Kneipe zu latschen oder in den Puff zu gehen, wo du ja bekanntlich auch nicht schläfst. Nee, nee, mein Lieber, wir wollen einander keinen Wind vormachen und das Kind beim richtigen Namen nennen.“ Wir schweigen. Sehen über das Wasser. Die afrikanische Küste steigt aus dem Blau, und die Sonnenscheibe schiebt sich blutrot an der Kimm empor. „Komm, Valentin, wir gehen schlafen.“ Von der Brücke glast es zwei Schläge – Fünf Uhr.
Die Wachen und Tage vergehen im Gleichmaß der Zeit. Den Äquator haben wir überquert. Sang- und klanglos. Auf einem deutschen Schiff ist das immer ein Fest, allerdings auch nur ein Grund, um sich wieder einmal anständig zu besaufen. Für mitfahrende Passagiere ein Grund, um Bier und Schnaps für die Besatzung springen zu lassen. Als Gegengeschenk wird ihnen nach der täuflichen Drangsalierung ein bunt bedruckter Taufschein überreicht, der sie mit dem Namen irgendeines Meerungeheuers bedenkt. Auf ausländischen Trampfahrern, gar noch unter der Panamaflagge, gibt es so einen Firlefanz nicht, obwohl wir einer zünftigen Sauferei und anschließendem Beischlaf mit den weiblichen Passagieren nicht abgeneigt wären. –
Wir laufen zum Bunkern für einige Stunden Kapstadt an. Bunkern Kohle, für uns eine mörderische Schinderei. Übernehmen Frischproviant, das meiste sind natürlich Konserven ... und Hammelfleisch. Landgang unmöglich. Abends sind wir wieder auf offener See, dem Indischen Ozean, Kurs Kalkutta. Diese Fahrt durch das Indische Meer hat etwas Seltsames an sich. Fast wochenlang ostwärts fahren heißt: den Sonnenaufgang überholen. Und zurück: einen Tag gewinnen. Raum fließt in Zeit und Zeit in Raum. Himmel, Wasser, runder Horizont. Reise durch die Zeit mehr als durch den Raum. Blaue Wellen unterm Steven, grauschwarze oder grüne. Hoch gekuppelter Himmel. Lämmerwolken. Wetterleuchtende Regensäcke. Landschaft aus Dunst. Fahren wir im Kreise? Kein Merkmal gibt der Raum. Allmorgendlich rückt die Zeit um fünfzehn Minuten vor. Um diese Zeit sind wir dem Sonnenaufgang näher gekommen. Wir überqueren die Linie noch einmal sang- und klanglos, diesmal nachts. Der Mond ist noch unten, aber die Sterne sind hell genug. Fettig glänzen die Wellenrücken wie flüssiges Blei. Perlmuttersplitt vorm Steven. Der Wind ist umgeschlagen, er ist unstet und unklar hier.