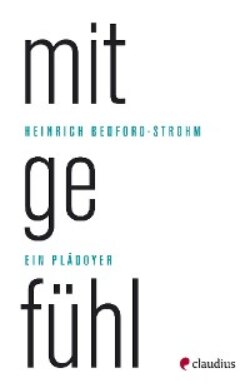Читать книгу Mitgefühl - Heinrich Bedford-Strohm - Страница 5
Оглавление„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen“. Dieser Satz aus der Bibel steht für eine öffentliche Kontroverse, die unser Land und ganz Europa im vergangenen Jahr mehr beschäftigt hat als jede andere Frage. Sie hat Europa an den Rand der Spaltung gebracht. Sie hat das Parteienspektrum in Deutschland verändert und für heftige und zuweilen erbitterte Diskussionen zwischen zwei Parteien geführt, die sich eigentlich als „Schwesterparteien“ verstehen. Sie hat für Streit in Freundeskreisen und Familien gesorgt, in dem starke Emotionen hervorbrechen. Und sie hat die Kirchen intensiv beschäftigt und in einem bislang kaum gekannten Maße zur öffentlichen Einmischung gebracht.
Die einen empfinden das Zitieren dieses Satzes aus dem berühmten Gleichnis vom Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums als Moralkeule, mit der alles, was an Fragen und Ängsten angesichts der großen Zahl der hier angekommenen Flüchtlinge aufgekommen ist, einfach beiseite gewischt werden soll. Die anderen beharren darauf, dass sich an diesem Satz eine grundlegende Überzeugung festmacht, die für das Christentum verbindlich ist: der Schutz der Schwachen und ganz besonders der Fremden.
Ich selbst habe diesen Satz zitiert, als ich am 13. September 2015 an der ungarisch-serbischen Grenze stand und in einer Live-Schaltung des heute journals meine Einschätzung der Lage zu erläutern hatte. Es war der Tag, bevor Ungarn das letzte noch offene Stück des Stacheldrahtzauns an der Grenze zu Serbien schloss. Der Schutz der Kultur des christlichen Abendlandes, die von den in ihrer Mehrzahl muslimischen Flüchtlingen bedroht sei, wurde vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wieder und wieder als Begründung für diesen Schritt ins Feld geführt. Der Schutz des „christlichen Abendlandes“ vor Menschen, in denen Christus selbst uns begegnet? Dass diese Spannung Stoff für Diskussionen bietet, liegt auf der Hand. Und dass die Kirchen nicht schweigen können, wenn das Wort „christlich“ in dieser Weise in die öffentliche Diskussion eingeführt wird, wird auch niemanden überraschen.
Wir haben uns eingemischt. Und das in einzigartiger ökumenischer Gemeinsamkeit. In den Interviews, die der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz Reinhard Kardinal Marx zu dem Thema gegeben hat, konnte ich jeden Satz unterschreiben. Immer wieder haben wir uns gemeinsam geäußert. Und der gemeinsame Besuch von Papst Franziskus und dem Oberhaupt der weltweiten orthodoxen Kirchen Patriarch Bartholomäus I. auf Lesbos hat gezeigt, wie sehr auch die orthodoxen Kirchen mit im Boot sind.
Ich will auf der Basis der dichten Erfahrungen des vergangenen Jahres und der Reflexion dieser Erfahrungen im Lichte der christlichen Überlieferung eine Zwischenbilanz ziehen und Wege für die Zukunft in den Blick nehmen.
Das Wochenende des 4. - 6. Septembers 2015 wird in die Geschichte eingehen. An diesem Wochenende kamen 20 000 Menschen am Münchner Hauptbahnhof an, die in ihrer übergroßen Zahl vor dem Krieg in Syrien und dem Nordirak geflohen waren und nach einem von Hoffnung und Enttäuschung geprägten Irrweg durch Europa nun endlich einen Zufluchtsort fanden. Es sollten im Jahr 2015 am Ende fast eine Million Menschen werden, die unser Land über Monate in Atem halten, aber dabei zugleich eine einzigartige Welle der Hilfsbereitschaft in Gang setzen würden.
Für mich begann die unmittelbare Konfrontation mit der Massivität der Flüchtlingssituation schon ein Jahr früher. Im September 2014 reiste ich in den Nordirak. Nur wenige Wochen vorher hatte der sogenannte „Islamische Staat“ dort die Stadt Mossul eingenommen. Seine Milizen hatten die Dörfer der Ninive-Ebene überfallen, Frauen und junge Mädchen entführt und versklavt, eine regelrechte Jagd auf die religiösen Minderheiten veranstaltet. Viele waren einfach in die Wüste oder in die Berge geflohen, hatten Zuflucht gesucht an Orten, die ihnen sicher erschienen. Ich habe mit vielen Flüchtlingen gesprochen, die ihre Hoffnung auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft setzten. Mir wurde unsere Verpflichtung deutlich, für eine von der Weltgemeinschaft garantierte Schutzzone sorgen zu müssen. Denn sonst, so sagten mir die Flüchtlinge, würden sie dorthin fliehen, wo Ruhe und Sicherheit herrschen und sie die Aussicht auf ein normales Leben hätten. Ich habe mich nach meiner Rückkehr für eine militärische Schutzzone der Vereinten Nationen eingesetzt, die den bedrohten Menschen in Nordirak Sicherheit gegeben hätte. Leider vergeblich!
Die Gefahr an Leib und Leben durch den IS wurde nicht überwunden. Viele machten sich tatsächlich auf den Weg in ein Land, in dem sie sicher sein und eine Perspektive für die Zukunft haben würden. Ganz ähnlich ging es den Menschen in Syrien. Sie gaben alles, um ihr Leben zu retten. Diejenigen, die wegen des Bürgerkrieges in Syrien nach Jordanien oder in den Libanon geflohen waren, fanden Bedingungen vor, die irgendwann für viele unerträglich wurden. Dem Lebensmittelprogramm der Vereinten Nationen ging das Geld aus. Die Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Schon aus Verantwortung für ihre Kinder machten sich viele auf den Weg nach Europa.
Während bis dahin die meisten an den Rändern Europas landeten, vor allem in Griechenland und Italien, war im Sommer 2015 alles anders. Die Menschen, die nach Europa kamen, wollten sich von Grenzen nicht mehr abhalten lassen – unbeirrt zogen sie dorthin, wo sie eine Zukunft vermuten.
Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland einreisen ließ, war richtig und ein Akt der Humanität in einer Notsituation. Die Gesamtbewertung der Situation hatte dazu geführt, die Regeln außer Acht zu lassen und einfach für die Menschen da zu sein.
An dem Samstag, an dem die ersten Züge mit Tausenden Flüchtlingen in München ankamen, habe ich mich mit Reinhard Kardinal Marx zum Münchner Hauptbahnhof aufgemacht. Dort arbeiteten Polizei, Behörden und viele, viele Ehrenamtliche Hand in Hand: Die Ankommenden wurden in Empfang genommen, mit Essen und Trinken versorgt und dorthin gebracht, wo sie zumindest die Nacht bleiben konnten, um dann zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gebracht zu werden. Die Anstrengung war gewaltig, die Stimmung aber sehr gut. Unter den Flüchtlingen herrschte große Dankbarkeit und unter den Helfern große Hilfsbereitschaft.
Es hat nicht lange gedauert, bis genau das unter Rechtfertigungsdruck geriet, was diese Bilder so erstaunlich machte. Ich bin davon überzeugt, dass es auch über ein Jahr später, nachdem die Euphorie wich und eine gewisse Nüchternheit eintrat, wichtig ist, sich daran zu erinnern und die Bilder vom September 2015 als besonders ausdrucksstarkes Zeugnis von etwas wahrzunehmen, das nach wie vor im Engagement von vielen Millionen Deutschen andauert. Es war eine gegenüber all den Leid- und Todbildern, die uns gegenwärtig so oft begleiten, wunderbar verkehrte Welt, die da sichtbar wurde und deren Zeuge ich bei einem Besuch am Münchner Hauptbahnhof zusammen mit Reinhard Kardinal Marx geworden bin.
Menschen, deren Leben eben noch durch Wellen auf dem Meer an Leib und Leben bedroht gewesen war, wurden jetzt mit einer Welle der Hilfsbereitschaft empfangen. In den Gesichtern der Menschen, die in ihren Heimatländern so Fürchterliches erlebt hatten und nun nach einer zum Teil lebensgefährlichen Reise in einem fremden Land ankamen, stand eine Mischung aus ungläubigem Staunen, Erleichterung und auch bloßer Freude.
Die Helferinnen und Helfer, mit denen ich gesprochen habe, haben trotz teilweise vieler Stunden bereits abgeleisteten Dienstes keine Minute an dem tiefen Sinn ihres Tuns gezweifelt. Und schließlich die Einsatzkräfte: Für mich ist ein Foto dieses Tages zu einem der Bilder des Jahres geworden. Es zeigt einen Polizisten am Münchner Hauptbahnhof, der einem gerade angekommenen kleinen Jungen seine Polizeimütze aufsetzt. Beide strahlen um die Wette. Eine Polizeiuniform, nicht Ausdruck einer staatlichen Gewalt, die Terror verbreitet, wie der Junge es in seinem Herkunftsland kennen gelernt haben mag, sondern sichtbarer Ausdruck von Humanität. Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht: Wie dankbar bin ich, dass ich in einem Land leben darf, in dem staatliche Beamte so mit Menschen in Not umgehen.
Wo immer ich konnte, habe ich meinen tief empfundenen Dank ausgedrückt gegenüber den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die geholfen haben und weiter helfen, aber auch an die unzähligen Hauptamtlichen in Politik, Verwaltung, Behörden, Polizei und Hilfsorganisationen, die mit unglaublichem Einsatz dafür gesorgt haben, dass die Erstaufnahme der Flüchtlinge so gut gelang.
Gut eine Woche nach dem historischen Wochenende in München stand ich an der ungarisch-serbischen Grenze in dem Grenzort Röszke. Die Menschen, die mir dort begegnet sind, waren erschöpft und erleichtert gleichermaßen. Sie hatten es gerade noch bis hierher geschafft, bevor die Grenze einen Tag später geschlossen wurde. Mir war klar, dass die, die nach ihnen kommen würden, vor dem Stacheldrahtzaun nicht stehenbleiben oder gar umkehren würden, sondern sich andere, möglicherweise auch gefährliche Wege nach Europa suchen würden. Am nächsten Tag reisten wir nach Serbien. An der serbisch-mazedonischen Grenze sprach ich mit Flüchtlingen, die gerade gehört hatten, dass der Weg über Ungarn an diesem Tag geschlossen würde. Kein einziger von ihnen erwog, einfach umzukehren. Hussein, ein Bäckergeselle aus Syrien, erzählte mir, wie er bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland fast ertrunken wäre. Seinen Pass hat er im Wasser verloren. Umkehren kam für ihn nicht in Frage. Wohin hätte er gehen sollen? Sein Optimismus schien unerschütterlich. Ich denke oft an Hussein und frage mich, was aus ihm geworden ist. Ob er auf anderem Wege nach Deutschland oder ein anderes Land Europas gekommen ist? Oder in Griechenland festsitzt? Oder wieder zurück in die Türkei gebracht wurde und dort in einem Lager gelandet ist?
Im September dieses Jahres habe ich ein solches Lager besucht – im türkischen Diyarbakir – 150 km von der türkisch-syrischen Grenze. In dem Lager wohnen vor allem jesidische Familien aus dem Nordirak, die meisten von ihnen aus Sindschar, wo im August 2015 Zehntausende vom IS eingeschlossen waren. Manche sind verhungert oder verdurstet. Viele konnten durch den Einsatz der amerikanischen Luftwaffe und der Peschmerga-Kämpfer gerettet werden.
Die jesidische Familie, mit der wir im Zelt gesprochen haben und die seit 2 ½ Jahren hier lebt, ist verzweifelt. Das Schlimmste ist die Trennung. Die Frau mittleren Alters, mit der wir sprechen, erzählt von ihrem Sohn in Griechenland und von einem anderen Sohn in Deutschland. Dort werde er gut behandelt. Ihr sehnlichster Wunsch ist, zu ihm zu kommen. Bisher haben sich keine Wege dazu aufgetan. Die jüngere Frau, die neben ihr sitzt, eine Cousine, hat zwei kleine Kinder auf dem Schoß. Sie hat keine Ahnung, wo sie hin soll. Die beiden Kinder haben keinen geregelten Schulzugang. Nur dank der Diakonie Katastrophenhilfe, die mit ihren türkischen Partnern zusammen, von der Stadt Diyarbakir unterstützt, das Lager trägt, bekommen sie Förderung.
Fast drei Millionen Menschen hat die Türkei aufgenommen. Ist es zu viel erhofft, dass eine jesidische Mutter, die seit Jahren ohne Perspektive in der Türkei in einem Lager wartet, zu ihrem Sohn nach Deutschland kann? Solche Geschichten sind der Hintergrund dafür, dass wir als christliche Kirchen nach wie vor mehr legale Fluchtwege nach Deutschland und Europa fordern.
Und noch von einer anderen Reise erzähle ich. Es war der Kurzbesuch auf Sardinien, zu dem ich im August 2016 aufgebrochen bin. Auf der Werra, einem Schiff der Bundesmarine, habe ich die Soldaten besucht, die in der Mission „Sophia“ im Mittelmeer eingesetzt sind. Ihr Auftrag ist vor allem die Zerschlagung der Schleppernetzwerke, die ohne Skrupel Flüchtlinge in akute Lebensgefahr bringen, indem sie sie in Schlauchboote pferchen und aufs Mittelmeer schicken. Ihr Motiv ist nicht Humanität, sondern reine Geldgier. Sie ist dafür verantwortlich, dass alleine in der ersten Hälfte des Jahres 2016 um die 3 000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Ich begrüße ausdrücklich die Zerschlagung dieser Schleppernetzwerke. Sie sind verbrecherisch. Es ist eine polizeiliche Aufgabe, die die Bundesmarine dort erfüllt. Gekoppelt mit alternativen, legalen Fluchtwegen, verdient diese Aufgabe Unterstützung.
Noch klarer ist das bei der Aktivität, die faktisch den größten Raum für die Werra einnimmt. 17 000 Menschen haben die Boote der Bundesmarine schon vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet. Zwei von ihnen hatte ich am Vorabend beim Besuch eines Flüchtlingsheims auf Sardinien persönlich kennen gelernt. Ohne den Einsatz der „Werra“ wären sie tot. Das war der Grund, warum ich bei meiner Predigt im Gottesdienst auf der „Werra“ von einem „Samariterboot“ gesprochen habe. Mancher mag sich gewundert haben, dass ein Bischof ein Militärboot so bezeichnet. Aber ich habe das bewusst getan. Denn hier ging es nicht um das Segnen von Waffen, sondern hier ging es um das Segnen von Nothilfe für die Schwächsten.
Meine Erfahrungen in der direkten Begegnung mit den betroffenen Menschen haben mir gezeigt: Das Leid der Menschen, die aus ihren Ländern fliehen, ist groß. Man kann, man darf es nicht einfach wegschieben, indem man die Grenzen schließt und die Menschen, um die es geht, damit lediglich aus dem eigenen Gesichtsfeld entfernt.
Was war es, das in München, in Saalfeld, in Dortmund und in so vielen anderen deutschen Städten die Menschen mobilisiert hat, um andere Menschen willkommen zu heißen, die sie noch nie gesehen hatten? Und aus welcher Quelle kommt es? Was ist es, was die Menschen motiviert hat?