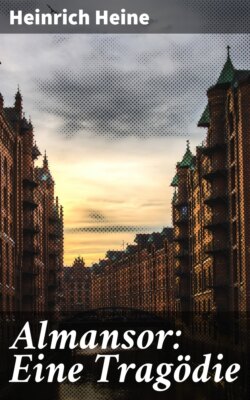Читать книгу Almansor: Eine Tragödie - Heinrich Heine - Страница 4
Einleitung des Herausgebers.
ОглавлениеDas leidenschaftliche Erlebnis Heines, das seine ersten Gedichtsammlungen beherrscht, hat sich auch in dramatischer Form aussprechen wollen; 1823 erschienen die beiden Tragödien Heines, „Almansor“ und „William Ratcliff“. — Der „Almansor“ ward in jenem Spätsommer 1820, den Heine im Dorfe Beul bei Bonn verbrachte, zu schreiben angefangen und während des darauffolgenden Göttinger Aufenthalts nahezu beendigt. Ein Brief Heines an Fouqué (10. Juni 1823) bekennt, die Romanze „Donna Clara und Don Gayferos“ aus Fouqués „Zauberring“, an die er in bedeutenden Lebenssituationen habe denken müssen, habe ihm vorgeschwebt, als er den „Almansor“ schrieb. Indessen ist es nicht vielmehr als die Gegnerschaft von Mauren und Christen und das Motiv der Liebe, die aus dem einen Lager in das andere übergreift, was die Fouquésche Romanze für den Almansor abgab (sie wirkte viel stärker auf Heines Gedicht „Donna Clara“ ein). Vielleicht war es jene schwüle Spannung zwischen Christen und Juden, die Heine in Hamburg verspürte, und die 1819 in einigen deutschen Städten zu Beunruhigungen der Juden durch den Pöbel führte, welche in ihm, der von Haus aus nichts weniger als Haß gegen das Christentum kannte, das Gefühl des konfessionellen Gegensatzes zum Bewußtsein gebracht, zu einer lebendigen Angelegenheit für ihn gemacht hat; dergestalt, daß er das dargebotene Motiv religiöser Gegnerschaft mit persönlicher Erbitterung aufgriff. Heine selbst bezeichnete das Stück als „religiös-polemisch“, und so verstand man es auch; am Rhein erhoben sich sogleich katholische Stimmen dagegen. Es ist die Indignation des Juden, die aus der maurischen Maske redet. — Heine gestand sich schon in Göttingen ein, was er da geschrieben, sei nicht nur keine gute Tragödie, sondern verdiene gar nicht mal den Namen Tragödie (4. Februar 1821). In der Tat ist sein „Almansor“ nichts weiter als ein Geschöpf des aufflackernden Gefühls, ohne Körperlichkeit, ohne Schwere. Der junge Mensch, der dies Stück verfaßt hat, will nicht ein Weltbild schaffen, sondern sich nur einen Exzeß der Leidenschaft bereiten. Dieselbe juvenile Einschätzung der Leidenschaft, wie sie den Gedichten Heines aus dieser Zeit zugrunde liegt, wählt sich hier einen auf nichts als auf seinen maßlosen Affekt gestellten Helden, der bereit erscheint, ohne daß er darum minder ernst genommen würde, um dieses Affekts willen die Glaubenspartei preiszugeben. Was nur eine moralische Bildungsstufe des Verfassers zu sein scheint, ist zugleich eine künstlerische: soweit nicht seine subjektivste Empfindung die Figuren zum Reden bringt, versiegt die Gestaltung. Er ergreift Partei, er ist nicht mit derselben bildenden Liebe wie bei seinem Helden beim Antagonisten, den er vielmehr zu einer magern Karikatur verzerrt; er fühlt seine Menschen nicht nach ihrem ganzen seelischen Komplex durch, es ist ihm genug, sie pittoreske Stimmungen aussprechen zu lassen: das Finale des Stückes, daß Zuleima in allem Ernst und ohne mehr zur Besinnung zu kommen, im Himmel zu sein glaubt und so sich hingibt und untergeht, ist ein Balladeneinfall. Und balladenhaft, ein bloßes Stimmungsbedürfnis befriedigend, bewegen sich die Figuren gegeneinander: zu rechter Zeit ist der alte Hassan da, wenn Almansor eine Frage in den Wind tut; Zuleima hat ein langes Liebesgespräch mit Almansor, bis ihr einfällt, daß sie ja heut mit einem andern Hochzeit machen muß; und wie in der Ballade, wo die einfachste Replik schon, indem sie als symbolisch empfunden wird, die schwerste Wirkung tun kann, stürzt Almansor auf ihre wenigen Worte hin unter Verfluchungen auf und davon. Wie das Renegatentum des Hauses durch die drei Motive der bisher verbotenen Speise (der Schweinskopf), der Kleider (das maurische Kostüm, das noch als Maske gut ist), des Tanzes (statt des maurischen der spanische Fandango) ironisch schmerzlich fühlbar gemacht wird, das hat ganz die Art, wie Heine so etwas in der Ballade behandeln würde: dort mit voller Wirkung, denn man nimmt es andeutend; hier in der „Tragödie“ bleibt es ein dünnes Spiel. So schwankt schließlich auch das Zuständliche dieser dramatischen Welt zwischen dem Wirklichen und dem Sinnbildlichen: daß etwa Almansor in Zuleimas Garten statt der Myrte, die Zypresse findet; den Granatbaum vermißt, wo die Nachtigall ihr Liebesweh den roten Rosen klagte, und ihm erwidert wird: „Die rote Rose ward vom Sturm entblättert, Die Nachtigall samt ihrem Liede starb, Und böse Äxte haben abgehau'n Den edlen Stamm des blühenden Granatbaums.“ Und wenn er sich im Schwärmen: „Bekannte Bilder hüpfen aus den Büschen ..“ unterbricht: „Doch sprich, mein Lieb, dort steht ein fremdes Bild“, so besitzt dies Bild, das Bild des Crucifixus, wie nur durch das Wort herbeigezogen, kaum mehr die Realität eines wirklichen Requisites. Ganz ungegenständlich ist vollends der Chor, der in seinen epischen Zwischensatz eine aktuelle Anspielung auf den modernen spanischen Insurgenten Rafael del Riego einwebt. Die völlig undramatische Organisation dieser Arbeit läßt sich am sichersten in der Sprache fühlen. Einem empfindlichen Gehör wird schon der Versstil, in welchem Satzende und Versende allzu wohlig zusammenfallen, verdächtig sein. Der ornamentale Aufbau der Reden in parallelen Satzgefügen mit gleichen Anfangsworten, bereichert durch Antithesen, entgeht niemandem. Auch die rhythmische Gliederung im großen ist auffallend genug: etwa im Zwiegespräch Almansors und Zuleimas durch die dreimal in Abständen vorgebrachten Einwürfe Almansors: „Doch, sprich mein Lieb ...“, was unmittelbar an die Technik Heinescher Gedichte erinnert. Die verblümte Beredsamkeit, mit der jedes Gefühl mehr umschrieben als ausgesprochen wird, die Bilderfülle hat Heine selbst schon als Mängel seines dramatischen Gedichtes empfunden. Im Grunde bedeuten diese Künste des musikalischen Aufbaues der Reden, des in sich selbst schwelgenden Ausdruckes nichts anderes, als daß die Personen gar nicht miteinander reden, sondern jede für sich; daß nicht dialogisch, sondern auf dem Boden der Einzelrede die Steigerung des Gefühls gewonnen wird. Ja, man muß nur an die Arie denken, die Almansor auf die einfachen Worte Zuleimas anstimmt: „Zuleima wird vermählt heut Mit einem Mann, der nicht Almansor heißt“, wie er sich monomanisch, durch Bilder, durch Redefiguren auf den Gipfel der Erregung bringt; oder: wie er sich aus der Rede Zuleimas „Ins Haus der Liebe trat dein Fuß, Almansor ...“ allein das Wörtchen „Liebe“ herausholt, um gleich darüber ein Wortfeuerwerk abzubrennen, und man wird der tief undialogischen Natur dieses Dichtwerks inne werden. Mit seinen Figuren, die so schlecht ihrem Gegenspieler zuhören, muß man die Geschöpfe eines wirklichen Dramatikers wie Heinrichs von Kleist vergleichen, die mit einer wahren Begierde sich das Wort vom Mund abfragen. Was der Dichter dieses „Almansor“ in der Welt sieht, ist nicht das Aneinandergebundensein der Menschen, das eigentliche Thema des Dramatikers; es ist vielmehr die einzelne Seele, der Zustand einer Seele, was ihn gefangen nimmt.
Die kleine Tragödie „William Ratcliff“, in der Heimat der Ballade, im Schottischen Hochland angesiedelt, nannte er später selbst einmal eine „dramatisierte Ballade“. Ihre „Grundidee“ bezeichnete er dem Buchhändler, dem er sie zum Verlag anbot, als „ein Surrogat für das gewöhnliche Fatum“. „Das gewöhnliche Fatum“ — der Ausdruck ist nicht ohne Humor. In der Tat: es ist das von Hand zu Hand gegebene Inventarstück der damals Mode gewordenen Schicksalstragödie; kurz bevor Heine den „Ratcliff“ schrieb, hatte er die „Ahnfrau“ im Theater gesehn. Aber wie dies modische Fatum ist auch die „Grundidee“ des Ratcliffs nichts, was mit einer persönlich notwendigen Konzeption des Wirklichen zu schaffen hätte. Das Motiv, daß eine ungestillte Liebe zwischen dem Vater des Helden und der Mutter der Geliebten dem Helden seinen Pfad vorzeichnet, bleibt eine poetische Seltsamkeit; es ist nur dekorativ gefaßt und bringt mit seiner Pantomimik allenfalls den Effekt einer ahnungsvollen Stimmung hervor. Die Sprache faßt sich hier knapper und unverblümter als im „Almansor“, doch muß über die dichterische Organisation, die hinter dieser Arbeit steht, dasselbe gesagt werden, was bei Gelegenheit des ersten Stücks gesagt worden ist. — Auch der „Ratcliff“ bezieht sich auf das entscheidende Erlebnis des jungen Heine: ja, er hat dem Dichter für eine „Hauptkonfession“ gegolten. Was in den „Jungen Leiden“ sich andeutete, springt hier nackt in Lebensgröße hervor. Amalie Heine hatte sich 1821 verheiratet, und das alte Gefühl, das noch einmal hervorbrach, ist zur phantastischen Wildheit gesteigert: weil die Geliebte nein sagt, wird der Liebhaber zum Vagabunden. Jenes Leben in Hamburg — „toll, wüst, zynisch, abstoßend“ — das er damals in seinem wütenden Schmerz geführt haben will (an Wohlwill, 7. April 1823), spiegelt sich mit einem finstern Glanz nun hier in dem romantischen Leben William Ratcliffs wider, und so ist es für den Dichter eingebracht: „Auch hab' ich mich ehrlich Tag und Nacht Mit Lumpengesindel herumgetrieben, Und als ich all diese Studien gemacht, da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben“. Es war nichts als ein Stimmungsrausch, eine Selbstrechtfertigung, Selbstverklärung, eine Exaltation des Ich, woraus der Ratcliff hervorging; man glaubt es gern, daß diese atemlose Flucht kleiner Szenen in drei Januartagen des Jahres 1822 improvisiert wurde, „in einem Zug und ohne Brouillon“. Ihre Substanz erschöpft sich fast im Erzählen. Ihre Figuren — bis auf den Helden — sind wieder nur obenhin angelegt, sie setzen eine vage Situation voraus, mit der eine Ballade, nicht ein Drama auskommt. Sie wirken nicht durch Verwicklung, durch dialogisches Ineinandergreifen der Spieler, sondern durch Gefühlsaufruhr und durch stimmungmachende Akzessorien: die greise Margarete ist nichts als eine unheimliche Staffage, die Edwardballade ist wie ein musikalisches Motiv in das Ensemble der Stimmen verwoben.
Als Heine 1851 den „Ratcliff“ seinen „Neuen Gedichten“ einverleibte, wußte er besonders zu rühmen, daß darin schon „die große Suppenfrage“ brodle. Er dachte an die Szene in der Diebsherberge. In Paris bildeten die sozialen Probleme eines seiner lebhaftesten Interessen: so begreift sich, daß er auch diesen Ton aus seinem geliebten Jugendwerk heraushören wollte. Mit ruhigem Blute wird man in den Bitterkeiten dieses William Ratcliffs, die dem jugendlichen Dichter sein allgemeines Verhältnis der Opposition eingab, kaum eine Gesinnung verspüren, der der soziale Organismus im Ernst fragwürdig geworden ist.
Auf die Bühne kam zu Heines Lebzeiten nur der „Almansor“. Er wurde am 20. August 1823 in Braunschweig unter dem Direktor Klingemann aufgeführt, der das Stück, in dem „eine südlich brennende Phantasie“ herrsche, wert hielt. Einer Personenverwechslung halber — es ward verbreitet, ein Braunschweiger Geldwechsler Heine sei der Verfasser — scheiterte die Aufführung, man konnte nicht zu Ende spielen. Klingemann wagte nicht, die Vorstellung zu wiederholen, die Absicht, den „Ratcliff“ zu geben, ließ er fallen.
Andere dramatische Pläne, mit denen Heine umging, sind nicht reif geworden. Im Sommer 1823 dämmern ihm die Umrisse einer venezianischen Tragödie, er liest Italienisches dafür, will „Naturmystik“ darin geben (23. Juni, 23. August 1823), — man weiß nichts weiter darüber. In den Jahren 1824 bis 1826 meldet sich immer wieder der Schatten einer Faustdichtung. Das Tagebuch seines Freundes Wedekind (vgl. Blumenthals „Neue Monatshefte für Dichtkunst und Kritik“ V., 325 f.) erzählt unterm 20. Juni 1824: „Wir kamen auf Goethes Faust zu sprechen. ‚Ich denke auch einen zu schreiben,‘ sagte er [Heine]; ‚nicht um mit Goethe zu rivalisieren, nein, nein, jeder Mensch sollte seinen Faust schreiben.‘“ Man erfährt weiter (16. Juli): Heines Faust soll nicht, wie der Goethesche, selbst handeln, befehlen, vielmehr von Mephistopheles zu allen Teufeleien verführt werden. Sein Faust soll ein Göttinger Professor sein; der Teufel belegt Kolleg bei ihm, macht ihn kirre, so daß er anfängt liederlich zu werden. Er kann sich in der Stadt nicht halten und geht mit dem Teufel auf Reisen. „Auf den Sternen haben die Engel inzwischen Teegesellschaften, zu denen sich Mephistopheles auch einfindet, und dort beratschlagen sie über den Faust. Gott soll ganz aus dem Spiele bleiben. Der Teufel schließt mit den guten Engeln eine Wette über Faust. Die guten Engel liebt Mephistopheles sehr, und diese Liebe, besonders zum Engel Gabriel, denkt Heine so zu schildern, daß sie ein Mittelding zwischen der Liebe guter Freunde und der Liebe der Geschlechter wird, die bei den Engeln nicht sind.“ „Über das Ende ist sich Heine noch nicht gewiß.“ Man könnte Heine einen solchen phantastisch-satirischen Faustentwurf ganz gut zutrauen und braucht wohl nicht anzunehmen, daß er damit den Freund habe mystifizieren wollen; es läßt sich in jenen Heineschen Jahren gar kein Gehalt, außer dem der Satire, entdecken, der in einem Faust niedergelegt werden sollte. Indessen kann man mit Wedekind wohl zweifeln, ob er überhaupt ernstlich die Absicht hegte, den Faust auszuführen. Als er 1824 Goethe in Weimar aufsuchte, soll er sich gegen ihn über einen Faustplan geäußert haben (Maximilian Heine, Erinnerungen). 1826 kommt er auf seinen Faust zurück: „Ihnen [Varnhagen] ist es nicht hinreichend, daß ich zeige, wieviel Töne ich auf meiner Leier habe, sondern Sie wollen auch die Verbindung dieser Töne zu einem großen Konzert — und das soll der Faust werden.“ Und noch einmal schrieb er im Sommer dieses Jahres aus Norderney: „In diesem toten Zustande nehme ich dennoch viel Naturanschauung in mich auf, und verarbeitet die Phantasie manches begonnene Gedicht, Seebilder und neue Szenen zu meinem Faust.“ Danach läßt er nichts mehr über den Plan vernehmen. Das Tanzpoem vom „Doktor Faust“, das er 1847 schrieb, hat wohl nichts mehr mit den damaligen Gedanken zu tun.
Nur in der Form des Balletts, eben in diesem „Doktor Faust“ (1847) und in der „Göttin Diana“ (1846), beide für den Direktor des Londoner Theaters der Königin geschrieben, hat Heines Produktion seit seinen dramatischen Anfängen auf die Vision selbständig bewegter Gestalten gegriffen; ja auch in diesen Ballettentwürfen ist der Stoff nicht überall rein in den pantomimischen Ausdruck übergegangen, hin und wieder zehrt ein Bild von dem erzählerisch interpretierenden Wort des Schriftstellers (wenn sich etwa Faust mit einer „Mischung von Unbeholfenheit und Mut, von linkischer Magisterhaftigkeit und trotzigem Doktorstolz“ bewegen soll). Auf die Erfindung eines individuellen Gebärdenspiels, eigentümlicher Tanzfiguren hat der Dichter sich nicht eingelassen, es sind vielmehr die ausgebildeten Tänze der Nationen und Zeiten, die er mit großer Geschicklichkeit verwendet, und er begnügt sich vorzuschreiben, was die Gebärden ausdrücken sollen. Auch die Dekorationen wirken mehr charaktergebend, symbolisch, als daß sie als individuelle Bilder durchgedacht wären. — Was den „Doktor Faust“ betrifft, so war sich Heine von vornherein bewußt, daß er bei den Mitteln, die ihm das Ballett zur Verfügung stellte, nicht mit Goethe konkurrieren könnte; doch, von aller Behandlungsweise abgesehen, bleibt ein „Faust“, wie dieser Heines, der allein auf das erotische Motiv abgestellt ist, außerhalb jedes Vergleichs mit der Universalität von Motiven, die der Goethesche in sich begreift. Heines „Faust“ steht in engstem Zusammenhange mit den Sagenstudien, die er in Paris betrieb, eine Vorrede von nicht ganz zuverlässiger Gelehrsamkeit, eine gelehrte Nachschrift, in die Form eines Briefes gekleidet, rahmen ihn ein; ja im Gefühl dieser Gelehrsamkeit, in irgendeiner historisch-romantischen Zärtlichkeit für das Überlieferte, wirft er es dem Gedicht Goethes vor, daß es seinen Helden, der Sage zuwider, der Hölle entreißt, und glaubt selber darin den Vorzug zu verdienen, daß er der alten Sage treu bleibt. Man braucht über diesen Vorwurf Heines, der einem seiner allzumenschlichen Augenblicke entstammt, kein Wort zu verlieren: er hat schließlich mit der Pietät gegen die Überlieferung, in welcher der Teufel am Ende den Helden holt, nur ein Kuriosum hervorgebracht.
Das andere Ballett „Die Göttin Diana“ hat eine etwas persönlichere Wendung. Die Antithese: deutsch-christlicher Spiritualismus und antike Sinnlichkeit, die seit der Berührung mit dem Saint-Simonismus in Paris Heines Denken beherrscht, löst er hier im Sinne seines Tannhäusergedichts: mit einer Glorie des Genusses. Stofflich knüpft dies Tanzpoem an die Erzählungen an, die er in Erinnerung an das Eichendorffische „Marmorbild“ in den „Elementargeistern“ gegeben hatte; er schloß es in seinen vermischten Schriften den „Göttern im Exil“ bei, mit denen es sich auch unmittelbar berührt. — Aufgeführt worden ist keines der beiden Poeme. Eine „Satanella“, die 1851 auf der Berliner Bühne getanzt wurde, lehnte sich wie es scheint, im Stoff an seinen „Doktor Faust“ an. Sie erinnerte aber, wie Heinrich Laube aussagt, nur wenig an diesen, und Heines Ansprüche auf Entschädigung blieben unbefriedigt.
Es ist etwas Sinnvolles, daß der Dichter des „Almansor“ der das stimmende Abendrot mit in das Spiel eingreifen ließ, dessen „Ratcliff“ in schauerlich-pittoresken szenischen Effekten gedichtet ist, am Ende sich in dieser Form der musikalisch-malerischen Pantomime äußert; was ihn hier reizt, ist dasselbe, wodurch er sich anfänglich zu dramatischen Produktionen veranlaßt fühlte: nämlich die Eigenschaft des Dramatischen, daß es durch Gegenwart bewegter Gestalten, durch bedeutende Hintergründe und Beleuchtungen unmittelbar auf das Gefühl wirkt. Dies ist aber nur eine Seite des Dramatischen; wenn dramatischer Dichter sein heißt, den Streit der Dinge so fühlen, daß man ihn in seiner ganzen Verfänglichkeit, mit Blut und Schmerzen, in sich heraufbeschwören muß, so war Heine es nicht. Er verstand selber ausgezeichnet zu streiten, er konnte tödlich lächeln und sich entrüsten, aber der Streit blieb ihm immer das Unvernünftige, das Schlechte; das, was zwischen Vernünftigen und Guten vermeidbar wäre: was jenseits von aller Vernunft, jenseits auch von Böse und Gut den Einzelnen in sein Schicksal verwickelt, hat niemals sein Denken gebannt.
Erwin Kalischer.