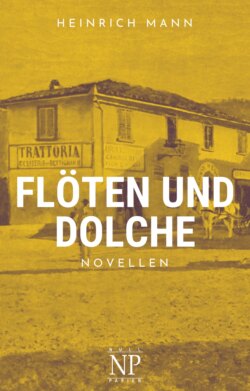Читать книгу Flöten und Dolche - Heinrich Mann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Die Komödie
Оглавление»Und verratet mich nicht«, sagte Mario Malvolto zu seinen zwei Freunden. »Lasst sie glauben, ich käme zurück.«
»Du kommst nicht?«
»Ich muss nach Hause. Ich habe Kopfschmerzen … Nein, ich will euch gestehen, ich muss allein sein.«
»Deinen Triumph überdenken. Gute Nacht, glücklicher Dichter.«
»Schlafen wirst du kaum.«
»Wer weiß. Gute Nacht.«
Die anderen gingen hinein. Mario Malvolto stand noch einen Augenblick oben an der Treppe. Hinter ihm verhallte das Bankett zu seinen Ehren. Links und rechts neigten sich tief zwei Lakaien voll goldener Schnüre. Er hielt seine schmächtige Gestalt ganz steif und schritt hinab, über den blassen, dicken Teppich, zwischen den vergoldeten Geländern.
»Diese Eitelkeit muss ausgekostet werden«, dachte er dabei. »Drinnen arbeitete ich zu sehr an meiner Rolle. Jetzt beherrsche ich das Erlebnis.«
»Wohin fahren wir, Herr Malvolto?« fragte der Kutscher.
»Nach Settignano.«
»Warum fragte denn der. Meinte er, ich fahre jetzt noch zu Mimi? O Mimi, du hinundherwehendes Seidenfähnchen! Bald flattert es dem um den Hals, bald jenem. Ich hab’ es geküsst, so oft an mir die Reihe war, habe sogar Abenteuer hineingestickt. Ja, Mimi, kleine Kokotte mit flüchtigen Impulsen, aber ohne Spur von Größe in deiner Sinnlichkeit, ich habe dir Leidenschaften angedichtet, habe sie zu meiner eigenen Genugtuung, aus Eitelkeit, aus Sehnsucht, deinen ganzen Lebenslauf entlang aufgestellt, wie Puppen, die große Gebärden schleudern. Du warst nur ein Mädel. Adieu, Mimi.
Wir wünschen mehr, wünschen Stärkeres. So etwas wie Mimi lässt sich noch neben einer Tragödie her lieben. Es nimmt so wenig Herz ein. Meine Tragödie hat heute Abend gesiegt. Ja, ich werde stark. Aber es heißt von den kleinen Genugtuungen ganz frei bleiben, die schwach erhalten, und die Der verbietet, der in meinem Zimmer über seine eiserne Schulter hinweg mich herausfordert!«
Nahm dieses enge Florenz kein Ende? Es verlangte ihn auf einmal heftig nach der Luft von seinen Hügeln, nach der von Öllaub durchschimmerten, von Lorbeer gewürzten Luft, die ihn bitter und sanft auf den Mund küsste. Die Gassen ließen noch immer ihr nächtliches Echo klappern. Der Schatten von Pferd und Kutscher stieg die Mauern hinauf und hinab. Dann lichteten sich die Vorstadthäuser. In die ersten Gärten tauchte das Mondlicht.
»Ich habe den Hügel dort hinten erobert, der mein Haus trägt. Und nicht bloß ihn – alle diese Hügel hab’ ich erobert.«
Seine Hand formte in der Luft einen Halbkreis; sie glitt über das entfernte Bild eines Hügels, wie über eine Frauenbrust.
»Dies ganze Land, alle seine Städte, jedes Haus, bis auf das letzte, hab’ ich erobern müssen. Denn mir gehörte keines. Kein heimlicher Feldweg in keinem Winkel des Landes kennt mich von meinem Anfang an. Bedenke das heute. Du bist auf dem Meer geboren, von einer Mutter aus fremdem Volk. Deine tragische Kunst hat um dieses Land, um jede seiner Ackerfurchen geworben, wie ein sehnsüchtiger Pilger im Kettenhemd, der aus Inbrunst Blut vergießt.
Jetzt hab’ ich Fuß gefasst. Jeder in Italien weiß, in welchem Dorf und auf welchem Tisch das Blatt Papier liegt, das ich mit Zeichen bedecke. Heute Nacht sind die Besiegten an mir vorübergezogen, ein ganzer Theatersaal, von mir unterworfen. Was habe ich zu vermerken? Elf Hervorrufe. Die Worte der Königin. Den Händedruck des Grafen von Turin. Dann das Bankett. Die beiden Deputierten, das Telegramm des Ministers. Der Bürgermeister redet. Die Kollegen helfen sich mit Ironie. Was noch? Nichts; keine Frauen beim Bankett. Keine Frauen – was bleibt von allem also übrig.«
Aus dem Wagen gelehnt, das Kinn in der Hand, sah Mario Malvolto zu, wie die Blütenbäume weithin in bleichem Lichte schwammen. Vor Ponte a Mensola meinte er einen Augenblick einen zweiten Wagen zu entdecken, dem seinigen voraus, in der Höhe. Er war gleich wieder verschwunden. Das Verdeck war aufgestellt gewesen. Der Kutscher hatte nichts gesehen, und wer sollte die Nacht auf der Landstraße verbringen.
»Ob sie’s eigentlich wissen, die Frauen, dass alles im Grunde nur für sie geschieht? Manche tun, als ob sie an den Geist glaubten – an den Geist, das hilflose Kind, das ohne unsere Sinne nicht stehen und gehen kann. Wir haben nur unsere Sinnlichkeit; und wem gilt die, wie heißt ihr höchster Preis? O, eine Sitzung am Schreibtisch ist verschwendetes Werben um die Frau, eine durchdichtete Nacht ist eine fruchtlose Liebesnacht. Ob sie’s wissen? Was frag’ ich. Ihr Misstrauen gegen das Talent lehrt mich genug, und ihre Vorliebe für den Dummkopf, der nur ihnen gehört, und nicht dem Buch. Die Frau und das Buch, das sind Feinde.
Ein Dichter von zwanzig Jahren, ich kann mich entsinnen, hat ihnen zu viel zu sagen – darum schweigt er linkisch; sucht zu viel Leidenschaft – das ist den Wesen unbequem, die keinen Rausch kennen als den der Eitelkeit. Ich habe damals von jeder einzelnen geträumt, so viele in einem Salon saßen, oder in den Wagen beim Korso. Mit fanatischer Entschlossenheit und fürs Leben hätte ich mich der zu Füßen geworfen, die mich erkannt hätte. Sie sind nicht so dumm. Keine einzige fühlt sich berufen, unsere neurasthenischen Überreiztheiten zu trösten. Sie gesellen sich niemals unsern einsamen Verfeinerungen, sondern unfehlbar dem wohlgelungenen Typus. Den erhalten sie, das ist ihre Bestimmung. Sie lassen es, unwissend über ihre Funktion, geschehen, dass wir schönen Krankhaftigkeiten uns an ihnen zugrunde richten. Sie aber sind von der Menschheit das Unverwüstliche. Und ich bete sie an, weil ich die Kraft anbete!
Mitten aus meinen Schüchternheiten heraus entführte ich mich damals plötzlich – mich, und die kleine Prinzessin Nora. Was für eine Überraschung! Ein Hauslehrer von unbedeutender Gestalt, dem die Damen nicht einmal ein Paket zu tragen gaben! … Ich hatte sie durch eine Tat der Verzweiflung alle auf einmal erniedrigt. Eine entführte Prinzessin Gallipoli – wer war die, vor der ich noch die Lider zu senken brauchte. Ach, ich behielt trotzdem immer die Neigung, zu Boden zu sehen. Jede Frechheit bei Frauen ist mir seither gelungen; aber zu jeder habe ich mich zwingen müssen.
Man wirft mir Unzartheiten vor, etwas Schlimmeres als Frechheiten. Ein Klubmann hat sich geweigert, sich mit mir zu schlagen, und ein Ehrenrat hat ihm recht gegeben. Die Toren, wie könnten sie ahnen, dass meine Unzartheiten aus meiner Furcht vor der eigenen Zartheit stammen. Ich leide an zu viel Verstehen, zu viel Bedenken, zu viel Voraussicht des Jammers der anderen. Ich habe ganz das Zeug, als Besiegter zu enden. Welche Selbstvergewaltigung hat es mich gekostet, die kleine Prinzessin Nora sitzen zu lassen, entehrt, deklassiert. Noch heute, wenn ich ihr in Rom in der hohen Halbwelt begegne – ich spüre etwas wie Angst …
Hab’ ich nicht oftmals Angst wegen Tina, der großen Tragödin, die an mir leidet?«
Mario Malvolto warf sich in den Wagen zurück, er spähte erregt nach der Höhe des fernen Berges, wo dem Mondgrau weiter Laubwellen mondgrau ein Schloss entstieg. Ein Licht, ein kleines, bohrendes, schwälendes Licht stak, ähnlich einem Gedanken, hinter einer Baumkrone und verwandelte sie in eine rötliche Wolke.
»Wo in der Welt wacht sie jetzt? Wie lange schon bin ich ohne Nachricht. Es ist schlimm diesmal, da sie sich geweigert hat, heute Abend die Schöpferin meiner Arachne zu sein. Habe ich ihr einen Schmerz zugefügt, den ich nicht von ihr empfangen hätte? Wer ist so kundig im Leiden und im Leidenmachen als wir beide. Wir wissen, dass wir nirgends so arbeiten, dass wir nie so große Künstler sind, wie beieinander, durcheinander. Und trotz aller Verwünschungen, aller Erschlaffung und allen Hasses stürzen wir immer wieder aufeinander zu. Es gibt in der Welt keine Komödie wie unsere Liebe. Hinter allen unseren Leidenschaften, wilden Gestalten, die von unserm Leben brennen, lauert die Kunst, ein zweifelhaft lächelnder Kulissenmensch, gierig nach Wirkungen für eine neue Rolle.
Von Zeit zu Zeit ertappt einer den anderen darauf, dass er nur Komödie spielt. Und plötzlich bricht bei beiden der Ekel aus, und wir prallen auseinander. Aber vier Monate später erscheinen wir wieder bei der Probe. Das ist Berufsangelegenheit. Von Liebe hat das nichts – nichts von der Liebe, für die man als Jüngling die arbeitsamen Nächte durchwacht, um derentwillen man den Ruhm ersehnt. Denn ich möchte wissen, wozu der Ruhm dient, wenn er nicht Liebe einträgt … Ach, er ist Phantom wie sie. Er entweicht immer weiter, je hastiger man auf ihn zuläuft. Als ich ganz unbekannt war, hatte er Körper; ein König, der den goldenen Kranz schwang. Seit ich ihn Fetzen um Fetzen erkauft habe und genau weiß, wie er hergestellt wird – was kann er mich noch fühlen lassen. Der Ruhm ist ein von mir weithin ausgestreuter, glänzender Irrtum über meine Person. Er gilt einem, der nicht ich bin. Über mich darf die Wahrheit keiner wissen.
Man muss sagen: Dieser Malvolto behandelt Weiber und Leben mit einer Entschlossenheit – etwas anrüchig ist er. Er ist ein stählerner Daseinskämpfer, das ist auch die Seele seiner Kunst. Die Größe und die Kraft der Rasse ist auferstanden in einem Dichter. Man sieht, auch in einer schmalen Brust können sie sich erheben. Die Renaissance ist, zum Angriff bereit, zurückgekehrt … Das muss man sagen, und darf nichts ahnen von meinen schwarzen Ängsten, von der Demütigung, die mir jede Frau, jedes große Kunstwerk, jeder gesunde Mann zufügt; nichts davon, dass ich für eine meiner Seiten, worin das Leben rauscht mit reichem Blut, halbe Tage seelischen Jammers und hygienischer Übungen bezahle. Ich will nicht, dass man es ahne. Es steht wohl hinter jeder vollendeten Schönheit der Schmerz und hat noch den Meißel in der Hand. Sollte ich nicht stolz sein?
Ich fühle den melancholischen Stolz auf ein Werk, das nicht die Kraft schuf, sondern nur der Wille zu ihr; auf ein Leben ohne wahre Stärke, das nur sehnsüchtiger Drang in die Höhe reckt, wie eine Niobe ihre Arme. Ich sehne mich am Schlusse von allen, die ich gehabt habe, noch heute nach der Frau. Ich träume noch von ihr wie mit zwanzig Jahren – nur hoffnungsloser. Denn ich habe sie inzwischen erprobt, und dass sie nie die Gefährtin des Komödianten ist. Sie ist mir zu ähnlich, was hätte sie mir zu bieten, oder ich ihr. Sie will selber Applaus. Sie will mit Leidenschaften bezahlt werden: – mir ist sie zu teuer. Ich brauche meine Gefühle, um sie den Leuten vorzuspielen. Ich muss an meiner Seele sparen, damit andere sich mit ihr berauschen können. Je mehr ich Leben austeile, desto ärmer muss mein eigenes werden.
Die seltenere Frau aber und die wahre – sie, die sich einfach hingibt, in unbedachter Leidenschaft; die an nichts zweifelt, nichts verlangt, keinen Beifall, kein Martyrium; die all ihr Leben zusammenrafft, um es ohne ein Zaudern, ohne ein Besinnen auf Welt, Ruf, Zukunft in meines zu werfen, mich reich zu machen, durch mich zu atmen und mit mir unterzugehen: natürlich gibt es sie für mich nicht. Träte sie auch leibhaftig in meine Tür, das Wunder wäre unvollständig. Denn in mir, in meinen Tagen, hätte sie nicht Raum: nicht sie selbst, die zu groß, zu stark wäre; nur die Sehnsucht nach ihr!
Hab’ ich sie heute Abend wieder begehrt, auf der Bühne, durch das Loch im Vorhang, hinter dem mein Platz ist! Hab’ ich sie alle begehrt!«
Mario Malvolto legte den Kopf in den Nacken, stöhnte und schaute tief in den bleichen Fluss der Sterne.
»Ich kannte fast alle. Ein paar hatte ich besessen, einige andere könnte ich haben. Wozu. Soll ich sie zu meiner sentimentalen Erziehung und zu meinem gesellschaftlichen Fortkommen benutzen, wie die kleine Prinzessin Nora, oder zum Studium von zwanzig verschiedenen Rollen, wie Tina, die Tragödin? Oder sollen sie arme leere Gliederpuppen sein wie Mimi, und ich behänge sie im Traum mit Leidenschaften, die weder sie erleben werden noch ich? Sollen sie zum Schluss dahinterkommen, wer ich bin, und mich beleidigt und voll Verachtung wegschicken? … Man wird müde, die Sterne dort oben mit den Augen zu pflücken, einen nach dem anderen, und am Ende nichts in den Händen zu halten …
So glänzten sie auf den Rängen heute Abend.«
Er betrachtete einen großen, reifen Stern.
»Die Linozzo. Ägyptisch platte, lange Nase, lange Augen eng beieinander. Die Brauen dicht unter der fettschwarzen Haarwelle. Weiter weicher Mund, feucht, tief gefärbt, beweglich. Sie ist am begehrenswertesten, wenn sie einen hellglitzernden Fächer an den Mundwinkel hält, oder wenn sie über die Schulter weg, den Kopf zurückgelegt, aus den Ecken ihrer Augen lächelt … Solange ich in der Loge der Königin war, hat sie immerfort hingesehen. Sie ist ehrgeizig, ich könnte sie haben.«
Seine Augen hängten sich an andere Gestirne.
»Die Borgofinale. Ein fettes Profil mit hängendem Kinn, wildäugig aus einem heftigen Wulst braunroter Haare hervor, über einem mächtigen Hermelinkragen. Das war eine der ersten, die mich hinaufgehisst haben. Auf ihrem zerstörten Gesicht treffe ich meine Erinnerungen an so viele erlogene Aufregungen. Sie aber war vielleicht ehrlich?
Eine Unmögliche: die Lancredoni. Magere Prinzessin von bräunlicher Haut. Ein steiler Hals trägt den kleinen, starren Kopf, mit der entweichenden Linie von Nase und Stirn. Der Spitzenärmel entfaltet sich sehr tief unter der nackten Schulter, die abfällt, zerbrechlich, rein. Unter den kalten Blitzen ihres Diadems gähnt die Prinzessin … Und heute Abend, hinter meinem Vorhang, hab’ ich sie vergewaltigt! Ich habe zu ihr hinaus triumphiert, wissend, dass ich mehr von ihr schmecke als der, der sie jede Nacht in den Armen hielte! Was bleibt davon übrig. Vielleicht ein paar Zeilen, die ich drucken lasse. Aber für mich, in der Seele? …
Die jungen Mädchen! Da saßen sie, ganz nah, und lugten helläugig aus einer Welt hervor, in die kein Weg führt. Die Cantoggi traf einmal mein Auge, im Loch des Vorhangs. Ich erschrak tief über diesen Blick, den sie aussandte, ohne zu ahnen wohin.
Welche von ihnen kommt und nimmt mich bei der Hand und führt mich heimwärts in ihr Land, wo man stark und mit Unschuld empfindet!
Keine. Denn sie haben selbst nichts Eiligeres zu tun, als die Komödie zu erlernen. Gemma Cantoggi, das Kind, frisch vom Lande, heiratet den Lanti, einen Viveur auf dem Abmarsch. Sauber ist das.
Verlangt man von einer, sie solle machen, dass man sich selbst vergisst – wahrscheinlich darf man auch von ihr nichts wissen? Im Parkett saß eine Fremde, ein schönes, starkes Profil unter der Samtschleife des großen Hutes. Eine wehende Kravatte hüllte sie bis an den Mund in rosige Gaze …«
Mario Malvolto träumte noch, als er auf den Platz von Settignano einbog. Der niedrige, flach geschweifte Kirchengiebel war von Mond bläulich gepudert. Eine einsame Laterne erblindete in der weiten Sternennacht, in deren Mitte auf seinem Hügel das Städtchen schlief.
Ein Geräusch verlor sich irgendwo. Mario Malvolto sah dahinten in der langen Gasse etwas Dunkles sich bewegen. Gewiss, es war der Wagen von vorhin; das Verdeck war aufgestellt. Ein Mondstreif fiel plötzlich darüber; etwas Weißes hatte sich herausgebeugt. Wo in der Umgegend war dieses Gefährt zu Hause? Nirgends, sagte der Kutscher. Es verschwand im Schatten.
Sie verließen die Gasse und fuhren ein Stück bergab. Mario Malvolto stieg aus, machte ein paar Schritte zwischen Hecken, elf Stufen hinan; da stand er vor seiner Tür. Sie war offen. Sein Diener lag schlafend davor.
Mario Malvolto schritt über ihn weg, er nahm im Vestibül die Lampe vom Tisch, ging die Treppe hinauf und betrat sein Arbeitszimmer. Auf der Bibliothek die Frauenbüsten in ihrer schmalen alten Tracht lächelten weiß, verschlossen, aus steilen Träumen; und auf ihren Stirnen die große Perle schien im Mondlicht an ihrer Kette zu schwanken.
Das Zimmer war so hell, dass Malvolto die Lampe löschte. Er lehnte sich in die offene Terrassentür. Wie weiß war der Garten! All dies schwere dunkle Laub über den ganzen Hügelrücken hin und bis unter die Mauer mit ihrem Baldachin von Steineichen, alles blitzte in bleicher und kostbarer Verzauberung. Als ein silberner Mantel hingen die Glycinien um die starre, tote Zypresse. Und die Kamelien in den Tiefen versenkter Büsche bluteten nur wie Geister.
Er sah ins Zimmer zurück, und er erschrak. Einen Augenblick hatte es ihm geschienen, der überlebensgroße Mensch dort auf der grellen Wand reiße sein Schwert in die Höhe. Mario Malvolto sagte in Gedanken zu ihm, zu diesem Bilde, dem einzigen, das täglich auf seine Arbeit herniedersah:
»So finden wir uns wieder. Als ich dich heute Abend verließ, war ich kampfesfroh, gespannt auf einen lauten Sieg oder eine derbe Niederlage. Es ist Sieg gewesen. Bei Wein und Reden ist er angeschwollen. Ich gehe, seiner sicher, davon. Ich brauche ihn nur aus der Brust zu ziehen und zu betrachten, nicht wahr? Und unterwegs, in einer Mondnacht voll gespenstigen Besinnens, wird eine Niederlage daraus – o, eine stille, blasse Niederlage, und eine schlimmere, als wäre ich lärmend ausgepfiffen.
Hast auch du einmal einen Sieg, wenn er am lautesten scholl, plötzlich umwenden und davonfahren gesehen? Krieg und Kunst, das ist dieselbe übermenschliche Ausschweifung. Kennst du den Ekel nach der Orgie? Antworte, Pippo Spano!
Da stehst du, aufgereckt, die eisernen Beine gespreizt, das riesige Schwert quer darüber in Händen, die aus Bronze sind. Du hast schmale Gelenke, bist leicht, bereit zu Sprung, Jagd, hitzigen Umarmungen und kalten Dolchstößen, zu Wein und zu Blut. In den Lauten deines Namens selbst geschieht ein Pfeifen von geschwungener Waffe, und dann ein breiter Schlag. Über deiner breiten Brust wölbt sich Eisen, um deine feinen Hüften kreist ein goldener Gürtel, auf dem fröhlichen Blau des Röckchens. Du hast einen kurzen, zweigespitzten Bart, dein Mund steht gewalttätig heraus aus deinem magern Gesicht, und düster blonde Locken umzotteln es. Es blickt zurückgeworfen über die Schulter, mit aufgerissenen Augen, wach und furchtbar. Wenn man länger hinsieht, lächelt es. Das Übermaß von grausamer Selbstsicherheit bringt dieses Lächeln hervor, das sich nicht nachweisen lässt, das man nur ahnt, das tief verwirrt, in Grauen stürzt, fesselt, dem man sich widersetzt, und das man schließlich verehrt!
Da du so ungeheuerlich zu triumphieren verstehst – wie entsetzlich musst du manchmal geschlagen sein! Ja! wie musst du gelitten haben, du und dein Maler, der so stark war wie du. Große Kunstwerke – dein Leben oder dein Bild – haben so leuchtende Höhen nur, weil sie so grausige Tiefen haben. Ach, du Türkensieger, verstell’ dich nicht – ich höre dennoch deinen tollen Aufschrei, wenn ein Schlag dich traf. Ich seh’ dich bluten, wenn ein Freund dich verriet. Ich versuche den Rausch von Schmerz zu ahnen, den du erlebt hast, so oft eine Frau ihre spitzen Finger in dein Herz grub!«
Mario Malvolto verschränkte die Arme. Er kam näher, die Augen auf dem Gesicht des Condottiere. Er flüsterte:
»Siehst du, nach solchem Rausche schmachte nun ich! Ich bin zu zerbrechlich dafür und zu nüchtern; darum erdichte ich Menschen, die anders sind. Darum stehst du hier, als mein Gewissen, als mein Zwang zur Größe. Du sollst mir Überdruss machen an der mäßigen Lust und dem haushälterischen Leiden, womit wir unzulänglichen Spätgeborenen uns bescheiden. Unsere Kunst befruchtet sich mit einem mattfarbenen Rokokoleiden, geziert und ohne Größe. Belanglose Neurastheniker-Geschicke dehnen sich aus über ein bürgerliches Dasein von siebzig Jahren, währenddessen man täglich für einige Kupfermünzen Leid verzehrt und für einen Nickel Behagen. Der Künstler gräbt umständlich in seiner verstopften Seele umher, immer nur in seiner eigenen, und fördert Traurigkeiten zutage, die er eitel herumzeigt. Mit feindseliger Ironie blinzelt er über alles weg, was stark ist und in ganzen Farben lebt.
So aber will ich leben! Ich will verschwenden; innerhalb meiner kurzen Jahre soll meine Kunst mir ein zweites, mächtigeres Leben schaffen. Nichts will ich wissen von mir, dem Schwachen; er lehrt mich immer noch genug von sich. Ich will fremde Schönheiten erleben, fremde Schmerzen. Recht fremde. Geopferte Frauen; Vornehme, die zu viel begehren; Meister, die einen vollen Schmerz an einem Stück Marmor austoben. Sie schlagen die Gestalten der Hölle aus dem Block heraus, und ihr Schmerz ist der Wirbelwind, der die Seelen durch purpurne Finsternis treibt … Zu Denen will ich auswandern, in Die hinein, die noch nicht auf die Launen ihrer Nerven lauschen; deren Schicksal noch nicht in ihrem armen Blut gefangen sitzt. Nein, draußen in freier Welt erwartet es sie zum Kampf, und sie dürfen hinstürmen!
In ihr Leben dringe ich ein, wie in eine mit Dornenhecken umstellte, üppigere und jähere Welt, wo Gewalt geübt wird und trunkene Hingabe; wo namenlose Untergänge ausgekostet werden und unfassbare Herrlichkeiten; wo man ganz lebt und auf einmal stirbt.
Und die Frau, die du lieben könntest, Pippo Spano, die ist der Preis aller meiner Sehnsucht. Die tritt mir als die Letzte aus der von mir entzauberten Welt entgegen. Nicht wahr –«
Und Mario Malvolto vergaß sich, er redete lauter.
»Nicht wahr, sie tritt mir entgegen? Glaubst du es, Pippo Spano? Sie tritt –«
Er brach ab: da stand sie.
Sie stand auf der Schwelle des kleinen weißen Salons, den ein paar Mondstrahlen plötzlich aus seinem Schatten hoben. Sie war selber weiß und bedeckt mit Mond. Ihr bleiches, kurznasiges Gesicht mit starken Lippen umrahmten schwere schwarze Flechten. Von ihrer kleinen, schmalen Gestalt, von Schultern und Nacken lösten sich gestickte Silberblumen bei jedem ihrer Atemzüge; sie lebten mit ihrem Atem. Sie hob ihren Arm zum Vorhang an der Tür – und der Ärmel aus lauter Blumenkelchen fiel auseinander in viele blasse Blätter. Ihr Arm stand darin als Blütenstempel, schimmernd von Mond.
Mario Malvolto war zurückgewichen. Er griff sich an die Stirn. Eine Sinnestäuschung? Er hatte viel getrunken und noch mehr geschwärmt. Aber sein Herz ging ruhig und stark, er fühlte sich helleren, freieren Geistes als gewöhnlich. Wollte das da noch immer nicht verschwinden? … Er machte zwei rasche Schritte darauf zu. Aber es blieb da, es sprach sogar.
Das junge Mädchen sagte leise und einfach:
»Mario Malvolto, ich liebe dich. Ich bin hergekommen, damit wir uns lieben.«