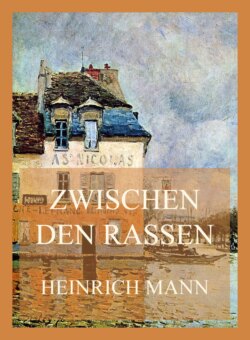Читать книгу Zwischen den Rassen - Heinrich Mann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеLola war allein.
Sie weinte auf einer Bank, zusammengekrümmt, lange und wild. Das Fräulein stand anfangs dabei und flüsterte hier und da ein Trostwort, das fragend klang, als wisse sie es selbst nicht genau. Dann machte sie einige Schritte, sah sich wartend um, verschwand im Hause. Bald kam sie wieder und rief sehr munter, ob Lola diesen schönen Pfirsich möge. Als aber das Kind zornig den Kopf schüttelte und wilder schluchzte, zog das Fräulein sich so rasch zurück, als flöhe sie.
Die Glocke läutete wieder, und Lola ließ sich fortführen, weil das Fräulein ihr sagte, nun würden die Mädchen kommen und sie weinen sehen. Das Fräulein öffnete die Tür zu ihrem eigenen Zimmer: da sprang kläffend ein kleiner weißer Spitz auf Lola zu, und Lola, die daheim vor Großpais riesigen Hunden keine Furcht gehabt hatte, wich mit einem Aufschrei zurück.
„Ami!“ rief das Fräulein und redete, zu ihm niedergebeugt, ernsthaft auf den Spitz ein. Es half nicht; das Kind und das Tier hatten sich gegenseitig erschreckt; und der Hund musste hinaus, — wo er winselte.
Nun kramte das Fräulein in einem Schrank, zog ein großes buntes Buch hervor und hielt es Lola entgegen. Sie wollte Lola auf einen Schemel setzen; Lola glitt damit aus, griff um sich und warf ein Glas Wasser über die Handarbeit, neben der es gestanden hatte. Das Fräulein strich ihr die Wange und lächelte. Dann schlug sie das bunte Buch bei der ersten Seite auf; es war ein Affe darauf, ein Ast und noch mehrere Dinge; und wiederholte, auf den Affen zeigend, ein Wort: immer nur das eine. Zuerst beachtete Lola es nicht; dann merkte sie wohl, dass sie es nachsprechen solle: aber sie schwieg; und diese Rache für alles, was mit ihr geschah, tat ihr wohl. Trotzdem richtete das Fräulein seinen Finger jetzt auf den Ast und sagte dazu ein anderes Wort, viele Male. Sie führte Lola auch zu einem weißen Turm, der in einer Ecke des Zimmers ragte, und zu dem Schirm, der davorstand: darauf waren aus bunten Perlen eine Dame und ein Kind, und zu beider Füßen ein Tier, das Lola nicht kannte. Es schien ihr sanft, zärtlich, zum Zerbrechen sein; und seine großen Augen glitzerten, als seien sie voll Tränen. Mitleid durchschauerte Lola, mit dem Tier, mit sich selbst, — und da stammelte sie das Wort nach, das das Fräulein ihr schon längst vorsagte: „Reh“, und weinte, leise und ohne Trotz.
Wie die Tränen gestillt waren, nahm das Fräulein sie mit zum Essen, an eine lange Tafel, wo viele Mädchen schwatzten und klapperten. Lola aß nichts, aus Traurigkeit; sie saß betäubt da, erschrak, wenn ihr Name genannt ward, und dachte, weh und wund: „Was wollt ihr alle? Was tue ich hier? Warum hat Pai mich nicht mitgenommen?“ Nach Tisch ward sie in den Garten gebracht, aber sie schüttelte den Kopf und ging dem Fräulein nach, bis sie wieder im Zimmer und bei dem Reh war: denn das war hier ihr einziger Freund. „Reh, Reh,“ flüsterte sie ihm zu. Das Fräulein küsste sie leise auf die Locken und ließ sie mit ihrem Kameraden allein. Als Lola später zu Bett gelegt werden sollte, hatte sie sich schon in Schlaf geweint.
Beim Erwachen in heller Sonne fiel ihr als erstes das Reh ein; dann der Spitz Ami. Sie bedachte vieles Erlebte und auch, ob sie dies Zimmer schon kenne. Neugierig sah sie sich darin um. Noch ein anderes Bett stand da, aber es war schon verlassen. Sie ließ sich aus dem ihren gleiten und trippelte umher: da trat das Fräulein herein, hob Lola auf ihren Arm, zeigte sich auf die Brust und sagte mehrmals:
„Erneste“.
Lola hatte in ihrem rotgeschlafenen Gesichtchen große, aufmerksame braune Augen, die, auf den Mund des Fräuleins gerichtet, ganz leise seitwärts hin und her rückten; ihre blonden Locken hingen wirr geringelt, die leichten Linien ihrer Lippen fügten sich fein ineinander; und am Saume ihres Hemdchens streichelten sich ihre rosigen kleinen Füße. Sie äußerte nichts; aber als sie fand, das Fräulein habe genug „Erneste“ gesagt, nickte sie bedächtig, zum Zeichen, dass sie verstanden habe.
Sie bekam ihren Kakao, grub im Garten, ward, wie die Glocke geläutet hatte, von den Mädchen in einem Ringelreihen geschwenkt und dann wieder von Fräulein Erneste in das Zimmer des Rehes geholt. Der Spitz Ami knurrte nur, und er wedelte dabei. Lola sollte auch heute „Affe“ und „Ast“ nachsprechen. Sie tat es zerstreut, sah dabei immer das Reh an: sie hatte keinen Sinn für die Dinge, auf die Erneste sie jetzt noch hinzulenken wünschte; und nur zufällig bemerkte sie, dass es sich um die zweite Seite des bunten Buches handelte, und dass dort jedes Bild mit einer Marzipanscheibe bedeckt war. Nahm man sie weg, kamen darunter zum Vorschein: ein Baum, ein Bäcker, ein Bottich. Sie erlernte diese Worte in großer Eile, um zu erfahren, was auf der dritten Seite wäre.
Von diesen Erlebnissen, die sie interessiert hatten, wollte sie bei Tisch — war nicht heute alles lustiger bei Tisch? — ihrer Nachbarin erzählen, einem Mädchen, dass nur wenige Jahre älter sein konnte. Sie erzählte ausführlich, die andere aber lachte nur und stieß eine dritte an. Lola, in Eifer, kam von dem Reh auf die Tiere daheim; sprach von daheim und von Nene und Mai. Plötzlich ward sie inne, dass alle still waren, zu beiden Seiten des Tisches, und sie ansahen: die meisten mit Neugier, einige spöttisch; — und keine, erinnerte sie sich nun, keine einzige hatte sie verstanden! Errötet, ratlos beschämt, sah sie die Reihen entlang, konnte, zitternden Gesichtes, die Tränen noch gerade hinunterschlucken und beugte sich mit einem kleinen einsamen Lächeln über ihren Teller.
Nun kam eine Stunde, in der alles durchs Haus sprang und sang. Auch Lola sollte singen, sie tat nur so, als begreife sie nicht. Da fasste aber Erneste ihre beiden Arme, und die Nase kraus vor Freundlichkeit und während alle umherstanden, sagte sie ihr mehrere Worte, deren jedes ungefähr klang wie „singen“: nur nicht ganz. Schließlich aber fand sie’s wirklich: singen; und da sang Lola. Sie sang näselnd: „Ihr Negerknaben meines Vaters . . .“, schloss dabei halb die Lider und sah nun alles, was sie sang, sah die Heimat . . . Noch wie sie schwieg, war sie aus dem Schwarm der auf sie Einredenden weit fort.
Eine Weile darauf fiel ihr ein, dass sie dieses Lied einmal bei der deutschen Großmama gesungen hatte. Seltsam: an den Aufenthalt bei der Großmama hatte sie noch gar nicht wieder gedacht; ihr war, als sei sie von der großen Insel gradeswegs hierher verschlagen, und alles dazwischen war verworren wie ein Schiffbruch. Nun kam ihr eine Fratze in den Sinn, die der lustige Onkel einmal geschnitten hatte: und von da aus fand sie sich in allem wieder zurecht. Ach! Das war doch Lolas Großmama, denn Pai war ihr Sohn, und sie hatte ihn lieb. Eine aufzuckende Hoffnung: Ob Pai nicht bei ihr war? Dass Lola daran nicht früher gedacht hatte! Pai war nicht abgereist, er war bei seiner Mama! Lola ging zu Fräulein Erneste und sagte „Großmama“: nur das eine, bittende Wort; und Erneste verstand es, sie ließ Lola hinführen.
Die Großmama breitete die Arme aus, Lola aber lief, ohne ihrer zu achten, um sie herum: „Pai! Pai!“ — in sein Zimmer, in das Wohngemach, in den Garten: „Pai! Pai!“ Sie kehrte von ihrer vergeblichen Runde wieder.
„Wo ist Pai?“
Die Großmama bedeutete ihr etwas, Lola wusste wohl, was, aber sie glaubte ihr nicht. Einer der Onkel kam, die Magd ward gerufen, und alle wiederholten dasselbe. Lola schüttelte nicht mehr den Kopf, aber ihre Meinung stand fest. Zuletzt erschien der lustige Onkel und wünschte ihr Guten Tag in ihrer Sprache. Immer die zwei Worte, die er sich einst von Pai hatte ins Ohr sagen lassen. „Dummer Papagei,“ dachte sie, und sie verlangte fort.
Sie spähte in jedes Haustor, zerrte ihre Begleiterin in die Läden, die sie mit Pai besucht hatte, und auf einem leeren Platz, wo es wehte, blieb sie stehen und rief flehentlich „Pai!“ Keins der trägen Fenster öffnete sich; es fror Lola bitterlich; und die Magd zog sie fort.
Aber für das bunte Buch war sie nicht mehr zu haben, nicht mehr für den Garten und kaum noch für das Reh. Sie sah jeden mit Misstrauen an, der ein Wort zu ihr sprach: eins dieser unverständlichen Worte, deren Geräusch um sie her war. Zu Fräulein Erneste sagte sie: „das ist nicht wahr,“ obwohl sie gar nicht wusste, was das Fräulein gemeint hatte; bei Berührungen brach sie in Geschrei aus; und ihr Drang war immer: auf die Straße, durch die Stadt, und in die Häuser spähen. Sie schrie, bis das Fräulein ängstlich ward und sie hinausließ. Das dauerte mehrere Tage.
Dann wich Lolas Glaube. Sie hatte gewiss in jedem Winkel nachgesehen und überall ihr „Pai!“ gerufen. So wollte Pai sie wohl nicht hören, oder er war wirklich fort. Ja, er war fort: die Leute hatten recht. Aber dann hatte Pai selbst sie verraten und unter diesen Fremden zurückgelassen. Wem also war noch zu trauen? Scheu sah das Kind sich um. In diesen Tagen brach ein Gewitter aus; und Lola — wie hatte sie daheim zu urweltlichen Unwettern gejauchzt! — ward von jedem dieser Blitze in eine andere Zimmerecke gescheucht: bleich und mit geschlossenen Lippen; denn niemandes Hilfe wusste sie anzurufen.
Ward Lola jetzt um ihr Lied gebeten, schüttelte sie, mürrisch und verlegen, die Schultern. Auch sprach sie nicht mehr; und sie dachte ganz Ungewöhnliches. „Ich werde vielleicht sehr krank werden und kann dann niemandem sagen, wo es weh tut, und muss immer so schreien, wie damals der Neger schrie, der ein Loch im Magen hatte.“ Wenn sie allein im Zimmer war und mit sich selbst und ihren Puppen plauderte, musste sie manchmal lauschen: so seltsam klein und allein klang ihr die eigene Stimme; — und sie fühlte es plötzlich, tief in ihrem erschauernden Herzen, es gäbe im Hause und in der ganzen Stadt und auf allen Straßen die hinausführten, keinen Menschen, der, wie die daheim, zu ihr sagen könne: „Meine kleine Lola, meine liebe kleine Lola.“ Sie flüsterte die ersehnten Worte vor sich hin und sah dabei ihre Puppen an. Da bemerkte sie, dass auch die Puppen sie ihr nie sagen und, was sie ihnen vorplauderte, nie verstehen würden: waren doch auch sie aus diesem fremden Lande. Sie schob sie weg. Und selbst das Reh! Daheim gab es kein solches Tier, und es wusste nichts von Lola. „Hörst du denn nicht?“ bat sie, mit Tränen. „Reh! Reh!“ Aber das Reh sah sie fremd an.
Lola war allein.
Am Sonntag ward sie wieder zur Großmama gebracht. Sie benahm sich scheu und verdrossen; man verlor endlich die Geduld und überließ sie nach dem Essen sich selbst. Unzufrieden, weil niemand mehr sich um sie bekümmerte, drückte sie sich im Garten umher. Wie es kalt war in diesem Lande! Ängstlich und feindselig sah sie zu den grauen Wolken hinauf, die herabdrohten. Der Pavillon, der sie am ersten Tage versteckt hatte, damals, als sie schon vorausgeahnt hatte, Pai werde sie allein lassen: heute stand er offen, und Lola betrat ihn. Es waren wunderliche alte Möbel darin; sie bemühte sich, einen Wandschrank zu öffnen: — da geschah ein Poltern unter ihr. Sie fuhr zusammen. Es polterte stärker, es schlug sogar gegen den Boden, auf dem sie stand. Erstarrt, horchte sie. Ein furchtbarer Krach: nun drang es gleich zu ihr ein; und Lola schrie los, mit allen Kräften höchster Not:
„Der Teufel! Der Teufel!“
Sofort hörte das Poltern auf, und im nächsten Augenblick stand in der Tür der lustige Onkel, ganz bleich, und blickte Lola zornig an. Sie schrie, zu ihrer Rechtfertigung und aus Eigensinn, noch einmal: „Der Teufel!“ Da stürzte aber der Onkel auf sie zu und legte sie über sein Knie . . . Und nachdem Lola dies durchgemacht hatte, war es ihr viel leichter und sanfter. Der Onkel nahm sie bei der Hand und führte sie in das Kellergewölbe, unter dem Gartenhaus. Er zeigte ihr, wie er Holz gehackt habe, und wie die geschwungene Axt manchmal gegen die niedrige Decke gestoßen sei. Was er dazu redete, hatte einen guten, tröstlichen Ton; — und Lola ward betroffen und sehr nachdenklich. Denn es war klar, dass dies gegen alle ihre bisherigen Erfahrungen ging. Wenn daheim aus dem Urwald heraus irgendeine ungewohnte Stimme erscholl, lief es bei den Schwarzen von Mund zu Mund: „Der Teufel“; und blinzelte irgendwo ein Licht, das niemand kannte, ward geraunt: „Der Teufel“. Als der Onkel Holz hackte, hätte die schwarze Anna nur bei Lola sein sollen: ganz sicher würde sie gewimmert haben: „Der Teufel“. Er war es also nicht? Wenigstens nicht immer? Das war tröstlich, und der Onkel war gut, dass er Lola dies gelehrt hatte. Sie lächelte ihm zu. Sie hatte auf einmal alle Menschen lieber, ging ins Zimmer, umarmte die Großmama und klatschte in die Hände bei dem Gedanken, dass sie auch dem Fräulein Erneste etwas recht Liebes antun wolle. Eifrig verglich sie im Innern die schwarze Anna mit Fräulein Erneste und wunderte sich, wie viel näher ihr Erneste sei. Die schwarze Anna war dumm, mit ihrem Teufel; Lola schämte sich ihrer ein wenig. Wie sie nach Haus kam, stellte sie sich vor Erneste hin, sammelte sich und sagte zutraulich:
„Ast, Boot, Reh, Erneste.“
Dabei lächelte sie entschuldigend, denn für ein achtjähriges Mädchen war dies natürlich kindisch; aber was sollte sie sagen? Erneste verstand Lola; vor Rührung bekam sie ein bekümmertes Gesicht und Tränen in die Augen.
Einige Wochen später schlug sie Lola vor, einen Brief an Pai zu schreiben.
„Schreibe in deiner Sprache.“
Lola tat es; aber sie fügte mit Genugtuung eine Anzahl ihrer deutschen Wörter hinein: alle waren in einem Brief schon nicht mehr unterzubringen. Die Antwort kam. Auch Herr Gabriel hatte auf Portugiesisch geschrieben; nur am Schluss stand der Satz: „Ich habe dich lieb“; und diese Worte, die er noch nie in seiner eigenen Sprache hatte äußern dürfen, waren von ihm mit einer Süßigkeit erfüllt worden, die Lolas schwache Hände noch nicht herauspressen konnten. Erneste sah diese Zeilen lange an und sagte dann:
„Bewahre den Brief gut auf, Kind.“
Den nächsten schrieb Lola — sie war vier Monate bei Erneste — ganz deutsch, und ihr Vater antwortete ebenso. Inzwischen aber war ein Brief angekommen; Lola wusste nicht gleich, wer ihn abgeschickt habe. Sie war sehr gespannt.
„Ah!“
„Nun?“ fragte Erneste.
„Von Mai!“ — und sie betrachtete ihn angestrengt.
„Was schreibt dir deine Mama?“
„Ja, ja“, machte Lola, und: „Gleich komme ich wieder.“
Sie lief ins Schlafzimmer und buchstabierte. Mais Schrift sah Lola zum ersten Mal; die schöne Mai lag immer nur in der Hängematte. Wie musste sie Lola lieb haben, dass sie ihr schrieb! Lola küsste den Brief. Dann versuchte sie es nochmals: nein; wirklich, sie verstand nichts, oder nur hier und da ein paar Worte. „Mai, Mai“, stammelte sie, und plötzlich weinte sie. Kleinlaut berichtete sie später Erneste:
„Jetzt ist es sehr heiß in Rio, schreibt Mai, und hier ist es so kalt.“
Tags darauf wusste sie:
„Nene war krank und ist nun wieder gesund.“
Sie las immer in dem Brief; er hatte schon Risse, Fettflecke und Tränenspuren. Eines Morgens beim Erwachen fand Lola ihr Händchen hoch in der Luft. Im Traum hatte sie’s nach einer Frucht ausgestreckt, die Mai ihr hinhielt, — und zog es nun leer zurück. Noch sah sie Mais Gesicht: und da verstand sie plötzlich einige von Mais Worten in ihrem Brief. Schon war Lolas erste Sprache, Wort für Wort, zurückgedrängt von ihrer zweiten; neue Gesichter schoben sich ihr vor die alten; und eine neue Luft malte alle Dinge anders. Draußen schneite es; das erste Mal hatte Lola den Schnee für Zucker gehalten; und Mai kannte ihn noch immer nicht. Mai lag in großer Wärme in ihrer Hängematte und kannte, obwohl sie Mai war, nichts von allem, was Lola sah. Wie rätselhaft das war! Lola dachte sich darin fest; sie saß am Boden, den Blick nach innen, die Lippen leise gelöst, und hielt mit allen Kräften den Geschmack solches Gedankens fest. Manchmal war es nur ein Wort, ein Name, den sie in solcher Weise ganz auszukosten suchte: Erneste, wie konnte jemand so heißen; Er—ne—ste, wie jede der Silben plötzlich verwunderlich und komisch war. Jeden Augenblick wurden sie fremder! Im Frühling, auf einem Ausflug, ward Lola vermisst und allein zwischen Waldhügeln bei einer Quelle gefunden. Das nasse Laub hing um sie her, es roch herb nach Kräutern, die Quelle rann, Lola saß ohne Regung. Worüber sie nachgedacht habe. „Über die Quelle.“ Im Sommer lag sie oft am Rande eines Heliotropbeetes auf dem Bauch, schob den Kopf zwischen die Blumen und lauschte in die große Tiefe dieses Duftes.
Ein Gesicht, das sie lange schon kannte, ward ihr auf einmal wie durchleuchtet: nun fühlte sie’s. Einmal, im Schulzimmer, sah sie, anstatt nachzuschreiben, unverwandt auf ihre Lieblingslehrerin, auf die raschen kleinen Mienen und die flinken, pickenden Bewegungen des Fräuleins.
„Lola, warum siehst du mich immerfort an?“ fragte Fräulein Mina. Lola erklärte:
„Du aussiehst wie ein klein Vogel.“
Die französische Lehrerin ward gehasst von Lola: besonders seit sie Lola gedroht hatte, wenn sie noch länger die Kirschkerne verschlucke, werde ihr ein Kirschbaum aus dem Halse wachsen. Lola wühlte sich mit dem Blick in dieses fette, graue, schnüffelnasige Geschöpf hinein, bis sie in dem Fräulein deutlich eine große, dicke Ratte sah und bei einer zufälligen Berührung besinnungslos aufschrie!
In eine Vorstellung, eine Begierde konnte sie sich rettungslos festrennen, bis zu kleinen Verbrechen. Einmal log sie, in dem unvermittelten Drange, eine Sache ganz für sich zu haben. Nun hatte sie’s: ein Geheimnis; und kostete tagelang aus, dass niemand wisse, was sie wusste. Das war ein neues Leben, eine eigene Welt! Etwas später stiftete sie, um des Abenteuers willen, eine große Verschwörung an, verbunden mit Diebstahl. Zwar handelte es sich um die „Ratte“, die ohnehin jeden Streich verdiente. Mittlerweile nannten alle sie so; Lola hatte den Namen durchgesetzt und in Vielen Widerwillen erregt gegen die Lehrerin. Es war nicht schwer, die Mädchen zu überzeugen, dass sie der Ratte eine große, scheußliche Puppe ins Bett legen müssten. Man brauchte eine Maske, eine Haube, eine Jacke, eine Brille. Das Geld? Man wusste doch, wo die Ratte ihres aufbewahrte. Es war nur gerecht, dass sie selbst sich die Puppe kaufte. So geschah es. Die Ratte fiel zuerst in Ohnmacht, und wie der Verlust des Geldes herauskam, erlitt sie einen Weinkrampf. Lola sah ihn mit an: sie sah den Schmerz des hässlichen und geizigen Geschöpfes, ward hineingezogen und lebte ihn mit, außer sich vor Reue. Sie sah eine dicke Ratte sich ängstigen, die sie vergiftet hatte, und hätte gern, wenn es noch möglich gewesen wäre, das Gift selbst gegessen. Sie bat um Verzeihung, nahm sogar, mit leidenschaftlicher Selbstüberwindung, die Hand der Ratte. Denselben Ekel empfand sie auch jetzt noch; aber sie sah dieses Wesen leiden; sah unendlich mehr davon, als die andern sahen; und begriff nicht mehr, wie sie solch Leiden hatte zufügen mögen! Viel lieber statt anderer leiden! In mancher Nacht kam ihr die Frage: „Wenn ich mich lebendig begraben lassen sollte, oder Erneste sollte sterben, oder Mai: was würde ich wählen?“ Sie warf sich seufzend und heiß umher: nun hieß es sich entscheiden, das Furchtbarste auf sich nehmen. Und plötzlich war sie hindurch, sah Licht, war sanft und süß durchronnen und hatte sich dargebracht: „O, lieber, viel lieber will ich lebendig begraben werden!“
Sie war erschüttert; ein Drang nach Güte, eine schmerzliche Wallung von Liebenwollen hob ihr Herz auf; — und da kam rechtzeitig der neue Geschichtslehrer, Herr Dietrich. Er war schüchtern und ironisch, und er sprach immer wie zu erwachsenen Damen. Alle interessierten sich für ihn, einige erkundeten seine Lebensumstände. Er wohnte mit seiner Mutter und seinen jungen Geschwistern zusammen und unterhielt sie. Wie Lola von seinem Leben träumte! Liebreich musste es dahinfließen, voll sanfter, gütiger, edler Gedanken. Mit zwei andern, die für ihn schwärmten, wagte sie es unter einem Vorwand, ihn aufzusuchen. Kein Teppich lag auf den weißen Dielen seines Zimmers. Herr Dietrich stand von seinem Schreibtisch auf, der dabei ins Wanken kam, und deckte verlegen ein Kissen auf einen Riss im Ledersofa. Das ganze Haus roch nach saurer Milch. Tagelang erbitterte Lola sich gegen Erneste, die ihn nicht besser bezahlte. Alle hätten hingehen sollen und es ihr vorhalten. Lola sonderte sich ab, so oft sie konnte, lernte den Leitfaden der Geschichte auswendig, und wenn sie ihn sich wiederholte, war es ihr, als sagte sie ihm etwas Liebes. Als sie an einem Märztag, es lag noch Schnee, allein im Garten gewesen war, kam sie erregt zu Erneste gelaufen.
„Erneste, ich weiß jetzt, wie der Frühling aussieht!“
„Wieso?“
„Wie Herr Dietrich sieht er aus!“
Lola leuchtete. Die Offenbarung, die sie soeben empfangen hatte, war einfach und tief wahr.
Erneste dachte: „Mit zwölf Jahren schon? . . .“ Sie fasste sich und äußerte:
„Aber Kind, für ein Mädchen, das bald dreizehn wird, ist das doch zu kindisch. Herr Dietrich ist natürlich ein Mensch wie wir alle.“
Lola stutzte; war er das? Warum musste sie dann so viel an ihn denken? Immer hatte sie jenen leichten Geruch von saurer Milch in der Nase: so viel dachte sie an Herrn Dietrich. „Ich will ihn mir ganz genau ansehen.“ Gerade heute war Herrn Dietrich sein gelber Strumpf über seinen schwarzen Schuh gerutscht. Lola starrte finster und nachdenklich darauf hin. Ähnliches konnte man auch bei andern Lehrern sehen: aber Herr Dietrich, der so edel war! an den Lola so viel denken musste! Nun bemerkte sie auch, wie Herr Dietrich sich mit Jenny abgab; wie die dicke, freche Jenny, das Kinn auf der geziert ausgespreizten Hand, ihn anschmachtete; wie er errötend wegsah und, nachdem er ein wenig an seinem Kneifer gerückt hatte, ihr zulächelte. Da ward es Lola kalt und zornig zu Sinn; es trieb sie, Herrn Dietrich zu zeigen, dass er für sie durchaus kein Ideal sei. Er stand grade vor ihr; seine rötliche, knochige Hand lag auf ihrem Tisch; und in seiner Manschette konnte sie Haare sehen. Vorsichtig führte sie zwei Finger hinein, erfasste ein Haar, machte „Kieks!“ — und da hatte sie’s. Herr Dietrich zuckte zusammen; dann rief er mit roter, entrüsteter Miene:
„So etwas tut man nicht!“
Lola, ziemlich erschrocken über ihre Tat, aber trotzig, betrachtete das Haar.
„Gib’s her!“ — und Herr Dietrich nahm es ihr weg.
Als er sie später etwas fragte, antwortete sie nicht, obwohl sie’s wusste. Sie beschloss ihm brieflich ihre Verachtung auszusprechen; den ganzen Nachmittag arbeitete sie daran. „Wenn ich einen Menschen gern habe, verlange ich mehr von ihm als von andern, Sie haben mich sehr enttäuscht,“ wollte sie ihm sagen, und: „Ich bin viel zu stolz, um jemand noch gern zu haben, der eine andere liebt.“ Indes fiel ihr ein, dass Herr Dietrich von ihrer Neigung nichts gewusst habe, und dass ihn darum auch ihre Enttäuschung nichts angehe. Wahrscheinlich würde er ihr mit seiner entrüsteten Miene den Brief zurückgeben und dazu schreien: „So etwas tut man nicht!“
Sie hielt sich nun für fertig mit der Liebe Dennoch verlor sie den Winter darauf ihr Herz an einen italienischen Leierkastenmann. Sie lag im Fenster und lebte in seinen Augen. Bleich und traurig schmachtete er herauf. Lola sagte:
„Wie ist er schön! Ich habe noch nie einen schönen Mann gesehen.“
Die dicke Jenny störte sie diesmal nicht: im Gegenteil, sie fragte, ob Lola seine Bekanntschaft machen wolle, sie begleite sie gern. Lola schrak zurück, sie wusste noch nicht, wovor. Aber am Sonntag wartete sie mit ihrem ganzen Wochengeld. Der Italiener kam, nur war er betrunken und kotbespritzt, fing Streit an und ward verhaftet. Lola warf aufs Geratewohl ihre zehn Mark hinunter und rettete sich.
Die Trennung von dieser Liebe war hart. Wochenlang zuckte Lola schmerzlich zusammen, pfiff jemand auf der Straße eine von des Italieners Arien. Bei der Ankündigung der Oper, aus der sie stammten, geriet Lola in Erregung und verlangte hin. Sogar die Begleitung der Ratte nahm sie mit in den Kauf. Auf ihrem Balkonplatz bekam sie Herzklopfen; aber wie sie sich den Leierkastenmann vor Augen rufen wollte, bemerkte sie, dass sein Bild unauffindbar war, und dass nur die Klänge und Gebärden von dort drüben sie erfüllten und bewegten. Ihr schien es der erste Theaterbesuch; und alles mutete sie wie eigene tiefe Erinnerungen an. Woran sie jemals ahnungsvoll gerührt hatte, das war hier aufgeschlossen und entzaubert. Der letzte Duft schöner Blumen, Namen, Gesichter schien hier herausgepresst. Die Worte klangen alle voller und sinnreicher, die Dinge hatten höhere Farben, die Mienen erglänzten inniger. Hier wiederholte sich, hätte man meinen sollen, das Leben Lolas in stärkerem Licht: als habe sie dort auf der Bühne ihr eigenes Herz, höher schlagend, vor Augen. Alles, wofür man sonst keine Verwendung wusste, konnte hier spielen. Man konnte sich ganz geben, wie man war; denn die Menschen hielten endlich das, was man sich von ihnen versprach. Der Held dieser Oper war so edel, wie Herr Dietrich hätte bleiben sollen, und so schön wie der Italiener, ohne sich dabei zu betrinken.
Bei der Heimkehr war es Lola, als habe sie nun ein Zauberwort erfahren: Schauspielerin, und sei dadurch erlöst und mit sich selbst bekannt gemacht.
„Wie sonderbar!“ dachte sie im Bett und starrte zur dunklen Decke hinauf; „das also bin ich!“ Erneste rührte sich, und Lola hätte sie fast, in rascher Regung, aufgeweckt und ihr Schicksal Erneste offenbart. Noch hielt sie zurück; sie hatte sich erst selbst an seine Erkenntnis zu gewöhnen. Beim Aufwachen aber erschütterte sie sogleich ein großer Jubel; sie machte sich schnell fertig und lief zu Erneste, gerade so herzhaft und ohne Arg, wie damals, als sie mit der Nachricht kam, der Frühling sehe aus wie Herr Dietrich.
„Erneste!“ rief Lola, „weißt du, was ich werden will? Schauspielerin!“
„Auch gut,“ erwiderte Erneste und befestigte gelassen den Papierdeckel auf einem Glas mit Eingemachtem. Lola erklärte freudig:
„Gestern im Theater habe ich es gemerkt, und jetzt weiß ich es ganz genau.“
„Dummes Kind; trinke lieber deinen Kakao.“
„Warum, dumm? Ich glaube, dass ich Talent habe.“
„Das glaube ich auch: du rezitierst sehr niedlich; deswegen verfällt aber doch kein verständiges Mädchen auf solches dumme Zeug. Möchtest du wohl einen Löffel Gichtbeerenkompott?“
Verwirrt ließ Lola sich den Löffel in den Mund schieben.
„Nun geh, Kind,“ sagte Erneste, und Lola ging, den Kopf gesenkt. Vor der Tür zum Frühstückszimmer richtete sie sich auf und kehrte nach der Speisekammer zurück.
„Erneste!“
Lola war blass, ihre Stimme hatte gezittert; Erneste sah sie sprachlos an.
„Erneste, du hast so getan, als ob es Scherz wäre. Es ist mir aber ganz ernst.“
„Umso schlimmer,“ sagte Erneste, polternd vor Schrecken. „Geh ins Klassenzimmer und erwarte, welche Strafarbeit ich dir aufgeben werde!“
„Ich will alle Strafarbeiten machen, die du mir aufgibst, Erneste. Aber ich bin fest entschlossen, Schauspielerin zu werden.“
Lola redete das wie ein Diktat; irgendeine Macht weihte sie zum Sprechen.
„Es ist das erste Mal, dass ich so zu dir spreche, Erneste: daraus kannst du ersehen, wie wichtig dies ist,“ sagte sie sanft, mit feuchten Augen; denn Erneste tat ihr leid. Erneste war auf einen Holzschemel gefallen; ihre von Fruchtsaft blauen Finger lagen wie tote kleine Soldaten durcheinander im Schoß; ihr Gesicht war ganz lang und über alle Maßen verstört.
„Was kannst du denn auch dagegen haben,“ meinte Lola, „wenn ich es nun einmal als meinen Beruf erkannt habe.“
Da aber kam alles wieder zu Leben an Erneste; sie sprang auf.
„Dein Beruf? Eine unanständige Person zu werden, das soll dein Beruf sein? Dazu habe ich dich durch sieben Jahre auf Gottes Wegen erhalten? Du weißt nicht, was du redest: das ist das einzige, was mir noch Hoffnung lässt. Jenny, mein Kind, sie weiß nicht, was sie redet; schweige um Gotteswillen über das was du gehört hast!“
Lola wandte sich um: in der Tür stand die dicke Jenny und sah sie mit heuchlerischem Entsetzen an.
„Du begreifst, Jenny, wenn sie dabei bliebe, das wäre noch schlimmer als das mit Susanne, und davon habe ich doch schon graue Haare. Versprich mir, mein Kind, dass niemand etwas erfahren soll!“
Jenny versprach es artig. Dann entließ Erneste sie; und da sie unbeachtet stand, ging auch Lola. Ernestes Aufregung begriff sie nicht. Lola wollte zur Bühne und möglichenfalls dieselben Stücke spielen, die in der Klasse gelesen wurden. Was hatte das mit Susanne zu tun, die weggeschickt war, weil sie irgendetwas, nicht recht verständliches, mit dem Gärtner zu tun gehabt haben sollte? Lola saß in Rätseln; aber schon nach der ersten Unterrichtsstunde fing sie neugierige Blicke auf, die sogleich, mit künstlicher Fremdheit, weggelenkt wurden; und auch die Lehrerin, die jetzt darankam, starrte erst einmal Lola recht unverschämt forschend ins Gesicht, und dann richtete sie plötzlich das Wort an eine andere. In der Pause bemerkte Lola, dass manche ihr auswichen, und dass einem harmlosen Mädchen, mit dem sie sprach, von Jenny und mehreren andern so lange bedeutsam gewinkt ward, bis es sich verlegen von Lola losmachte. Lola ging gradeswegs auf Jenny zu: was das eigentlich heiße. Jenny wendete sich gepeinigt hin und her, murmelte, als sei sie um Lolas willen in Sorge, dass nur keine es höre: das wisse Lola wohl selbst am besten; und rasch tauchte sie in einen Kreis Schwatzender.
Ernestes Benehmen war noch viel auffallender. Lola erinnerte sich nicht, dass Erneste jemals länger als eine Nacht mit ihr böse gewesen war. Am Morgen hatte sie sich immer anmerken lassen, dass sie gern versöhnt werden wolle. Dabei ging sie beinahe bittend zu Werke; infolge jeder von Lolas Ungezogenheiten war Erneste es, die gewissermaßen Vergebung suchte, und deren Miene um ein gutes Wort warb. Lola bat schwer um Verzeihung. Wenn sie sich dazu entschloss, tat sie’s aus Mitleid mit Erneste. Das junge Mädchen dachte dann an des Kindes erste Begegnung mit Erneste: als Erneste zuerst streng auf sie eingedrungen und plötzlich, wie sie Lolas Tränen sah, ganz aus der Fassung geraten war. So ging es immer. Erneste schien sich manchmal viel zu dünken, und plötzlich fiel sie in Schüchternheit. Nachdem sie anfangs ihre gnädige Gesinnung als Belohnung hingestellt hatte, bemühte sie sich schließlich um Lolas Zuneigung. Was sie bekam, war eine etwas geringschätzige Freundlichkeit.
Jetzt aber gebärdete sich Erneste, Tag um Tag, traurig und behutsam gegen Lola: wie wenn Lola schwer krank sei und man könne mit ihr nur noch wenig und leise reden. Lola sah: auch die wohlwollenden Mitschülerinnen bekamen davon die Empfindung, Lola sei aufgegeben; — und sie selbst geriet über sich ins Unklare. Hätte Erneste ihr Szenen gemacht! Lola würde sich versteift, sich behauptet haben. So erschien, was sie gewagt hatte, allmählich ihr selbst als etwas Ungeheuerliches. Keine andere also war dessen fähig! Lola fühlte sich abgesondert, ihre Schritte unheimlich gedämpft, ihr ganzes Dasein fragwürdig. „Bin ich denn anders als alle?“
Da erinnerte sie sich gewisser Träume, gewisser ahnender, grübelnder Gefühle, für die sie, kam sie damit heraus, nirgends Verständnis gefunden hatte. Befremdet und etwas peinlich berührt, hatte man sie stehen gelassen. Die besten hatten gutmütig gelacht. Auch das mit Herrn Dietrich und dem Frühling fiel Lola wieder ein: und nun bedeckte sie, im verschlossenen Schlafzimmer, die Augen mit den Händen, glühend rot durch diese vor Jahren gesprochenen Worte. Plötzlich richtete sie sich auf.
„Und ich bin doch so!“ sagte sie laut vor sich hin, und:
„Auch ich habe mein Recht!“
Sie überlegte:
„Sollte alles daher kommen, dass ich aus einem andern Lande bin? Wenn im Sommer alle stöhnen, dann wird mir erst wohl. Natürlich: ich gehöre gar nicht hierher! O, zu Hause, wie viel schöner war es zu Hause!“
Irgendein glänzendes Bild aus Kindertagen war ihr unvermutet durch den Sinn geschossen; sie hielt den Atem an: es war fort. Durch Nachdenken wollte sie ihre Gefühle von einst zurückbannen: es kam nichts; und als sie endlich eins zu halten meinte, war es nur die Erinnerung an eine Ansicht aus den Tropen, die sie kürzlich in einer Zeitschrift gesehen hatte. Klagend trat sie ans Fenster, die Schultern hochgezogen, als träfe sie der kalte Regen, der gegen die Scheibe schlug.
„Hier bin ich nicht heimisch geworden; und das, was meine Heimat war, habe ich vergessen. Wohin gehöre ich denn?“
„Drüben hatte ich meine Familie und meine Freunde. Drüben verstanden alle mich. Drüben war ich glücklich.“
Und bittere Gedanken richteten sich gegen den Vater, der sie losgerissen und verbannt hatte.
„Warum grade mich? Nene hat dort bleiben dürfen. Pai kann mich niemals lieb gehabt haben!“
Lola überdachte seine Briefe und fand sie kalt. Gleichwohl schrieb Herr Gabriel ihr jeden zweiten Monat; und nur sein besonnener kaufmännischer Stil war schuld, dass seine Sätze kühl klangen. Lola war nicht gestimmt, die Liebe zu fühlen, die hinter den Worten bebte.
„Niemals hat er mich besucht, in all den Jahren!“
„Und wie grausam ist er gegen Mai gewesen! Mai, die weinte und mich festhalten wollte, als der große Schwarze mich forttrug!“
Das ganze phantastische Grausen jener Sturmnacht entstand noch einmal in Lola; und mit der Kinderangst von einst wallte Sehnsucht auf:
„Mai!“
Die Arme ausgestreckt:
„Mai! Mai!“
Ein weißer, glänzender Nebel erschien vor Lolas Augen und, weich darum gelegt, ein Rahmen aus dunklem Haar. Lola wollte Züge hervorlocken: der Nebel blieb leer; er drohte wegzufließen. Sie flüsterte bange Koseworte, hielt in ekstatischer Beschwörung dem Phantom ihrer Mutter die Lippen hin: umsonst. Lolas Kraft war aus und das Bild zerronnen.
Sie ergab sich nicht; sie suchte, mit einem Blick der Not, nach Hilfe umher, nach einem Anhalt — und traf auf eine alte Schreibmappe. „Mais Brief!“ Sie wühlte ihn heraus, legte aufschluchzend ihre Wange in das alte Papier. „Das kommt von Mai!“ Jeder dieser kleinen flüchtigen Buchstaben war ein Geschenk von Mai an Lola. Sie las darüber hin, lange Zeit. Dann enträtselte sie, mit Hilfe des Französischen, einige Worte. Dann sprach sie sie laut, fügte andere hinzu und horchte jedem nach, mit offenem Mund und seitwärts gewendeten Augen. Dazwischen erregtes Lachen: ja, so klang es. Ein Jubelruf: das war Mais Stimme! So sagte Mai dies! O, und dies war die schwarze Anna; und dies —. Die Namen ehemaliger Freundinnen klangen mit; ein Gesicht sprang aus einer Silbe, eine Begebenheit. Lola wusste nicht mehr, wohin sie lauschen sollte. Ihr Geist stürzte hinter alledem her, nach allen Seiten, wie ein Kind hinter Schmetterlingen. Minutenlang war sie glücklich. Schließlich zerflatterte alles; — aber Lola war nun gewiss: „Ich muss hinüber! O, gleich, gleich an Pai schreiben!“ Sie setzte sich daran, wollte schmeicheln, Pai günstig stimmen und fand vor fieberhaftem Drängen keine Worte. „Kann ich nicht telegraphieren? Kann ich nicht fliehen? Sofort? Sofort?“ Sie irrte, hochatmend, durchs Zimmer. Notdürftig gesammelt, schrieb sie:
„Lieber Pai, darf ich jetzt nicht bald zu Euch zurück? Du wolltest wohl, dass ich hier etwas lernen sollte. Ich kann Dir versichern, ich habe schon viel gelernt.“
Was sagte dies! Gegenüber erblickte sie ihr Spiegelbild in einem fremden Raum: in dem Raum, der sie seit sieben Jahren umfing und nun aussah wie ein Zufallsquartier zum Übernachten. Sie dachte ihr Gesicht neben denen draußen, ringsumher: lauter Gesichter mit anderen Wesenszügen, geformt von einem fremden Blut. Im Geist hörte sie die Stimmen: anders fallende Stimmen, Künderinnen fremder innerer Gewohnheiten. Sie schrieb:
„Ich hätte Dir noch viel zu sagen; aber ich kann mich nicht recht ausdrücken, da ich ja keine Sprache ganz beherrsche. Bitte, erlaube mir, dass ich kommen darf. Ich grüße Nene und Mai. Wäre es nicht möglich, dass ich ein Bild von Mai bekäme?“
Im Gefühl, sich gerächt zu haben, ging Lola zu den andern. Sie benahm sich so entschieden und selbstbewusst, dass Jenny mit ihr reden musste und Erneste sie nicht länger durch leises Sprechen für krank ausgeben konnte. Am Abend fing sie sogar mit einer Streit an und, entgegen ihrer Alltagsnatur, bereute sie nichts von dem, was sie im Zorn gesagt hatte.
Sie blieb hochgemut: wie konnte Pai ihre Bitte abschlagen! — und inzwischen sammelte sie Anhängerinnen, denen sie den Ton angab, denen sie half, am Sonntag, bei den lebenden Bildern, in Kostümen und Kunst der Stellung die andern zu besiegen. Die Pension spaltete sich; die eine der Parteien scharte sich um Jenny, die andere um Lola, und jede warb mit Leidenschaft um die draußen wohnenden Schülerinnen. Erbitterte und wortlose. Kämpfe wurden bestanden. Einmal ward das Ziel des Ehrgeizes darin entdeckt, als erste beim Frühstück zu sein; aber mochten Jennys Freundinnen bei kaum grauendem Tag hinabschleichen: Lola mit den Ihren saß doch schon am Tisch. Am Abend hatte sie von sich zu den andern, unter den Stubentüren hindurch, einen Bindfaden geleitet. Jede war mit der Nächsten verbunden; regte sich eine, erwachten alle; und geschlafen hatte keine. Dafür genoss man nun Triumphgefühle, die einen sprengten.
Zu Lolas Hochgefühl wirkte Verachtung mit. Sie übte ihre Macht als Parteiführerin und dachte dabei: „Was ihr alle mich angeht! Wie lange dauert dies überhaupt noch! In vierzehn Tagen ist Pais Brief da!“ Manchmal sah sie Erneste an, die nichts ahnte, und konnte ihr Frohlocken kaum niederringen. Einmal verriet sie sich. Am Sonntagnachmittag hatte Jenny gesungen: etwas peinlich Sentimentales, wobei sie himmelte und die Fingerspitzen auf die Brust setzte. Lola rief aus tiefster Seele:
„Das ist aber über alle Maßen geschmacklos!“
Jennys Anhängerinnen gaben dies nicht zu; nicht einmal unter ihren eigenen waren viele der Meinung Lolas. Die Tochter eines Reichstagsabgeordneten sagte:
„Es war so deutsch.“
„Es war geschmacklos!“ stieß Lola hervor. „Wenn es deutsch war, dann war es eben eine deutsche Geschmacklosigkeit!“
Darauf ward es still; und wie Lola sich bei den Ihren nach Beistand umsah, wichen die Blicke ihr aus, und die Schultern drehten sich hin und her, bis sie aus Lolas Nähe waren. Drüben versetzte eine spitz:
„Du bist eben eine Brasilianerin!“
„Wenn sie das noch wäre,“ entgegnete die Tochter des Abgeordneten. „Aber sie ist nichts: sie ist —“
Mit gekrümmten Lippen, die das Wort unter Selbstüberwindung hervorbrachten:
„International!“
Der Ekel im Gesicht der Sprechenden steckte alle übrigen Mienen an; und als habe man neben sich eine Schande, wandte man sich schweigend zu etwas Anderem. Ein Dienstmädchen trat ein:
„Fräulein Lola, ein Brief für Sie!“
Von Pai! Lola stürzte damit hinaus, schloss sich ein. Sie zitterte; und im jähen Gefühl, in einer äußersten Minute ihres Schicksals zu stehen, murmelte sie: „Mein Gott! Mein Gott!“
Dann erfuhr sie:
„Meine liebe Tochter! Deine Nachrichten habe ich erhalten und ihnen zu meinem Bedauern entnommen, dass die dortigen Verhältnisse Dir nicht mehr so zuzusagen scheinen, wie ich gewünscht und erwartet hätte. Es ist jederzeit für uns von Nutzen, unserer Umgebung Wohlwollen entgegenzubringen; umso mehr aber erscheint dies geboten, wenn wir, menschlicher Berechnung nach, einen großen Teil unseres Lebens am fraglichen Platze verbringen werden. Übrigens denke ich mich in einiger Zeit persönlich nach Dir umzusehen und verspreche ich mir von diesem, nicht durch meine Schuld so lange verschobenen Wiedersehen eine bedeutende Genugtuung. Somit halte ich ein Herkommen deinerseits zurzeit nicht für angezeigt. Du darfst versichert sein, dass wir nicht mehr allzu lange getrennt bleiben werden, und dass, wenn ich einst in der Lage sein werde, meinen Wohnsitz ganz nach dort zu verlegen, auch Deine Mutter mit hinüberkommen wird. Deine Mutter grüßt Dich, kann Dir jedoch das gewünschte Bild nicht schicken, da sie sich neuerdings auf keiner Photographie mehr getroffen findet.“
„Über das, mein liebes Kind, was wir im Leben sein werden, entscheidet das Blut, welches wir bei unserer Geburt mitbekommen. Unter einem nicht blutsverwandten Volk werden wir uns niemals vollkommen wohl und heimisch fühlen. In Dir, meine Tochter, fließt, wie ich hoffe und glaube, ein vorwiegend deutsches Blut, und als deutsches Mädchen gedenke ich Dich dereinst wiederzufinden. Es wird Deine Aufgabe sein, Dich dort mehr und mehr heimisch zu machen.“
„Nimm diese Worte von Deinem Vater mit Liebe auf. Es ist und kann ja nur mein einziger Wunsch sein, Dich glücklich und zufrieden durchs Leben schreiten zu sehen.“
Lola war fertig und nahm doch das Blatt nicht von den Augen. Kein Bild von Mai: nicht einmal das! Nicht nach Hause, kein Bild, kein gutes Wort. Denn diese alle hörten sich hart und verständnislos an. Sich heimisch machen! Hier, wo sie noch soeben beschimpft und geächtet war! Pai wusste nichts; niemand wollte etwas wissen von Lola. Alles aus, alles aus.
„Was ist dir?“ fragte, als es zum Essen geläutet hatte, teilnahmsvoll Erneste. „Du hast doch keine schlechten Nachrichten von den Deinen?“
„O nein, es geht ihnen gut; aber mir selbst ist nicht wohl.“
Sie bekam die Erlaubnis, sich sogleich niederzulegen, und war froh, als der Arzt ein wenig Fieber feststellte. Im Bett bleiben, niemand sehen, nur nicht den Blicken der Fremden ausgesetzt sein. Lola fühlte gar keinen Mut, sich zu behaupten. Wie sie, drei Tage später, sich wieder zeigte, genoss sie die Vorrechte der Genesenden, durfte schweigen und Launen nachgeben. Sie saß bleich und schwach da, und anstatt einer Lehrerin zu antworten, musterte sie sie, als erblickte sie sie zum ersten Mal. Was für ein Gesicht war doch dies; wie viel Unschönes enthielt es! Diese immer geärgerten Augen, die gelben Schläfen, die kleinlichen Falten, die den Mund zerkniffen! Vor Lolas starrem Blick ward es älter, immer älter und endlich zur Mumie. Erschreckt riss sie sich los. Wenig später aber sah sie sich im Gesicht einer rezitierenden Mitschülerin fest, dessen Leere sich Lola plötzlich auftat wie ein Abgrund.
Das ward zur Sucht. Sie las aus einem der vielen Gesichter, die ihr jetzt abstoßend schienen, alle in der Familie möglichen Abweichungen des Typus heraus, und ward bedrängt von Fratzen. Die Dummheit oder Gewöhnlichkeit gewisser Züge überwältigte sie täglich wieder, wuchs ihr entgegen, wie eine Sonne, in die man fällt. Lola atmete dann kürzer und meinte zu verblöden.
Sie bekam einen quälend feinen Sinn für das Alberne eines Tonfalls und das Untergeordnete einer Gebärde. Sie frohlockte und litt bei jeder Geschmacklosigkeit, die jemand beging. Sie legte eine Liste der Armseligkeiten an, die um sie her geschahen und geredet wurden, und las darin mit bitteren Rachegefühlen. So waren ihre Feindinnen! Denn Lola war überzeugt, dass alle sie hassten, und sie erwiderte es ihnen. Aus jeder Gruppe von Mädchen glaubte sie ihren Namen zu hören; sie trat herzu: „sprecht weiter, bitte“; und ihre Stimme, die sie aus ihrer Einsamkeit unter die Feinde schickte, wollte höhnisch sein und war unsicher. Eines Abends beim Teemachen explodierte die Spiritusmaschine und überschüttete Lola mit blauen Flämmchen. Während sie noch mit einer Serviette ihr Kleid abtupfte, rief sie schon:
„Das warst du, Berta! Du wusstest wohl, dass ich heute an der Reihe war, Tee zu machen: eigens deswegen hast du vorher aufgegossen und hast den Docht falsch eingeschraubt!“
„Um des Himmels willen, Lola, ich habe dich doch nicht verbrennen wollen!“
„Wer hat mir neulich die glühend heiße Schüssel in die Hand gegeben?“
„Ich wusste es doch nicht! Auf der andern Seite war sie kalt!“
Das gutmütige Mädchen weinte fast. Erneste bemerkte kummervoll:
„Du bist misstrauisch, Lola: das ist keine schöne Eigenschaft.“
Lola war misstrauisch, weil sie sich verraten fühlte. Sie war empfindlich, weil sie allein und immer auf der Wacht war. Andere hatten Stützen: das Ansehen eines Vaters, einen Namen, jemand der sie besuchte. Eine kleine plumpe Person mit Eulenaugen und Brillen davor, ging, so oft sie sich irgendwie blamiert hatte, umher und wiederholte: „Ich habe das Wörtchen von. Du hast es nicht, ich aber habe es.“ Lola suchte vergeblich nach einer Rache dafür. Da aber begegnete ihr in der Zeitung, dass der Reichstagsabgeordnete, der Vater ihrer ärgsten Feindin, Bankerott gemacht habe. Das Herz klopfte ihr bis an den Hals vor Freude. War’s eine Schande, „international“ zu sein, war’s hoffentlich auch eine, Bankerott zu machen! Mit dem Zeitungsblatt lief Lola von einer zur andern, gefolgt von der Tochter des Abgeordneten, die jammerte: „Es ist nicht wahr“ und endlich zu Erneste floh: sie möge Lola Einhalt tun. Aber Lola war unerbittlich. Dafür konnte sie’s, als unerwartet Jennys rote, spießige Mutter bei Tisch saß und das Wort führte, vor Erbitterung und Gram nicht bis zu Ende aushalten, musste sich in ihr Zimmer retten und einen Weinkrampf durchmachen. „Nie wird Mai kommen! Die hässlichen, gewöhnlichen Menschen sind wenigstens gut mit ihren Kindern!“
Erneste sah den Krisen Lolas unschlüssig zu. Sie, die Lola liebte, beschämte es, dass sie sie nicht verstand. Manchmal ward sie ungeduldig und wollte mit Erzieherinnenderbheit dazwischenfahren. Aber ihre altjungferliche Achtung vor den Dingen des Herzens hielt sie zurück. „Es muss etwas sein . . . Sie wird damit fertig werden.“ Eine Frage drückte Erneste; sie fürchtete sich, sie zu stellen. Jetzt sprach sie zu Lola vor anderen in freudig ermunterndem Ton; waren sie aber allein, ward Ernestes Stimme, was sie auch sagen mochte, mitfühlend und beruhigend. Lola entzog sich ihrer Teilnahme, stellte sich früh und abends schlafend und verließ, kaum dass Erneste sie vertraulich zu stimmen suchte, das Zimmer. Endlich wagte Erneste, ohne Vorbereitung, ihre Frage:
„Möchtest du noch zum Theater?“
„Zum Theater?“ machte Lola, die Brauen gefaltet; und mit gehobenen Schultern:
„Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.“
Auch dort waren die Menschen schwerlich anders, und Lola wusste sich so wenig zur Bühne gehörig wie sonst irgendwohin. Aber Erneste hatte den Atem angehalten; nun traten ihr Tränen der Erleichterung in die Augen.
„Gott sei Dank, Kind! Mein liebes Kind, Gott sei Dank!“
Sie reckte sich an Lola hinauf und küsste sie auf den Mund. Eine ihrer Hände ließ sie segnend über Lolas Kopf schweben.
„Das andere wird alles gut werden,“ verhieß sie innig. Lola, in Wut, weil sie gleich weinen musste, sah kalt zu ihr hinunter. Erneste trat von ihr weg.
„Du sollst auch eine Belohnung haben,“ — ganz lustig, nur nicht mehr sentimental. „Wohin möchtest du diesen Sommer lieber: ins Gebirge oder an die See?“
„Ich weiß wirklich nicht.“
„Du wirst dich schon besinnen.“
Aber Lola setzte ihren Ehrgeiz darauf, keine Vorliebe zu verraten; Erneste musste schließlich selbst wählen; und zu Beginn der Ferien, als die andern alle daheim waren, fuhren Erneste und Lola ins Gebirge.
„Wir müssen viel zusammen spazieren gehen,“ hatte Erneste gesagt; aber dann zeigte sich’s, dass sie vom Steigen ihre Herzbeschwerden bekam. Lola ließ sie auf einer Bank zurück und eilte weiter, den Passionsweg mit den Bildstöcken hinauf, an der geweihten Quelle und der Einsiedelei vorüber und in den Wald, wo er recht tief, recht wild und menschenfern war, wo im Tannendickicht die kaum ausgetretenen Graspfade und über Schluchten der morsche Steg zu einsamen, schmerzlich stillen Zielen führten. Denn Lola war so glücklos, dass der Anblick eines Menschen sie unsinnig erbitterte.
Sie fühlte sich hässlich: unablässig peinigte sie die Empfindung ihrer zu hohen Stirn, ihres bleichsüchtigen Mundes, ihrer langen Glieder, die in den Gelenken nicht recht heimisch schienen. Ungeschickt und in ihrer Haut unbehaglich, musste sie sich immerfort betasten, immer wieder feststellen, dass an ihrem in falschen Verhältnissen aufgeschossenen Körper kein Rock und keine Bluse richtig sitze. Sie fühlte ihre Hässlichkeit noch gehoben durch die Begleitung Ernestes, in ihrem Kapotthut, ihren schwarzen Zwirnhandschuhen, ihrem alten Mantel, der schief von ihrer zu hohen Schulter hing. Waren sie beide nicht ein lächerliches Paar? Lola sträubte sich gegen die Verwechslung mit Erneste, und dabei musste sie gestehen, man könne sie äußerlich ganz gut zur gleichen Klasse rechnen: sie, die nicht von Erneste nur, nein, von allen so weit Getrennte! Begegnete sie Leuten, sah sie entweder scheu weg, oder sie musterte sie frech, wie eine für immer Draußenstehende, die sich ihrer Ungezogenheit nie zu schämen haben wird. Dennoch hätte sie bei Tisch, wo Erneste sie mit ihren Nachbarn zu reden nötigte, in den ersten jungen Menschen sich fast verliebt. Ihr Stolz verhinderte es: weil sie sich hässlich wusste; und die Erinnerung, dass kein Geschöpf liebenswert sei, keins sie angehe und jede Gemeinschaft nur wieder Gram bringe. In der Einsamkeit ward ihrer freier; sie konnte in ein Buch aufgehen, ihr qualvolles Ich darin aufgehen lassen. Umso schlimmer war’s, wenn die Feinde sie auch hier erreichten. Einmal — sie glaubte an einer Stelle zu sein, wohin nie ein Mensch den Fuß gesetzt habe — erhob sich plötzlich der Lärm zahlreicher Stimmen, die auf Sächsisch voneinander Abschied nahmen. Die Gesellschaft verteilte sich auf zwei Wege, die fünfzig Schritte weiter unten wieder zusammenstießen; bei den unverhofft nochmals Vereinigten ging eine freudige Begrüßung an; und Lola, der das vorkam wie eine ihr zum Hohn aufgeführte Komödie, rang die Hände im Schoß. Darauf blieb es still: bis ein Knacken im Gebüsch und ein kleiner wilder Schrei sie erschreckten. Sie warf einen Stein nach dem Tier. Gleich darauf stürzte sie ins Gras und schluchzte heftig und unstillbar auf ihre erschlafften Arme nieder. Ihre Tränen flossen dem, was sie getan hatte und allem, was sein musste: flossen ihr selbst.
Wenn es andern zu heiß war, oder beim Nahen eines Gewitters, stieg Lola in den Wald. Bei sich hatte sie Lamartines Meditationen. „Die Freundschaft verrät dich, das Mitleid lässt dich im Stich, und allein schreitest du den Pfad der Gräber abwärts,“ las sie auf dem Weg mit den Bildstöcken; — und trat sie dann am Ende der fahl bläulichen Steige an den Rand der Bergwand und sah hinaus in ein grenzenloses Land, dessen Wellen schwarze Gehölze, grelle Wiesen, rostrote Kornfelder in tiefhangende Wetterwolken hineintrugen — im unheimlichen Flackerlicht solcher Stunde durfte Lola verzweifelt frohlocken: „Ich durcheile mit dem Blick alle Punkte der ungeheuren Weite und sage: Nirgends erwartet mich Glück.“ Mochte doch in jenem getürmten Grau die Sonne für immer untergehen; Lola wusste im Ernst: „Ich wünsche mir nichts von allem was sie bescheint; vom ungeheuren All verlange ich nichts!“
Aber die Verse selbst, in denen diese äußersten Schmerzen laut wurden, bargen in sich den Balsam dagegen; „Akzente, der Erde unbekannt“, regten sich in ihnen; und sie trugen einen, indes man sich hoffnungslos wähnte, unversehens in gütigere Welten. Nun saß Lola geborgen unter dem Dach des Holzfällerhüttchens aus Reisern und Moos, und beim Geprassel des Regens flog ihre Seele nach einem fernen, sanften und einsamen Gestade. Wie die Wogen sangen! Welche Harfenakkorde die klare, duftlose Luft durchperlten! Lola stieg in eine Barke, und mit ihr einer, der zu ihr sprach: „Sieh mitleidigen Auges auf die gemeine Jugend, die von Schönheit glänzt und sich mit Lust berauscht: Wenn sie ihren Zauberkelch geleert haben wird, was bleibt von ihr? Kaum eine Erinnerung: das Grab, das ihrer wartet, verschlingt sie ganz, ewiges Schweigen folgt auf ihr Lieben; über deinen Staub aber, Lola, werden Jahrhunderte dahingegangen sein, und noch immer lebst du!“
Der Dichter war’s, der dies gesprochen hatte. Lola erwachte; sie kauerte und bohrte die Handknöchel in ihre von Scham und Glück roten Wangen; und sie erbebte von der Ahnung jener liebreichen Ewigkeit, die ihr verheißen war. Lieben und geliebt werden bis zur Unsterblichkeit! War es zu ermessen? Dennoch fühlte sie, ihr sei’s bestimmt; und aufgehoben und erstarkt, entwand endlich ihr sehnsüchtiges Herz sich dem Menschenhass. Lolas Gefühle und die Verse, die sie trugen, hatten einen Gang, der nicht der Gang irdischer Menschen war. Menschen, die einer bestimmten Nation und eines Standes waren, die Dialekt sprachen, Vorurteile hatten, an Erde und Metall klebten: solche Menschen hatten wohl nie in solchen Versen gefühlt. Es mussten andere leben, lustigere, gütigere und reinere, die man lieben konnte. Sie waren auf anderen Sternen: gewiss, es gab überirdische Lebensstufen, und Gott — o, er war also da! — erlaubte uns, von Stern zu Stern uns zu veredeln! Ihrer hässlichen Hülle ledig, schwebte Lola in Gemeinschaft einer seelenhaften Menschheit durch die Unendlichkeiten der Poesie; und kehrte sie nach dem Gewitter heim, war sie trunken von der wetterleuchtenden Weite, dem Jubel der befreiten Natur, von Menschengüte, Tugend und Allliebe.
Dann sagte Erneste:
„Nein aber, du triefst; du verdirbst noch alle deine Kleider!“
Und Lola musste herabsteigen und sich mit den Wesen behelfen, zu denen eine mürrische Wirklichkeit sie gesellt hatte.
Erneste war vor dem Gewitter ins Zimmer geflüchtet und hatte an ihrem Buch keine Freude gefunden, weil sie immer denken musste, dass sie nun doch allzu wenig Gutes habe von ihrem Liebling, von dieser Lola, die sie, ganz insgeheim, ihr Kind nannte. Dies Berghotel war ein teurer Aufenthalt, und wenn er für Lola ohne Schwierigkeit bezahlt ward, Erneste fiel’s nicht leicht. Sie wohnte sonst den Sommer in einem Dorf nahe ihrer Stadt, mit andern Lehrerinnen und mit Lola. Um Lola zu erfreuen, hatte sie dies Jahr die Reise gemacht; und auch, weil das Kind groß ward und es nicht mehr lange dauern konnte, bis man es ihr wegnahm. Vorher noch eine Zeitlang es ganz für sich haben, noch einmal so vertraut mit ihm leben wie einst, als es klein war: danach hatte Erneste sich gesehnt. Nun aber saß sie meist allein, immer in der Stube, bei dem ewigen Regen hier im Gebirge, und Lola hatte noch nie daran gedacht, ihr Gesellschaft zu leisten. „So junge Menschen sind zu sehr mit sich beschäftigt und sehen in andere nicht hinein. Dass sie wegläuft, ist kein Mangel an Zartgefühl, bewahre. Warum kann ich ihr nicht sagen, wie gern ich mit ihr beisammen wäre? Es ist meine Schuld.“ Dabei errötete Erneste, sogar hier im verschwiegenen Zimmer.
Wieviel verschämtes Leid hatte ihr die Liebe zu diesem Kinde bereitet! Bis in das erste Jahr zurück wusste sie noch alle Strafen, die sie Lola hatte erteilen müssen: so schwer waren sie ihr geworden. Schmerzensworte, zornige Ausrufe der Kleinen, die Lola selbst längst vergessen hatte, fielen Erneste oft wieder ein, und noch immer erschrak sie darüber. War sie nicht zart genug gewesen mit dem einsamen Kinde? Wohl hatte sie es über die empfangenen Strafen zu trösten gesucht: indem sie ihm das Fleisch, das es nicht gern aß, wie einen Kuchen herrichtete; oder dadurch, dass der Spitz Ami, der Lola angeknurrt hatte, vor ihr schön machen musste. Ami war nun tot: Alles war verändert. Nie mehr saß Lola wie damals, als sie noch nicht Deutsch konnte, zu Ernestes Füßen und gab ihr die wenigen Worte, die sie kannte, als Schmeichelnamen. Nie mehr schlüpfte sie am Morgen zu Erneste ins Bett und weckte sie mit einem Gedicht, dass die Anrede „Herzmama“ enthielt! „Wenn die Kinder klein sind, brauchen sie uns.“ War das wirklich alles in der Liebe der Kinder? Nein, nein! Und doch war Erneste von einer verdrießlichen Ahnung erfasst worden, als eines Tages Lola nicht mehr unter ihrem waagerecht ausgestreckten Arm stehen konnte.
Ganz leicht machte nun die Herangewachsene sich los: so leicht, als habe sie sich innerlich nie bei Erneste gefühlt! Zwar durfte man nicht ungerecht werden: sie hatte das Leben vor sich und wandte sich ihm zu; und dann war wirklich viel Fremdes in ihr, das man nicht begriff, und das einem Sorge machen konnte. Schon immer war Erneste ängstlich berührt, beinahe eingeschüchtert worden durch die Anzeichen der fremden Herkunft bei Lola. Die auffallenden Äußerungen des Kindes zuerst, seine eigenartigen Vergehen, und dass es eigentlich niemals Kameraden gehabt hatte. Dann seine etwas frühen kleinen Verliebtheiten; nun, sie waren schwärmerisch und rein und mochten hingehen. Endlich aber diese schlimme Lust nach dem Theater: o, etwas ganz Schlimmes war da in Lola entstanden, aus Keimen, die Erneste trotz aller Pflege dieser Seele nicht hatte ersticken können. Wie unheimlich ihr’s damals zu Mut gewesen war! — und wie kummerschwer sie nun die Entfremdung zwischen ihnen beiden wachsen und die Trennung sich nähern sah!
„Warum ist sie so? Was hat sie mir vorzuwerfen? Denkt sie doch noch ans Theater?“ Auch andere Mädchen in Lolas Alter und gerade die Besseren, wusste Erneste, hatten ihre scheuen und eigenwilligen Zeiten, standen immer im Begriff, in Ohnmacht zu fallen — dies geschah Lola nie —, waren schwach, erregbar und tief. Lola aber war gar zu unergründlich, und in ihrer Verschlossenheit spürte man etwas Bitteres, Feindseliges. Hatte sie zu klagen: warum eröffnete sie sich nicht ihrer alten Freundin? „Früh genug bleiben wir allein im Leben. Noch hat sie eine, der sie alles ist. Aber die Jugend trumpft auf ihre Selbständigkeit. Später wird sie an mich denken.“ Gereizt vom einsamen Grübeln, war Erneste nahe daran, Lola ein recht schlimmes Später zu wünschen, damit sie an sie denke. Dann wurden Lolas Schritte vernehmlich, und noch bevor sie in der Tür stand, hatte Erneste ihr alles abgebeten.
„Bist du nun genug umhergelaufen?“ fragte sie munter. „Setzt du dich nun gemütlich zur alten Erneste?“
Dabei stellte sie sich ganz mit ihrer Häkelei beschäftigt und sprach nur in Pausen.
„Weißt du wohl, woran ich eben erinnert wurde? An das seidene Kleidchen, in dem du damals aus Amerika kamst. Dies da hat eine ähnliche Farbe, und die Ärmel sind auch wieder so. Was alles zwischen den beiden Kleidern liegt, nicht?“
Lola sah mit einer Falte zwischen den Augen vom Buch auf, wartete, was sie solle, und las weiter.
„Du kamst zu einer Zeit, als ich sehr einsam und traurig war,“ sagte Erneste nach einer Weile.
„Beliebt?“ fragte Lola; und Erneste sprach, trotz ihrer Scham, den Satz noch einmal.
„So?“ machte Lola, ungeduldig, weil sie einen Augenblick von sich selbst fort und über jemand anderen nachdenken musste.
„Ach ja, du warst das erste Jahr immer in Trauer.“
Sie sah noch in die Luft: ob sie weiterfragen müsse. Wozu; und sie kehrte zum Buch zurück.
„Wenn man so allein geblieben ist, wie ich damals, dann ist das Herz vorbereitet. Drum gewann ich dich, die du auch allein warst, gleich sehr lieb,“ sagte Erneste einfach. Nach einer Pause, da Lola sich nicht regte:
„Nun, ganz vergessen wirst du die alte Erneste wohl niemals!“
Ein stockendes Selbstgespräch.
„Solltest du einst ein Kind zu erziehen haben: Ja, dann denkst du gewiss an mich . . . Du musst es selbst erziehen . . . Bei Rousseau — hier den Emile wollen wir zusammen lesen — steht folgendes: ‚Wenn ein Vater Kinder zeugt und ernährt, leistet er damit erst ein Drittel seiner Aufgabe . . . Wer die Vaterpflichten nicht erfüllen kann, hat kein Recht, Vater zu werden. Weder Armut noch Arbeiten noch menschliche Rücksichten entheben ihn der Pflicht, seine Kinder selbst zu ernähren und zu erziehen. Leser, ihr könnt mir glauben, jedem, der ein Herz hat und so heilige Pflichten versäumt, sage ich voraus, dass er über seinen Fehler lange Zeit bittere Tränen vergießen und sich nie trösten wird.‘“
Erneste sah vom Buch auf: Lola saß blass da und sah sie durchdringend an. Plötzlich, klar, rasch und eintönig:
„Meinst du etwa meinen Vater?“
Erneste öffnete erschreckt den Mund und konnte nicht sprechen. Sie wehrte mit der Hand ab.
„Meinst du etwa meinen Vater?“ wiederholte Lola. Rosig bis über die Stirn brachte Erneste hervor:
„Um Gottes willen, Kind, was fällt dir ein! Ich habe von uns gesprochen, von dir und mir. Ich halte dich in meinen Gedanken ja immer für mein eigen!“
Lola prüfte sie noch immer: nein, Erneste hatte wohl nicht an Pai gedacht. Wie sie sich aufregte! Welch seltsamer Ton: ich halte dich für mein eigen. Lola stutzte; aber dann verglich sie unwillkürlich das an Ernestes verwachsenem Körper schlechtsitzende Kleid mit ihrem eigenen, das sie auch immer vergeblich zurecht zog; und sie sah weg.
Erneste beugte sich über ihre Häkelei und sann erschüttert: „Sie kann glauben, dass ich ihr wehe tun will? Armes Kind! Armes Kind!“
Etwas später stellte sie eine Frage, und als Lola nicht verstanden hatte, klopfte Erneste auf den Tisch und bemerkte streng:
„Wenn du beim Lesen die Finger in die Ohren steckst, kannst du mich allerdings nicht verstehen. Sprich übrigens französisch!“
Und sie führten zur Übung ein langes, gleichgültiges Gespräch.
Nein, wahrhaft liebenswerte Wesen gab es nur auf andern Sternen; in ihrer Nähe suchte Lola sie nicht. Eines Tages aber fand sie einen jungen Vogel, der vergeblich ins Gebüsch zu flattern versuchte, und nahm den aus dem Nest Gefallenen mit nach Hause.
„Was ist das überhaupt für ein Tier?“ sagte Erneste.
„Das ist ganz gleich,“ erklärte Lola. „Ich habe ihn gern.“
„In der Stadt wollen wir gleich im Buch nachsehen.“
„Nein, bitte nicht! Von welcher Gattung er ist, und alles übrige kümmert mich nicht. Vielleicht ist er ein kleiner Fremder: ich habe ihn gern.“
„Kind, du bist sonderbar; aber wie du willst.“
Nun saß Lola halbe Tage mit dem Vogel in ihrem Zimmer, ließ ihn über ihre Finger steigen, auf ihre Schulter flattern und bot ihm, mit einem Körnchen zum Picken, ihre Lippen. Als er zu fliegen anfing, schloss sie das Fenster, setzte ihn vor sich hin auf den Tisch, betrachtete ihn, den Kopf in der Hand, wie er pickte, eckig den Kopf rückte, sie ansah und einen kleinen hellen, einsamen Laut ausstieß; und stellte sich vor, dies sei ein Käfig und sie beide seien darin eingesperrt.
Zurück in der Pension, sehnte sie sich keinen Augenblick nach ihrem Walde, nach den Gewittern und der Holzfällerhütte; sie hatte ihren kleinen Genossen, der zwischen den Stäben seines Bauers, in ihrem Zimmer auf sie wartete. Sie dachte immer an ihn, ließ es sich aber nie anmerken und bekam ein hartes, abweisendes Gesicht, wenn jemand von ihm sprach.
Niemand übte Kritik an ihren Seltsamkeiten; man konnte Lola nur anstaunen: denn in diesem Winter verwandelte sie sich und ward schön. Die große Natur, der sie im Sommer sich hingegeben hatte, schien in ihr fortzublühen und Ebenmaß und Vollendung zu wirken. Lola tastete nach ihren Schultern, deren Spitzen nicht mehr zu spüren waren, nach ihren Gliedern, die sich formten und ihr nicht mehr den Eindruck machten, als seien sie zu lang und schlenkerten locker umher; und sie fragte sich mit gerunzelten Brauen, was werden solle. Ihr Schicksal war doch schon fertig gewesen? Auf einmal befiel sie eine betäubende Freude, eine neue entzückende Selbsterkenntnis. „Das also bin ich!“ So oft sie konnte, zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück: „um nach meinem Vogel zu sehen;“ aber sie sah nicht mehr nach ihm, sie sah nur nach sich selbst; und des Abends ging sie früher hinauf als die übrigen, um allein mit ihrem Spiegel zu sein. Er zeigte ihr eine goldblonde, große Haarwelle von nie geahnter Weichheit über einer Stirn, deren Höhe nicht mehr auffiel; zeigte ihr so genau und zart hingezeichnete Brauen über so warm glänzenden Augen, so fein gefügte Lippen, schmal und feuchtrot; die Wangen, die sie noch ein wenig voller wünschte, füllten sich genau in der Linie, die sie wünschte; färbten sich, wie sie’s verlangt hatte; und war diese weich gebogene Nase jemals hässlich und zu groß gewesen? Lola erfuhr, sie könne ein sehr damenhaftes Gesicht annehmen, das sie fast selbst verlegen machte, und, wenn sie das Haar auflöste, ein ganz kindliches. Beim Öffnen der Bluse freute sie sich auf die schlanke, weiße Biegung ihres Halses, beim Ablegen des Mieders auf ihre Brust. Sie hätte sich gern ganz gesehen: aber Erneste konnte eintreten; und als Lola es dennoch gewagt und den Spiegel auf den Fußboden gestellt hatte, lag sie gleich darauf im rasch verdunkelten Zimmer mit Herzklopfen unter der Decke, und ihr war zumut, als kehre sie zurück von einem heimlichen Ausgange, sie wusste nicht wohin.
Wer war so schön und vermochte so viel? Natürlich: jetzt drängten alle heran, ihre Freundinnen zu werden! Lola legte ihnen Prüfungen auf, ließ sich einen Gegenstand schenken, an dem der andern viel lag: nur um ihre Macht zu fühlen. Dann gab sie das Geschenk zurück und sagte, sie könne niemandes Freundin sein; die Freundin mehrerer am wenigsten. Freundschaft: ihr sagte das Wort zu viel. Nachdem die Ihren sie verlassen hatten, konnte ihr Freund, wenn sie einen hatte, nur auf einem andern Sterne leben! und vieler Schmerzen, eines Lebens voller Schmerzen bedurfte es sicherlich, bis sie zusammentrafen. Die Gefühle dieser Menschen hier waren zu billig. Lola horchte nicht mehr argwöhnisch, ob von ihr gesprochen wurde. Hässlich und fremd, hatte sie die Menschen gehasst. Fremd und schön, sah sie von ihnen weg. Freundinnen? Diese Berta, diese Grete, die sich noch gestern Abend um einen Pfannkuchen gestritten hatten, bis beide weinten?
Wenn Lola jetzt an einen Aufsatz gehen wollte, fand sie den fertigen Entwurf, von einer Hand, die sie nicht kannte, schon in ihrem Heft liegen. Von derselben Hand bekam sie Briefe voll schmachtender Freundschaft. Anfangs warf sie sie weg; dann spürte sie Lust, eine Probe zu machen. Sie tat kund, sie habe etwas Merkwürdiges, und versammelte alle Pensionärinnen um sich. Unvermutet zog sie einen der Briefe hervor, hielt ihn empor: „Wer hat das geschrieben?“ und sah dabei fest in die Gesichter. Alle reckten sich neugierig: nur das der langen Asta sah nicht den Brief an, sondern Lola, und blinzelte befangen. Lola steckte den Brief wieder ein. „Danke,“ sagte sie und drehte sich um.
Am Nachmittag lag zwischen ihren Schulbüchern ein neuer Brief: diesmal in Astas Schrift. Asta bat sie, um sechs in die Gartenlaube zu kommen, sie werde alles erfahren. Lola war entschlossen, nicht hinzugehen. Als es dämmerte, saß sie am Fenster ihres Zimmers. Drunten stapfte Asta, lang und gebückt, in Gummischuhen durch den Schnee. Lola sah nachdenklich zu. Plötzlich nahm sie ihren Mantel und stieg hinab.
„Nun?“ fragte sie und trat unversehens hinter den Lebensbäumen hervor. Asta schnellte von der Bank auf.
„Verzeih,“ stammelte sie. „Verzeih! Ich wollte dich nicht belügen, aber im Beisein der andern konnte ich dir’s nicht sagen.“
„Es tut nichts,“ entgegnete Lola. Dieser kleine magere Kopf mit dem dünnen Haar und der Nase wie bei einem Totenschädel erbarmte sie. Sie stellte sich vor, sie hätte ihn küssen sollen, und ihr schauderte. Noch mehr aber fürchtete sie sich davor, diesem Wesen weh zu tun.
„Wer hat denn für dich geschrieben?“ fragte sie sanft. Asta schlug die Augen nieder.
„Ich habe meine Briefe einem der Dienstmädchen mitgegeben, und sie hat sie in der Stadt abschreiben lassen.“
Sie atmete beklommen.
„Wie du gütig bist, Lola, dass du kommst. Ich verdiene das nicht.“
„Warum nicht?“ fragte Lola, und fand ihre Frage nicht ganz ehrlich.
„Weil du so schön bist und so reizend. Alle möchten dich zur Freundin: wie komme gerade ich dazu, mich dir aufzudrängen. Aber sieh, ich kann nicht anders. Ich weiß bestimmt, dass kein anderer Mensch mir je so nahe stehen wird wie du. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich meine Mutter und meinen kleinen Bruder noch lieb habe. Aber wenn ich an dich denke — und wann dächte ich nicht an dich? — dann habe ich Mutter und Bruder nicht mehr lieb. Hörst du? nicht mehr lieb.“
„Was willst du denn von mir?“
„O! Lola!“
Und Lola, die nicht abzuwehren wagte, fühlte sich umschlungen. Sie bog den Kopf zurück, um aus Astas Atem zu entkommen; aber ein paar Hände schlichen fieberhaft um ihren Leib, unter ihrer Brust hin.
„Fühlst du gar nicht, was ich meine? Gar nicht?“ Vorwurfsvoll und flehend.
„Gar nicht!“ sagte Lola mit Nachdruck; denn Angst stieg in ihr auf. Im Begriff, sich loszumachen, meinte sie ein Kichern zu hören. Der Gedanke an Lauscher empörte sie. „Ich bin nicht gekommen,“ dachte sie, „diese hier zu verhöhnen. Ich habe nichts mit ihr gemein; aber Seiten der andern stehe ich erst recht nicht.“ Sie sagte laut, wie für Zuhörer:
„Aber dies kann ich trotzdem tun.“
Und rasch küsste sie Asta auf die Wange. Wie sie ging, schluchzte es hinter ihr auf. Oft noch hörte sie, wenn sie allein war, dies Schluchzen und spürte wieder die Angst, die die fieberhaften Hände jenes Mädchens ihr beigebracht hatten: sie begriff nicht, warum.
Jenny klärte sie auf. Ostern war nahe, und Jenny, die konfirmiert werden sollte, ging im Voraus mit einem feierlichen Gesicht umher. Es war schon so rot und nur noch wenig kleiner als das ihrer Mutter. Wie sie Lola einst im Garten traf, fasste sie sie unter den Arm und sagte:
„Lola, du bist manchmal recht unvorsichtig: ich als die Ältere möchte dich warnen. Ja, sieh mich nur an! Du kannst von Glück sagen, dass ich neulich hinter den Lebensbäumen stand. Wenn Asta mich nicht hätte husten hören, wer weiß, was sie mit dir angestellt hätte.“
„Du hast nicht gehustet, du hast gekichert; und Asta hat es gar nicht gehört.“
„Du glaubst nicht, wie schlecht manche Mädchen sind. Und die Herren . . .“
Ein Instinkt benachrichtigte Lola, es komme etwas Peinliches, und sie wollte einfallen. Aber Jenny war nicht aufzuhalten. Sie hatte keine Zeit zu verlieren: bald verließ sie die Pension. Sie bot Lola nicht mehr an, sie mit einem Leierkastenmann bekannt zu machen: solche Scherze lagen hinter ihr. Aber Lolas Naivität war doch nicht mit anzusehen.
„Ich glaube dir einen wirklichen Dienst geleistet zu haben;“ so schloss sie ihre deutlichen Ausführungen.
„Nun ja,“ machte Lola und hob die Schultern. Ihr war beklommen; umso hochmütiger sagte sie sich: „Ich habe mir die Menschen ganz richtig vorgestellt: Dies setzt allem die Krone auf.“ Sie äußerte:
„Du entschuldigst wohl, ich muss meinem Vogel Futter geben.“
Aber den Vogel, der sie langweilte, vergaß sie gleich wieder und dachte einige Tage an nichts so inständig, wie an Jennys Aufschlüsse. Sie riefen phantastische Bilder hervor; und so oft Lola sich über diesen Vorstellungen ertappte, ekelten sie sie. Allmählich zogen sie sich zurück und warfen nur manchmal noch melancholische Schatten herauf. „Ach, dass es keine reine Liebe gibt.“
Ein Brief von Pai brachte sie davon ab. Pai schrieb aus Argentinien, wohin seine Geschäfte ihn genötigt hatten.
„Es geht alles nach Wunsch, und ich darf hoffen, mich bald an dem Ziel zu sehen, das ich mir vorgesteckt habe: die Meinen sicher zu stellen und sie in meinem Lande zu vereinigen. Vorerst denke ich Dich, mein Kind, in nächster Zukunft dort aufzusuchen. Nur eine kurze Rückkehr nach Rio ist geboten.“
„Und dort hält dann wieder irgendetwas ihn fest,“ dachte Lola. „Das kennen wir doch.“
Sie glaubte Pai nicht mehr. Vielleicht hatte er die besten Absichten; aber so vieles war ihm wichtiger als Lola und lenkte ihn von ihr ab. Nach all den Jahren konnte er sich höchstens sagen: Ich habe eine Tochter, und den Gedanken an seine Tochter gern haben. Lola gern haben konnte er schwerlich: kannte er sie doch gar nicht.
„Nicht von Belang“; damit legte sie den Brief zu den übrigen. Aber bei der Arbeit ertappte sie sich plötzlich auf einer freudigen Unruhe und darauf, dass sie schon während der ganzen letzten Seite nur an Pais Kommen gedacht und alles falsch gemacht hatte. Vergebens ermahnte sie sich: „Als ich klein war, hat Pai sehr schlecht an mir gehandelt; nie kann ich das vergessen“: — so oft sie an Pais Besuch dachte, bekam sie Herzklopfen. Und allmählich dachte sie nur daran. Unter allen anderen lächelte dieser eine Gedanke, und Lola selbst hatte beständig ein Lächeln zu unterdrücken. In ihr begann ein Steigen und Fallen von Plänen, wie ein Springbrunnen, den man aufschließt: immer höher, immer zuversichtlicher schnellt er empor. Anfangs wagte sie zu hoffen: „Wenn Pai kommt, vielleicht kann ich mit ihm zusammen wohnen? Einmal doch von den Fremden weg und bei meinem Vater wohnen!“ Dann fiel ihr ein: „Aber warum denn hier bleiben? Warum nicht eine Reise machen?“ Viele Orte, die sie gern gesehen hätte, sprangen ihr durch den Sinn. Auf einmal stand alles andere still, und eine kleine schüchterne Stimme fragte: „Und Rio?“ Zuerst war Lola fassungslos; plötzlich entschloss sie sich: „Ja, Rio! Was ist dabei? Wenn ich Pai bitte, wird er mir doch erlauben, Mai wiederzusehen. Die Reise ist jetzt so kurz. Und für ihn ist es das bequemste: er bleibt dann gleich dort, wenn ich zurückfahre.“ Endlich, auf dem Gipfel des Springstrahls: „Nein! Ich fahre nicht wieder zurück. Bin ich dort, will ich’s schon durchsetzen. Was kann denn Pai dabei tun, wenn ich ihm um den Hals falle und nicht loslasse? Mündlich ist das alles ganz anders als in diesen dummen Briefen. Und schlimmsten Falles stecke ich mich hinter Mai oder hinter die Großeltern auf der großen Insel — ach nein, sie sind tot! — oder ich laufe davon: lieber als dass ich zurückkehre! O, jetzt hab’ ich’s!“
Sie klatschte in die Hände: zum ersten Mal seit den Kinderzeiten. Dann lief sie zu Erneste, ihrem Glücke Luft zu machen. Im Schwatzen bat sie plötzlich, ausgehen zu dürfen. Zu viel blühte in ihr auf, das Haus ward ihr zu eng. Nun schwatzte und lachte sie mit allen, wahllos und gedankenlos. Keinen Augenblick konnte sie stillhalten. Immer: „Wie seid ihr langweilig!“ Und: „Geht heute niemand aus?“ Im Gehen, im durch die Straßen Irren schien ihr’s, als komme sie ihren Wünschen näher. Zu Hause versank man in der Zeit, wie in Lehm. „Vorwärts, o Gott, nur vorwärts!“
Eines Tages wie sie heimkam, trat Bertha ihr verstörten Gesichts entgegen.
„Dein Vogel ist tot,“ sagte sie vorwurfsvoll; und Lola, kopflos:
„Wieso?“
„Ich sollte für Erneste etwas aus eurem Zimmer holen und da hab’ ich gesehen, dass er tot ist.“
Lola schüttelte den Kopf. Sie ging hinein: wirklich, da lag er auf der Seite. Sie streckte mit Widerwillen einen Finger durch die Stäbe und zog ihn rasch wieder zurück. „Im Näpfchen sind noch viele Körner, er hat schon lange nichts mehr gefressen. Und gestern Abend sang er noch; ich musste ihn zudecken. Nun, diese Art lebt vielleicht nicht länger: tröste dich.“ Sie hatte das Bedürfnis, rasch weiterzukommen. Ihr nach Glück jagender Sinn wusste mit dem Tod, der ihr in den Weg trat, nichts anzufangen und erkannte ihn kaum. Wie sie die Tür öffnete, stand jemand davor mit einem schwarzgeränderten Brief. Erstaunt nahm sie ihn und trat zurück ins Zimmer. Die Schrift kannte sie nicht; die ersten Worte hießen:
„Liebe Lola! Ein großes Unglück ist geschehen, unser Vater ist gestorben.“
„Wessen Vater?“ Sie sah nach der Unterschrift: „Dein Bruder Paolo.“ „Paolo? Welch Unsinn! Mein Bruder hieß Nene.“ Sie las weiter.
„Unser Vater reiste, wie dir vielleicht bekannt ist, die letzte Zeit in Argentinien und kaum zurückgekehrt, nahm er das Gelbe Fieber: so wahr ist es, dass kein nicht in Rio Geborener sich entfernen darf ohne Gefahr, bei seiner Heimkunft ein Opfer der schrecklichen Krankheit zu werden.“
„Es scheint doch Pai zu sein.“ Sie las noch:
„Unsere liebe Mama weint mit mir. Weine mit uns, Schwester!“
„Pai ist tot?“ dachte Lola. „Er wollte doch herkommen!“ Ihr planloser Blick durchsuchte das Vogelbauer; da bemerkte sie:
„Das sind nur leere Hülsen! Wahrhaftig, kein einziges Korn. Dann ist er verhungert! Ich habe ihn verhungern lassen! Mein Gott! Und ich hatte ihn doch lieb!“
Sie gedachte und rang dabei die Hände, der Zeit, da sie den kleinen Vogel fand und zu sich nahm, und der Zärtlichkeit, die sie auf dies rührende, jetzt so kalte Gefieder gehäuft hatte: all das Gefühl, dessen sie nur die luftigeren, gütigeren, reineren Geschöpfe höherer Sterne wert gehalten hatte. Wie hatte es geschehen können, dass ihr diese große Liebe nach und nach ganz aus dem Sinn gekommen war: so sehr, dass dies arme Tier sie langweilte und sie’s verhungern ließ? Wir waren also unseres Herzens nicht sicher? Wie schrecklich! „Nur aus Eigennutz liebte ich ihn. Ich hätte ihn in seinem Walde lassen sollen. Aber auch er hatte mich lieb: lieber als ich ihn. Er pfiff, wenn ich ins Zimmer trat, und sobald ich die Lippen hinhielt, legte er den Schnabel dazwischen. Gestern Abend hat er noch gesungen: vielleicht um mir zu sagen, er sei mir nicht böse.“
Und unter dem Bewusstsein versäumter Liebe brach sie in die Knie und schluchzte: „Pai ist tot!“ Alles was sie bis dahin gedacht hatte, war nur wie das Keuchen, bevor die schweren Tränen kommen. Jetzt erst wusste Lola: „Pai ist tot;“ und von allen Seiten fiel’s über sie her: „Du hast ihn nicht lieb gehabt. Du bist ihm böse gewesen, hast ihn nicht verstanden. Er wollte dein Bestes und hat nur dafür gearbeitet. Lies seine Briefe!“
Sie las den letzten und erkannte plötzlich, welche wichtige Sache es für ihn gewesen war, sie wiederzusehen. Die Zeilen zitterten auf einmal von Sehnsucht und Ungeduld: „Dass ich das nicht gemerkt habe! Ich nannte ihn kalt. Die Kalte war ich: ich wollte nach Hause zurück, vielleicht mehr aus Eigenwillen, aus Hochmut. Das Zusammensein mit ihm genügte mir nicht; er aber sehnte sich nur danach. Wie er deswegen gelitten haben muss, ehe er starb!“
Ihr Schmerz entriss ihr selbst alles Herz und gab es dem Toten. So zärtlich war er gewesen! „Es kann ja nur mein einziger Wunsch sein, dich glücklich und zufrieden durchs Leben schreiten zu sehen.“ Dies stand in dem Brief, worin er ihr die erbetene Heimreise abgeschlagen hatte; den sie für den liebeleersten gehalten, wegen dessen sie ihn fast gehasst hatte! Jetzt lernte sie, in die Worte hineinzuhorchen. „Ich habe dich lieb,“ sagten alle, wie einst Pais erste deutsche Worte in seinem ersten Brief es Lola gesagt hatten.
Pais schweren, ruhigen Schritt vernahm sie aus seinen Worten, fühlte seine starke, gute Hand, sah die verhaltene Empfindung in seinem ernsten Gesicht. „Auf der Großen Insel! Pai besuchte mich; ich war ganz klein, er so groß und blond, viel größer als alle Menschen. Alle bewunderten ihn und beneideten mich, wenn ich an seiner Hand ging. Wie stolz war ich auf ihn!“ Bei dieser Erinnerung warf Lola sich, aufschreiend, zu Boden.
Erneste kam und wagte lange nichts zu sagen. Lola lag da, reichte Erneste, ohne das mit den Armen verhüllte Gesicht zu erheben, den Brief hin, schüttelte sich aber, sobald Erneste, über ihren Nacken gebeugt, nur flüsterte. Plötzlich fuhr sie empor.
„Ich bin eine schlechte Tochter gewesen!“
„Wie magst du das sagen!“ stammelte Erneste. „Seit früher Kindheit hast du deinen guten Vater nicht mehr gesehen.“
Lola stampfte auf.
„Ich habe ihn gehasst! Eine schlechte Tochter!“
„Der Schmerz verwirrt dich, Kind;“ und Erneste, die schluchzte, umarmte Lolas Kopf und drückte ihn an sich. Lola wollte sich losreißen; aber Erneste nahm alle Kraft zusammen; und allmählich ließ Lola sich schlaff werden, sinken und weinen.
„Du musst an Mutter und Bruder schreiben,“ sagte schließlich Erneste im Ton der höchsten Eile, froh, eine Tätigkeit für Lola gefunden zu haben, die aus ihrem Schmerze selbst hervorging, und in die er sich ergießen konnte. Wie Lola dann ihre blutenden Gedanken sammelte, kamen auch unerwartete. „Was soll ich ihnen schreiben? Dass ich kommen möchte! Jetzt kann ich kommen, denn Pai ist tot.“ Mit Entsetzen: „Das ist ja, als ob ich mich freute! Nein! nein! Ich werde nicht nach Hause reisen: er hat es nicht gewollt, und ich verdiene es nicht.“
Sie schrieb, sie müsse hier noch ihre Ausbildung beenden, und fühlte sich, als sie aufstand, gewachsen.
Nachts weinte sie; über den dahingegangenen Vater, über das Verbot, an das er sie noch als Toter band, über die verlorene Heimat: über alles weinte sie dieselben Tränen. Erneste hörte sie die ganze Nacht und lag ganz still. Am Tage aber tat die Buße, die sie sich auferlegt hatte, Lola wohl. Die Schmerzen und der Verzicht, um Pais willen erduldet, waren etwas wie eine Familie, waren ein Stück Heimat.
Auf einmal stand sie wieder ganz am Anfang: als sie mit Erstaunen den Trauerbrief erbrach. „Es ist nicht möglich, dass er tot ist! Vor ein paar Tagen lebte er doch. Auch noch, als der Brief schon unterwegs war, lebte er doch! Hätte ich diesen schwarzgeränderten Brief nicht gelesen, er lebte noch immer. Es wäre alles wie sonst. Ich habe ihn nicht leben gesehen und sah ihn auch nicht sterben. Was weiß ich? Pai! Pai!“
Und da sah sie sich als Kind, wie sie auf ihren Irrwegen durch die Stadt, inmitten eines leeren Platzes, wo es wehte, stehen blieb und flehentlich ihr „Pai!“ rief. Auch damals hatte er sie allein gelassen, und sie hatte es nicht glauben wollen! Jetzt war er noch viel weiter fortgegangen, und der Glaube war noch schwerer. „Er wollte doch herkommen!“ Ja: auch damals hatte er gerufen „noch einen Kuss, kleine Tochter“; und indes sie einem Schmetterling nachlief, war er verschwunden.
„Warum kommt auch kein Brief mehr! Ich habe sie noch so viel zu fragen!“
Sie schrieb Briefe über Briefe, und in jeden wollte sich die Bitte hineindrängen: „darf ich zu euch?“ „Nein, nein! Ich darf nicht. Am Ende würde auch Mai sterben. Pai ist gestorben, weil er zu mir wollte. Auf mir ist ein Verhängnis: ich soll allein bleiben.“ Und aus solchem feierlichen Schicksal machte sie sich einen Halt für das Leben, das sie zu bestehen hatte. Gleich zu Anfang des Herbstes vertrat sie den Wunsch, Konfirmationsstunden zu nehmen.
„Schon?“ fragte Erneste bestürzt. „Ich wusste wohl, Kind, dass ich dich würde hergeben müssen; aber so früh!“
„Was willst du, ich bin sechzehn,“ versetzte Lola, ohne Ernestes Aufregung zu beachten: kaltblütig, wie jemand, der sich mit allem Kommenden abgefunden hat.
„Und was wirst du dann tun, Kind? Nach Hause reisen?“
„Keinesfalls. Alles muss sich finden.“
Wieder begann Lola Pläne zu machen; und diesmal hielt sie sie für unangreifbar: denn sie rechnete auf sich selbst allein. „Ich werde von niemand abhängen. Niemand kann mich verlassen, keinem werde ich mehr nachzutrauern haben. Allein werde ich meines Weges ziehen.“
An einem Nachmittag des nächsten Frühlings saß Lola mit einigen Altersgenossinnen beim Tee. Erneste gab den Herangewachsenen die Erlaubnis, sich Kameradinnen aus der Stadt einzuladen, und sie ließ die Mädchen unter sich. Schwarz und sehr elegant — denn die Schneiderin der Pension bestellte ihr gegen Vergütung und ohne Ernestes Wissen manche Sachen aus Paris — lag Lola im Schaukelstuhl und blies ihren Zigarettenrauch, damit man ihn nachher nicht rieche, aus dem Fenster. Ein blühender Apfelbaum griff mit seinen Ästen herein; es war dasselbe Zimmer, worin einst die kleine Lola mit ihrem Vater von Erneste begrüßt worden war.
„Ja ja, wer weiß, was jeder bevorsteht. Die meisten von euch werden zweifellos im Geleise bleiben und heiraten.“
„Rede nur nicht, Lola. Als ob es bei dir nicht aufs selbe hinauskäme.“
„Schwerlich. Ich kann mir nicht gut einen Mann denken, zu dem ich gehören würde. Ich habe ein eigentümliches Schicksal, meine Lieben. Vor mehreren Jahren — Gott, wir waren noch halbe Kinder — nanntet ihr mich mal aus Bosheit international. In eurer Bosheit hattet ihr aber ganz recht. Ich gehöre nicht hierher, und anderswohin vermutlich auch nicht.“
„Na, du bildest dir aber was ein!“
„Ich denke mir die Sache anzusehen. Wenn ich hier glücklich heraus bin, gehe ich, vermutlich mit einer Gesellschafterin, auf Reisen. Spanien und Portugal nehme ich mir besonders vor.“
„Wie willst du als junges Mädchen denn durchkommen? Schon die Sprache!“
„Meine Muttersprache ist Portugiesisch!“
„Du hast längst alles vergessen.“
„Ich kann schon noch etwas.“
„Sprich mal!“
Lola blies Rauch aus dem Fenster. Die Tür ward geöffnet, und Ernestes Stimme sagte französisch:
„Ein Besuch, meine Damen.“
Süßes Parfüm drang herein, und eine schöne Dame, schwarz und sehr elegant, noch jung, mit glänzend weißem Gesicht und glänzend schwarzen Haarband, trat rasch in den Kreis der jungen Mädchen, die aufstanden. Sie erhob das Lorgnon und sah umher.
„Da ist sie,“ sagte Erneste und zeigte auf Lola. Die Dame ließ das Lorgnon los; vom Anblick Lolas schien sie betroffen.
„Die Kinder werden groß,“ bemerkte Erneste. Die Dame lächelte. Lola, die erblasst war, murmelte zitternd:
„Mai?“
Die Dame sprach, ganz schnell, etwas Unverständliches; Lola konnte, mit stockender Stimme, nichts erwidern als „Mai, Mai“; und beide standen, die Arme unschlüssig ein Stück erhoben, einander gegenüber. Erneste sagte in ihrem korrekten Französisch:
„Ist das seltsam, gnädige Frau! Als Ihre Tochter ehemals in dieses Haus eintrat, konnte sie nicht mit mir sprechen; und jetzt nicht mit Ihnen.“