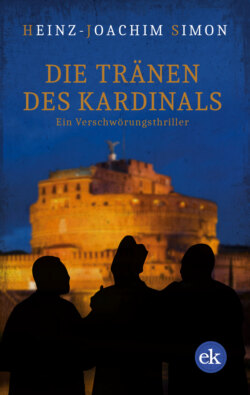Читать книгу Die Tränen des Kardinals - Heinz-Joachim Simon - Страница 4
1
Im Kolosseum brennen wieder die Kreuze
ОглавлениеDie Wolken hingen tief über Hamburg. Als ich aufwachte, regnete es. Ich bin Hamburger und das mit Leidenschaft. Also machte mir das „Schietwetter“ nicht viel aus. Genauso leidenschaftlich übe ich meinen Beruf als Ermittler aus. Damit wird man nicht reich, aber das ist auch nicht mein Lebensziel. Meine Ausbildung bestand aus fünf Jahren Fremdenlegion. Um über die Runden zu kommen, habe ich noch eine Sportschule für asiatische Kampftechniken. Ich bin zwei Meter groß, wiege hundert Kilo und man sagt mir nach, dass ich ein harter Hund bin. In manchen Kreisen dient dies als Kompliment. Mein Name ist Serge Christiansen. Klingt eigentlich recht friedlich.
Ich saß mit meinem Kumpel Dieter Prätorius in der Gurke im schönen Stadtteil Pöseldorf. Wir hatten bereits eine Runde Squash in meiner Sportschule hinter uns und genossen das Hamburger Nationalgericht Labskaus. Wenn Sie kein Hamburger sind, versuchen Sie es erst gar nicht. Mein Leibgericht besteht aus Hering, Kartoffelbrei, Roter Bete, saurer Gurke mit einem Ei drauf. Die Gurke war um diese Zeit gut besucht. Darunter eine Menge Bürohengste mit weißen Hemden, Krawatte und Hochwasserhosen.
Dieter Prätorius war etwas stinkig. Ich hatte ihn beim Squash tüchtig verprügelt. Unsere Freundschaft vertrug auch dies. Er gehörte zum feinen Hamburger Klüngel und hatte die beste Anwaltskanzlei Norddeutschlands. Seine Büroadresse war der Jungfernstieg, was genug über ihn aussagt. Wir genehmigten uns seine Lieblingszigarre, eine Montecristo Edmundo, und dazu einen feinen Chieftain. Ich fühlte mich gut, hatte meine beste schwarze Lederjacke an und die ausgewaschenen Jeans von Lewis. Prätorius dagegen trug wie immer einen schnieken, auf Taille geschnittenen schwarzen Anzug und sah aus, als wenn er Außenminister werden wollte. Man könnte meinen, dass wir nicht viele Gemeinsamkeiten hatten. Ich war HSV-Fan, er schwärmte von Bayern München. Bayernfans sind in Norddeutschland nicht sehr zahlreich. Er war rasiert, ich hatte einen Dreitagebart. Wir liebten beide den Blues, die guten alten Sachen von B.B. King, Howlin’ Wolf und Jack Dupree. Er hatte ungefähr fünfhundert Blues-Platten, ich dagegen nur mickrige zweihundert. Außerdem war er ein Gerechtigkeitsfanatiker. Auch ich gehörte zu dieser Schwadron. Wir lasen beide gern, was man von uns beiden kaum vermutete. Seine Lieblingsautoren waren Faulkner und Steinbeck, meine Ernest Hemingway und F. Scott Fitzgerald. Bis dahin hatten wir über Autos geredet. Ich fuhr einen englischen Oldtimer, einen roten Triumph TR6, dessen Motor es an Lautstärke mit einem Ferrari aufnehmen konnte. Ich hatte ihn einem Schauspieler vom Ohnsorg-Theater abgekauft. Er fuhr natürlich Porsche. Der Hamburger Klüngel fuhr immer Mercedes oder Porsche. Und das nächste Thema waren natürlich die Frauen. Ich hatte ihm gestanden, dass mir meine Verlobte Maja Buardi den Laufpass gegeben hatte und nach Rom zurückgekehrt war. Sie hatte mir eine Menge Gründe genannt, die dies rechtfertigten. Erstens sei ich kaum da. Zweitens müsse sie sich dauernd um mich sorgen. Drittens sei ich zu verschlossen. Viertens seien die Menschen in Deutschland trübe Tassen. Fünftens das Wetter … und so weiter. Der Hauptgrund war, dass über der Klingel an meinem Loft „Privatermittler“ stand. Sie mochte meinen Beruf nicht.
Wir pafften also seine teuren Havannas. Ich war normalerweise mit meinen Gauloises zufrieden. Zwölf DM für eine Zigarre konnte ich mir nicht leisten. Er schon. Aber ich gebe zu, dass eine Montecristo ihren Preis allemal wert war.
„Hast du immer noch das Zweitbüro in Rom?“, fragte er plötzlich.
„Ja doch. Seit meinen Ermittlungen hinsichtlich des Todes von Johannes Paul I. habe ich mich mit Majas Bruder zusammengetan, der einst bei der Guardia di Finanza Berlusconi und andere Säcke geärgert hatte. Er verfügt aus der Zeit über großartige Verbindungen, ist clever und ein Bruder im Geiste.“
„Ich habe einen seltsamen Anruf von dem Büro eines Kardinals bekommen. Man wollte wissen, ob du noch immer als Ermittler arbeitest, was ich bejaht habe. Meines Wissens wärst du im Moment frei, aber ich habe denen gesteckt, dass sie sich beeilen sollten, wenn sie dich engagieren wollen. Du wärst ein sehr gefragter Ermittler.“
„Frei wofür? Doch nicht für die Kurie zu arbeiten? Sie haben mich im Vatikan bestimmt nicht in allerbester Erinnerung.“
„Du hast doch im Fall des letzten Papstes keine so schlechte Rolle gespielt.“
Unter dem Tisch knurrte Spencer. Dies bedarf der Erläuterung. Spencer ist ein australischer Hirtenhund und ohne allzu sehr zu übertreiben, klüger als die meisten Menschen. Er sah zwar immer verträumt und zottelig aus – das Haar fiel ihm bis auf die Schnauze – aber er konnte zur Bestie werden, wenn er mich bedroht wähnte. Er hatte leider die lästige Angewohnheit, meine Schuhe zu lecken. Er war ein ausgesprochener Frauenliebling und ließ sich von jeder Schönheit das Fell streicheln. Andererseits war er extrem eifersüchtig. Kurz: Eine sehr komplizierte Hundeseele.
Prätorius hatte mich also gründlich herausgestrichen. Von seinem Freund konnte man das auch erwarten.
„Ich nehme an, dass er bald auf dich zukommen wird.“
„Nichts dagegen. Ich habe gerade eine kleine Flaute.“
Spencer knurrte zustimmend.
„Jedenfalls muss dieser Kardinal ein ganz wichtiger Mann sein. Er hatte einen polnisch klingenden Namen.“
„Ich hätte nichts gegen einen Auftrag in Rom einzuwenden. Vielleicht könnte ich dabei versuchen, die Sache mit Maja wieder in Ordnung zu bringen.“
„Du scheinst immer noch in sie verknallt zu sein.“
„Sieht ganz danach aus“, tat ich kühl. Dabei kribbelte mir die Gesichtshaut, wenn ich nur an sie dachte.
Es wurde noch eine lange Nacht. Wir beendeten sie in einem Jazzclub in der Nähe des Gänsemarkts. Ich war ein wenig angeschlagen, als ich mein Loft nahe den Landungsbrücken aufsuchte. Es ging bereits auf fünf Uhr zu. Ich hörte wie immer meinen Anrufbeantworter ab. Mein alter Freund Fürst Mazarini bat um Rückruf, egal zu welcher Uhrzeit. Ich tat ihm den Gefallen.
„Dein Typ wird hier in Rom verlangt!“, fiel er gleich mit der Tür ins Haus.
„Ich wollte mich ohnehin in den nächsten Tagen in Rom sehen lassen.“
„Nichts da! Du wirst sofort gebraucht!“
„Das ist wirklich eilig.“
„Komm her! Ich kann dir am Telefon nicht den Grund sagen. Aber es ist Feuer in der Hütte des Apostel Petrus.“
„Gib mir ein Stichwort.“
„Es geht um ein sehr peinliches Geheimnis des Vatikans!“
„Noch ein Geheimnis? Wie viele schmutzige Geschichten hat denn der Vatikan am Tiberstrand verbuddelt?“
„Spricht man so zu einem Kammerherrn des Vatikans? Ich erwarte dich morgen Abend.“
„Schade, dass ihr Italiener keinen Danton hattet!“
„Du kommst?“
„Ja doch!“
Spencer stupste mich an, so andeutend, dass er damit einverstanden war.
Als ich am Morgen aus meinem Schlafzimmer trat, das hinter meinem Büro lag, war Iphigenie Alexios bereits bei der Arbeit. Sie war der Ava-Gardner-Typ, wenn Sie sich darunter etwas vorstellen können. So schön, dass die Griechen noch einmal nach Troja gezogen wären, wenn ein liederlicher Lümmel wie Paris sie entführt hätte. Sie war groß gewachsen, mit schmaler Taille und dunklem, langem Haar, das sie als Zopf trug, und Augen so dunkel wie Achat.
„Ein Rasseweib!“, hatte Prätorius geschwärmt. „Wie kannst du mit einer solchen Frau ernsthaft arbeiten?“
Ich konnte es. Sie hatte einen Vater, den es aus den Bergen Makedoniens nach Deutschland verschlagen hatte, außerdem drei Brüder, die auch ihre Wildheit noch nicht abgelegt hatten. Wer versuchte, etwas mit ihr anzufangen, würde sie heiraten müssen. Zudem waren Maja und sie die besten Freundinnen. Nur ein falsches Wort und ihre Augen sprühten Funken.
„Ich muss nach Rom“, sagte ich nun und nahm von ihr die Tasse Kaffee entgegen. Spencer bekam bereits ein Kotelett.
„Dachte ich mir. Ich habe den Anrufbeantworter abgehört. Majas Bruder hat auch schon angerufen.“
Ich schnappte mir das Telefon und rief Marcello an.
„Was ist los? Ganz Rom schreit nach mir?“
„Es gibt in der Stadt die wildesten Gerüchte. Ein wichtiges Dokument, das die Existenz des Vatikans begründet, sei verschwunden. Was Genaues weiß man nicht. Mich rief ein Kardinal Wischnewski an, der wissen wollte, wann du wieder in Rom bist. Du musst in den heiligen Hallen des Vatikans einen Ruf wie Donnerhall haben.“
Wir waren mehr als Geschäftspartner, wir waren wie siamesische Zwillinge. Er war zwar mehr der Analytiker vom Schreibtisch her und konnte messerscharf kombinieren. Castor und Pollux hatte uns Maja genannt. Selbst mein Zerwürfnis mit ihr hatte er nur mit den Worten kommentiert: „Macht das unter euch aus und bringt es auf die Reihe!“
„Dieser Kardinal scheint sehr umtriebig zu sein. Er hat bei Prätorius anrufen lassen und Fürst Mazarini hat mich heute Nacht nach Rom zitiert. Du kennst ja die rigorose Art des italienischen Hochadels.“
„Und wann kommst du?“
„Ich denke, heute Abend.“
„Na schön. Wenn es uns reicher macht. Bis dann also! Ach übrigens, ich werde Maja sagen, dass du wieder im Land bist. Vielleicht hilft es.“
Es knackte.
„Flugzeug, Bahn oder TR6?“, fragte Iphigenie.
Spencer stupste mich an und sah erwartungsvoll zu mir hoch.
„Seine Herrlichkeit, der Hund, will mitgenommen werden. Spencer verlangt, dass wir mit dem Auto fahren.“
„Aber nicht ohne Frühstück“, sagte sie streng. „Ich habe in der Küche schon etwas für dich zurechtgemacht.“
„Ich habe keinen Hunger.“
„Habt ihr gestern wieder zugeschlagen?“
„Ein wenig“, gab ich zu. „Du weißt doch, wie das mit Dieter Prätorius immer endet.“
Das Frühstück konnte auch im Atlantic nicht besser sein. Sie hatte einen Korb mit Brötchen, eine Käseplatte sowie Mett- und Leberwurst hingestellt, dazu englische Marmelade.
„Dann halte mir mal schön die Stellung!“, sagte ich ihr beim Abschied.
„Keine Sorge. Was hier an Kleinkram anliegt, kann ich auch ganz gut ohne dich erledigen.“
In der Tat konnte sie das. Einst hatte ich sie für meine Büroarbeit engagiert, aber mittlerweile war sie so etwas wie meine rechte Hand geworden. In Fällen, bei denen es um Fremdgänger ging, war sie unschlagbar. Sie konnte kombinieren wie Sherlock Holmes und war einfühlsam wie eine Scheherezade aus Tausendundeiner Nacht.
„Wenn du mich in Rom brauchst, komme ich gern mit“, bot sie an. „Maja würde sich bestimmt freuen!“
Das hätte mir gerade noch gefehlt. Das würde bedeuten, dass sie mich von zwei Seiten unter Feuer nehmen würden.
„Grüß Maja und sage ihr, dass ein gewisser Ermittler langsam verwildert, wenn sie nicht bald zurückkommt.“
„Den Teufel werde ich!“, knurrte ich.
Spencer verriet mich, indem er mich anbellte.
Ich holte meinen Triumph aus der Garage. Spencer hopste auf den Beifahrersitz und sah mich an, als wolle er sagen: „Nun kann es losgehen. Mach schon!“
Bis zum Brenner war das Wetter genauso wie in Hamburg. Bei Bozen konnte ich endlich das Verdeck runterklappen und Spencer genoss es, seinen Kopf in den Wind zu halten. Bei Florenz aß ich in einer Raststätte einen Teller Spaghetti Carbonara. Spencer bekam ein Kotelett. Er war ein sehr anspruchsvoller Hund. Als ich in Rom einfuhr, ging die Sonne gerade unter. Am Himmel blieb noch ein roter Lichtstreifen. Die Luft war warm und samtig. Ich fuhr über die Piazza del Popolo den Corso hinunter bis zum Kolosseum und dann zurück in die Via del Babuino. Wir hatten in einer Seitenstraße für mich eine Garage gemietet. Marcello fuhr ohnehin nur Vespa. Oben in unserem Büro gegenüber dem Café Canova brannte noch Licht. Aber ich ging weiter bis zur Spanischen Treppe, wo der Palazzo des Fürsten Mazarini stand. Ein rotgelber langgestreckter Bau aus der Barockzeit. Vor dem Palast standen zwei Kutschen, die für Touristen eine Fahrt durch das nächtliche Rom anboten. Sein Diener – wir kannten uns seit meinem ersten Romaufenthalt – begrüßte mich freudig.
„Seine Exzellenz, der Fürst, erwartet Sie schon.“
Er führte mich durch die prächtige Halle durch noch prächtigere Säle und schließlich zur gemütlichen Bibliothek, in der kostbare, in rotes Leder gebundene Bücher aus fünf Jahrhunderten in den Regalen standen.
Vor dem Kamin saßen zwei Männer, die sehr verschieden aussahen. Mein Freund, der Fürst Mazarini, hatte ein vornehmes, durchgeistigtes Gesicht mit einer scharfen Nase und gütigen braunen Augen. Der andere Mann hatte eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Cary Grant.
„Da bist du ja!“, begrüßte mich der Fürst, stand auf, umarmte mich und küsste mir die Wangen. „Du bist wieder mit deinem verrückten Auto gefahren?“ Er sah auf den Hund. „Wegen dieses Ungeheuers, nicht wahr?“
Spencer knurrte.
„Darf ich dir Seine Eminenz Kardinal Wischnewski vorstellen? Er hat das Vatikan-Archiv unter sich und ist außerdem in Personalunion für die Sicherheit des Papstes verantwortlich. Ihm unterstehen die Schweizergarde und die Vatikanpolizei. Der Heilige Vater und er kennen sich aus Krakau. Ach ja, soll ich dir etwas zu essen bestellen?“
„Ein Sandwich wäre nicht schlecht.“
„Was möchtest du trinken? Wir führen uns gerade einen Chianti von meinem Gut bei Volterra zu Gemüte.“
„Erst als Aperitif ein Bier, bitte.“
Er klingelte und der Diener trat sofort ein, als habe er vor der Tür auf Anweisungen gewartet. Der Fürst gab die Bestellung auf. Der Kardinal hatte mich ausgiebig gemustert. Ich schien ihm zu gefallen. Er lächelte freundlich.
„Sie sind also der Mann, der den Mord an Johannes Paul I. aufgeklärt hat. Der Fürst hat mir wahre Wunderdinge über Sie erzählt.“
Sein Englisch war geschliffen, als hätte er Cambridge oder Oxford hinter sich gebracht.
„Zu viel der Ehre!“, spielte ich den Bescheidenen.
„Er hat es sogar mit der Mafia aufgenommen“, strich mich der Fürst heraus.
„Das könnte auch diesmal auf Sie zukommen, wenn Sie den Auftrag annehmen.“ Wischnewski sah mich bedeutungsvoll an. Es wunderte mich nicht. Letztendlich lief es in Italien immer auf die Mafia hinaus. Der Fürst bemerkte, dass ich langsam ungeduldig wurde, weil der Kardinal nicht zur Sache kam.
„Ein wichtiges Dokument ist aus dem Vatikan-Archiv entwendet worden“, half der Fürst dem Kardinal auf die Sprünge. Dieser seufzte.
„Haben Sie schon einmal von den Lateranverträgen gehört?“
„Meinen Sie die Konstantinische oder die Pippinische Schenkung?“
„Aber nein!“, entgegnete Wischnewski. „Der Lateranvertrag wurde am 11. 2. 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem italienischen Königreich abgeschlossen. Auf unserer Seite leitete Pietro Gasparri die Verhandlungen. Für das Königreich Benito Mussolini.“
„Der Diktator mit dem vorgestreckten Kinn?“
„Richtig. Er war damals Ministerpräsident.“
„Und was ist daran bedeutsam?“ Mir schwante etwas. Wenn die Kirche und ein Diktator Verträge miteinander abschlossen, geschah dies immer in trüben Gewässern.
„Der Vertrag erkannte den Vatikan als souveränen Staat an und garantierte die Unabhängigkeit und die Unverletzlichkeit des Heiligen Stuhls. Und legte die Grenzen des Staates fest. Dieser Vertrag wird auch heute noch uneingeschränkt vom italienischen Staat anerkannt.“
„Verstehe ich das richtig? Die Souveränität des Vatikans ist auf einen Pakt zwischen Faschisten und der Kirche zurückzuführen?“
„Nein. So stimmt das nicht!“, widersprach der Kardinal vehement, eine leichte Röte im Gesicht. „Wir schlossen den Vertrag mit dem Königreich Italien ab.“
„Das es nun nicht mehr gibt!“
„Das ist nicht das Problem. Die heutige Republik ist Rechtsnachfolger.“
„Das hat zwar ein Geschmäckle, aber wo liegt denn nun das Problem?“
Der Kardinal schluckte, faltete die Hände und starrte vor sich hin.
„Sie können Christiansen vertrauen“, half ihm der Fürst.
„Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist eines der großen Geheimnisse des Vatikans!“, quetschte er schließlich heraus.
„Wenn das in der Öffentlichkeit bekannt würde, gäbe es einen weltweiten Aufschrei!“, bekräftigte der Fürst.
„Sie kennen das Geheimnis?“, staunte Wischnewski.
„Nichts Genaues. Aber als Kammerherr bin ich in viele politische Aktivitäten des Vatikans eingebunden. Und da hört man so manches, was nicht im Osservatore Romano steht.“
Der Butler kam herein und reichte mir auf einem Silbertablett ein Weißbrotsandwich, belegt mit Thunfisch und Mayonnaise. Es war köstlich. Das Bier war kalt und schmeckte vorzüglich. Es war ein Astra aus Hamburg. Ich hatte gegenüber dem Fürsten mal geäußert, dass es eines meiner Lieblingsbiere sei und als vollkommener Gastgeber hatte er diese Bemerkung nicht vergessen.
„Was ist denn nun das große Geheimnis?“, fragte ich mit vollem Mund kauend, was mir von Maja einen strengen Blick eingebracht hätte.
„Es gab einen geheimen Zusatzvertrag, der dem Faschistenführer versprach, dass man nach dem Tod des Königs Viktor Emanuele II. das Königreich wie in Deutschland in einen Führerstaat umwandeln würde. Dazu kam es bekanntlich nicht. Mussolini wurde gestürzt und getötet. Die Italiener zwangen den König nach einer Wahl abzudanken. Er starb im Exil.“
„Peinlich, peinlich!“, kommentierte der Fürst. „Es ist der Beweis, dass sich die Kirche damals noch tiefer mit den Faschisten eingelassen hatte, als ohnehin schon bekannt ist.“
„Ja, es wäre noch heute ein Riesenskandal“, gab der Kardinal mit säuerlicher Miene zu.
„Und dieses Dokument ist verschwunden?“, kam ich auf des Pudels Kern.
„Und du sollst es wiederbeschaffen!“, ergänzte der Fürst.
Der Kardinal nickte eifrig. Er sah mich fast bittend an. Er sah aus, als wäre er beim Klauen in Nachbars Garten erwischt worden.
„Irgendwelche Verdachtsmomente?“
Nachdem ich meinen ersten Durst gestillt hatte, ließ ich mir vom Fürsten den Chianti einschenken. Er war wie erwartet fürstlich.
„Sehr gut“, lobte ich. Der Fürst strahlte.
„Nein. Keine“, gestand der Kardinal mit unglücklicher Miene. „Dem Leiter des Archivs Giuseppe Casardi ist es auch unerklärlich. Er arbeitet seit dreißig Jahren im Vatikan. Ein absolut zuverlässiger Mann von großer Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Für ihn lege ich meine Hand ins Feuer.“
„Weiß Seine Heiligkeit, Johannes Paul II., davon?“
„Nein. Wir wollen den Heiligen Vater damit nicht belästigen. Er hat genug um die Ohren! Für solche Petitessen ist der Kardinalstaatssekretär zuständig.“
„Petitessen? Ich denke, wenn der Inhalt des Zusatzvertrags bekannt würde, fliegt Ihnen der Vatikan um die Ohren.“
„So schlimm würde es nun auch wieder nicht werden! Nein, der Vatikan hat die Vandalen, Goten, Martin Luther und die deutschen Nazis überstanden. Aber eine Menge Ärger und Häme käme dann auf uns zu. Ärger, über den sich die Kommunisten besonders freuen würden. Aber Kardinalstaatssekretär Domus ist involviert.“
Ich schaute die beiden ratlos an.
„Wer ist das jetzt?“, fragte ich vorsichtig. Ich hatte mit Kardinalstaatssekretären keine guten Erfahrungen gemacht. „Ist der auch über mich informiert?“
„Ja, natürlich. Ich werde Sie ihm morgen vorstellen. Kommen Sie Punkt 12 Uhr in den Governatoratspalast. Danach stelle ich Ihnen den Chefarchivar vor. Sie wären also bereit, den Auftrag anzunehmen?“
„Der Vatikan muss nur meine Honorare akzeptieren!“ Ich nannte sie ihm.
Er schluckte und sagte: „Einverstanden! Wie werden Sie vorgehen?“
„Erst einmal ein paar Steine umdrehen, um darunter Skorpione aufzuschrecken!“
„Es werden welche darunter hervorkriechen!“, sagte der Fürst voraus.
„Sicher. Immerhin ist der Vatikan alles andere als ein demokratischer Staat.“
Der Kardinal verzog das Gesicht, als hätte er Zahnweh. Danach tauschten sich die beiden über ein paar amüsante Skandale aus. Römer lieben anrüchige Geschichten. Ich verabschiedete mich. Spencer hatte herzhaft gegähnt und mich angesehen, als wolle er sagen: „Wird’s bald? Wir sollten uns ein wenig Schlaf gönnen.“
„Pass auf dich auf!“, sagte der Fürst zum Abschied.
Es sollte sich herausstellen, dass dies eine sehr berechtigte Aufforderung war. Ich mochte den Fürsten, obwohl er seine Ahnen bis auf die Kreuzritterzeit zurückverfolgen konnte. Trotzdem war er kein bisschen eitel oder schwierig. Ich wusste, dass er mich gern als Schwiegersohn gesehen hätte. Seine Tochter traf ich in der Halle. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass sie mir aufgelauert hatte.
„Hallo, Barbar! Mal wieder zurück in der Zivilisation?“, begrüßte sie mich und fiel mir um den Hals. Estefanias Kuss war gar nicht schwesterlich. Ich hatte mit ihr mal eine Affäre gehabt, doch sie war ein gar zu wildes Mädchen. Sie hatte die Moral einer Gottesanbeterin. Aber jeder fühlte sich geschmeichelt, von ihr eine Weile geliebt zu werden. Schließlich war sie so schön wie die Cardinale. Ihre Liebe hatte jedoch die Halbwertszeit eines Wetterberichtes.
„Maja hat sich von dir verabschiedet, habe ich gehört“, bohrte sie auch gleich in meiner Wunde. „Na ja, ein braves Mädchen aus Trastevere ist auch nichts für einen Räuber wie dich!“
„Wir haben lediglich eine Auszeit genommen“, log ich. Dies war eine gehörige Untertreibung.
„Läuft bei dir bereits etwas anderes?“
„Nein. Ich lebe so keusch wie einst Franz von Assisi.“
„Ha, das soll ich dir glauben? Eher so keusch wie Papst Alexander, der Borgia. Aber dem können wir Rechnung tragen. Kommst du ein bisschen zu mir hoch? Du könntest dein müdes Haupt auf mein Kopfkissen legen. Wir könnten eine Menge Spaß haben.“
„Ich melde mich zum Spaß gern an. Aber ich muss noch ins Büro, um mit Marcello den nächsten Fall zu besprechen.“
„Ach, wegen des neuen Vatikangerüchtes, über das alle sprechen, über das aber niemand etwas Genaues weiß? Vater hat sogar mir gegenüber nichts rausgerückt. Aber er sprach davon, dass ein Auftrag auf dich wartet, der sich mit deinem letzten Fall durchaus messen könnte. Du bleibst also länger in Rom?“
„Sieht ganz danach aus.“
„Treffen wir uns doch in Harry’s Bar auf der Via Veneto. Ich laufe dort um zehn Uhr ein.“
„Nachts?“
„Ja, was denkst du denn?“
„Mal sehen, ob es passt.“
„Sei kein Berlusconi“, erwiderte Estefania. Es war in ihren Kreisen die größtmögliche Beleidigung. Berlusconi war für sie der Inbegriff des Parvenüs. Ich bekam dazu einen Augenaufschlag, der mir das Paradies verhieß. Estefania war darin eine Meisterin. Spencer knurrte.
„Du hast ja immer noch den Köter.“
Sie mochte meinen Hund nicht. Die Abneigung bestand gegenseitig. Er hatte ihr öfter mal auf die Pumps gepinkelt. Spencer konnte gemein sein. Sie nickte mir noch einmal hoheitsvoll zu und stieg die Freitreppe zu ihren fürstlichen Gemächern hoch. Sie machte ein unzufriedenes Gesicht.
Ich ging zurück zur Via del Babuino. Obwohl es bereits zwölf Uhr war, herrschte immer noch viel Leben in den Straßen. Ich tippte die Geheimzahl in die Alarmanlage und die Haustür sprang auf. Ich nahm den Fahrstuhl. Er knarrte immer noch und signalisierte seine Altersschwäche. Er stammte noch aus der Zeit, als Caruso das „Ave Maria“ sang. Oben empfing mich Marcello Buardi. Er hatte ein paar Kilo zugelegt. Es stand ihm gut. Mit der Schönheit seiner Schwester hatte er ohnehin nichts gemein. Während Maja das Aussehen von ihrer Mutter geerbt hatte, war er ein Abbild seines Vaters, der durch seine Fülligkeit signalisierte, dass er ein hervorragender Pizzabäcker war. Marcello hatte etwas von Bud Spencer an sich. Nicht, dass er fett war. Er hatte an Muskelmasse zugelegt.
„Übertreib nicht zu sehr! Wenn du so weitermachst, siehst du bald aus wie Arnold Schwarzenegger.“
„Und du ähnelst immer mehr Bruce Willis.“
Daran war kein Wort wahr.
„Wie stehen die Geschäfte?“
„Wir könnten einen dicken Auftrag gebrauchen. Im Moment begnügen wir uns mit Kleinvieh. Macht zwar auch Mist, aber wir werden den dritten Monat rote Zahlen schreiben. Warst du beim Fürsten? Kommt tatsächlich ein dicker Brocken auf uns zu, wie der Fürst andeutete?“
Ich informierte ihn über die Sachlage.
„Oha, das sieht nach einem großen Knochen aus.“
„Richtig. Kümmere dich mal um Archivar Giuseppe Casardi. Leumund, Nachbarschaftsklatsch, Verwandtschaftsverhältnis, teure Leidenschaften etc.“
„Hast du den bereits in Verdacht?“
„Ach was! Aber mit irgendetwas müssen wir ja anfangen. Wie geht es Maja?“
„Nicht so gut!“, sagte er und setzte seinen vorwurfsvollen Dackelblick auf. Aber sagen tat er nichts. Er hielt sich wirklich raus.
„Bestelle ihr liebe Grüße.“
„Komm nachher mit, dann kannst du ihr das selber sagen. Mutter und Vater würden sich freuen, dich wiederzusehen.“
„Nein. Sie hat mich verlassen, nicht ich sie! Da muss erst mal von ihr ein Leuchtfeuer kommen.“
„Maja hat recht. Du bist schwierig.“
„Sie ist nicht weniger schwierig. Wo hast du mich einquartiert?“
„Gegenüber in der Residenza Canova.“
„Wunderbar. Dann habe ich keinen langen Weg vor mir.“
Pünktlich fand ich mich am nächsten Mittag im Governatoratspalast ein. An dem Torbogen Cortile della Sentinella hatte ich mit der Schweizergarde keine Probleme. Man war bereits informiert worden. Der Palast war rein äußerlich nicht ganz so prächtig wie der Amtssitz des italienischen Staatspräsidenten, aber im Innern übertraf er ihn bei Weitem. Sämtliche Renaissancemaler gaben sich hier ein Stelldichein. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, um die Bilder gebührend zu bewundern. Ich meldete mich im Vorzimmer des Kardinals Wischnewski. Sein Sekretär hätte auch auf dem Laufsteg einen guten Eindruck gemacht. Wischnewski empfing mich mit ausgebreiteten Armen, als wären wir schon seit langen Jahren gute Kumpels.
„Schön. Ich mag pünktliche Menschen“, sagte er.
Sein Zimmer war eine Bildergalerie. Ich kam aber auch hier nicht dazu, sie mir anzusehen.
„Wir gehen gleich zum Kardinalstaatssekretär.“
Er ging mir voran. Die Schätze an den Wänden wurden immer anspruchsvoller. Leonardo, Michelangelo, Botticelli und Raffael. Sein Vorzimmer war gleich mit zwei Sekretären bestückt. Selbstredend sahen auch sie aus, als hätte Raffael sie ausgesucht. Der Kardinalstaatssekretär empfing mich, als stünde mir auf der Stirn geschrieben, dass ich Protestant war.
„Eminenz, darf ich Ihnen Serge Christiansen vorstellen?“
Der Staatschef, denn dies besagte sein Titel, musterte mich kalt.
„Der Mann aus Hamburg. Er ist uns nicht ganz unbekannt.“
Die Größe seines Schreibtisches hätte auch dem Duce gefallen. Er war mit vielen Papieren überladen. Er gab mir die Hand. Wenn er geglaubt hatte, dass ich sie küssen würde, hatte er sich getäuscht. Er wies auf eine Sitzecke. Die rotbraunen Ledersessel passten farblich zu seiner Soutane. Er fragte, ob er etwas zu trinken kommen lassen solle. Ich entschied mich für ein Mineralwasser. Er nickte zustimmend und klingelte. Einer der Cherubine trat ein und nahm die Bestellung entgegen. Wischnewski sah aus wie Cary Grant und dieser Priester ähnelte Anthony Perkins. Den Kardinalstaatssekretär hatte Gott nicht mit körperlichen Vorzügen bedacht. Er war klein, schmächtig, hatte flinke Augen und ein gelbes, pergamentartiges Gesicht. Er schien Schwierigkeiten mit der Leber zu haben.
„Sie sehen viel Arbeit!“, sagte er und wies auf seinen überladenen Schreibtisch. „Ich bin ja erst seit Kurzem im Amt. Sie haben, wie ich hörte, dem Vatikan unschätzbare Dienste erwiesen.“
„Danke für die Blumen! Ich habe nur meine Arbeit getan“, wehrte ich bescheiden ab.
„Ja. Lassen wir die traurige Geschichte um unseren armen Luciani. Kardinal Wischnewski hat Sie über die Bedeutung des vermissten Dokuments informiert?“
Ich nickte. Wischnewski nickte.
„Schön. Ich wollte Sie kennenlernen, denn einen Deutschen mit dieser Aufgabe zu betrauen, ist doch etwas …, sagen wir, ungewöhnlich.“
Ich verstand ihn durchaus. Wir Deutschen galten im Vatikan als etwas schwierig und zu nachgiebig gegenüber dem Zeitgeist.
„Ich bin auch in einer Stadt am Meer geboren“, sagte er nachdenklich. „Ich komme aus Genua. Den Menschen aus Hafenstädten sagt man nach, dass sie sehr weltoffen sind.“
Ich korrigierte ihn nicht, dass Hamburg nicht am Meer, sondern an der Elbe lag.
„Aus Hamburg!“, wiederholte er. „Na, die Deutschen sind wenigstens gründlich, obwohl sich dies nicht immer sehr sympathisch auswirkt. Diese Sache muss schnell erledigt werden!“, sagte er unvermittelt. „Ganz schnell! Wir haben ohnehin genug Sorgen. Der Heilige Vater hält uns auf Trab. Er ist eine Naturgewalt und räumt kräftig mit den alten Zöpfen auf.“
Er bekam dabei einen verbissenen Gesichtsausdruck. Chefs, die viel Arbeit verursachen, werden vielleicht geachtet, aber nicht unbedingt geliebt. Nun, es war sein Acker und ging mich nichts an.
„Man hat Sie noch nicht mit einer Forderung konfrontiert?“, insistierte ich.
„Forderung? Was für eine Forderung?“
„Man könnte ja sagen, wenn Sie nicht dies oder das tun, übergeben wir das Dokument der Presse. So was in der Art.“
„Nein. Nichts dergleichen. Bisher jedenfalls nicht.“
Wischnewski nickte bestätigend.
„Wir würden auch nicht darauf eingehen, sondern behaupten, dass es eine Fälschung ist. Eine Intrige der Kommunisten.“
„Und wenn sie die Beglaubigung eines Historikers vorlegten, dass das Dokument echt ist?“
„Werden wir einen Historiker finden, der das Gegenteil behauptet. Aber zugegeben, es wäre eine höchst ärgerliche Geschichte, die wir zurzeit nicht gebrauchen können.“
Mein Blick fiel auf ein Bild hinter dem Schreibtisch. Es zeigte einen Mann, der Geld zählte. Domus bemerkte meine Verwunderung und schmunzelte.
„Ein Bild des flämischen Malers Quentin Massys aus dem Jahr 1514. Es ist sehr symbolträchtig. Die Waage verdeutlicht die Gerechtigkeit. Der Spiegel steht für die Zerbrechlichkeit des Lebens. Ein ähnliches Bild hängt im Louvre. Doch beachten Sie die Inschrift auf dem Rahmen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Matthäus 22, Vers 21. Die Worte Jesu!“, fügte er andächtig hinzu. „Bischof Kaczinski vom IOR, besser bekannt als Vatikanbank, hat es mir beim Amtsantritt in mein Büro hängen lassen. Für das, was sich der Heilige Vater vorgenommen hat, braucht er viel Geld. Sehr viel Geld. Ein Danaergeschenk!“, fügte er mit sardonischem Lächeln hinzu.
Dass sich auch im Vatikan alles ums liebe Geld drehte, war keine Erkenntnis mit hohem Neuigkeitswert. Das Problem gab es bereits beim Bau des Petersdoms. Aber für einen so hohen Würdenträger, immerhin der zweite Mann nach dem Papst, war es doch ein erstaunliches Eingeständnis. Ich zuckte mit den Achseln.
„Falls eine Forderung eintrifft, so bitte ich Sie, mich umgehend zu informieren.“
„Das wird Kardinal Wischnewski übernehmen, der mich wiederum auf dem Laufenden hält. Nun, Mann aus Hamburg, dann zeigen Sie mal Ihre hanseatischen Tugenden! Wussten Sie, dass Danzig auch eine Hansestadt war?“
Ich wusste es, unterließ es aber, ihn darüber aufzuklären. Er lächelte ironisch und nickte Wischnewski zu. Wir waren damit entlassen.
Wischnewski war über den Verlauf der Audienz, so konnte man unser Gespräch vielleicht bezeichnen, sehr zufrieden.
„Das neue Pontifikat ist noch in der Einarbeitungsphase“, erklärte er. „Seine Eminenz hat wahnsinnig viel um die Ohren. Außerdem gibt es eine große Diskussion über die Ausrichtung des Pontifikats Johannes Pauls II. Die Traditionalisten kämpfen gegen die Modernisten. Vereinfacht gesagt: Wie politisch darf ein Papst sein?“ Er biss sich auf die Lippen. Wahrscheinlich machte er sich Vorwürfe, zu viel gesagt zu haben.
Wir fuhren mit dem Fahrstuhl hinunter ins Archiv, das unter der Bank IOR lag, dem Institut für gute Werke. Wir mussten einige Sicherheitsschleusen passieren. Der Kardinal hatte die entsprechende Codekarte dafür. Wir kamen in einen Saal, der so groß wie zwei Fußballfelder war und Hunderte von Regalreihen enthielt. Von einem Schreibtisch erhob sich ein Mann, der einen weißen Kittel trug, der ihn wie ein Arzt aussehen ließ. Er hatte ein durchschnittliches Gesicht, das leicht zu vergessen war. Seine Glatze wurde von einem schüchternen weißen Haarkranz umrahmt. Er hatte träumerische Augen, die durch dicke Augengläser vergrößert wurden. Der Kardinal stellte uns vor.
„Wie ich Ihnen bereits sagte, Herr Casardi ist schon eine Ewigkeit bei uns. Er diente bereits unter vier Päpsten.“
Ich bat mir zu zeigen, wo das Dokument archiviert gewesen war. Casardi ging mit uns zu einer Regalreihe, die viele Schubladen aufwies und zog ein Fach heraus. Er zeigte mir ein Dokument.
„Das ist der Lateranvertrag. Das Zusatzdokument lag dahinter.“
„Wie sind Sie darauf gekommen, dass etwas fehlt? Sie haben sicher Zehntausende von wichtigen Dokumenten!“
„Das ist richtig. Bischof Kaczinski wollte wissen, wie viel der Staat Italien damals für den Gebietsverlust von 1870 gezahlt hat und ob alle Zahlungen erfolgt sind. Dabei bemerkte ich, dass der Zusatzvertrag fehlt. Ich habe es sofort Seiner Eminenz gemeldet.“
„Das ist richtig“, bestätigte Wischnewski.
„Wie viele Leute arbeiten hier?“
„Zwölf Männer. Alle seit Jahren.“
„Sie sind Geistliche?“
„Teils, teils.“
„Kommen auch Besucher oder andere Fremde hier hinein?“
„Nein. Wissenschaftlern wird in einem Sicherheitszimmer das Dokument ausgehändigt, das sie interessiert. Hier ins Archiv kommen sie nicht. Oberste Vorschrift: Kein Dokument darf das Archiv verlassen.“
„Und doch ist es passiert?“
„Wir stehen vor einem Rätsel.“
„Einmal ist immer das erste Mal, sagte der Fuchs, als er in den Hühnerstall einbrach.“
Dem Kardinal war mein Spruch sichtlich peinlich.
„Wer hat die Sicherheitsanlage installiert?“
„Da müsste ich nachschauen. Es ist das Beste vom Besten. Wir sind mit Lasern gesichert. Ich weiß aber, dass es ein deutsches Unternehmen war. Und die sind auf dem Sektor Sicherheit wirklich gut.“
„Wann war das?“
„Vor fünf Jahren. Ich lasse Ihnen die Anschrift und den Namen des Sicherheitsingenieurs zugehen.“
Ich gab ihm meine Visitenkarte mit der römischen Adresse.
„Hier kommt niemand unbefugt herein!“, setzte er trotzig hinzu.
„Ich weiß. Ich muss nur alles ausschließen. Irgendwo muss ein Schwachpunkt sein, sonst wäre der Zusatzvertrag ja noch im Archiv.“
Er grummelte etwas.
„Das wäre es erst mal“, beruhigte ich ihn. „Ich brauche noch die Namen aller Mitarbeiter und deren Personalakten“, sagte ich zum Kardinal. Er nickte.
„Für meine Leute lege ich die Hände ins Feuer!“, protestierte Casardi.
„Ich glaube Ihnen gern, dass Sie ehrliche Mitarbeiter haben. Aber ich muss das überprüfen.“
„Wär’s das?“, fragte Wischnewski ungeduldig.
„Nicht ganz. Ich möchte jetzt mit Bischof Kaczinski sprechen.“
„So unangemeldet wird das kaum gehen. Ich werde mit seinem Sekretariat einen Termin vereinbaren.“
„Ach, schaun wir mal rein. Wir haben es doch eilig und wollen möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen.“
Casardi staunte, dass sich der Kardinal fügte.
Wir fuhren mit dem Fahrstuhl hoch in die Bank. Sein Sekretariat war von einer Nonne besetzt. Sie war sogar ansehnlich. Der Kardinal trug unsere Bitte vor. Sie sah uns an, als hätten wir verlangt, ein Bild von Martin Luther aufzuhängen.
„Man kann Bischof Kaczinski doch nicht ohne Terminabsprache …!“
„Nun hören Sie mal gut zu, Schwester! Soll ich dem Heiligen Vater berichten, dass dieses Sekretariat meine Arbeit behindert?“, mischte ich mich ein.
Sie war diesen Ton nicht gewöhnt. Meine Drohung wirkte, als hätte ich ihr das Erscheinen des heiligen Petrus angekündigt. Sie verschwand hinter der gepolsterten Tür.
„Aber Sie können doch nicht …!“, krächzte Wischnewski entsetzt.
„Ich kann schon. So geht das in der realen Welt zu.“
Der Bischof kam mit rotem Kopf herausgestürmt.
„Was reden Sie da für Unsinn? Sie kommen vom Heiligen Vater? Das ist unmöglich! Ich war doch gerade bei ihm.“
„Wir untersuchen die Causa Zusatzvertrag“, sagte der Kardinal fast demütig. „Wir waren gerade bei Kardinalstaatssekretär Domus.“
„Und was soll das Gerede, dass der Heilige Vater …?“
„Das geht auf meine Kappe! Es sollte Ihrer schönen Schwester die Dringlichkeit verdeutlichen!“, gab ich zu, arrogant wie der Aufsichtsratschef einer deutschen Bank. Ich mochte ihn nicht. Er passte nicht zu der Bischofssoutane, war groß, breitschultrig und hatte Fäuste wie Schmiedehammer. Sein bulliges Gesicht hätte mich bei einem Wrestler nicht erstaunt. Er wies mit seinem mächtigen Kopf hinter sich. Wir folgten ihm in sein Büro.
„Signore Christiansen kennt sich mit unseren Gepflogenheiten nicht so aus“, bot ihm Wischnewski die Friedenspfeife an. Er schnaubte nur.
„Sagen Sie endlich, was Sie wollen, damit ich meine Arbeit tun kann!“
„Sie haben den Lateranvertrag angefordert?“
„Ja, habe ich. Und der Zusatzvertrag war nicht bei den Akten“, sagte er scharf.
„Schon gut. Warum haben Sie den Lateranvertrag angefordert?“
„Ich durchforste alle Verträge, die wir in diesem Jahrhundert abgeschlossen haben. Wir prüfen, ob noch irgendwelche Forderungen bestehen.“
„Der Lateranvertrag wurde doch bereits 1929 abgeschlossen. Daraus sind doch kaum noch irgendwelche Ansprüche abzuleiten.“
„Nach Ihrer Aussprache sind Sie Deutscher. Auch wir im Vatikan sind gründlich. Wir drehen jeden Stein um.“
„Das verstehe ich. Ist auch meine Devise.“
„Also, was wollen Sie noch wissen?“
„Das wäre es erst einmal.“
„Wegen solcher Kleinigkeiten stören Sie mich bei der Arbeit?“, platzte er heraus.
„Für mich war es ein durchaus interessantes Gespräch“, erwiderte ich vage und erhob mich. „Ich wünsche Ihnen noch einen zufriedenstellenden Arbeitstag.“
An der Tür drehte ich mich noch einmal um. „Stimmt es, dass die Vatikanbank immer noch Geld von der Mafia wäscht?“
Zugegeben, das war frech und unhöflich. Aber die Spatzen pfiffen es von den Dächern, dass diese Praxis entgegen aller Verlautbarungen immer noch nicht aufgegeben worden war.
„Was erlauben Sie sich! Ich habe das absolute Vertrauen des Heiligen Vaters!“, brüllte er los. Er schien dicht vor einem Schlaganfall zu stehen.
„Verstehe. Ein Dementi hört sich anders an!“
„Raus! Sie … Sie …! Schleppen Sie mir diesen Kerl nicht noch einmal an!“, wandte er sich an den Kardinal.
Wir gingen hinaus. Die Nonne sah mich an, als wäre ich der Leibhaftige persönlich.
„War das nötig?“, klagte Wischnewski.
„Der Besitz des Zusatzvertrages kann Millionen wert sein. Und wo Geld ist, nehme ich die Witterung auf. Und Bischof Kaczinski verwaltet die Milliarden des Vatikans, deswegen musste ich feststellen, was für ein Mensch er ist.“
Man sah dem Kardinal an, dass er sich die Frage stellte, ob es richtig gewesen war, den Mann aus Hamburg zu engagieren. Ich verabschiedete mich von ihm und wir versprachen einander, uns auf dem Laufenden zu halten.
Als ich aus dem Torbogen auf den Petersplatz trat, sah ich mich noch einmal nach dem mächtigen Gotteshaus um. Wie viel Blut hatte der Bau einst gekostet. Schließlich war seine Finanzierung der Grund für den Ablasshandel gewesen und dieser wiederum hatte zum Schisma und letztendlich zum Dreißigjährigen Krieg geführt. Der Dom löste bei mir keine Emotionen aus. Das einzig wirklich schöne war die Pietà Maria und Jesus vom großen Michelangelo. Dass Maria eher wie seine Schwester aussah, war für mich kein Problem.
Ein Taubenschwarm flog über den Platz. Er lag still und friedlich im Sonnenlicht. Dabei hatte der Papst die Schlacht um Polen bereits eröffnet. Wie hätte ich auch ahnen können, dass ich in seinem Krieg eine wichtige Rolle spielen würde.