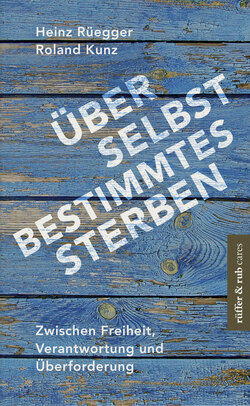Читать книгу Über selbstbestimmtes Sterben - Heinz Rüegger - Страница 9
ОглавлениеDie Medikalisierung des Sterbens und die Fortschritte der Medizin brachten es mit sich, dass sich im Verlauf eines Sterbeprozesses immer häufiger komplexe Entscheidungssituationen ergaben und dass die Entscheidungsbefugnis faktisch weitgehend in die Hände der Ärzteschaft geriet. Ihr gestand man kraft ihres medizinischen Wissensvorsprungs weithin unhinterfragt zu, darüber zu bestimmen, was im Kampf gegen den Tod medizinisch gemacht werden sollte und wie lange der Kampf fortzusetzen sei. Aus dem unspektakulären, selbstverständlichen Sterben war ein medizinisch kontrolliertes und dominiertes Sterben unter der Oberaufsicht von Ärzten geworden.33
Die Angst vor medizinischer Übertherapie und die Einforderung des Rechts auf den eigenen Tod
Diese Situation war durchaus ambivalent: Auf der einen Seite entlastete sie die betroffenen Patientinnen und ihre Angehörigen von medizinisch-fachlich wie existenziell schwierigen Entscheidungen über Leben und Tod. Die Verantwortung konnte nach diesem Modell des ärztlichen Paternalismus an die Experten abgegeben werden. Auf der anderen Seite war damit eine Entmündigung der Betroffenen verbunden; sie sahen sich mitunter ohnmächtig der Eigendynamik einer medizinischen Logik ausgeliefert, die davon ausging, dass im Kampf gegen den Tod alle zur Verfügung stehenden therapeutischen Mittel eingesetzt werden soll ten, denn: Das Leben als höchstes ethisches Gut rechtfertigte zu seinem Schutz einen solchen Einsatz moralisch nicht nur, sondern es verlangte ihn geradezu. Daniel Callahan sieht darin die »moralische Logik des medizinischen Fortschritts«.34 Nach seiner Einschätzung sind »die Forderung nach Kontrolle und die Ablehnung eines Todes, wie er sich ereignet, wenn wir ihn unmanipuliert geschehen lassen, nicht nur stark, sie sind für viele eine Leidenschaft geworden. Das einzige Übel, das größer scheint als der persönliche Tod, wird zunehmend der Verlust der Kontrolle über diesen Tod.«35 Und dank der beeindruckenden Fortschritte in der jüngsten Vergangenheit stehen der Medizin inzwischen sehr viele Instrumente zur Verfügung, um eine solche Kontrolle über den Tod wahrzunehmen beziehungsweise seine Bekämpfung zwecks entsprechender Lebensverlängerung erfolgreich durchzuführen. Darum stellt sich die Medizin, wie die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften selbstkritisch festhält, in der Regel spontan auf die Seite des Lebens und versucht den Tod zu verhindern.36
Als Kehrseite dieser Medaille hat sich allerdings in weiten Kreisen eine diffuse Befürchtung ausgebreitet: Wenn man heutzutage mit einer potenziell tödlich verlaufenden Krankheit in die Hände der Medizin gerate, werde man immer weiter therapiert, und als Patient lasse man einen, auch wenn man dies möchte, gar nicht mehr sterben. »Früher war die Situation oft mit Ängsten verbunden, dass am Lebensende zu wenig gemacht wird; heute ist es wohl eher das Gegenteil. Es werden unnötige Leistungen befürchtet.«37 Und solche Befürchtungen sind keineswegs nur aus der Luft gegriffen. Der Lausanner Palliativmediziner Gian Domenico Borasio spricht von einer »allgegenwärtigen Übertherapie« am Ende des Lebens.38 Und der Synthesebericht des Nationalen Forschungsprogramms NFP 67 »Lebensende« weist darauf hin, dass Spitäler grundsätzlich darauf ausgerichtet sind, Patientinnen diagnostisch abzuklären und in kurativer (nicht palliativer!) Absicht zu therapieren. Zudem hält der Bericht fest, dass »ein exklusiver Fokus auf körperliche Störungen und auf deren Abklärung und Behandlung die Wahrscheinlichkeit der Überbehandlung erhöht«.39 Eine solche Überbehandlung gereicht nicht zum Wohl der Patienten, sondern steht vielmehr deren »berechtigtem Interesse (entgegen), am Sterben durch übermäßige Medizin nicht gehindert zu werden«.40
Der wohl häufigsten Situation der Überbehandlung begegnen wir bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen. Dem Patienten wird eine weitere Chemotherapie empfohlen, obwohl sein Lebensende absehbar ist. Statistisch kann bestenfalls eine Verlängerung seines Lebens um einige Wochen erwartet werden, die Lebensqualität in diesen Wochen bleibt aber tief und wird unter Umständen noch zusätzlich beeinträchtigt durch die Nebenwirkungen der Therapie. Auch im Endstadium einer schweren Herz- oder Lungenkrankheit kann eine Behandlung auf der Intensivstation zwar den Tod hinauszögern, für die Betroffenen und die Angehörigen wird dadurch aber die Zeit des bewussten Abschiednehmens weitgehend der Abhängigkeit von Medizintechnik geopfert.
Im Gegenzug zu der Tendenz eines extensiven Kampfes gegen den Tod entwickelte sich international in vielfältigen Gesellschaftsfeldern die Forderung nach dem »Recht auf den eigenen Tod« oder nach einem »selbstbestimmten Sterben«. Auf dem Hintergrund von sich durchsetzenden Autonomieansprüchen ging es grundsätzlich darum, dass jede Person selbst über Zeitpunkt und Art ihres Sterbens entscheiden können sollte.41 Faktisch fokussierte das hinter diesem Ruf stehende Anliegen aber hauptsächlich auf den assistierten Suizid,42 nicht jedoch auf andere Formen selbstbestimmten Sterbens.
Ein breiter und fundamentaler Gegenakzent dazu ergab sich erst durch das Aufkommen der Palliative-Care-Bewegung und durch die neuere medizinethische Diskussion um die Bedeutung der Patientenautonomie und das Prinzip der informierten Zustimmung, des sog. »Informed Consent«, von Patienten als Grundvoraussetzung für die moralische Legitimität und juristische Legalität medizinischer Interventionen. In diesem Kontext ist das Einfordern eines »Rechts auf einen eigenen Tod« und der Ruf nach »selbstbestimmtem Sterben« eine wichtige Herausforderung an die Medizin, ihr Handeln und ihr Selbstverständnis kritisch zu reflektieren.
Medizinische Lebensende-Entscheidungen
Eine selbstkritische Sensibilität ist unter anderem deswegen geboten, weil sich als Folge der rasanten medizinischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte rund um den potenziellen Sterbeprozess immer mehr Situationen ergeben, die die Akteure vor grundsätzliche Entscheidungen stellen. Die Rede ist von Lebensende-Entscheidungen – »medical end-of-life decisions«.43 Krankheiten, an denen man früher starb, sind durch neue Therapie möglichkeiten entweder heilbar geworden oder man kann sie inzwischen so weit in den Griff bekommen, dass man an ihnen nicht mehr einfach stirbt, sondern man kann mit verschiedenen Krankheiten weiterleben (Multimorbidität). Angesichts dieser Vielfalt an Interventionsmöglichkeiten stellt sich immer wieder die Frage: Soll man in fortgeschrittenem Alter bei einer potenziell tödlich verlaufenden Erkrankung durch lebensverlängernde therapeutische Maßnahmen intervenieren? Oder soll man dem Sterben seinen Lauf lassen und den Sterbeprozess einfach durch die breite Palette palliativer, also lindernder Maßnahmen unterstützen? Und wenn lebensverlängernde Maßnahmen erfolgen sollen, welche sollen gewählt werden? Welches Risiko, mit etwaigen daraus resultierenden körperlichen Schädigungen und biopsychosozialen Beeinträchtigungen weiterzuleben, ist eine Patientin bereit einzugehen? Dies sind in vielen Fällen nicht einfach rein fachlichmedizinische Fragen. Es sind Fragen danach, welche Behandlungsziele sich eine Patientin setzt oder welche Maßnahmen ein Patient präferiert beziehungsweise welche er allenfalls ablehnt. »Das Lebensende gilt heute als nicht nur therapeutisch behandelbare, sondern als individuell und sozial gestaltbare und dabei verhandelbare Sache.«44 Angesichts der Vielzahl heutiger Interventionsmöglichkeiten sprechen der Soziologe Reimer Gronemeyer und der Theologe Andreas Heller von einem »Multioptionsdilemma«, das sich in heutigen Sterbeprozessen stellt.45
Ein typisches Multioptionsdilemma besteht zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit einer Demenz erkrankung im frühen Stadium. Leidet die Patientin an einer ernsthaften Erkrankung der Herzkranzgefäße, bestehen zwei Möglichkeiten. Durch einen Eingriff an den Herzkranzgefäßen, durch das Einlegen eines sogenannten Stents zur Offenhaltung der Durchblutung des Herzmuskels, kann ein Herzinfarkt und damit ein plötzlicher Herztod verhindert werden. Das bedeutet aber auch, dass die Patientin mit großer Wahrscheinlichkeit das Fortschreiten der Demenz bis ins Endstadium erleben wird und vielleicht lange nicht sterben kann. Ein Verzicht auf den Eingriff erhöht die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Todes an Herzversagen, möglicherweise schon zu einem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Lebensqualität noch als gut erlebt. Das Dilemma besteht in der Frage, länger zu leben mit der Demenzerkrankung oder früher zu sterben, bevor einem die Demenz alle Selbständigkeit raubt, dafür aber noch lebenswerte Zeit zu opfern.
Solche medizinischen Lebensende-Entscheidungen hat die EURELD-Studie (European End-of-Life Decision Making in Six European Countries) untersucht und dabei auch die Verhältnisse in der Schweiz 2001 und 2013 berücksichtigt. Dabei lassen sich verschiedene Formen unterscheiden:46
Lindern von Symptomen unter Inkaufnahme möglicher lebensverkürzender Wirkung (auch als indirektaktive Sterbehilfe bezeichnet);
Beendigung von oder Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen (auch als passive Sterbehilfe bezeichnet);
Tiefe Sedierung bis zum Tod, wobei das Ziel der Sedierung nicht die Herbeiführung des Todes ist, sondern die Ausschaltung des Bewusstseins mithilfe von Schmerz- und Beruhigungsmitteln, sodass der Patient nicht mehr an den ihn belastenden Symptomen leidet und in Ruhe an seiner Krankheit sterben kann;
Bewusster Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit mit der Absicht, dadurch den Sterbeprozess zu beschleunigen oder einzuleiten (auch als Sterbefasten bezeichnet);
Ärztlich assistiertes Sterben: Darunter fallen die in der Schweiz verbotene ärztliche Tötung auf ausdrückliches Verlangen der Patientin (auch als aktive Sterbehilfe bezeichnet) oder auch ohne ein solches Verlangen sowie der in der Schweiz erlaubte assistierte Suizid (auch als Beihilfe zum Suizid bezeichnet).
Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen in vielen Fällen erst dann sterben (können), nachdem entsprechende medizinische Lebensende-Entscheidungen gefällt worden sind, also Entscheide, dass man sie sterben lässt, obwohl man sie noch weiter durch entsprechende Maßnahmen am Leben erhalten könnte.47
Die Lungenentzündung und andere Infektionen zählen zu den häufigsten Todesursachen. Durch eine Therapie mit Antibiotika kann in den meisten Fällen die Infektion bekämpft und damit das aktuelle Weiterleben ermöglicht werden. Die Entscheidung, ob das Antibiotikum eingesetzt wird oder nicht, ist somit in vielen Fällen ausschlaggebend für das Weiterleben oder das Zulassen des Sterbens. Der Entscheid gegen die Behandlung einer Infektion im Verlaufe einer fortschreitenden Krankheit ist deshalb eine der häufigsten Lebensende-Entscheidungen neben dem bewussten Verzicht auf intensivmedizinische Behandlungen.
Gemäß der jüngsten Studie, die sich auf Todesfälle im Jahr 2013 bezieht, ergibt sich, dass in 58,7% der Todesfälle in der Schweiz entsprechende Entscheide dem Sterben vorausgingen.48 Gian Domenico Borasio vermutet sogar, dass der Prozentsatz von Situationen, in denen sich Lebendsende-Entscheidungen stellen, in der Schweiz bei etwa 75% liegt. Er geht davon aus, dass in manchen durch die Studie untersuchten Fällen die anstehenden Fragen, ob lebensverlängernde Maßnahmen eingesetzt oder weitergeführt werden sollen oder nicht, gar nicht ernsthaft erörtert wurden, sondern einfach weitertherapiert wurde.49
Insgesamt lässt sich sagen, dass der Prozentsatz solcher Entscheidungen in der deutschen Schweiz höher liegt als in der französischen und italienischen Schweiz, aber generell höher als in anderen europäischen Ländern. Dies ist wohl als Zeichen für die hohe Bedeutung des Prinzips der Patientenautonomie insbesondere in der deutschen Schweiz zu werten, denn das Kriterium für solche Entscheide ist grundsätzlich der aktuelle, vorausverfügte oder mutmaßliche Patientenwille. Von den oben genannten verschiedenen Formen von Lebensende-Entscheidungen geht es in der deutschen Schweiz am häufigsten um einen Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen, wobei in etwa der Hälfte der Fälle verschiedene Formen miteinander kombiniert wurden.50
Nach Dieter Birnbacher, Moralphilosoph, gilt auch für Deutschland, dass der Tod »vielfach das Ergebnis einer Entscheidung ist, in der Hauptsache der Entscheidung, die Bemühungen um eine weitere kurative, auf Heilung ausgerichtete Behandlung abzubrechen«. Birnbacher zufolge trifft dies auf mehr als 40% der Sterbefälle zu.51 Und Ralf J. Jox, geriatrischer Palliativmediziner und Medizinethiker, hält mit Blick auf die große europäische EURELD-Studie, die die Situation in Belgien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Schweden und der Deutschschweiz im Jahr 2001 miteinander verglich, fest: »Je nach Land war jeder vierte bis jeder zweite aller untersuchten Todesfälle mit der bewussten Entscheidung verbunden, das Sterben des Patienten zu ermöglichen. Meist geschah dies dadurch, dass eine oder mehrere lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr begonnen oder nicht mehr fortgeführt wurden.«52 Mit anderen Worten: In vielen Fällen haben wir es mittlerweile nicht mehr mit einem »natürlichen Sterben« zu tun, sondern mit einem »Sterben durch Handlungsbegrenzung zu potenziell lebensverlängernden Maßnahmen«.53
Selbstbestimmung beim Sterben als Zumutung für die Sterbenden
Mit dieser Entwicklung hat sich – von vielen Medizinalpersonen wie von Patienten gar nicht bewusst wahrgenommen – eine gegenüber früher qualitativ neue, he rausfordernde Situation ergeben. Das Nationale Forschungsprogramm NFP 67 »Lebensende« kommt zum Schluss: »Der Tod hat nicht länger den Charakter eines Schicksalsschlags, sondern wird immer mehr zu einer Folge individueller Entscheide: Wie, wann und wo will ich sterben? Diese Fragen zu stellen und zu entscheiden bringt zwar einen Freiheitsgewinn, aber auch eine Verantwortung mit sich, die in Überforderung münden kann.«54 Ging es früher darum, gegen ein Gesundheitswesen, das dazu tendierte, nach einer inneren medizinischen Logik am Lebensende immer weiter zu therapieren, das Recht auf den eigenen Tod und ein selbstbestimmtes Sterben einzufordern, hat sich das Blatt inzwischen gewendet: Die Medizin und die ethisch-rechtlichen Bedingungen unseres Gesundheitssystems verlangen von Patientinnen am Lebensende geradezu, sich selbst für das Sterben (oder für das Noch-nicht-sterben-Wollen) zu entscheiden. Sterben wird planbar; das ist ein Grundzug moderner Gesellschaften mit einer hoch entwickelten Medizin.55 Oder um es ganz pointiert zu sagen: Aus der Freiheit zur Selbstbestimmung wurde so etwas wie ein »Zwang zur Selbstbestimmung«.56 Denn »der moderne Mensch hat in den neuen Freiheiten nicht nur Möglichkeiten, er steht auch unter dem Zwang, wählen zu müssen. Er kann nicht nur wählen, er muss sein Leben und sein Sterben wählen, gestalten, als Projekt betrachten.«57 Oder mit den Worten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes: »Wir haben nicht die Wahl, ob wir entscheiden wollen oder nicht. Wir können lediglich zwischen vorhandenen Möglichkeiten wählen.«58
In neuerer Zeit hat vor allem die Medizinethikerin Nina Streeck darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung die Gefahr in sich birgt, dass aus dem emanzipatorischen Einsatz für ein selbstbestimmtes Sterben, also für das Sterbe-Ideal des »eigenen Todes«, unter der Hand ein neues Gebot, ein gesellschaftlicher Imperativ wird, nur ja ein autonomes Sterben zu verwirklichen, weil nur so auch noch im Sterben die menschliche Würde gewahrt werden kann.59
Die 57-jährige Journalistin leidet an einem Krebs der Bauchspeicheldrüse. Seit dreißig Jahren ist sie Mitglied von EXIT und hat stets erklärt, dass sie einmal ihren Todeszeitpunkt selber bestimmen wird. Für sie besteht darin eine Voraussetzung für ein Sterben in Würde. Nun liegt sie schwerkrank auf der Palliativstation, und ihr Tod ist absehbar. Sie wehrt sich gegen das natürliche Sterben und will ihm durch einen assistierten Suizid zuvorkommen. Das Geschehenlassen des natürlichen Endes widerspricht ihrer Vorstellung des selbstbestimmten Todes. Erst nach vielen Gesprächen kann sie auch das Zulassen des natürlichen Todes als autonome Entscheidung akzeptieren – und stirbt wenige Stunden danach.
Diese Herausforderung eines selbstbestimmten Sterbens als Konsequenz der durch die abendländische Aufklärung bedingten Betonung von Individualismus und Autonomie einerseits und der enormen Fortschritte moderner Medizin andererseits ist insbesondere ein Phänomen moderner westlicher Kultur. Patienten aus anderen Kulturkreisen, in denen medizinische Entscheide entweder vom Arzt, von der Familie oder von einem Geistlichen gefällt werden, tun sich damit zuweilen schwer. Die damit aufgeworfenen Fragen stellen sich aber unweigerlich und in zunehmendem Maße auch in anderen Kulturen, wo immer hoch entwickelte westliche Medizin Eingang hält. Umgekehrt fordern uns Patienten oder Heimbewohnerinnen fremder Kulturen, die in Institutionen unseres westlichen Sozial und Gesundheitswesens betreut werden, dazu heraus, medizinische Entscheidungsprozesse so zu gestalten, dass auch kollektive oder stellvertretende Formen der Meinungsbildung zum Tragen kommen können, ohne das Anliegen der Patientenautonomie aus den Augen zu verlieren.
In der genannten Herausforderung der Selbstbestimmung liegt eine nicht zu unterschätzende Zumutung für Sterbende beziehungsweise auf den Tod zugehende Menschen. Wir sind es nicht gewohnt, über unser Ableben zu entscheiden, wenn wir keinerlei Suizid-Absichten haben. Es ist eine mental und kulturell neue Situation, dass der Tod nicht bloß erlitten wird, sondern dass sich der Sterbende aktiv der Arbeit an der Gestaltung seines Ablebens zu widmen hat. Es liegt eine Zumutung darin, damit klarzukommen, dass es normal geworden ist, den Tod in eigener Regie übernehmen zu müssen.60 Denn es ist nach wie vor so, dass der überwiegende Teil der Menschen eigentlich lieber ungeplant, spontan sterben möchte: einfach einschlafen können und nicht mehr aufwachen müssen, ohne sich genauer mit dem Wie und Wann auseinandersetzen zu müssen. Es spricht manches dafür, dass die Verantwortung des Einzelnen für die Planung und Kontrolle des eigenen Sterbens in Zukunft noch zunehmen wird. Diese Aufgabe dürfte von einem Teil der Bevölkerung eher als Chance, als Zugewinn an individueller Freiheit begrüßt werden, von einem anderen Teil eher als Zumutung und Überforderung empfunden werden.61 Denn die Aufgabe, die letzte Lebens- und Sterbephase im Sinne eigener Überzeugungen und Werthaltungen selbstbewusst zu gestalten, ist allemal anspruchsvoll und kann für jeden Menschen, auch den religiös gut verankerten, durchaus zu einer Überforderung werden.62
Moralisierung des Sterbens: das eigene Sterben verantworten müssen
Wenn der Tod nicht länger einfach den Charakter eines Schicksalsschlags hat, sondern immer mehr zu einer Folge individueller Entscheide zwischen verschiedenen medizinischen Möglichkeiten wird, bringt das zwar einen unbestreitbaren Freiheitsgewinn mit sich, bürdet den Sterbenden aber zugleich eine moralische Verantwortung für ihr Sterben auf. Es findet so etwas wie eine Moralisierung oder Responsibilisierung des Sterbens, also eine moralische Zuschreibung von Verantwortung für die Gestaltung des Sterbens statt. Denn »Selbstbestimmung bedeutet zugleich, dass wir Verantwortung für unser eigenes Handeln und Unterlassen zu übernehmen haben«63 und dass Sterben in den Horizont ethischer Rechenschaftspflicht rückt. Reimer Gronemeyer hält treffend fest: »Das ist das Neue: Sterben und Tod sind für uns moderne Menschen zum ›Problem‹ geworden. Der Tod kommt nicht mehr, sondern er wird zur letzten Gestaltungsaufgabe des Menschen […] Solange der Tod ›kam‹, musste sich keiner rechtfertigen: Es bedurfte einer solchen Debatte nicht. Das moderne Subjekt, der ›homo modernissimus‹, hat sich in die fatale Lage gebracht, dass er nun selbst sein Sterben und seinen Tod zu verantworten hat«.64 Es fand so etwas wie die Transformation des Todes von einem früheren biologischen Ereignis in ein moralisches Ereignis statt, das nun ethisch zu verantworten ist.65 Wir können gar nicht mehr verhindern, in gewissem Umfang unser Sterben selbstbestimmt zu planen und dafür Verantwortung zu übernehmen: vor uns selbst, vor unseren Mitmenschen, vor der Gesellschaft, vor Gott oder vor wem auch immer – selbst wenn wir Passivität vorziehen und unseren Sterbeprozess lieber dem Schicksal oder einer Entscheidung des »Herrn über Leben und Tod« überlassen würden.66
Die Frage ist nicht, ob das wünschbar ist oder nicht, ob wir das ethisch-moralisch für sinnvoll erachten oder nicht. Es ist einfach eine Gegebenheit, um die wir nicht mehr herumkommen, mit der wir verantwortlich umzugehen lernen müssen. Ulrich H. J. Körtner, in Wien lehrender Theologe und Ethiker, ist zuzustimmen: »Mit dem nicht mehr aus der Welt zu schaffenden medizinischen Fortschritt ist dem Menschen an den Grenzen des Lebens eine Verantwortung zugewachsen, aus der er sich nicht durch willkürliche Selbstbegrenzung davonstehlen kann. […] Dieser Zuwachs an Freiheit und Verantwortung gehört zur ›Würde des Menschen‹. Der Hinweis auf Gott, den Herrn über Leben und Tod, oder die angebliche, in der Praxis aber ständig widerlegte Unverfügbarkeit des Lebens darf nicht dazu missbraucht werden, die Verantwortung Gott zuzuschieben, wo sie dem Menschen übertragen ist.«67
Die neu entstandene Situation mit dem nun einmal nicht mehr wegzudiskutierenden »Wandel von der Widerfahrnis zur Gestaltung, von der Kontingenz zum Arrangement, von der Heteronomie zur Autonomie [des Sterbens] hat weitreichende Folgen: […] Die Selbstverständlichkeit des natürlichen Todes wird abgelöst durch Wertungen – Wertungen des Patienten (wie und unter welchen Umständen will er sterben?), der ärztlichen Profession (wann besteht eine Indikation für lebenserhaltende Maßnahmen, wann nicht mehr?), der Angehörigen (wollen sie den Kranken sterben lassen?) und nicht zuletzt der Gesellschaft insgesamt (etwa bei Entscheidungen über die solidarische Finanzierung medizinischer Maßnahmen).«68
Die moralische Herausforderung bezieht sich dabei nicht nur auf Situationen, in denen ein urteilsfähiger Patient am Ende seines Lebens selbst eine aktuelle medizinische Entscheidung treffen sollte, sondern auch auf die Frage, ob es so etwas wie eine moralische Verpflichtung des Individuums gibt, vorausschauend das eigene Lebensende für den Fall zu planen, dass dies einmal aufgrund eigener Urteilsunfähigkeit nicht mehr möglich sein sollte. Nina Streeck betont, dass diese Frage sich ethisch förmlich aufdrängt, aber kaum je explizit thematisiert wird. »Es liegt ein Mantel des Schweigens über diesen Fragen, während sich zugleich der Eindruck aufdrängt, es sei angezeigt, Entscheidungen über das eigene Ableben zu treffen.«69 Denn wer sich weigert, eine solche vorsorgende Planung – zum Beispiel mittels einer Patientenverfügung – vorzunehmen, schiebt die Verantwortung eines allfälligen Entscheiden-Müssens auf Mitmenschen ab: Angehörige, Bevollmächtigte, Ärztinnen, die müssen dann stellvertretend diese unter Umständen schwierige und belastende Aufgabe übernehmen.«70 Und das dürfte doch eine eher problematische Haltung im Umgang mit der Verantwortungspflicht für das eigene Leben und Sterben sein. Die beschriebene Moralisierung des eigenen Sterbens im Zeichen des selbstbestimmten medizinischen Entscheiden-Müssens kann allerdings auch eine problematische Seite haben: Es kann leicht ein Druck auf hochbetagte, multimorbide Patienten entstehen, doch rechtzeitig auf weitere Behandlung zu verzichten und so ihrem »unwürdigen«, »unmenschlichen«, »nicht mehr lebenswerten« Krankheitszustand ein Ende zu bereiten und auf weitere lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten. In Deutschland wurde dafür der Ausdruck des »sozialverträglichen Frühablebens« geprägt (der zum Unwort des Jahres 1998 erklärt wurde). Dem gilt es auf jeden Fall wachsam zu begegnen. Der deutsche Gerontologe Paul B. Baltes, warnt: »Es sollte nicht dazu kommen, dass Einzelpersonen gedrängt werden, ihren Tod einzuleiten oder früher zu sterben, als sie das möchten, gleichzeitig trifft dies aber auch für das Gegenteil zu, das jetzt vorherrschende Erwartungsmuster, was eher zum späten Sterben drängt.«71