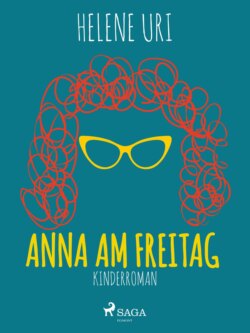Читать книгу Anna am Freitag - Helene Uri - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ich und Anna begegnen einem Wikinger
Оглавление»Hassumanpakroon?«
»Klar kann ich dir gern ein paar Kronen geben«, antwortete Anna überrascht. Sie legte ihr Buch zur Seite. Helle saß zu ihren Füßen auf dem Boden und spielte mit einem Rennauto. Gustav Mahler lag auf Annas Schoß und schnurrte laut, obwohl er Fremde sonst eigentlich nicht leiden konnte. Annas Buch war dick und grau, es hieß »Theoretische Linguistik« und sah ebenso grau und öde aus wie Anna selber. Auf dem Tisch lag die größte Tüte Himbeerbonbons, die ich je gesehen hatte, besonders voll war sie allerdings nicht mehr. Ich blieb in der Wohnzimmertür stehen und wartete auf das Geld. Anna musterte mich lange und ausgiebig. Ich wollte gerade noch einmal um das Geld bitten, als sie sagte: »Übrigens hast du gerade ein wunderbares Beispiel dafür geliefert, warum du und ein Wikinger einander nicht verstehen könntet.«
»Ein Wikinger?«, fragte ich. Ich kapierte überhaupt nichts.
Und dann passierte etwas. Annas Augen leuchteten fast gelb hinter ihren Brillengläsern, ihre großen Ohren glühten und sie murmelte etwas Unverständliches. Dann hörte ich ein scharfes Geräusch und fuhr herum. Neben dem Fernseher stand ein seltsam gekleideter Mann. Er trug einen kurzen Kittel aus dickem Wollstoff. Der Kittel war blau, darunter hatte er ein weißes Hemd. Er trug einen Ledergürtel und seine Hose war ebenfalls aus Leder. Er war barfuß, seine Haare fielen ihm auf die Schultern und unrasiert war er auch. Er sah aus wie ein Rocksänger. Nachdem er Anna lächelnd zugenickt hatte, schaute er mich an und sagte: »Góðan dag. Ek heiti Gunnleikr. Hvé heitir þú?«
Ich starrte den Mann an, brachte aber kein Wort heraus. »Guten Tag, Gunnleikr, nett dich zu sehen«, sagte Anna und zwinkerte mir zu. Sie sprach sehr langsam und betont deutlich, das fiel mir auf. »Das hier sind Björn-Oskar und seine kleine Schwester Helle.«
»Bjørn-Ásgeirr?«, wiederholte Gunnleikr.
»Oskar«, korrigierte Anna. »Aber im Grunde ist es ja der gleiche Name«, sagte sie dann zu sich. Danach schaute sie mich neugierig an und meinte: »Hier hast du deinen Wikinger, Björn-Oskar – verstehst du, was er sagt?«
Ich hatte mich in den Schaukelstuhl fallen lassen und mein Herz hämmerte wie wild. Ich hatte richtig Angst. Anna dagegen saß auf dem Sofa und sah ein wenig gespannt, aber sonst ganz ruhig aus. Sie sollte nicht sehen, dass ich mich fürchtete. Deshalb sagte ich nur:
»Er hat gesagt, wie er heißt, und dann wollte er meinen Namen wissen. Aber wer ist er? Und warum redet er so komisch?«
Anna, die mich fragend angesehen hatte, lächelte jetzt zufrieden und sah fast ein wenig erleichtert aus. »Er spricht Altnordisch, so haben in Nordeuropa die Menschen in der Wikingerzeit und auch später noch geredet«, sagte sie, meine erste Frage beantwortete sie nicht. »Du hörst ja, dass es gar nicht so fremd klingt, aber es gibt doch auch viele Unterschiede. Gunnleikr und ich haben übrigens allerlei zu besprechen. Aber du kannst ja zuhören, vielleicht fallen dir die Unterschiede auf.«
Ich saß im Schaukelstuhl und versuchte zuzuhören, aber alles kam mir so seltsam vor, dass ich mich gar nicht richtig konzentrieren konnte. Wer war Gunnleikr? Wie hatten er und Anna sich kennen gelernt? Und wie war er in unser Wohnzimmer gekommen? Nach einer Weile ging es ein bisschen besser und ich hörte Anna und Gunnleikr zu und versuchte sie zu verstehen. Die beiden hatten wirklich viel zu besprechen, sie redeten laut und lange und eifrig miteinander. Ab und zu lachten sie, dann sahen sie wieder ernst aus. Einmal schauten die beiden zu mir herüber und machten eine Bemerkung. Schließlich wandte Anna sich an mich: »Na, wie sieht’s aus?«
»Das war ziemlich schwierig«, sagte ich nur, obwohl ich eigentlich lieber gefragt hätte, woher Anna und Gunnleikr sich kannten. »Besonders viel habe ich nicht verstanden. Ihr habt so seltsame Geräusche gemacht. Manchmal hat es sich angehört wie gelispelt.«
»Richtig«, sagte Anna. »Wir haben über die Reise hierher gesprochen.«
»Ja, die ist ja sicher ziemlich schnell gegangen«, warf ich dazwischen, aber Anna redete einfach weiter.
»Gunnleikr hat erzählt, dass es unterwegs neblig war. Nebel heißt in seiner Sprache poka, das fängt mit einem Lispeln an. Reisen heißt auf Altnordisch ferða, das ist dasselbe Wort wie fahren, und auch hier gibt es einen Buchstaben, den wir heute nicht mehr haben, nämlich das ð, das klingt ein bisschen wie ein gesummtes d.«
»So wie father im Englischen?« fragte ich, Englisch konnte ich ganz gut.
»Ja, genau«, sagte Anna.
»Ich glaube, ihr habt über mich geredet. Ich habe meinen Namen gehört und dann war noch die Rede von einem Bjarnar.«
»Wir haben eigentlich nur über dich gesprochen«, sagte Anna lächelnd. »Weißt du, im Altnordischen gibt es Fälle oder Kasus. Das bedeutet, dass ein Wort sich verändert, es kommt darauf an, mit welchen anderen Wörtern es in unmittelbarer Nachbarschaft steht. Der erste deiner beiden Namen ist so ein Beispiel. ›Ich heiße Björn‹ klingt ziemlich ähnlich, nämlich: ›Ek heiti Bjørn.‹ Aber wenn Gunnleikr sagen will: ›Anna ging zu Björn‹, dann wird das zu ›Anna gekk til Bjarnar‹. Und noch komischer klingt ›Wir gaben Björn Brot‹, dann heißt du nämlich plötzlich ›Birni‹, nicht wahr, Gunnleikr? Sag bitte mal ›Wir gaben Björn Brot‹.«
»Vér gáfum Birni brauð«, sagte Gunnleikr.
»Himmel«, sagte ich, »das klingt ja kompliziert. Wie konnten die Leute denn diese Fälle auseinander halten? Wie kann Gunnleikr sich das alles merken?«
Anna und Gunnleikr lächelten und Anna sagte: »Tja. Ich muss ja zugeben, dass ich mir ein etwas ausgefallenes Beispiel ausgesucht habe. Die meisten altnordischen Wörter haben sich nicht so sehr verändert wie Bjørn. Aber ich glaube sowieso, dass keine Sprache schwierig ist für die, die sie als Muttersprache gelernt haben. Gunnleikr schüttelt deshalb alle Fälle nur so aus dem Ärmel, nicht wahr, Gunnleikr?«
Gunnleikr war zum Telefon gegangen und hielt den Hörer in der Hand. Er starrte die Sprechmuschel an, dann legte er den Hörer wieder auf die Gabel und betastete die Leitung. Er blickte zerstreut zu Anna herüber und fragte: »Hvat?«
Ich war nicht sicher, ob Gunnleikr Annas Frage verstanden hatte. Das wollte ich Anna schon sagen, aber in diesem Moment klingelte das Telefon. Gunnleikr fuhr zusammen und rief: »Háva Valholl!«
Anna und ich mussten losprusten. Das Telefon klingelte weiter. Und Gunnleikr sagte leise: »Hjalpi mér Óðinn, Þórr ok allar vættir!«
Anna, die dicht bei ihm stand, nahm ab. »Da fragt ein Tom nach dir, Björn-Oskar«, sagte Anna. Sie hatte ihre Hand über die Sprechmuschel gelegt. Ich schüttelte den Kopf, sagte aber nichts.
»Nein, der scheint noch nicht hier zu sein«, sprach Anna ins Telefon. »Doch, ich sage ihm Bescheid, wenn er auftaucht.« Sie schwieg eine Weile und sagte schließlich: »Ich bin die Babysitterin.« Dann legte sie auf.
»Ich soll dir ausrichten, dass Tom und noch ein paar andere, ich habe mir nicht alle Namen gemerkt, nicht mehr warten wollen und jetzt Fußball spielen gehen.«
Ich nickte und wollte eigentlich losstürzen, doch Anna redete gleich weiter: »Viele Sprachen haben so ein Kasus-System. Die Finnen haben sogar fünfzehn Fälle. Im Deutschen gibt es vier. Finnisch ist übrigens keine indogermanische Sprache wie Norwegisch oder Deutsch. Andere nichtindogermanische Sprachen, die in Europa gesprochen werden, sind Samisch, Ungarisch und Baskisch. Aber weder Deutsche noch Finnen haben damit Probleme. Aber für Norweger oder Schweden, die nicht an Fälle gewöhnt sind, ist es sehr schwer, eine Sprache wie Finnisch zu lernen. Weißt du übrigens, was Ausländer, die unsere Sprache lernen, daran schwierig finden?«
»Nein, doch, sicher die Sache mit den Geschlechtern. Ob es der Schaukelstuhl oder die Schaukelstuhl oder das Schaukelstuhl heißt, und so.«
»Ganz genau, auch die Präpositionen sind für viele ein Problem. Warum heißt es, wir fahren nach Italien, aber in die Schweiz?«
»So schwierig kann das doch nicht sein!«
»Nein, da hast du’s ja. Ebenso wenig war es für die Wikinger ein Problem, die verschiedenen Fälle deines Namens auseinander zu halten.«
»Ich kapiere noch immer nicht, wozu sie diese Fälle gebraucht haben.«
»Vielleicht verstehst du das besser, wenn ich dir zwei Mini-Mini-Mikro-Kriminalgeschichten erzähle. Sie sind ganz gleich, nur gibt es jedes Mal einen anderen Mörder. Ich erzähle sie zuerst in der heutigen Sprache. Die eine geht so: Kongen drepte hesten – König tötete Pferd. Und die andere: Hesten drepte kongen – Pferd tötete König. Die Reihenfolge der Wörter zeigt, wer wen tötet. Richtig?«
»Klar doch«, sagte ich und dachte im Stillen, dass ein Fernsehkrimi ja doch spannender wäre. Fußball übrigens auch. Tom und die anderen standen jetzt garantiert nicht mehr beim Kiosk. Sie spielten Fußball. Vielleicht war Anniken auch dabei.
»Aber im Altnordischen war die Reihenfolge nicht so wichtig, da ist nämlich auf jeden Fall klar, wer der Mörder ist«, erzählte Anna eifrig weiter, während sie ihre Mini-Mini-Mikro-Kriminalgeschichten auf Altnordisch aufschrieb. Gunnleikr warf seine langen Haare zurück und schien sich zu langweilen. Er bückte sich und redete leise mit Helle. Helle nahm das Rennauto aus dem Mund und gab es Gunnleikr, der es sich ganz genau ansah.
1 Hestr drap konung.
2 Konung drap hestr.
3 Konung drap hest.
4 Hest drap konungr.
»Drap?«, fragte ich, nachdem ich den Zettel gelesen hatte. »Auf Altnordisch hieß es also drap und nicht wie im Norwegischen drepte?«
»Ja«, sagte Anna, »richtig, die Sprache entwickelt sich weiter. In einigen Jahren werden wir wahrscheinlich auch les und ess sagen statt lies und iss.«
»Ja, ich sage immer ›jeg skjærte brødet‹, ich habe das Brot geschneidet, und Tom und die anderen tun das auch. Aber Jonas, unser Lehrer, lässt uns das nicht schreiben. Und meine Mutter ärgert sich sogar, wenn ich es sage. Jonas sagt übrigens auch immer, wir sollen nicht ›ich und Tom‹ schreiben, das sei unhöflich. Er sagt, es heiße ›Tom und ich‹.«
Anna lächelte kurz. »Gefällt dir der Norwegischunterricht?«, fragte sie.
Ich nickte und sagte: »Haben wir jetzt eigentlich vier Mini-Mini-Mikro-Geschichten?«
»Nein, wir haben immer noch zwei. Die beiden ersten Sätze bedeuten dasselbe, nämlich: Das Pferd tötete den König. Die beiden anderen bedeuten: Der König tötete das Pferd. Wir sehen an den Wörtern, wer wen umgebracht hat.«
»Das sind also die Fälle?«, fragte ich.
»Genau. Die Reihenfolge der Wörter spielt im Altnordischen keine Rolle. Das Norwegisch, das wir heute sprechen, kennt keine Fälle, deshalb müssen wir die Wörter an die richtige Stelle setzen, wenn wir wissen wollen, wer der Mörder ist. Und ...«
Ich fiel ihr ins Wort und sagte: »Zwei Dinge wüsste ich gern. Erstens: Vorhin hast du gesagt, einer der Gründe, aus denen es mir schwer fallen würde, Altnordisch zu lernen, wäre, dass ich Geld von dir leihen wollte. Und zweitens: Wieso sind die Fälle verschwunden – schließlich benutzen wir sie nicht mehr?«
Anna nahm die Brille ab und zum ersten Mal konnte ich ihre Augen richtig sehen. Sie waren fast gelb und sie waren traurig und froh zugleich. Anna hauchte ihre Brille an und wischte sie dann mit einem Taschentuch ab, ehe sie sie wieder aufsetzte. Dann steckte sie sich ein Himbeerbonbon in den Mund und sagte: »Die beiden Fragen hängen zusammen. Nehmen wir die zweite zuerst. Ja, die Fälle sind verschwunden. Es war mitunter zu schwierig den Überblick zu behalten, weil viele Formen sich ähnlich anhörten. Das ist jedenfalls eine Erklärung für diese Entwicklung.«
»Wieso waren sie sich denn so ähnlich?«, fragte ich ein wenig ungeduldig.
»Moment noch. In vielen Fällen bestand der Unterschied zwischen zwei Fällen nur aus einem kleinen Laut. Mit der Zeit wurden diese kleinen Unterschiede immer kleiner, bis sie schließlich gar nicht mehr vorhanden waren. Aber da die Fälle ja nicht nur zur Zierde dienten, mussten die Menschen eine andere Möglichkeit finden, um das, was sie sagen wollten, auch ausdrücken zu können.« Anna reichte mir den Zettel mit den altnordischen Mini-Mini-Mikro-Kriminalgeschichten.
1 Hest drap konung.
2 Konung drap hest.
3 Konung drap hest.
4 Hest drap konung.
Anna hatte in einigen Wörtern den letzten Buchstaben durchgestrichen. »Siehst du, dass jetzt der erste und der letzte Satz dasselbe bedeuten? Und die beiden in der Mitte auch.«
»Aber was hat denn nun die Unterschiede zwischen den einzelnen Fällen zum Verschwinden gebracht? Und was hat das damit zu tun, dass ich Geld von dir leihen wollte?«, langsam hatte ich Annas Kriminalgeschichten satt und wäre lieber losgegangen, um Tom und die anderen zu suchen. Vielleicht spielten sie ja gerade Fußball. Und vielleicht waren Anniken und Karin auch dabei. Anniken ist übrigens eine ziemlich gute Fußballspielerin. Inzwischen begann ich in meiner dicken Jacke zu schwitzen, aber ausziehen wollte ich sie nicht.
»Ich meinte nicht, was du gesagt hast, sondern wie du es gesagt hast«, war Annas Antwort. »Du hast so schnell gesprochen, dass du die Hälfte aller Laute verschluckt hast. Du hast mich gefragt: ›Hassumanpakroon?‹ Wenn du langsam und deutlich gesprochen hättest, hätte es sich ungefähr so angehört: Hast du mal ein paar Kronen? Was ich damit sagen will: Die Sprache, die wir heute sprechen, ist in vieler Hinsicht eine Schnellfassung, bei der manche Laute verschwunden sind. Altnordisch dagegen ist die langsame Fassung.«
Ich war nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden hatte, aber ich war inzwischen auch ziemlich müde vom vielen Zuhören. Als Anna verstummte, drehte Gunnleikr sich zu uns um und begann mit leiser Stimme zu sprechen. Anna sagte nichts. Gunnleikr redete weiter, es hörte sich ziemlich ernst an. Anna gab noch immer keine Antwort, aber jetzt sah sie wütend und traurig aus. Schließlich sagte sie: »Gunnleikr muss jetzt bald wieder nach Hause. Möchtest du ihn vor seinem Aufbruch noch etwas fragen?«
»Ja«, sagte ich. »Eines wüsste ich wirklich gerne. Kannst du singen?«, fragte ich Gunnleikr, und zwar so langsam, wie ich nur konnte, er sollte doch alles verstehen.
»Ek kan syngja, já«, antwortete Gunnleikr.
»Rock?«, fragte ich.
»Rokkr?«, wiederholte Gunnleikr, Þat er fyrir konur.«
»Gunnleikr denkt, du redest von einem Spinnrocken, Björn-Oskar, und offenbar glaubt er, das sei nur etwas für Frauen«, lachte Anna, dann erklärte sie mir, was ein Spinnrocken überhaupt war. Ich musste zugeben, dass ich von solchem Wollkram keine Ahnung hatte.
»So was macht doch heute kein Mensch mehr«, sagte ich zu meiner Verteidigung.
»Nein, heute spinnen wir unsere Wolle nicht mehr selber. Gunnleikr weiß viele Wörter für Dinge, die wir nicht kennen, weil sie nicht mehr benutzt werden. Und wir wissen viele Wörter, die die Wikinger nicht verstanden hätten, ganz einfach, weil es die Dinge noch nicht gab: Küchenmixer, Pizza, Gangschaltung, Rollo. Und Telefon.«
Wir schauten zu Gunnleikr hinüber, der wieder den Telefonhörer in der Hand hielt und verwirrt in die Sprechmuschel schaute.
»Und Rock natürlich«, fügte Anna hinzu und kicherte.
Helle wurde jetzt auch ein wenig ungeduldig, sie krabbelte auf mich zu und wollte auf meinen Schoß. Ich hörte hinter mir ein Geräusch, und als ich mich umdrehte, glaubte ich ein rotes Glühen zu sehen. Gunnleikr war verschwunden, der Telefonhörer lag noch immer neben dem Telefon. Ich fand, dass es ein klein wenig angebrannt roch. Gustav Mahler kroch unter das Sofa.
»Was ist passiert?«, fragte ich. »Anna, woher kennst du Gunnleikr?«
Anna gab keine Antwort, sie beugte sich vor und nahm sich ein Himbeerbonbon aus der riesigen Tüte auf dem Tisch. Wir schwiegen eine Weile. Ich dachte an alles, was ich Gunnleikr gerne gefragt hätte. Ich war so blöd gewesen. Da war mir nun ein waschechter Wikinger über den Weg gelaufen und wir hatten nur über Fälle gesprochen! Und wie um alles in der Welt hatte Anna hier plötzlich einen Wikinger auftauchen lassen? Ich schaute wieder zu ihr hinüber. Nein, es hatte sicher keinen Zweck, sie noch einmal danach zu fragen. Aber ich wollte es herausfinden.
»Was machst du eigentlich, wenn du nicht auf Helle aufpasst?«, fragte ich sie.
»Ich studiere«, antwortete Anna mit eifrigem Tonfall. »Ein Fach, das Linguistik heißt.«
»Das klingt aber nicht sehr spannend«, sagte ich und schaute zu dem dicken grauen Buch hinüber.
»Ist es aber! Linguistik ist ein anderes Wort für Sprachwissenschaft. Wir studieren unterschiedliche Sprachen. Wir sehen, wie Sprachen aufgebaut sind, wie sie sich im Laufe der Zeit verändern und noch vieles andere. Was wir hier in der letzten Stunde gemacht haben, war auch Sprachwissenschaft. Und das hat doch Spaß gemacht, oder?«, fragte Anna und wurde wieder ein wenig rot.
»Ja, das war nicht schlecht«, gab ich zu und fragte mich, ob zur Sprachwissenschaft immer Wikinger gehören, die aussehen wie Rocksänger, aber gar keine sind.
Als ich endlich zum Kiosk kam, war natürlich kein Mensch mehr da, und auf dem Fußballplatz waren sie auch nicht.