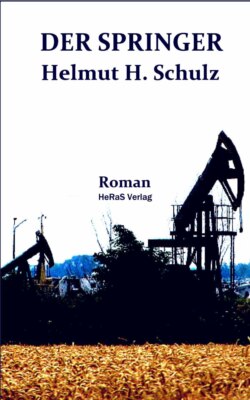Читать книгу Der Springer - Helmut H. Schulz - Страница 3
Erstes Kapitel
ОглавлениеJäger wollten ihn beobachtet haben. Er lenkte, so berichteten sie, seinen Wagen auf das Feld, stieg aber nicht sofort aus. Des Herbstnebels wegen wären sie, die Jäger, nicht zum Schuss gekommen, obschon ihre Hunde genügend Wild aufgespürt hätten. Wie ein Bauer oder Arbeiter habe der Fremde nicht ausgesehen, eher wie ein Angestellter in Stadtanzug und Krawatte. Zwar habe der Nebel alles grau gefärbt, das Bruch sei an diesem Tage wie der Ton einer Oboe gewesen, dumpf und klagend, dennoch habe sich der Fremde gut erkennen lassen. Barhäuptig lief er ein paar Schritte geradeaus und geriet, wie sie annahmen, in eines der Wasserlöcher. So habe sich seine Unkenntnis des Bruches erwiesen. Kurz darauf ging der Fremde zurück zum Wagen, und es geschah etwas Merkwürdiges. Er begann sich umzuziehen. Stück für Stück seines Stadtanzuges legte er ab, stand schließlich nur noch in Hemd und Unterhosen da. Aus seinem Wagen, einer Kombi-Limousine, habe er, wie sie mit dem Glas beobachtet hätten, Cordhosen und eine Strickjacke geholt, auch Gummistiefel. Zuletzt habe er einen langen Schafpelz angezogen und eine lederne Mütze aufgesetzt, eine Mütze von eigenartiger Form, wie sie früher vielleicht von Bergleuten getragen worden sei, wenn sie auch nicht wüssten, welche besonderen Mützen Bergleute tragen würden. Für einen Pelz sei es längst nicht kalt genug gewesen. Die Verwandlung des Fremden von einem Angestellten in einen Bauern oder Arbeiter vor ihren Augen, das sei ihnen doch seltsam vorgekommen.
Wie jemand, der einen Acker oder einen Schlag Wald in Besitz nimmt, sei der Fremde später hin und her gegangen, mit beiden Händen habe er Linien in den Nebel gezeichnet, so als arbeite er an einem Entwurf für die Veränderung des Bruches. Noch später habe der Fremde mit einem Handbeil Holz geschlagen und nicht ohne Mühe ein Feuer entfacht, durchaus sachgerecht, aus Zeitungspapier und trockener Birkenrinde. Erst habe das Feuer mehr gequalmt als gebrannt, bei der Nässe des Holzes nur zu begreiflich. Schließlich aber standen die Flammen orangerot in dem Grau, eine schrill klingende Flöte. Vor dem Feuer habe sich der Fremde niedergehockt, so die Jäger, um in Papieren zu blättern und darin zu schreiben. Das würde ihnen den Gedanken nahegelegt haben, er sei ein Feldvermesser. Mehrere Stunden lang hätten sie das Treiben des Fremden im Bruch beobachtet. Ohne das Feuer zu löschen, sei er wieder weggefahren.
Auf dem Rückweg ins Dorf hätten sie dann den Wagen vor dem Krug gesehen, dem Anschein nach ein neues Auto, aber schon mit Rostflecken, und tatsächlich habe der Fremde auch in der Gaststube am Tisch gesessen und zerstreut gegessen. Den Fremden schätzten sie zwischen vierzig und fünfzig, eher an fünfzig. Sein Haar sei schon grau gewesen. An seinen Händen wollten sie erkannt haben, dass er früher schwere Arbeit verrichtet habe. Wie Kupfer sei ihnen die Haut seines Gesichtes erschienen, die Wangen seien eingefallen und die Kinnpartie fest gewesen. Auch die Farbe seiner Augen sei ihnen aufgefallen, getriebenes Silber, so hell. Kurz gesagt, habe die Erscheinung des Fremden einen starken Eindruck hinterlassen, obschon keiner von ihnen mit ihm zu tun haben wollte, zumindest nicht im Bösen.
Den Wirt habe er nach der Größe des Dorfes, nach Fahrverbindungen und dergleichen gefragt, alles sehr laut, nach der Art von Freiluftarbeitern, und kurz angebunden. Seine Stimme habe geklungen wie Steine, die eine Halde herabrollen, genau so habe seine Stimme geklungen. Nach dem Essen und dem Gerede habe er Münzen aus einer abgegriffenen Geldbörse auf den Tisch gelegt. Zuletzt sei er weggefahren. Niemand habe etwas mit dem Fremden anzufangen gewusst.
Für Wochen hätte das Bruch dann wieder ihnen gehört, bis die Zeit der Treibjagden begonnen hätte. Nur der Jäger kenne dieses Gefühl des Gespannt seins, die Büchse halb im Anschlag, den Treibern folgend. Sicher gäbe es hunderte Arten von Spannung, aber den raschen Wechsel von Erfolg und Enttäuschung böte nur die Jagd.
Um diese Zeit sei der Fremde wieder aufgetaucht. Sie, die Jäger, hätten von der Forstverwaltung den Auftrag bekommen, eine ziemlich große Fläche freizuschlagen, gegen Lohn, den der Fremde gezahlt habe. Ihnen seien Hauarbeiter gefolgt, die Lagerräume und ein Maschinenhaus errichtet hätten. Abschließend sei mit den Wohnwagen dieses stählerne Ungetüm auf das Feld gestellt worden. In rollender Schicht hätten nun Maschinen gedröhnt. Mit der Jagd in ihrem Bruch sei es aus und vorbei gewesen.
Flüchtig hätten sie den Fremden später auch kennengelernt, einen grauhaarigen Fünfziger, ohne Spur von Humor oder Gemütlichkeit, ein Nichttrinker und Nichtraucher, scharf wie rostiges Eisen. Dieser Fremde scheine viele Wandlungen durchgemacht zu haben und doch immer derselbe geblieben zu sein.
Das gebe es. Auch der Jäger verändere sich oft. Zu Anfang würde er, vom Jagdfieber gepackt, ungenau schießen, Fehler machen. Dann würde er ruhiger werden. Ganz alte und erfahrene Jäger behielten sogar einen Schuss im Lauf, wenn sie irgendwas störe, das Verhalten des Wildes, das Wetter, das Licht. Solche Jäger verachteten unberechneten Erfolg, Geduld zeichne sie aus. Ein zutreffendes Urteil über den Fremden könnten sie, die Jäger, aber nicht abgeben, obwohl sie die Neugier plage, wer dieser Fremde nun eigentlich gewesen sei. Er reise seit vielen Jahren, stelle Bohrtürme auf, greife in den Schoß der Erde; mehr wüssten sie im Grunde genommen auch heute nicht von diesem Gnievotta ...
Die ihn kannten, beurteilten ihn meistens falsch. Er galt manchem als Draufgänger, riskierte mitunter viel, ungern, wie Katja, seine Frau, glaubte, er war kein Spider, nichts weniger als ein Spieler. Allerdings suchte er nach Gelegenheiten, Freunde zu gewinnen, und sei es am Spieltisch; jedoch rührte er wiederum wochenlang keine Karten an, setzte sich an kein Schachbrett, vergaß Würfel und Becher. Zugegeben, er trank, wenn es sich ergab. Eigentlich brauchte er keinen Anlass. Dennoch war er kein Trinker.
In der wärmeren Jahreszeit trug er stets das gleiche Zeug, buntgemustertes Hemd und erdbraune Cordhosen, eine abgetragene Anzugjacke, Gummizeug bei Regen und den weißen Helm, Vorschrift und Gewohnheit. Kam die Zeit niedriger Temperaturen, zog er eine Strickjacke unter das alte Jackett, in dessen oberer, für ein weißes Tuch bestimmter Tasche Zigaretten steckten. Dann trug er auch Filzstiefel. Er roch nach Schweiß, nach Tabak und Öl, den wilden unbestimmbaren Geruch mobiler Städte brachte er mit.
Urteile gab es viele über ihn, aber Katja war sicher, dass sie allesamt nicht zutrafen. Sie besaß Bilder von Gnievotta, Bilder, die sie leicht hervorrufen konnte: Gnievotta im Rund der Wagenstadt, Griff zur oberen Tasche nach Zigaretten und Lunte, Schnipsen mit dem Zeigefinger gegen die Schachtel, Aufflammen des Feuerzeuges. Gnievotta zur Baustelle gehend, rauchend, die Hände in den Taschen der Cordhose. Gnievotta bei gewöhnlichen Verrichtungen, die Art, wie er trinkt, Schnaps mit einem Ruck, Bier in langen Schlucken, die Art, wie er ein Buch aufschlägt, bedächtig, mit einem komisch anmutenden feierlichen Respekt für Gedrucktes, wie er die Lesebrille aufsetzt, die Bügel erst auf das eine, dann auf das andere Ohr schiebt, wie er Karten mischt, schnell und geübt, wie er Schachfiguren rückt, zögernd, seines Zuges nicht sicher.
Bei längerer Abwesenheit Gnievottas, was häufig vorkam, schrieb sie ihm lange Briefe, hielt ihm Reden oder teilte ihm Neuigkeiten mit. Antwort bekam und erwartete sie nicht. Ihre Vorstellungskraft, diese Briefe und gelegentliche Telefonanrufe halfen ihr, Trennungszeiten zu überbrücken.
An ihrem Arbeitsplatz, sie arbeitete als technischer Zeichner im Konstruktionsbüro eines Berliner Maschinenbaubetriebes, bot sie den Anblick einer ruhigen und gewissenhaften Frau. Unauffällig bestimmte sie selber das Maß ihrer Anstrengungen. Sigalla, ihr Abteilungsleiter, schätzte sie als ruhenden Pol des Büros.
Jetzt las sie eine Zeichnung, Linien, Kreise, Ellipsen, deren Ganzes ein System von Zahnrädern darstellte, den Entwurf des Getriebes einer Werkzeugmaschine, auf mattglänzendem Transparentpapier, eine Ingenieurarbeit, nicht ihre. Sie stellte sich vor, dass Gnievotta, auf einem staubigen Platz stehend, ihren Brief in der Hand hielt, den Helm ins Genick geschoben. Vielleicht war Koschinski bei ihm oder der kleine Lawretzki. Sie kannte beide aus einer anderen, der Senftenberger Zeit, die viele Jahre zurücklag.
Damals war Katja mal mit Kosch das Revier abgefahren. Im Winter oder gegen Ende des Winters. Gnievotta studierte noch in Freiberg, Lawretzki - oder Laski, wie ihn seine Freunde nannten - war Fördermaschinist und Koschinski Sicherheitssteiger. Kosch steuerte einen Kohlezug durch den abgesoffenen Tagebau; riesige Wasserlachen, unter denen sich Gleisanlagen verbargen, tauender, schwarzgesprenkelter Schnee zwischen den Schienen. Links und rechts erhob sich die nackte Haldenlandschaft, öde, vegetationslos, gezackt, grauschwarz, mit Masten und Leitungen bestückt. Zwischen Koschs grauen Lippen brannte ein Zigarillo. Kosch, während er den Triebwagen vorsichtig in die Schmelzwasserlachen hineinlenkte, zeigte ihr die Stelle, wo neulich ein Zug abgestürzt war. Sie legte beide Hände um irgendeinen Griff, lehnte ihren Rücken an Koschs Schulter, eine junge Frau damals noch und geängstigt während der Fahrt durch die Krater der Grube. Solange Kosch rauchte, war überhaupt keine Gefahr. Kosch hielt dauernd das Mundstück des Zigarillos zwischen den tabakschwarzen Zähnen, und Gnievotta paffte endlos Zigaretten. Laskis Pfeife qualmte von Schichtbeginn bis Schichtende. Einen Mann konnte man am ehesten nach der Art beurteilen, wie er seinen Tabak anzündete oder ein Buch aufschlug, vorausgesetzt er rauchte und schlug ein Buch auf.
Katja las viel, wenn sie auch selten Bücher kaufte. Romane lieh sie aus der Gewerkschaftsbibliothek. Mit der Bibliothekarin verband sie so etwas wie Freundschaft. Beide Frauen nötigten einander Urteile über Bücher ab. Die Bibliothekarin war überzeugt, dass Frauen von der Art Katjas ihre besten Kundinnen seien. Mit Vorliebe erledigte Katja ihre Anrufe in der Bibliothek, wo sie, ihrer Freundschaft mit der Bibliothekarin gewiss, ungestört Dauergespräche führen durfte, wenn Gnievotta auf dem Bohrfeld festgehalten wurde.
Katja meldete sich für eine Stunde bei Sigalla ab, ging hinunter zu der winterfesten Bibliotheksbaracke, ließ sich auf einen Stuhl nieder und musterte die Buchrücken in den Regalen. Die Bibliothekarin empfahl ihr einen dünnen Erzählungsband, neu hereingekommen. Katja liebte jedoch die dickleibigen Wälzer, die breit ausgemalten Situationen.
«Schön», sagte sie zustimmend, «nehm ich mit. Lass mich mal telefonieren.»
Sie klingelte Kosch aus dem Vormittagsschlaf, Kosch hatte Telefonwache im Geschäftswagen und schlief ein bisschen zwischen den Gesprächen, die er für Gnievotta entgegennahm, wenn der unterwegs war.
«Es tut mir leid, Kosch», sagte sie.
«No, lass gutt sein», sagte Kosch, durchaus nicht ungehalten.
Bereitwillig erzählte er von der Arbeit, und das weckte ihre Aufmerksamkeit. Draußen herrsche eine blödsinnige Hitze. Was noch fehle, sei die Havarie oder sonst ein Unheil. Laski, die alte Unke, habe es schon vorhergesagt. Laski fühle das, es käme demnach todsicher.
«Dann kommt es auch», sagte Katja, Kosch bestätigend, sagte es ohne rechte Überzeugung, denn Laski unkte dauernd. Nur hin und wieder trafen seine Vorhersagen ein. Gerade die blieben natürlich im Gedächtnis.
Gnievotta, falls sie ihn sprechen wolle, sei nicht da. Jedenfalls habe er heute früh gesagt, er werde in die Stadt fahren, um dies und das zu besorgen, Getränke, auch Bier und Schnaps, die Hitze sei unerträglich geworden, der Verbrauch gestiegen. Er, Kosch, wisse nicht, ob Gnievotta schon zurück oder aber noch gar nicht weg sei, aber er würde sich gern mal erkundigen. Es mache ihm absolut nichts aus, zumal er zum Bohrfeld raus müsse. Übrigens habe der Scheich Nowacki früh mit Gnievotta telefoniert.
«Wenn Gnievotta zurück ist», sagte Katja, «soll er sich hier melden.»
Im August ließ das Wetter viel zu wünschen übrig.
Es lässt stets zu wünschen übrig, das Wetter, ewiges Thema unter Freiluftarbeitern. Wenn Gnievotta sagt: Ich fahre in die Stadt, dann denkt er an keine besondere Stadt. Zu viele dieser kleinen Städte kennt er, ihre geraden oder gekrümmten Hauptstraßen mit Geschäften, Postämtern, Märkten; Städte, die nach Ladenschluss wie ausgestorben scheinen, wären nicht die blauen Reflexe der Bildröhren hinter den niedrigen Fenstern zur Straße, die abendliche Flucht in die Illusion.
Nowacki hatte angerufen, der Freund, Schwager und halbe Vorgesetzte, der es fertigbrächte, den Weltuntergang zu versäumen, weil dieser nicht in seinem Terminkalender steht. Gnievotta versuchte sich Nowacki vorzustellen, während er der Stimme des Schwagers lauschte. Sie klang leise, aber deutlich. Nowacki rief von Berlin aus an, von zu Hause, über rund zweihundert Kilometer Luftlinie hinweg bis in die Altmark. Nowacki trug vermutlich einen seiner dunkelgrauen Anzüge, obwohl die Stadt unter heißem Staub zu ersticken drohte. Sein Kinnbart war kurz geschnitten, die Ecken sorgfältig ausrasiert.
Die Gewitterfront bewege sich in ihre Richtung, hatte Nowacki gesagt, sie sei von orkanartigen Stürmen begleitet, ein Wechsel in der Großwetterlage noch nicht abzusehen. Ob ihre Anlagen standhalten würden? Ob Gnievotta eventuell Hilfe brauche? Welche? Wie? Man müsse auf alles vorbereitet sein.
Nowacki zählt zu den Leuten, auf die immer Verlass ist. Laski ist anders und Kosch auch. Sie sind auf ihre Art verlässlich, aber sie sehen wenig im Voraus, von Laskis Ahnungen abgesehen. Kosch sowohl als auch Laski brauchen den Augenblick, der sie zum Handeln veranlasst. Dann tun sie das Notwendige, schnell, energisch, ohne sich zu schonen.
Es mochte gegen neun Uhr gewesen sein, als der Anruf durchkam. Von einer Gewitterfront spürten sie nichts. Ihr Himmel war wie geschmiedetes Kobalt, glutflüssiges Blau überm Turm. Gnievotta fuhr zur Anlage. Laski hatte Schicht. Auch ein paar Freischichten, die eigentlich hier nichts zu suchen hatten, hielten sich am Turm auf. Schweiß ätzte die nackten Rücken der Leute, deren Hände dicke Handschuhe schützten; unter weißen Helmen sah nasses Haar hervor.
Laski kaute auf seiner Pfeife. Er habe keine Zeit für ihn, sagte er zu Gnievotta, das kommende Unheil könne er förmlich riechen. Überhaupt gehe er in die Kohle zurück, wo man nach Schichtschluss was Greifbares abrechnen könne, Kohle nämlich, die gebraucht werde. Noch diese Bohrung hier, dann haue er in den Sack, nach ihm die Sintflut, sie könnten ihm alle.
Gnievotta nickte. Es war Laskis altes Lied. Seit Jahren ging dieser Laski in die Kohle zurück.
Gnievotta musterte den glatten wolkenlosen Himmel. Hinten verlor sich ein Streifen Wald in einem dunstigen Schleier über dem Horizont. Zeichen für ein Unwetter gab es nicht.
«Natürlich, Laski», sagte Gnievotta, «gehst du in die Kohle zurück, bloß noch diese Bohrung und noch ein paar anderer, ich weiß, ist mir klar.»
Ja, bestätigte Laski, und diesmal sei es nicht nur so dahingesagt, wie Gnievotta vielleicht annehme. Auch an seine Frau, an Berta, müsse er mal wieder denken.
Dann erschien Kosch und sagte, Katja habe angerufen, er solle sich melden.
Gnievotta winkte ab. Er fahre jetzt in die Stadt, sagte er, verärgert über das Wetter und über die Arbeit, die nicht vorankam.
Kosch ließ sich im Lager absetzen.
Gnievotta ritt den Jeep über staubige Straßen mit breiten Radspuren. Nach Regentagen waren die Wege aufgeweicht, dann arbeiteten sich ihre schweren Fahrzeuge bis auf den Lehmgrund durch. Während Gnievotta fuhr, dachte er an Nowacki. Er dachte auch an Kasch und an Laski, der das alles satt hatte. Es war, als habe Gnievotta eine Schuld an Nowacki abzutragen, etwas, was lange zurücklag und sich nur unklar bestimmen ließ. Am deutlichsten stand Gnievotta noch die Stimmung jenes Apriltages fünfundvierzig vor Augen: Ein trüber, kühler Morgen, träge zwängte sich die Spree zwischen hohen Ufermauern. Damals hatte sich Nowacki als entschlossen erwiesen, hatte ihnen, Gnievotta und Angermann, zu einer neuen Einsicht verholfen, zu der, dass nach diesem Krieg ihre Zeit begänne. Ein ungerechtfertigter Optimismus, denn dem damals dreiundzwanzigjährigen Nowacki ging es dreckig. Selbst Angermann, der heute Chemiker, Pflanzenphysiologe und wer weiß was noch ist, musste hinter Nowacki zurücktreten.
Von Schuld konnte keine Rede sein, dann hätte sich Gnievotta auch Kasch oder Laski gegenüber verpflichtet fühlen müssen oder sonst wem, dem er eine Erkenntnis verdankte, eine geöffnete Tür, den Anstoß für eine Unternehmung. Also nicht Schuld, sondern ein Gefühl der Unterlegenheit?
Über Stendal erhoben sich, schon von Weitem sichtbar, die Kirchtürme des Domes und der Stiftskirche. Die Letztere schien bloß die Ältere, ihrem Zustand nach, mindestens aber war sie die Vornehmere. Ein paar Krautjunker oder reiche Bürger mochten sie einst gebaut haben. Später kamen vielleicht noch andere Kirchen hinzu, überflüssig, damals wie heute, aber sie behaupteten ihren Platz, verlangten Achtung vor ihrem ehrwürdigen Alter und noch mehr Mittel zu ihrer Erhaltung. Auf einem Platz stand ein steinerner Engel über einem tauben Brunnen, in dem Abfälle lagen. Baudenkmäler waren Gnievotta ziemlich gleichgültig. Er holte die Post, kaufte Zeitungen, Tabak, Zigarillos und Zigaretten, einige Flaschen Kornbrand, Doppelkorn, auf dessen Güte sein Trupp derzeit schwor, einige Kästen Bier. Reichlich Zeit ließ er sich, aß spät zu Mittag in einer Kneipe am Rathaus.
Dann fuhr er zurück. Den Jeep parkte er auf einer Anhöhe.
Er war dem Bohrfeld schon so nahe, dass er den Maschinenlärm hören konnte. Die Geräusche störten ihn nicht, im Gegenteil, hätten sie gefehlt, würde er vielleicht weitergefahren sein. Mit dem Rücken lehnte er gegen das heiße Metall der Karosserie und öffnete eine der Flaschen. Sachte ließ er sich zu Boden gleiten, in den Schatten des Wagens. Der warme Schnaps schmeckte abgestanden, schal, aber Gnievotta trank ihn in langsamen Schlucken.
Zwei Briefe fand er in der Post, den einen von seiner Mutter, den anderen von Katja. Er riss beide Umschläge zugleich auf und begann den kürzeren der Briefe zu lesen, den von seiner Mutter. Sie schrieb, dass sie anbauen werde, und der Sohn solle sich mal wieder blicken lassen in Altefähr. Wörtlich schrieb sie: Die Kirschen waren reif, aber niemand kam sie ernten. Das klang nach Vorwurf. Wahrscheinlich enthielt auch der andere Brief Vorwürfe. Er war ziemlich lang, und Gnievotta las ein paar Klagen Katjas über das Verhalten der Kinder. Es gebe Schwierigkeiten mit Bodo, aber auch mit Elke, schrieb Katja, schrieb es mit den sauberen kleinen Buchstaben, die auf technischen Zeichnungen zu sehen sind. Gnievotta seufzte verdrossen und schob die Briefe in die Umschläge zurück.
Die Sonne stand schon niedrig über dem Wald streifen, als er sich entschloss, weiterzufahren. Ihr schräg einfallendes Licht färbte das trockene Gras zinnoberrot, es war ein überraschender Farbklang. Eine Lerche hielt sich sehr hoch überm Feld; ein zappelnder Käfer an einem dünnen, nicht sichtbaren Faden. Die Hitze hatte sich noch gesteigert. Jetzt gab der Boden die über den Tag gespeicherte Wärme wieder ab.
Auf dem Weg, der von hohen Pappeln gesäumt war, kamen Gnievotta die rückkehrenden Fahrzeuge entgegen, Geländewagen, Laster, Motorräder, Mopeds. Es lohnte nicht mehr, aufs Feld hinauszufahren, zum Schichtwechsel käme er doch zu spät. Gnievotta wendete und setzte sich mit dem Jeep an die Spitze der Kolonne, die langsam ins Lager rollte, eine heimkehrende, nicht mehr ganz muntere Armee, lange Staubfahnen hinter sich lassend.
Gnievotta holte Kosch und Laski in den Geschäftswagen. Sie zogen die Gummistiefel von den Füßen. Laski entnahm dem Kühlschrank Eisstücke und verteilte sie gleichmäßig auf ihre Plastbecher, die Kosch mit Kornbrand auffüllte, sorgfältig, um nichts zu verschütten. Den Rest der Eisstücke schoben sie unter die verschwitzten Hemden, auf ihrer Haut schmolz das Eis schnell.
Laski gab die erste Runde Karten. Gnievotta reizte Grand, obwohl er sich nur vier sichere Stiche ausrechnete. Da er Mittelhand spielte, war die Sache ungewiss. Die beiden Buben nutzten nicht viel. Den Grand verlor er, und sie tranken.
«Anfänger», sagte Kosch geringschätzig.
Er habe es tun müssen, sagte Gnievotta, zwei Wenzel und drei Asse habe er gehabt.
An und für sich, erklärte Laski, sei ein solches Spiel zu gewinnen, aber das sei Papierrechnung. Man wisse nie, wie sich ein Grand entwickle, dafür sei es Spiel. Niemand könne auch vorhersagen, was morgen oder übermorgen geschehe. Ungewissheit sei stets das Schlimmste an einem vorausgeahnten Übel.
«Spuk man wieder vor», sagte Kosch, «beschrei es.»
Achtundfünfzig Augen habe er bekommen, immerhin, sagte Gnievotta, um nur drei Augen habe er dieses Spiel verloren.
Sie wussten, dass ein anderes Gespräch fällig war. Kosch musste auch zurück zur Schicht. Trotzdem gab er eine neue Runde. Laski reizte mit Gnievotta ein kleines Farbspiel aus. Kosch reizte nicht mit.
Die Sonne, deren Strahlen durch das Fenster des Geschäftswagens fielen, zeichnete rötlichen Glanz in Kaschs gelbe Augen, die scharf und stechend waren wie der Blick eines Geiers. Die Haut seines mageren, faltigen Gesichtes mit den schmalen grauen Lippen erschien in diesem Licht wie stumpfes Umbra, das dünne Haupthaar in einem fahlen Blond. Nur schwer ließ sich das Alter dieses grobknochigen Mannes bestimmen. Er stieß die Worte in dem knarrenden, rollenden Dialekt, der im Erzgebirge gesprochen wird, hervor, leitete seine Rede mit bestimmten Wendungen ein und schloss sie ebenso, wobei er seine Geieraugen fest auf den Mann richtete, den er ansprach. Mehr als einem wurde unter diesem Blick unbehaglich. Er war ein guter Erzähler, und er trug seine vorgeblich erlebten Geschichten immer in einem bemühten Hochdeutsch vor, was ihnen großes Gewicht verlieh. Im Lager war er eine der großen Legendenfiguren.
Kreuz, sagte Laski, und er werde sich eine oder zwei Stunden hinhauen und dann Kasch ablösen.
«Alsdann», sagte Kasch.
Laski spielte eine rote Zehn an. Das konnte nur heißen, er besaß das dazugehörende As. Ausgetragenes Kind, dieser Laski. Neben dem untersetzten, stämmigen Gnievotta und dem langen vertrockneten Kasch, wirkte Laski klein oder sogar schwächlich, aber er hielt Schritt mit beiden; zäh, schnell, findig war er, misstrauisch und querköpfig. Sein Haar, auf der Mitte des eiförmigen Schädels stark gelichtet, stand hinten ab, wie bei einem kampflustigen Hahn. Aus blauen Augen konnte Laski manchmal überraschend sanftmütig blicken. Unter einer abwärts gekrümmten Nase trug er einen kräftigen Bart von schwarzer Farbe. Selten schloss Laski Freundschaft mit neuen Leuten. Er hasste Glücksritter und Zugvögel, die, auf der Suche nach leichtem Leben und hohem Verdienst, gelegentlich zu ihnen stießen. Als Schichtleiter machte Laski ihnen das Leben sauer. Wer sich aber halten wollte, wem wirklich an der Arbeit lag, der erfuhr, dass dieser sarkastische, zu bitterem Spott aufgelegte Mann den Gutwilligen schützte und deckte, wo er es vermochte. Als Folge dieser Erziehung fehlten stets Leute. Der Rest Stammpersonal, die zwei Dutzend, die Laski erzogen, hätten einen Turm bis zu den Sternen gebaut, würde man ihnen die Mittel dazu an die Hand geben, versicherte wenigstens Laski.
Laski spielte die rote Zehn an. Er riskierte es, obwohl er damit rechnen musste, dass einer der beiden anderen überhaupt kein Rot in der Hand hielt. Dann wäre die Zehn weg gewesen. Entweder spielte Laski ohne Lust, betäubt von dieser brutalen Sonne, oder er dachte an das fällige Gespräch über den Zustand ihrer Bohrmeißel, das sie stillschweigend auf einen anderen, besseren Tag verschoben hatten.
«Gnievotta müsste eigentlich zur Schicht», sagte Kasch, «der ist heute den ganzen Tag spazieren gefahren.»
Laskis rote Zehn ging durch. Natürlich besaß er das As und wusste genau, was er tat. Das war ärgerlich für Kasch und Gnievotta, die zusammen spielten. Gnievotta bediente die Trumpflusche, die Laski gleich darauf zog. Die Kleinen holen die Großen. Kasch gab folgerichtig den Kreuz-Jungen dazu und pfefferte mit Schwung die Karten auf den Tisch.
In dieser Weise müsse man mit ihnen spielen, sagte Laski und ramschte die Karten ein. Sie brauchten neue Meißel, erklärte er, die Düsen müssten erneuert werden, deshalb nehme er die Schicht, während sich Gnievotta und Kosch um die Reparatur der Meißel kümmern müssten, wie, sei ihm völlig gleich. Ob sie die Zentrale anriefen, das Dienstleistungskombinat oder den Friedhof, ob sie selber ans Werk gingen, überlasse er ihnen.
«Hast dir wieder das Bequemste ausgesucht», sagte Kosch.
Ernsthaft widersprach Kasch dieser Entscheidung Laskis nicht; sie war vernünftig: Laski reparierte nicht gern. Lieber nahm er eine Doppelschicht in Kauf, nichts Besonderes bei ihnen. Laski verschwand auch bald darauf, um sich, wie er angekündigt, schlafen zu legen. Ein paar Stunden ging es draußen auch ohne ihn.
«Der will mal wieder weg», sagte Gnievotta gähnend.
Kosch erwiderte nichts. Dieser Laski überspannte den Bogen mit seiner dauernden Drohung. Kosch zündete sich einen neuen Zigarillo an.
Später untersuchten sie Bohrmeißel, reparierten einiges, tranken den Rest der Flasche aus, bis Kosch sagte, nicht verärgert, sondern mehr feststellend: «Flickwerk, niederträchtiges. Seidene Lappen auf einem Lumpensack.»
«Was willst du anderes machen», sagte Gnievotta.
«Wann fährst du nach Berlin?», fragte Kosch. «Katja wollte es wissen.»
«Sonnabend früh», sagte Gnievotta, «gleich von der Schicht weg.»
Er solle, falls er ihn sehe, dem Scheich Nowacki die Augen öffnen, sagte Kasch, ewig gehe es mit diesen Meißeln nicht weiter. Mal sei der Bart ab.
Ja, sagte Gnievotta, wenn auch Nowacki nichts mit Bohrausrüstungen zu tun habe.
Die Bogenlampen des Lagers erloschen. Nur am Turm, ein paar Steinwürfe weiter, brannten Lichter. In der Dunkelheit wirkte die Anlage wie ein strahlender Stern, wie eine leuchtende Insel in der Steppe.
Die Vorbereitungen, wenn er kam, wenn Gnievotta wirklich mal am Sonnabend kam, die Umstände seinetwegen, davon ahnte er nichts. Für ihn war es ein Besuch, ein Ortswechsel, Aufenthalt für ein paar Stunden oder Tage, mit Gedanken an draußen. Für Katja war er der heimkehrende Odysseus, dem alles verziehen: die lange Abwesenheit, die Seitensprünge und die faulen Ausreden. Freilich belagerten keine Freier sein Haus; bei seiner Ankunft starb kein Hund nach einem wehmütigen Wiedererkennen auf dem Mist. Ihn verwandelte keine Göttin, die hätte auch Mühe mit ihm gehabt; Odysseus Gnievotta, der erschien, um nach dem Rechten zu sehen, und doch nichts sah. Er setzte sich in die Küche, fertig, mürrisch, aschgrau im Gesicht, rauchte. Das war alles.
Banales Gerede: Ich habe dich später erwartet. Ist was passiert? - Was soll denn passiert sein? Immer muss gleich was passiert sein, wenn es mal nicht nach der Uhr geht. - Das ist vielleicht ein Sommer. - Sommer? Milder Winter mit tropischen Einlagen. - Das kannst du laut sagen. - Hast du was zu trinken? - Im Kühlschrank ... Rede, Gegenrede, immer dasselbe.
Falls Gnievotta am Sonnabend kam, was selten geschah, begannen die Vorbereitungen spätestens am Freitag...
Freitag meldete sich Katja bei Sigalla ab. Sie nannte keinen Grund, weshalb sie früher ging, sie sagte nur, dass sie jetzt gehen müsse. Sigalla fragte prompt, warum, und sie antwortete: «Weil mein Mann kommt.»
Alle Frauen im Konstruktionsbüro setzten bei Sigalla Verständnis für ihre Angelegenheiten voraus, enttäuscht wurden sie selten. Deshalb war Sigalla bei seinen Frauen beliebt. Sigalla, sechzig vielleicht, Stirnglatze. Die zahlreichen Falten seines vollen Gesichtes schienen abwärts auf das fleischige Kinn zu streben. Ein älterer Ingenieur mit einer großen Familie, etwas umständlich oder betulich, das war Sigalla.
Gnievotta sei vielleicht auch am Montag noch da, sagte Katja, während ihr Sigalla in den Mantel half.
«So», sagte er.
Ja, sagte Katja, und deshalb würde sie am Montag eventuell ihren Haushaltstag nehmen.
Wie sie das mit ihren zwei Kindern schaffe, fragte Sigalla, wie es die berufstätigen Frauen überhaupt schafften, mit Mann, Kindern und Haushalt, das komme ihm manchmal wie ein kleines Wunder vor.
Deshalb gehe sie ja auch früher, erwiderte Katja, weil das Wunder eben nicht zu schaffen sei, anders.
Das sehe er ein, sagte Sigalla, er verstünde es sehr gut. Seine Töchter zum Beispiel, die studierten noch, ihre Männer und Freunde würden sich durch ständige Abwesenheit auszeichnen. Was wären seine Töchter ohne sie, die alten Sigallas? Die nämlich zögen deren Kinder groß. Und vor dreißig etwa kämen seine Töchter nicht zur Ruhe. Sie wüssten nicht, wo sie eingesetzt würden, Absolventenlenkung lasse auch zu wünschen übrig. In der Schule, sagte Sigalla, dürften sie nicht, während des Studiums sollten sie nicht, nach dem Studium würden sie vielleicht keine Kinder mehr kriegen. Wann sollten sie? Nein, es falle eben auf die Großeltern zurück, auf die alten Sigallas, denn, allgemein gesprochen, heute stünde der junge Mensch vor seinem dreißigsten Jahr kaum voll im Beruf. Demzufolge seien die Jungen auf Unterstützung durch die Alten stärker angewiesen.
Sie hätte es vorher sagen sollen mit ihrem Haushaltstag, meinte Katja, das wisse sie, aber Gnievotta käme auch immer so überraschend.
Und trotzdem, entwickelte Sigalla seinen Gedanken weiter, würden die meisten Männer dann noch erwarten, dass ihre Frauen wie die Fürstinnen aussähen. Das gehe natürlich nicht. Missbilligend schüttelte er den Kopf und trug ihr Grüße an Gnievotta auf. Sie brauche sich keine Sorgen zu machen, er drehe das hier schon.
«Da kannst du ganz beruhigt sein», sagte Katja tröstend, «deswegen mache ich mir wahrhaftig keine Sorgen.»
Sigallas Bemerkung über das Äußere der Frauen brachte Katja auf einen Einfall. Ani, Gnievottas Schwester, arbeitete als Masseuse in einem Krankenhaus. Mit Ani stand Katja so gut, dass sie ohne Anmeldung erscheinen und eine Behandlung verlangen durfte.
«Ich verzisch mich», sagte Katja, «bis Dienstag.»
Die Schwägerin bemerkte, Katja setze Fett an, reichlich sogar, da würden Massagen nichts nützen, nur Bewegung.
«Ich hab genug Bewegung», sagte Katja, «morgen kommt Eckhard.»
Er würde kommen, gerade von der Schicht weg, und auf dem Küchenstuhl sitzen, in seinem verschwitzten Zeug, die Zigarette zwischen den Fingern drehen, den Pfeifkessel beobachten, müde und ein bisschen ratlos, wie die zwei Tage zu verbringen seien, ohne Kosch und Laski, ohne Bohrplatz und Skat. Sie also würde zu ihm hingehen und in die kalten hellen Augen Gnievottas sehen, zwei nicht mehr junge Leute mit einem Haufen guter, und einem ebenso großen Haufen schlechter Gewohnheiten.
«Lasst ihr euch mal blicken?», fragte Ani.
Katja, jetzt in Tücher gewickelt, lag still und fühlte sich angenehm ermüdet.
Das wäre immer so nach Ganzmassagen, sagte Ani, und ob sie mit einem Besuch rechnen könnten.
«Das ist nicht sicher», sagte Katja. Sie würden vielleicht auf einen Sprung kommen.
Es gab immer was zu bereden zwischen Nowacki und Gnievotta. Wenn nicht, dann erfand er einen Grund, um Nowacki zu sehen, Gnievotta kann nicht still sitzen, er hat es nie gekonnt; sitzen, trinken, Karten spielen und reden, groß angeben und zuhören, das ja, aber bloß so sitzen, das nicht.
«Wir können ja auch noch telefonieren», sagte Katja. Sie spürte, wie sich ihr Körper belebte. Außerdem, sagte sie, habe Gnievotta seit vierzehn Tagen keine Frau gehabt. Acht Tage hielte er aus ohne Frau, vierzehn nicht, wie sie aus Erfahrung wisse.
«Denkst du», sagte Ani, die sich in einem kleinen Handbecken die Hände wusch. Hinten stand ihr Kittel offen. Sie trug der heißen Tage wegen keinen Unterrock, nur Büstenhalter und Schlüpfer. Lang und gerade waren ihre Beine. Jugendlich wirkte sie mit dem hinten aufgebundenen Rossschwanz. Ihre Stirn war hoch, die Haut weiß und rein, ihre Augen glichen Gnievottas Augen. Gelassen glitten ihre Blicke über Menschen und Sachen, nachsichtig und mit überlegener Freundlichkeit. «Ich kenn doch meinen Bruder», sagte sie.
So unrecht hatte sie nicht, wie Katja wusste, obwohl Gnievottas Gekrame mit dieser Schlampe in Senftenberg weit zurücklag. Schuld hatte sie, Katja, auch gehabt. So lange lässt man keinen Mann aus den Händen.
Dann sagte Ani, dass Gnievotta vielleicht aus der Altmark abgezogen werde, vielleicht, das entscheide sich noch. Sie habe es von Nowacki.
Katja richtete sich auf. «Im Ernst?», fragte sie, da sprangen ein paar freie Tage heraus für sie und Gnievotta. Vielleicht ging auch alles mal wieder Hals über Kopf.
«Ich habe es dir unter uns Pastorentöchtern erzählt», sagte Ani warnend.
«Ich halt schon meinen Mund», sagte Katja.
Von Ani rannte sie zum Frisör. Die Frisöse riet ihr zu einer neuen Frisur, aber Katja entschied sich fürs Solide.
«Mein Mann kommt morgen», sagte sie, «der hält mich glatt für verrückt.» An solchen Vorabenden kam sie nie mit sich zurecht. Die Jahre hätten da was abschleifen sollen, fand sie. Zuletzt warf sie ihre Entscheidung um. Vielleicht gefiel Gnievotta eine neue Frisur.
Zu Hause mied sie den Spiegel. Sie band ein Tuch um den Kopf. Morgen früh würde nicht mehr viel davon zu sehen sein.
Der Rest des Abends ging mit Hausarbeit drauf. Spät bezog sie die Betten neu, setzte sich vor den Fernseher und erwischte gerade noch das Ende eines Filmes.
«War es ein Film?», fragte sie Bodo.
«Es war eine Info», sagte der Junge und schaltete das Gerät aus.
«Eine was?», fragte sie.
«Eine Art Nachricht», sagte er gelangweilt.
«Ach so», sagte sie, «ich habe dich nicht richtig verstanden, du kriegst ja die Zähne nicht auseinander.»
Er lächelte unverblümt zu dieser Ausrede, diesem Bildungsrückstand, wirkte wie ein großes und gepflegtes Baby, und sie fühlte sich durchschaut.
«Morgen bleibst du zu Hause», verlangte sie gebieterisch, «dein Vater kommt.»
Es hätte der Ermahnung nicht bedurft, Bodo wäre auch so zu Hause geblieben, Er suchte das Gespräch mit dem Vater. Bisweilen schuf sich der junge Bodo Dialoge, in denen er sich völlig offenbarte. Dann standen sich zwei gleiche Partner gegenüber. In der Praxis sah es anders aus. Nicht nur, dass der Vater unregelmäßig kam, er hielt sich auch an Äußerlichkeiten, denen der Junge viel weniger Bedeutung beilegte, als die Eltern glaubten. Aus Missverständnissen ergaben 'sich Fehlurteile auf beiden Seiten.
Übrigens brachte Gnievotta, der sich fremd und unbehaglich in seinen vier Wänden fühlte, Unruhe mit, Mann aus Mahagonny, Goldwäscher aus Klondike und im großen Revier zu Hause, nicht in der Wohnung, die ihn an ein Hotel erinnerte, Seemann auf blauen Straßen.
Von alledem spürte der junge Bodo genügend. Verstimmt sah er zu, wenn der Vater die Zimmer seinen Vorstellungen anzupassen suchte, Lampen abnahm, Möbel rückte, Regale und Stellagen baute. Mürrisch half er mit, wenn ihn der Vater dazu aufforderte. Der junge Bodo verstand: Architekten hatten die Gewohnheiten vorherbestimmt, und Gnievotta sträubte sich gegen die Normierung seines Lebens oder eines Teiles davon.
Anders die Mutter, sie fühlte sich wohl im Hochhaus. Ihren Bedürfnissen entsprachen Haus und Nebeneinrichtungen, die nahe Einkaufshalle, das Waschhaus. Für Bodo war sie ein Dutzendmensch, wie es sie genügend gab. Er folgte ihr beim Bummel durch Geschäftsstraßen, beobachtete, wie sie rechnete, gut und schnell. Selten unterlief ihr ein Fehler, ihr Wirtschaftsgeld ging auf. Eilig schlang sie Würstchen an Marktständen, löffelte Eis aus schlanken Bechern, trank Kaffee in Mokkastuben, aß hohe fette Tortenschnitten und klagte über Gewichtzunahme. Wo er konnte, drückte sich der junge Bodo vor diesen gemeinsamen Einkaufsgängen, peinlich berührt vom Gewöhnlichen, dem Hang der Mutter zu auffallender Kleidung, zu Ringen und Ketten. Sie trug am liebsten, was ihr nicht stand. Tüchtig war sie und ungemein mitteilsam. Veränderungen, die sie nicht selbst umständlich eingeleitet hatte, fürchtete sie.
Dem jungen Bodo widerstrebte diese geordnete Welt. Er ertappte sich bei der Vorstellung, die Mutter könnte plötzlich einen anderen Anspruch stellen, sich beispielsweise scheiden lassen, die kleine gesicherte Existenz aufs Spiel setzen. Darüber musste er lächeln, das war undenkbar. Hin und wieder beteiligte sich die Mutter an Vergnügungen, Ausflügen, Brigadefeiern. Solche Dinge bereiteten ihr Freude. Hörte man sie vorher, so glaubte man, sie sei im Begriff, etwas Unerhörtes zu unternehmen. Ihre Kleider, Mäntel, Schuhe, Frisur nahmen sie in solchen Fällen ganz in Anspruch. Hörte man sie nach solchen Festen, dann waren Lobreden auf die Frauen gehalten worden, von Männern, die nicht immer den richtigen Ton im Umgang mit den Frauen fanden. Kurz nach Mitternacht war die Mutter dann beunruhigt aufgebrochen, es hätte sein können, der Vater nutzte die Gelegenheit zu einem Seitensprung, oder es war etwas mit den Kindern geschehen, also mit ihm, Bodo, oder mit Elke. Es geschah ja immer dann etwas, wenn die Mutter nicht damit rechnete. Natürlich lag der Vater in tiefem Schlaf, wurde geweckt und verbat sich die Ruhestörung. Auch dass er nichts unternommen, war falsch. «Na ja», sagte der Vater, «und sonst war nichts, auch im Fernsehen war nichts.» Der dünnen Zimmerwände wegen konnte Bodo an solchen Gesprächen teilhaben.
Aufgeräumt waren die Schränke der Mutter, Tassen und Gläser standen an ihren Plätzen, gefüllt war der Kühlschrank mit rohem Fleisch, Gemüse, Obst, Eiern, Butter, Milch und Wein. Immer war sie darauf vorbereitet, dass sich ein ausgehungerter Mann oder Sohn zu Tisch setzte. Soweit war das nicht der Rede wert, aber es gab Stunden mit der Mutter, die sie in einem anderen Licht zeigten. Zuverlässig traf sie in verfahrenen Lagen Entscheidungen. So robust der Vater aussah, mit seinen Niederlagen kam er zu ihr. Dann sagte sie: «Pfeif drauf, andere machen auch Fehler!» Ohne zu prüfen, ohne überhaupt prüfen zu wollen, wo im besonderen Fall der Fehler zu suchen, wo das Recht war, trat sie streitbar an die Seite des Vaters, und oft genug trat sie vor ihn.
Mit der Mutter kam der junge Bodo schlecht aus, er wünschte sie geistiger, ließ sich nach alter Mütterweise bedienen, dankte ihr wenig oder gar nicht und schämte sich gelegentlich. Auf den Vater wartete er und vermutete mit Recht hinter kargen Äußerungen für ihn nützliche Erfahrungen.
Am Sonnabend kommt Gnievotta früh an, gegen sieben etwa. Langsam fährt er mit dem Wagen durch leere Straßen. Gnievotta denkt an Nowacki, den er wegen der Arbeit sprechen will, obwohl er sich nicht allzu viel davon erhofft, auch Ani will er wiedersehen. Seine, Gnievottas, Wohnung im Fischerkietz ist ihm noch immer fremd.
Drüben am Spittelmarkt hatte Nowacki ihre Waffen versenkt, an einem trüben, regnerischen Apriltag war das gewesen. Merkwürdigerweise hatten sie keinen Menschen gesehen; außer zerstörten Kriegsfahrzeugen, mit Kalk bestreuten Pferdekadavern und ihnen waren die Straßen leer gewesen.
Nowackis Arm hing in einer schwarzen Schlinge. Sie, Angermann, Gnievotta und natürlich auch Nowacki, wussten damals noch nicht, dass er diesen Arm verlieren würde. Sie standen am Geländer der Spree, auf der tote Soldaten und Zivilisten trieben. Nowacki ließ seinen Karabiner ins Wasser fallen. Ihre Gewehre warf er hinterher. Angermann sagte, er würde jetzt gehen und was Vernünftiges tun. Um seine Schultern hing eine durchlöcherte Schlafdecke. Außer dieser Decke, den paar Sachen auf dem Leib und einem leeren Brotbeutel besaß er nichts weiter als das bisschen Leben, eine ganze Menge immerhin. Er gab Nowacki die Hand, das heißt, er nahm die linke, unverletzte Hand Nowackis und hielt sie lange fest, während er behauptete, er würde etwas Großartiges unternehmen. Er ging, mit zuckenden Schultern, ohne sich umzudrehen.
Nowackis Augen glänzten fiebrig oder vor Erregung. Wohin Nowacki gehen würde, wusste Gnievotta nicht, der hatte niemand, der ihn aufnehmen konnte. Nowacki sank vor dem Geländer zusammen. Gnievotta stützte ihn. Nowackis Gesicht verfärbte sich. Aufgeregt nahm Gnievotta den Verband herunter. Der Arm sah böse aus, oberhalb des Gelenkes war ein eiternder, faulender Brei. Gnievotta suchte eine trockene Stelle der Binde und wickelte sie wieder um den Arm.
«Komm mit nach Rügen», sagte er.
«Nein», sagte Nowacki, «hau ab!»
Irgendwie gerieten sie in einen erregten Wortwechsel. Zwei- oder dreimal schlug Gnievotta zu, um Nowacki zur Besinnung zu bringen oder um selber zur Besinnung zu kommen. Nowacki wischte das Blut nicht ab. Es rann von den aufgeschlagenen Lippen über das Kinn herunter auf den Waffenrock. Eine Gruppe Rotarmisten kam am Geländer entlang auf sie zu.
«Hau doch bloß ab, du Idiot», sagte Nowacki leise.
Da lief Gnievotta in Richtung Fischerkietz, Eine MP-Salve, schlecht gezielt, ging über seinen Kopf weg. Kann auch sein, es wurde gar nicht oder absichtlich schlecht geschossen. Nowacki jedenfalls blieb zurück. Auch dieses Übel hatte Gnievottas Wohnung. Sie erinnerte ihn dauernd an jenen Apriltag 1945.
Wie große blaue Ziehharmonikabälge hängen die Plastjalousien vor den Fenstern. Katja ist im Badezimmer. Seinetwegen braucht sie länger als sonst, weiß Gnievotta. An einer Raststätte hat er heißen Gulasch gegessen und Brot, und er hat sich zwei Schnäpse genehmigt, die ihn halbwegs auf die Beine brachten. Jetzt will er Kaffee kochen, sitzt auf einem Küchenstuhl, in Arbeitsklamotten, die Zigarette zwischen den Fingern, und wartet auf das Pfeifen des Wasserkessels.
Im Zimmer deckt Elke den Tisch. Gnievotta ist aus dem Zimmer gegangen, weil Bodo dort sitzt und Zeitung liest, ohne von ihm Notiz zu nehmen. Bodo ist größer als Gnievotta, dünne Handgelenke hat er und knochige Schultern. Auf den Hemdkragen fällt die rotblonde, seidige Mähne. Weißhäutig ist das lang gestreckte Gesicht, mit engen Augenspalten und schmalen Lippen. Viele Rotblonde haben diese weiße, lichtempfindliche Haut. Bodo trägt eine kreisrunde Nickelbrille. Viel Zeit wendet die Jugend für sich auf, eine kostspielige Abgerissenheit ist das, auf Wirkung berechnet. Hier in der Küche verspürt Gnievotta Lust, mit Bodo anzubinden. Ihn ärgert die Gelassenheit und Ahnungslosigkeit, mit der Bodo seinem, Gnievottas, Leben und dem Leben überhaupt gegenübersteht. Er hätte ihn gern ein paar Monate draußen gehabt, bei der Arbeit, bloß um zu wissen, welch Kern unter dieser Art Eleganz steckt.
Gnievotta trägt noch seine Arbeitssachen, nur die Gummistiefel hat er ausgezogen. Eine von Gnievottas Gewohnheiten, zu Hause in Strümpfen zu gehen. Unten steht der Jeep. Das Fuhrwerk sieht dem Kutscher ähnlich, zwei ermüdete, verdreckte Arbeiter, die ein bisschen Ruhe wollen. Gnievotta geht doch hinüber ins Wohnzimmer.
Ob es was Neues gebe, fragt er und deutet auf die Zeitung.
Bodo schüttelt den Kopf, legt die Blätter zusammen und reicht sie Gnievotta. Er habe nur die Schlagzeilen gelesen. Morgens überfliege er stets nur die Schlagzeilen, um informiert zu sein.
Gnievotta nimmt die Zeitung, entfaltet sie aber nicht, sondern legt sie weg. Wie es in der Schule vorangehe, will er wissen.
Es gehe voran, sagt Bodo ruhig.
Gnievotta hat eine scharfe Zurechtweisung auf den Lippen, so wie er Laski rügen würde, wenn der nicht Farbe bedient, aber Gnievotta hält sich zurück. Er fühlt sich herausgefordert, kann nur nicht sagen, warum. Dass ihm der ganze Knabe gegen den Strich geht, ist kein Grund, die sind heute so. Außerdem hat diese Jugend eine weiche Haut. Sein Sohn trägt ein knallrotes Hemd und resedafarbene Hosen. Eine handbreite Gürtelschnalle mit einem Stierkopf hält diese Hose auf den Hüftknochen fest.
Wenn der Kaffee nicht bald käme, sagt Bodo, dann müsse er ohne Frühstück weg, was er bedaure.
«Dann musst du eben so gehen», sagt Gnievotta.
Es ist die Mischung, die Gnievotta irritiert, die deutlich gezeigte Überlegenheit, der Anspruch, als erwachsen zu gelten und doch abhängig zu sein von ihm, Gnievotta. Die Haltung, aggressiv und zugleich verstockt. Gnievotta kann sich darauf nicht einstellen, findet nicht den richtigen Ton und will ihn gar nicht finden.
Protest, denkt Gnievotta, na schön, warum nicht, aber gegen gutes Essen und weiche Betten, gegen eine gesicherte Zukunft protestiert doch keiner. Eine feste Hand würde hier mehr ausrichten. Katja hat sie nicht, und er ist leider zu wenig da, um die Erziehung des Jungen in die Hände zu nehmen.
Bevor Bodo die Wohnung verlässt, sieht er noch einmal ins Zimmer. Er trägt jetzt eine Lederweste, Sicherheitshelm und Schutzhandschuhe. Unten wird er sein Moped starten, Fuchsschweif an einer Stahlrute, wird die Gänge einlegen, viel unnötiges Zwischengas, versteht sich, Gnievotta kann das schon hören, dreimal um die Ecke fahren und das Rad vor der Schule aufbocken.
«Wiedersehen», sagt Bodo.
«Du hast was vergessen», sagt Gnievotta, «die Sporen.»
«Sehr witzig», sagt Bodo.
So sitzt Gnievotta wieder allein, Unruhe im Kopf; sieht herunter auf seine schmierige Cordhose, fühlt das schweißdurchtränkte Hemd an den Schultern kleben und sehnt sich nach einem heißen Bad. Er brennt sich die nächste Zigarette an.
Elke kommt mit Kaffee. Ihre Haut hat den sanften Glanz bläulicher Perlen. Rosa bis weiß sind die leicht aufgeworfenen Lippen, die keine Gnievotta sonst hat. Ihr Kleid reicht nicht ganz bis zur Mitte der Schenkel. Das Haar ist ebenfalls rötlich, nur ist es heller als Bodos. Wegen der breiten Backenknochen verjüngt sich ihr Gesicht zum Kinn, das gibt ihrem Gesicht einen kindlichen Zug. Augen, ein blaugrünes Email. Elkes Hände sind schlank, gepflegt und schön, von keinem Aufwasch verdorben, durch keine Seifenlauge ruiniert. Welche Gnievotta konnte sich je solche Hände leisten?
«Wolltest nicht du den Kaffee kochen?», fragte sie und stellt die dampfende Kanne auf den Tisch.
«Ja», sagt Gnievotta und hält das Mädchen, das ihm so fremd ist, fest, sieht in die blinzelnden, spöttischen Augen Elkes. Wer dieses Mädel mal kriegt, der kann sich auf was gefasst machen. Kunstreich gekämmt ist ihr Haar, sieht er jetzt.
«Ist was?», fragt sie, stillhaltend, sich ihrer Wirkung auf den Vater bewusst, der letzten Endes auch nur ein Mann ist.
«Na ja», sagt Gnievotta und lässt sie los. Dieses Fräulein ist seine Tochter. Väter gehen mit halb erwachsenen Töchtern am Arm spazieren; die Väter sagen «mein Kind» zu ihren Töchtern; die Töchter wiederum sagen «Papa», mit gedehnten Vokalen. Das soll es geben. Kommt die Zeit, wo die Väter ältlich werden, nach dem ersten Schlaganfall, dann sagen die Töchter: «Dein Stock, Papa.» - «Danke», antworten die Väter in solchen Fällen.
Diese Tochter hier sagt einfach: «Hast du schon wieder gesoffen? Kannst du das nicht lassen?»,
Ich bin heute früh alle gewesen, könnte Gnievotta sagen. Dann kam Kosch, du kennst ihn. Soll man so auseinander gehen? Später, an der Raststelle, habe ich noch zwei Kleine gehoben. Das ist alles. Er sagt aber nichts.
Der Tisch ist gedeckt. Katja erscheint. Gnievotta betrachtet Katjas Frisur, die großen Hände mit dem roten Lack auf den kurzen Nägeln, schweigend mustert er die breite Gestalt seiner Frau. Nach dieser Frau verlangt es ihn nur noch selten. Tiefbraune große Augen hat sie, ihr Haar ist mittelblond und dicht. Sie ist nicht schön, war es vielleicht nie, bloß jung war sie. Das genügte, obwohl Gnievotta für so was keinen Blick hat und wahrscheinlich nie hatte. Er sucht, was hinter schönen Hüllen steckt, was nützlich ist. Katja ist von seiner Größe, sie erscheint schwerer, als sie wirklich ist. Gegen das Altern kämpft sie, möchte jung sein, jung ist Mode. Nie ist Jugend so idealbildend gewesen wie heute. Nicht, dass Gnievotta viel darüber weiß, er empfindet nur Missbehagen. Hier stimmt was nicht, glaubt er, das Verhältnis zwischen Anspruch und Leistung stimmt auch hier nicht. Die Gnievottas verbindet ein gewichtiges Bündel Jahre, das gewöhnliche Leben eigentlich. Sie sind lange her, die Kälberspiele, gut war's, schön war's. Was denn noch? Gnievotta sitzt am Tisch, kaut schweigend belegte Brote, trinkt Kaffee, den er kochen wollte und doch nicht gekocht hat.
Nach dem Frühstück stellt er sich unter die Dusche. Bis auf einen schmalen Streifen um die Hüfte ist seine Haut braun, glänzt wie öliges Kupfer, kein Gramm Fett; nur die Narbe, von der Schulter bis zur Rückenmitte, ist rosa und wulstig. In diesen Tagen arbeiteten sie draußen fast nackt, war nicht anders zu ertragen, aber gefährlich, Gummistiefel, Helm und Handschuhe natürlich. Es riecht dort draußen nach Staub, verbranntem Metall und Altöl. Im heißen Wasser hält es Gnievotta lange aus.
Katja kommt herein und reibt ihn trocken. Ob er wisse, was eine Info ist, fragt sie, und ob alle so dämliche Kinder hätten wie sie, die Gnievottas.
Es hat keinen Zweck, auf das Gerede einzugehen. Außerdem sind ihre Hände sanfter geworden, gleiten zu den Hüften, und in ihren Augen ist das, was er mal sehr geliebt hat. Kälberspiele also sind vorbei, er hat auch kein Geschick dazu. Er führt sie ins Schlafzimmer, nimmt sich, was er braucht. Sein Atem geht schnell und stoßweise, einen Moment bleibt er auf ihr liegen, erschlafft, legt seinen Kopf in den Winkel, der durch Hals und Schulter gebildet wird. Jetzt, danach, küsst er sie auch.
«Wenigstens rasieren hättest du dich können», sagt Katja, «so viel Zeit wäre schon noch gewesen.»
«Na ja», sagt Gnievotta, dessen Gedanken schon wieder bunt durcheinander laufen. Die Kinder halte er für ganz in Ordnung, alles zusammengenommen und ihr Alter berücksichtigt. Was er auch glaubt. Von seinen Kindern hat Gnievotta ein heiles Bild, solange er sie nicht sieht. Katja hat sie dauernd um sich.
«Ich auch», sagt sie, «ich bin die Mutter.» «Ganz was Neues», sagt Gnievotta. Man müsse sich mal an die eigene Jugend erinnern. Sie seien früher auch angeeckt. Er greift zum Nachttisch, wo die Zigaretten liegen, und zündet sich eine an.
Neulich, sagt Katja, wäre hier einer im Haus erstickt, weil er im Bett geraucht habe und darüber eingeschlafen sei.
Das Märchen kenne er, sagt Gnievotta, er habe aber noch nie einen getroffen, der im Bett beim Rauchen erstickt sei. Sie lachen beide über diesen ungewollten Witz, und Katja beißt Gnievotta in den Oberarm.
«Hör auf», sagt Gnievotta. «Was soll das?»,
Die Liebe geht schnell bei Gnievotta. Dann liegen sie eine Weile still. Gnievotta raucht und denkt nach.
«Du», sagt Katja, «ab September geh ich zur Abendschule.»
September, damit kann nur der nächste September gemeint sein, viel Zeit, wer weiß, was bis dahin geschieht.
«Sigalla rät mir zu», sagt sie, «was meinst du?»,
Gnievotta grinst. Er kennt doch Sigalla, den leicht vertrottelten Ingenieur, eine Art Bürovorsteher, dem zwanzig Weiber auf dem Kopf rumtanzen. Der rät, dass Katja studiert. Gnievotta glaubt nicht, dass sie ihre Arbeit so wichtig nimmt.
Er steht auf, sucht den Rasierer und nimmt den zwei Tage alten Bart herunter. Auch Katja steht auf, bringt ihm ein weißes Hemd, eine graue Hose, an der noch das Preisschild baumelt. Die Hosen, die Katja kauft, passen nicht, sie haben nie gepasst.
«Du hast abgenommen», sagt sie.
«Kann sein», sagt er. «Du musst ja dauernd was kaufen.»
«Was du an Hosen ramponierst», sagt sie. Sie zweifelt, ob sie Gnievotta dahin bringen kann, so auszusehen wie Nowacki, so ordentlich.
Gnievotta schaut auf das Thermometer, auch heute wird ein heißer Tag werden. Die Sonne steht noch nicht hoch, aber es sind schon vierundzwanzig Grad. Katja holt Kornbrand aus dem Kühlschrank, die Flasche ist so kalt, dass sie beschlägt. Katja trinkt stets, was Gnievotta trinkt.
«Pass auf», warnt er.
Wie lange er bleibe, fragt Katja.
Gnievotta erklärt, dass er mit Nowacki sprechen müsse, aber vielleicht erst am Montag abreise.
«Oder schon in ein paar Stunden», sagt sie.
Er überlegt, was er mit den anderthalb Tagen machen könnte, falls er bliebe. Mit Bodo müsste er sich aussprechen, was heißt aussprechen, zurechtstuken muss er ihn. Er könnte mit den Kindern auch mal baden fahren bei diesem schönen Wetter, könnte sich von seiner besseren Seite zeigen. Er kehrt hier zu sehr den Erzieher heraus. Seine Kinder sind doch schon halb erwachsen, aber eben nur halb erwachsen. Es fehlt noch viel. Katja beurteilt alles nach dem Augenschein. Aber er, Gnievotta, sieht da tiefer. Manchmal hört man zwar von sehr großen Schwierigkeiten, die andere Eltern mit ihren Kindern haben, aber die sind dann auch danach, die Eltern und die Kinder. Seine beiden haben ein ordentliches Zuhause. Was sie wünschen, bekommen sie, in Maßen, versteht sich. Zuviel soll ihnen nicht geschenkt werden. Am Ende renkt sich alles von selbst wieder ein, vielleicht ist auch überhaupt nichts, sicher.
«Es wäre gut, wenn du bis Montag bliebst», sagt sie.
Vielleicht ist es möglich, bis Montag zu bleiben, aber Gnievotta wäre doch gern früher draußen gewesen. Sie liegen beträchtlich zurück. Ohne die Reparaturzeiten an den Meißeln, ohne diese verfluchten Sandsteinschichten, deren Mächtigkeiten keiner genau kennt, ohne diese Hitzewelle, die Kräfte zehrt, würden sie besser dastehen, nicht gut, aber besser. Demnächst würde ihm Schikora ohnehin den Marsch blasen. Es kommt mal wieder alles zusammen. Draußen brennt jetzt die Hitze das Eisen aus, dreht sich der Bohrkopf, schlägt tonnenschweres Gestänge, setzen Männer Flaschen an die staubigen grauen Lippen, schwere Arbeit bei diesem Wetter, auch sonst schwere Arbeit.
Katjas Hände sind trotz der Hitze kalt. Die Gnievottas kennen sich seit zwanzig Jahren, etwas weniger. Er war ihr Erster und ist vielleicht ihr Einziger geblieben, vielleicht auch nicht. In zwanzig Jahren passiert viel, weiß Gnievotta. Es war bei Bek, eine elende Zeit, als sie zu ihm kam, jede Nacht, bis die Eltern sie rausschmissen. Das ist nie wieder in Ordnung gebracht worden. Katjas Eltern starben kurz hintereinander, vor acht Jahren ungefähr. Gnievotta wohnte in einem Verschlag über dem Bootsschuppen und reparierte Motoren, Sachs, König und andere Systeme. Nowacki holte ihn da raus. Oder war es Kosch? Jetzt also will Katja zur Abendschule.
Sie fragt, ob er glaube, es lohne noch.
«Warum soll es nicht lohnen», sagt er.
«Weil ich nicht mehr jung bin», sagt sie.
«Probier es», sagt Gnievotta.
Dann telefoniert er mit Nowacki, hört dessen sichere, etwas leise Stimme. Nowacki sagt, bis jetzt wäre es nirgends zu einem durchgreifenden Wetterwechsel gekommen. Auch für die nächsten Tage erwarte niemand eine Änderung. Im Norden habe das Unwetter viel Schaden angerichtet, es bewege sich langsam in südliche Richtung.
Gnievotta erwidert, dass ihn Gewitter weniger schrecken als veraltete Maschinen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Technologie wäre nicht seine Sache, sagt Nowacki. Geologie, Mineralogie, damit sei er befasst. Das reiche ihm vollauf. Nowacki am Schreibtisch, die Armprothese aufgestützt, den Telefonhörer in die Schulter geklemmt.
«Wie sieht es denn sonst aus?», fragt Nowacki.
«Nichts Besonderes»" sagt Gnievotta.
Nowacki rät, gleich wieder abzufahren. Von allem anderen mal abgesehen, müsse eben noch immer mit dem Unwetter gerechnet werden.
Gnievotta ist verstimmt über Nowackis Beharrlichkeit. Er glaubt einen Anspruch auf zwei ruhige Tage zu haben, wenn er auch mit den Tagen nichts anzufangen weiß. Er werde am Sonntagnachmittag fahren, sagt er, ein Vorschlag zur Güte.
«Wenn du heute noch fährst», sagt Nowacki, «dann müssten wir uns gleich nach dem Mittag sehen.»
«Ich weiß nicht», sagt Gnievotta mürrisch, «kommt erst mal her. Sagen wir, gegen vierzehn Uhr?»,
«Das ist entschieden», sagt Nowacki und legt den Hörer auf. Nutzlos wird der Vormittag vertan, Gnievotta sitzt in der Küche, sieht zu, wie Katja Gemüse putzt, Fleisch zum Braten vorbereitet, hört ihr zu. Dann wird ihm ihr Gerede lästig. Er schützt eine Arbeit vor und setzt sich an den Fernseher. Die könnten vormittags, wenn die Schichtarbeiter zu Hause sind, etwas mehr Fußball bringen, findet er. Das tun sie natürlich nicht, ist ja auch Sommer, Pause im Fußball. Gnievotta nimmt sich die alten Fußballzeitungen vor, Sympathie für die Berliner Klubs konnte er nie aufbringen, die enttäuschen zu oft. Unbeständig sind sie.
Beim Tischdecken fragt Katja, ob er das arbeiten nenne?
Dann essen sie und Gnievotta wartet auf Nowacki. Ani und Nowacki passen zueinander. Als Kinder lernten sie sich kennen und verloren sich aus den Augen. Ein paar Jahre haben sie sich verschenkt, die Jugend. Dann fanden sie sich wieder. Ani hatte ein paar Illusionen und Nowacki einen Arm verloren. Gnievotta beobachtet Nowacki, der auf die Spree hinuntersieht. Unbedingt muss er sich jenes Apriltages erinnern, der in Gnievotta noch immer verschwommen lebendig ist, aber als er den Schwager fragt, ob er jetzt zurückdenke, antwortet Nowacki reserviert: «Nein. Wozu?»,
Es ist nichts zu machen mit einem Mann, dem Gedanken an Vergangenes lästig sind. Vergangenes, das heißt hier auch, an einen Mann mit zwei gesunden Armen denken.
Sie trinken irgendein fades Zeug, weil Nowacki selten Alkohol trinkt. Trotzdem ist es nicht langweilig. Mit Nowacki kann es nie langweilig werden. Er hockt im Sessel, die langen Beine weggestreckt, und trainiert die bio-elektrische Prothese, ohne sich bei der Entwicklung eines Gedankens stören zu lassen. Er spricht über Theateraufführungen, Konzerte; die er gehört, über wissenschaftliche Entdeckungen, Politik. Sein blasses Gesicht wird von dem dunklen Kinnbart; beherrscht, die Augen haben die Farbe braunen Waldbodens. Das Haar, glatt, seitlich gescheitelt, ist schwarz. Alle Sachen, die Nowacki trägt, wirken immer, als seien sie gerade gekauft. Selbst der Schutzhelm, den er draußen wie alle aufsetzt, scheint eben aus der Presse gekommen zu sein.
«Warst du mal bei unserer Mutter?», fragt Ani.
«Nein», sagt Gnievotta «sie will anbauen, schreibt sie.»
«Red es ihr aus», sagt Ani, «auf dich hört sie manchmal.»
Ani ist vierzig, aber sie wirkt jünger als Katja. Ihr straff zurückgekämmtes Haar endet als baumelnder Rossschwanz. Ihre Bewegungen haben was von der behänden Leichtigkeit junger Mädchen. Außer zwei kleinen Perlen in den Ohrläppchen trägt sie keinen Schmuck.
«Es ist doch nur ein Sprung bis Altefähr», sagt sie.
«Vielleicht mal in der Woche», sagt Gnievotta. Er müsse heute noch zurück. Den Blick, den er von Katja auffängt, sieht auch Nowacki. Es ist eine seiner sympathischen Eigenschaften, Unausgesprochenes zu verstehen. Er sagt, vielleicht gebe es bald ein paar Ruhetage. Katja nickt und gibt sich zufrieden. Es ist ein alter Streitpunkt. Trennung bedeutet für Katja Verzicht.
Dann spricht Gnievotta noch mal ausführlich von der Arbeit. Mit ganz leeren Händen will er nicht zurückfahren. Er erläutert die Schwierigkeiten und sagt, es sei ein Unterschied, ob man am Schreibtisch sitze und Pläne mache oder ob man draußen liege und solch schönen Plänen Gestalt geben müsse, mit Ausrüstungen, die den Anforderungen nicht mehr genügen. Die Geologen, habe er den Eindruck, wüssten besser in den Dolomiten Bescheid als hier.
Der Eindruck sei falsch, die Geologen wüssten über Erdschichten recht gut Bescheid, antwortet Nowacki trocken, und deshalb werde überhaupt der ganze kostspielige Aufwand getrieben, nämlich um Bescheid zu wissen. Die großen Entdeckungen stünden noch aus, aber sie würden gemacht werden, heute oder in zehn Jahren. Alle bedeutenden Öllagerstätten der Welt wären in den letzten vierzig Jahren gefunden worden.
Gnievotta schüttelt den Kopf. Es ist seine elfte Tiefbohrung, gefunden wurde nichts. Nowackis Glauben an ein Wunder kann er nicht teilen, aber der Stolz auf einen sauberen Kern aus vier- oder fünftausend Metern Tiefe, mit dem der Geologe was anfangen kann, ist ihm nicht fremd.
Was die Frage der Ausrüstungen beträfe, er, Nowacki, sehe es so: Neue Anlagen seien mit einem Schlage natürlich nicht zu beschaffen, aber es gebe genügend Leute, die nicht auf den Kopf gefallen wären. Koschinski zum Beispiel, der wäre mal ein großer Erfinder gewesen, und Lawretzki, auch der, soweit Nowacki sich der beiden erinnere. Man müsse aus den Anlagen eben herausholen, was irgend möglich, wahrscheinlich sei viel mehr drin, als Gnievotta annehme. Betriebsblindheit wäre nur ein anderes Wort für moralischen Verschleiß.
Sie lassen das Thema fallen, es ist unergiebig. Am Abend fährt Gnievotta ab.
Das Gewittertief bewegte sich nur langsam in Nordsüdrichtung. Möglicherweise löste es sich auf, und ein Hoch entstand. Jedenfalls brachte der Sonntag zunehmend Schwüle in die Stadt, die Sonne schien am Himmel zu zerfließen. So gut wie keinen Schatten warf ihr Licht.
Der junge Bodo ordnete Schulsachen. Zu dem Gespräch mit Gnievotta war es nicht gekommen, abgesehen von der Rangelei gestern früh. Nach dem Essen trieb sich Bodo in den überhitzten Straßen herum, ungestört beobachtend. Die Stadt war voll von Gnievottas, schien dem jungen Bodo, dauernd begegnete man ihnen. Sie glichen einander, in allen denkbaren Verkleidungen traten sie auf, jung oder alt, der Ausdruck ihrer Gesichter kennzeichnete sie. Die Welt gehört uns, den Gnievottas, das gaben sie deutlich zu erkennen. Hüte oder Mützen im Nacken, auch barhäuptig, gingen die Gnievottas ihre ruhigen Straßen, Frauen oder Mädchen an Händen haltend, denn sie lieben Frauen ganz allgemein. Kinder liefen vor ihnen her, wurden ermahnt; gerufen; Kinder sind ein Teil ihres moralischen Besitzes.
Überall fügten sich die Gnievottas mühelos ein, so schien es dem jungen Bodo, sie sprachen mit Taxifahrern im Ton von Taxifahrern, mit Postfrauen im Ton von Postfrauen, redeten wildfremde Menschen an, die sie nie wieder treffen würden und die ihnen im Grunde gleichgültig sein konnten. Oft drängte es sie zu sagen, wir sind der und der, unser Leben ist eine Kette von Erfolgen und Misserfolgen. Sie brauchten den Beifall derjenigen, die ihnen ähnlich. Immer suchten und fanden sie scheinbar Kontakt, passten sich an, stellten sich ein.
Ihre Arbeit war ein eigenes Kapitel. Sie hetzten vom halben Erfolg zur ganzen Niederlage, rappelten sich auf, fingen neu an, Opfer einer Welt, die sie selber schufen, ohne die sie zurückgeworfen würden in alte Zwänge.
Aber stimmte das alles, war Gnievotta so oder anders? Der junge Bodo entsann sich Gnievottas als Autofahrer. Der Vater liebte es, flüssig zu schalten, Fahren als Geschicklichkeitsspiel. Die Spur zu wechseln, sich noch irgendwie durchzuschlängeln, das liebte er. Die er behindert hatte, antworteten mit empörtem Hupen. Das kümmerte ihn wenig. Jetzt und wahrscheinlich immer glaubte er an seine Funktion, glaubte zu steuern, und fuhr doch eingezwängt in Ströme, deren Lauf geregelt; dieses Schild, jene Wegkreuzung bezeichneten die Grenzen der Gnievottas.
Wie lebt er, dachte der junge Bodo, eintönig, ohne Zukunft, wenigstens ohne besondere Zukunft. Jeder Tag gleicht dem vorangegangen. Er kann nicht ausbrechen. Was er leistet, ist belanglos, nicht beschrieben, und es ist vielleicht überhaupt unbeschreibbar.
Oder Gnievotta las Zeitung, so wie er Zeitung liest, gründlich, Satz für Satz. Über den oberen Rand des Blattes lugte sein graues Stichelhaar hervor, darunter war das Gesicht Gnievottas. Die Pupillen hatten fast die gleiche Farbe wie die Augäpfel, ein blasses, kaltes Weiß, ungemein hell. Ihr Blick hatte manchmal eine erstaunliche Kraft, eine lauernde, versteckte Brutalität. Meist war der Blick offen und klar. Ein Abzug auf falsch gewähltem Fotopapier müsste Gnievotta mit leeren Augenhöhlen zeigen und zwei nadelscharfen Punkten, die sich in Wirklichkeit rasch veränderten, größer oder kleiner wurden. Diese Leere, war das der wahre Gnievotta? Über der Nasenwurzel standen zwei senkrechte Falten, von dichten Brauen fast berührt. Starke Falten liefen von der Nase bis in die Mundwinkel.
Gnievotta auf Katjas Maschine schreibend, die nie richtig funktionierte, die stets hängte oder klemmte, deren Farbband immer ein blasses Schriftbild lieferte. Also musste Gnievotta das Farbband wechseln, die Maschine reinigen, sich darüber ärgern, dass irgendein Kamel die Schreibmaschine geölt hatte, musste Typenhebel richten. Dann schrieb er, Wort für Wort, tippte stöhnend mit beiden Mittelfingern an einem Bericht. In diesen Fällen war er nicht ansprechbar; eine Störung brachte ihn in Rage. Seine ganze Haltung drückte Anstrengung aus, der gekrümmte Rücken, die hochgezogenen Schultern; dunkles büschliges Haar sah vorn aus dem offenen Hemd heraus. Ein Stier, der Spitzen klöppelt, ist verhältnismäßig selten. Zu Katja sagte er: «Deren Sorgen da oben möchte ich haben.» Und Katja spielte auch ihre Rolle in diesem Spiel. «Wie bei uns», sagte sie, «Papierkrieg, kenne ich, einer arbeitet, Drei gucken zu.» Gnievotta lachte über diese an nichts und niemand gerichteten Floskeln. Das lag ihm. Er lachte mit weit offenem Rachen, zwei Reihen starker gelber Zähne waren zu sehen, die Wangen hohl, die Lippen rissig. Das könnte auf eine verborgene Krankheit hinweisen, aber Gnievotta war kerngesund. Ruhige, traumlose Nächte verbrachte er, auf dem Rücken schlafend, die großen Hände auf der Brust, sein Kinn sank herab, Schleimfäden sickerten aus den Mundwinkeln, er schluckte im Schlaf. So wie er schlief, so erwachte er auch, ein Ruck ging durch seinen Körper. Gnievotta streckte sich, gähnte und stand sofort auf, mürrisch, übel gelaunt.
Es heißt, von einem Buch gehe eine große Anziehungskraft aus. Niemand, heißt es, könne lange vor einem aufgeschlagenen Buch sitzen, ohne zumindest darin zu blättern, wenn schon nicht zu lesen. Bei Gnievotta war es anders. Auch von Arbeitsgeräten geht eine große Anziehungskraft aus. Eine Maschine, die er noch nicht kannte, war für ihn wie ein Buch, das er noch nicht gelesen hatte. Ständig reparierte er Haushaltsgeräte, nörgelte über seiner Meinung nach ungeschickte Konstruktionen, verbesserte, baute um, stemmte Löcher in Wände, mörtelte, gipste, zog elektrische Leitungen, tapezierte, strich an. Telefonierte er mit Nowacki, so war seine Stimme anders als gewöhnlich. Zustimmende Bemerkungen streute er ein: «Vollkommen richtig» oder «Darum solltest du dich mal kümmern», empört, verständnisvoll, eben anpassungsfähig. Mit Nowacki telefonierte er gern, er bewunderte ihn.
An diesem schwülheißen Sonntag sah Bodo, liefen die Gnievottas durch die Straßen, blieben vor verschlossenen Läden stehen, trafen sich, erkannten sich, schüttelten Hände, gingen in Kneipen, tranken Bier und Schnaps, schrien auf Sportplätzen, studierten Wettergebnisse, notierten enttäuscht die Zahlen der Lotterie, wieder nichts, na ja. Abends stellten sie Radios und Fernseher an, legten Schallplatten auf, umarmten Frauen, lasen, rauchten, stritten sich mit anderen Gnievottas herum.
Wie lange geht das?
Am Spätnachmittag verschwand die Sonne ganz. Sturm hauste in den Straßenbäumen, warf abgestorbene Äste herunter, trieb Staub vor sich her. Die Straßen leerten sich und das Wetter brach los. Ein Platzregen überschwemmte die Stadt. Der junge Bodo saß rauchend in einem überfüllten Café und genoss die Frische, die durch das offene Fenster drang.
Am Vormittag wehte noch leichter Wind, den milchigen Himmel vermochte die Sonne nicht mehr zu durchstoßen. Über dem Waldstreifen wurde der Grauschleier so dicht, dass die Bäume wie in blaue Watte gepackt schienen. Gegen Mittag schlief das bisschen Wind ganz ein, drückende Schwüle lastete auf dem Feld. Jeder Schritt scheuchte Wolken beißlustiger Insekten auf; böse graue oder bunte dreieckige Fliegen bohrten ihre gierigen Rüssel in erhitztes Fleisch, ließen sich durch keine Handbewegung vertreiben.
Von Stunde zu Stunde sank das Barometer, ohne dass sich der Himmel veränderte. Schlaff und bestaubt hing das Laub an den Ästen der Bäume. Die Zitterpappeln an der Straße zum Feld ließen die silbrigen Unterseiten ihrer Blätter sehen, sie vibrierten nur noch leicht. Das Feld, die ganze Natur erwartete das Unwetter.
Etwas abseits vom Bohrfeld standen Rinder, eine kleine Herde auf verbrannter Weide. Gras fanden sie nur noch an tiefer liegenden feuchten Stellen oder unter den Bäumen, in deren Schatten der Boden nicht so ausgedörrt war. Unruhig liefen die Tiere hin und her, legten sich für einen kurzen Augenblick, um, gepeinigt von den großen Bremsen, wieder aufzuspringen, sich anzustoßen und erneut herumzuwandern. Von Hals und Nacken rieselte Blut über das Fell. Ihr Gebrüll hielt seit dem frühen Morgen dieses Sonntags an.
Am Turm war die Schwüle noch größer, hier strahlten heiß gelaufene Maschinen Wärme ab. Kerzengerade, reglos standen Melde, Disteln und harte Gräser auf einem Boden, der wie gewachst glänzte. Alle paar Augenblicke ging einer der Leute unter den Wasserschlauch, spülte Dreck und Schweiß herunter. Lange hielt die Abkühlung nicht vor. Kasch befand sich auf der Aushängebühne, auch Laski und Gnievotta arbeiteten mit. Das heraufziehende Wetter fiel ausgerechnet in eine Arbeitsphase, bei der es um Minuten ging. Kasch trug eine leichte Jacke aus Schilfleinen, als Einziger behielt er die Sachen an, unter der Schwüle schien er nicht zu leiden. Auf seinem Gesicht zeigte sich kein Schweiß, obgleich er sich ebenso wenig schonte wie die anderen. Ein stechender Geruch erschwerte das Atmen; bei der Wärme und Trockenheit begann das Dieselöl zu gasen.
Eine violett schimmernde Wand zog überm Wald auf, ihr folgten schwarze Wolkenberge, streiften beinahe die Baumwipfel. Schwefelgelb leuchtete der Rand des Wolkengeschiebes. Allmählich schloss sich der Himmel um einen gläsernen Fleck. Ein blaugraues schweres Dämmerlicht veränderte alle Farben. Strohblond erschienen die Haare Kaschs, aus dem dunklen Umbra seines Gesichtes schoben sich millimeterlange weiße Bartspitzen, seine untere Gesichtshälfte wirkte wie bereift.
Sie legten eine Pause ein, stellten sich in ein großes Zelt, in dem Zement lagerte. Kasch rauchte jetzt nicht. Bei Gelegenheiten, die ihn stark in Anspruch nahmen, vergaß er seinen Zigarillo. Laski suchte in den Ecken herum, fand einige Brauseflaschen, öffnete sie und reichte sie weiter; das Getränk schäumte lauwarm aus den Flaschenhälsen.
«Schmeckt wie Pisse», sagte Gnievotta.
«Tee ist nicht mehr», sagte Laski. Die großen Thermophoren, die Gnievotta morgens und abends mit Tee gefüllt aufs Feld schaffen ließ, enthielten keinen Tropfen mehr.
«Wasser ist jetzt überhaupt besser», sagte Gresbeck, einer der Leute.
«Warte die Zeit ab», sagte Kosch, «werden bald genug Wasser haben.» Er kaute Sauerampfer, hin und wieder schob er eine Handvoll Sonnenblumenkerne in den Mund. Er hatte stets welche in der Tasche, gingen sie ihm aus und konnte er sich keine beschaffen, behalf er sich mit Mandeln oder Erdnüssen. Zu den Mahlzeiten aß er weniger als die anderen.
Sie traten heraus, spürten aber keinen Wind, nur die Luftfeuchtigkeit hatte anscheinend zugenommen, denn das Feld verschleierte sich merklich. Selbst den Turm, der dicht bei ihnen stand, nahmen sie wie durch Milchglas wahr.
Es wäre die unwiderruflich letzte Bohrung gewesen, die ihn gesehen habe, sagte Laski und wischte sich ein paar Stechfliegen vom Nacken. Seine Handfläche zeigte hellrote Tropfen. Unbegreiflich, aber Laski wurde von allen beißenden Insekten bevorzugt.
Das deute auf gutes Blut hin, sagte Kosch, Laski möge es dankbar als ein Zeichen großer Gesundheit nehmen.
«Quatsch dich ruhig aus», sagte Laski,
«Lass gut sein», sagte Kosch.
Sie rätselten darüber, wie lange das Unwetter noch auf sich warten lassen würde. Laski vermutete, es könne noch Stunden dauern. Kosch stellte die Maschinen ab. Auf dieses Zeichen hin begannen sie festzumachen, was der Sturm wegtragen konnte, und lockerten Zeltleinen.
Noch während sie mit dieser Arbeit beschäftigt waren, überfiel sie unerwartet heftig die erste Bö, straffte Leinen und Ketten, zerrte an den Ankern. Stahl schlug mit hellem Glockenton zusammen, Bolzen und Werkzeug wurden von der Bühne gefegt. Unter der Wucht des ersten Anpralls bog sich die Pappelreihe, grellweiß flammte der Himmel auf. Donner hörten sie nicht. Obwohl Böen über das Feld rasten, Bäume entwurzelten, Masten knickten, setzte ihnen die Schwüle unverändert zu. Auch das Barometer wollte nicht zur Ruhe kommen, es fiel weiter.
«Warum regnet es denn nicht, verflucht noch mal», sagte Laski.
Niemand antwortete, obgleich sie alle dasselbe dachten. Diese brutale Sonne an den Vortagen, diese idiotische Schwüle jetzt machten sie krank, reizbar, nervös. Das Zelt schwankte unter dem Druck des Sturmes. Noch hielten die gelockerten Leinen; wenn der Wind zunahm, würden sie wahrscheinlich nachgeben, und das große Zelt würde wie ein Haufen Lumpen davon getragen werden.
Die Rinderherde stand jetzt dicht beisammen; stoisch, ohne sich zu rühren, erwarteten die Tiere das Unwetter, senkten ergeben die schweren Köpfe.
«Denen wird die Milch sauer», sagte Kasch.
«Milch», sagte Laski, «pfui Deibel.»
Auf dem Bohrplatz herrschte schon ein großes Durcheinander, wie Gnievotta feststellte. Nur mit Mühe blieben die Leute auf den Beinen, und dann brach es los. Es war, als würde der Himmel in zwei Hälften gerissen. Halb geblendet, sah Gnievotta eine schäumende Wand auf sich zukommen. Er flüchtete ins Zelt. Im Handumdrehen verwandelte sich das Feld in einen kochenden See. Derart dicht fiel der Regen, dass sie die Umrisse des Turmes überhaupt nicht mehr sahen. So langsam das Wetter gekommen war, so rasch zog es weiter. Die Leute wateten barfüßig und lachend durch knietiefe Pfützen. Das Ganze hatte weniger als eine halbe Stunde gedauert. Weit und klar öffnete sich der Himmel, leichter Wind bewegte die Bäume, die vor Nässe tropften. Die Abendsonne verlieh dem überfluteten Feld einen hellen weichen Glanz.
Gnievotta versuchte den Jeep in Gang zu bringen. Der abgesoffene Motor gab keinen Mucks von sich. Sie gingen ins Lager, frische Zigaretten wurden angesteckt, Helme in der Hand getragen. Auf dem Feld war so lange nichts auszurichten, wie das Wasser nicht abgelaufen war. Durch die Lachen trotteten behaglich brummend die Rinder heran, den kürzesten Weg nach Hause nehmend. Ihre frisch gespülten, reinen Felle dampften, eine Dunstwolke stand über der kleinen Herde.
Im Lager gab es kein Licht. Laski ging mit einem Trupp los, um die Freileitungen zu kontrollieren und den Schaden, wenn möglich, sofort zu beheben. Das war Laskis Sache. Gnievotta wollte telefonieren, aber der Apparat summte nur, kein Rufzeichen kam. Entweder schwammen die Leitungen im Wasser, oder sie waren vom Sturm zerrissen. Kasch kramte einen alten Spiritusbrenner hervor und stellte den Kaffeekessel auf.
Die Seen verliefen sich schneller als gedacht. Gnievotta wollte aufs Feld. Kasch sagte, es habe keinen Zweck, jetzt rauszufahren. Ohne Licht würden sie nichts machen können. Besser, Gnievotta setze sich auf seinen Hintern und warte die Zeit ab. Es würde noch mehr Regen geben.
Ein paar Augenblicke später bezog sich der Himmel tatsächlich, es begann leicht zu tropfen, klapperte auf das Wagendach. Der eintönige Klang schläferte ein. Kasch brühte Kaffee. Das war mühsam, die kleine Herdstelle brachte nur wenig Wasser zum Sieden, aber geduldig brühte Kasch Kaffee, trank, bot Gnievotta an und füllte etliche Thermosflaschen für die anderen.
Warum Laski so lange wegbleibe, fragte Gnievotta, was da wieder los sei.
«Wird schon kommen», sagte Kosch.
Kaschs Ruhe, sagte Gnievotta, die möchte er haben.
Bei schwachem Nieselregen und zunehmender Dunkelheit fuhr er raus. Nur an wenigen Stellen versanken die Räder noch bis zur Hälfte. Im Scheinwerferlicht des Wagens suchte sich Gnievotta einen trockenen Weg zum Turm. Langsam umrundete er den Turm. Durchnässte Zementsäcke sah er, aber Turm und Maschinenhaus hatten den Sturm heil überstanden. Es hätte schlimmer ausgehen können, fand Gnievotta.
Im Lager brannten Glühlampen, als er zurückkam. Die Mannschaft saß im Geschäftswagen, trank Kaschs Kaffee, aß zu Abend. Ihre Stimmen dröhnten in dem engen Raum.
«In einer Stunde muss raus, was Beine hat.»
Gnievotta erwartete keinen Widerspruch, und niemand sagte etwas Ablehnendes oder Zustimmendes. Es war hartes Personal, hart im Nehmen. Gnievotta wünschte sich kein anderes. Er glich ihnen, oder sie glichen ihm. Manchmal schlug einer über die Stränge, trank zu viel und suchte Streit. Gut entsann sich Gnievotta der ersten schweren Zeit auf abgelegenen Bohrplätzen. Damals gab es noch keine behaglichen und zweckmäßigen Wohnwagen. Die Leute mussten einzeln in dörflichen Quartieren untergebracht werden. Beförderungsmittel war in der Hauptsache das Rad, häufig genug musste es auf dem Buckel durch den Dreck geschleppt werden, es fehlte auch an geeigneter Schurzkleidung, alles war in den Anfängen. Bohrten sie Salzschichten an, dann sogen sich die Jacken häufig mit Lake voll; die Kleidung wurde getrocknet und wieder angezogen. Bei feuchtem Wetter nahmen die Salzkristalle sofort Wasser auf. Nässe ging bis auf die Haut. Pionierzeit. Alle zusammen lebten sie vom Zufall, von dem Augenblick, wo eine Bohrung fündig werden würde, von dem Augenblick also, wo Erdöl aus dem Bohrloch trat, nicht gerade mit elementarer Gewalt, sondern kontrolliert; kein Springer jedenfalls, bei dem ein Gas-Öl-Gemisch hoch aufschoss, sich entzündete, brannte und schwer zu bändigen war.
Kosch berichtete der Bohrmannschaft gerade von einem Bergmann, der an zahlreichen Krankheiten gelitten habe. Sein nahes Ende vor Augen, habe er die Geschichte seiner Leiden erzählt. Schließlich, nach Jahren uralt, sei er wirklich gestorben. In seiner Tasche habe sich ein Zettel gefunden. Darauf soll gestanden haben: Nun seht ihr es, wie krank ich gewesen bin.
«Dann wollen wir mal», sagte Laski, «die Gesunden und die Kranken.»
Gnievotta blieb allein zurück. Später, in der Nacht, kam ein Anruf durch, Nowacki. Die Telefonverbindungen funktionierten wieder. Auch andere Leute waren also unterwegs, um Schäden zu beheben, die Postleute, denen so wenig Gutes nachgesagt wird. Gnievotta redete lange mit Nowacki. Dann bemerkte der Schwager, im Oktober würden sie verlegt werden.
Ob er das gestern noch nicht gewusst habe, fragte Gnievotta.
Offiziell wisse er auch heute noch nichts, sagte Nowacki und fragte, ob ihm Katja nichts angedeutet habe.
Wieso Katja? fragte Gnievotta, Was habe sie damit zu tun?
Sie wisse es sicher von Ani, sagte Nowacki, oder er würde ihre Frauen schlecht kennen.
Das war typisch für Nowacki.
Dann kamen die Trupps herein; den Rest würden sie bei Tage erledigen.
Es regnete. Landregen. Warme große Tropfen durchschlugen den Hemdstoff, sammelten sich zu kleinen Bächen, die angenehm die sonnenverbrannten Schultern kühlten. Zu dritt gingen sie durch das Lager. Die Lichtkegel der Lampen an den Masten leuchteten wie weit geöffnete Augen, in ihrem Schein zitterte das Regengespinst. Leise klirrte das Glas eines schlecht verriegelten Fensters.
Er habe es vorhergesagt, meinte Laski, und er täusche sich selten, sehr selten.
Dunkelheit umfing die drei Männer. Gnievotta hielt das Gesicht in den Regen. Nach diesen Hundstagen erfrischte das linde Wasser, anscheinend ging mit dem Unwetter die Hitzeperiode zu Ende. Überhaupt war es ein merkwürdiger Sommer gewesen. Unbeweglich standen die drei im Regen wie Scherenschnittfiguren. Schwarz hoben sie sich gegen den Lampenschein ab.
«No», sagte Kosch, «hauen wir uns auch hin.» No bedeutete so viel wie gut, in Ordnung.
Ein ausgedehntes Regengebiet wusch den Staub von den Straßen der Städte.
Dies war die Zeit, in der Gnievotta seine Züge noch ungenau berechnete. Er hat den Tag noch nicht erlebt, wo er aufstehen will, wie jeden Morgen, gegen fünf, um das Gas anzuzünden, Wasser für seinen bitteren Kaffee aufzustellen, sich zu rasieren. Er steht nicht auf, er bleibt einen Augenblick länger liegen als gewöhnlich, er ist nicht voll da wie sonst, merkt er. Die Mitte seines Lebens ist überschritten, wird ihm bewusst. Er hat sich erprobt. Kein Gedicht könnte er mehr schreiben, kein Lied mehr singen; keine Frau umarmen, ohne sich zu wiederholen. Gnievotta hat natürlich nie ein Gedicht geschrieben. Frauen hat er dagegen reichlich umarmt, auch Lieder hat er gesungen, bis die anderen gegen seinen Gesang protestierten.
Diesen Gnievotta gibt es noch nicht.
Er steht auf einer Straße, in Sandalen, Hose, Hemd und Weste, ein Netz trägt er über der Schulter. Ohne Eile geht er pfeifend die Straße entlang, das Lockern und Straffen seiner Muskeln genießend. Sein Haar ist vor der Zeit ergraut, aber das macht nichts. Dunkelhaarige ergrauen schneller als Blonde. In einem Gartenlokal sitzt Gnievotta. Das Netz hat er über die Lehne eines Stuhles gehängt. Die Frau neben ihm ist jung. Er wird aufstehen und diese Frau nach Hause begleiten, in ihren Armen wird er liegen und zufrieden sein. Ohne Bedauern wird er sich von dieser Frau wieder trennen.
An einem anderen Tag geht Gnievotta in die Stadtbibliothek. Er hat an diesem Tag Sorgen, er redet sich ein, Sorgen zu haben. Deshalb tritt er ernst und sachlich auf, verlangt bestimmte Bücher, wird an Karteikästen verwiesen, sucht lange, weil er das System nicht durchschaut, findet endlich, was er sucht. Bestellscheine füllt er aus und reicht sie der Bibliothekarin. Die sagt, für diese oder jene Schrift bedürfe es einer Sondergenehmigung, es sei denn, Herr Gnievotta bediene sich der Bücher im Lesesaal des Hauses, unter Aufsicht. Dazu hat Gnievotta keine Lust und auch keine Zeit. Sie nennt die Dienststelle, die Sondergenehmigungen erteilt. Gnievotta erklärt, er brauche die Bücher, er sei Bergbauingenieur, könne sich sogar ausweisen. Es ist ein nettes Mädchen, sieht er, das bei den Männern einen bestimmten geistigen Typ bevorzugt. Sie wolle sehen, sagt die Bibliothekarin und holt den Leiter der Bücherei. Der will sich mit Gnievotta mal unterhalten. Lange betrachtet er den Betriebsausweis Gnievottas und kann eine Ausnahme machen, wenn Herr Gnievotta die Sondergenehmigung nachreicht. Gnievotta erhält also die Bücher. Eine Bescheinigung wird er nicht bringen, die Bibliothek wird er nur noch einmal betreten, um die Bücher zurückzubringen, nach zwei, drei Mahnungen. Die Bücher nutzten ihm auch nichts, sie lagen zu Hause herum, bis Katja fragte: «Was wird denn mit den Schwarten?»,
In einer Dorfkneipe. Gnievotta muss einen Streit schlichten, muss seinen Leuten sagen, haltet Ruhe hier, sonst schick ich euch nach Hause. Eindeutig gehört seine Sympathie seiner Mannschaft, die Dorfbengels haben sie herausgefordert. Wenn ihre Mädchen keiner anfassen darf, dann sollen sie die Ischen gefälligst zu Hause lassen. So einfach.
Gnievotta bei einer Demonstration. Am Rande des Marktes der Kleinstadt sind Buden aufgestellt, dort hat sich Gnievotta schon ein paar Biere genehmigt und Laski und Kasch dabei verloren. Während der Rede müssen die Budiken schließen. Das ist so, weil sonst der Marktplatz zur Hälfte voller Besoffener sein würde. Gnievotta schiebt sich zur Tribüne durch. Vielleicht treiben sich Laski und Kosch da vorn herum. Gnievotta fasst die Arme und Hüften der Frauen an, es sieht zufällig aus, absichtslos. Gnievotta hat einen besonderen Griff, und das fällt in dem Gedränge kaum auf. Er tut es eben und quittiert die empörten oder Einverständnis ausdrückenden Reden der Frauen mit einem Augenzwinkern.
Das alles wird so lange gehen, bis dieser Morgen kommt, wo Gnievotta eine große Müdigkeit aus den Gliedern schütteln muss, um überhaupt hochzukommen. Er wird einen langen Augenblick brauchen, um sich darüber klar zu werden, was denn eigentlich mit ihm geschehen ist. Körperlich fühlte er sich am Vortage ganz in Ordnung. Er hat nichts getrunken, hat nichts getan, was seinen Zustand erklären könnte. Beim Rasieren sagt er sich, dass es eine Art Erschöpfung ist. Einem Springer gleicht Gnievotta, der siebenmal die Latte legen ließ, ebenso oft scheiterte und nicht mehr den Mut für einen neuen Versuch aufbringt, der alt und zaghaft wird.
Das ist es. Und mit diesem Gefühl wird Gnievotta jetzt jeden Tag aufstehen, sich in den neuen Zustand einleben und schließlich dahin kommen, vorsichtiger mit sich umzugehen. Vor sich selber wird er den alten, überwundenen Zustand als seine späten Flegeljahre bezeichnen, als den Abschluss einer bestimmten Zeit seines Lebens. Er muss Distanz dazu halten; Träume sind Sache der Jugend.
Da man die Gnievottas überall trifft, ist auch das möglich: In Schikoras Sitzungszimmer hockt Gnievotta eingezwängt zwischen anderen. Schikora ist nun mal kein Redner. Er verhaspelt sich. Gnievotta nimmt einen Witz auf. Er lacht. Sein Lachen steckt an. Schikora muss sagen: «Genossen, wir sind hier nicht im Zirkus.» Nun lacht die ganze Bande, denn Schikora weiß nicht, dass die Leute den Betrieb Zirkus Schikora nennen, ein Vergleich, der aus manchen Gründen naheliegt. Schikora ist ohne Humor. Er hat den Tag schon erlebt, den Gnievotta noch vor sich hat ...
Gnievotta, Kosch und Laski aßen Büchsenfleisch, Eier und Brot. Dazu trank Kosch seine Morgenration Korn und heißen Kaffee. Laski und Gnievotta tranken nur Kaffee. Es war ein starkes Frühstück, Fleisch, Eier.
Seit dem Unwetter Mitte September war es Herbst geworden. Die Kette kühler und regnerischer Tage war nicht wieder abgerissen. In den Wohnwagen lieferten die elektrischen Anlagen Wärme. Kosch hätte zur Schicht müssen, wäre der Anruf kurz vor sechs nicht gekommen, der sie alle drei nach Magdeburg rief. Die in der Zentrale wussten gut, wann sie die Leute antrafen und wann nicht. Zwischen Essen und Trinken erzählte Kosch gerade seine Morgengeschichte von einem Bergmann, der zum Arzt ging. Mancherlei stellte der Doktor fest, herausgesprungene Bandscheiben, bisschen Staublunge und dergleichen Kleinigkeiten. Der Mann sagte, er fühle sich gesund, aber er brauche Tabletten für seine Frau, die in letzter Zeit an Schlaflosigkeit leide. Ob das ginge?
Kosch suchte in den Taschen nach Zigarillos, aber er fand keine. Aus der Schublade seines Schreibtisches kramte Gnievotta eine Schachtel heraus und gab sie ihm.
«Das ist sehr aufmerksam von dir», sagte Kosch. Freundlich richtete er seine Geieraugen auf Gnievotta.
Ohne den Anruf hätte Kosch des Regens wegen die Gummijacke genommen und den Helm, mit einem kurzen Gruß wäre er zur Schicht gegangen. Er ging auch wirklich zum Schrank und nahm sein Zeug heraus.
Gnievotta suchte einen Mann, der zum Bohrfeld fuhr; und erteilte ihm ein paar Aufträge, vermutlich würden sie erst spät zurückkehren. Sie mussten sofort losfahren, wollten sie noch rechtzeitig in der Zentrale sein. Den Geschäftswagen schloss er nicht ab, er hätte ihn auch verschließen können. Hier nahm niemand mehr einen Anruf entgegen. Während sie fuhren, Laski am Steuer, berichtete Kosch weiter von dem Bergmann, der einen Bengel im Bootsschuppen aufgegabelt habe, als der an Benzinmotoren bastelte, offensichtlich ohne was davon zu verstehen. Nicht mal einen Vergaser habe der Junge richtig einstellen können. Aus Barmherzigkeit habe der Bergmann den Jungen in die Kohle geholt, um einen Menschen aus ihm zu machen, was auch teilweise gelungen sei.
Na, na, sagte Laski über die Schulter hinweg zu Kosch, der Bengel habe weder spielen noch trinken können, von Arbeit zu schweigen. Die erste Schweißnaht von dem Bengel habe Laski einem Nervenzusammenbruch nahe gebracht. Kaum mehr als einen großen Säugling habe Kosch angeschleppt. Ob Kasch sich noch daran erinnere, wie der Junge auf dem Förderzeug stand? Nicht mal dort wäre er zu gebrauchen gewesen.
«Nicht mal das, no», bestätigte Kasch. Überhaupt sei doch nicht so viel mit dem Jungen los gewesen, eine Lusche, kein schönes Spiel mit Luschen.
Das war eine von Koschs Morgengeschichten. und Gnievotta fragte, ob Kosch nicht mal was anderes drauf habe.
Woher er wisse, dass von ihm die Rede sei, fragte Laski, von Gnievotta, dem bedeutenden Ingenieur? Nicht alles auf sich beziehen dürfe Gnievotta, das erwecke nur einen schlechten Eindruck. Von einem Mann werde Selbstachtung erwartet, eine Eigenschaft, die Gnievotta wohl nicht besitze, seinen Bemerkungen zufolge. «Aber auch Zurückhaltung wird verlangt», sagte Kosch ernsthaft zu Laski.
Gewiss, auch Zurückhaltung, aber erst in zweiter Linie, sagte Laski, man könne hier nicht alles erörtern, was einen Mann auszeichnen müsse, der einem Trupp von dreißig Mann vorstehe, nur soviel solle noch gesagt werden, der betreffende Bengel, also nicht Gnievotta, sei nur unter großen Mühen erzogen worden.
«Sehr großen Mühen», sagte Kosch.
«Ach, leckt mich doch», sagte Gnievotta.
Schikora und Glücksmann erwarteten sie. Das Zimmer Schikoras lag in einer niedrigen, winterfesten Baracke. Die ganze Zentrale bestand aus solchen eilig errichteten Bauten. Die Baracken glichen einander, ein Mittelgang führte durch sie hindurch, links und rechts gingen die Zimmer ab.
Schikora fragte, ob sie den Anruf noch rechtzeitig bekommen hätten, was überflüssig war, denn sonst würden sie nicht hier sein, und Glücksmann setzte hinzu, er habe das Gespräch abends angemeldet, sei aber erst gegen Morgen verbunden worden.
«Setzt euch doch», sagte Schikora, «wir haben mit euch zu reden.»
Glücksmann erklärte, wegen bestimmter Strukturveränderungen in der VVB läge ihr nächstes Bohrfeld weit im Norden, auf Usedom. Zu überstürzen brauche man nichts. Mit dem Abbau der Anlage könne nach Erreichen der geplanten Bohrtiefe begonnen werden. Vor November oder gar Dezember seien die Vorarbeiten der Geologen mit Sicherheit nicht abgeschlossen. Nowacki, der Chefgeologe, habe in der vergangenen Woche allen Betriebsleitern eindringlich die Schwierigkeiten dargelegt, mit denen die Geologen zu kämpfen hätten. Diese Probleme würden ihre Arbeit jedoch im Augenblick nicht berühren. Nowacki ließe sich im Übrigen nicht drängen.
«Wenn die Könige bauen, kriegen die Kärrner Arbeit», sagte Kosch.
Mit Glücksmann verband sie wenig, der war ein Büromensch, kein Bergmann. Nicht seine fehlende Praxis oder umgekehrt ihr Mangel an Verständnis für ökonomische Fragen trennte sie, sondern Glücksmanns Hang zu langen doppeldeutigen Reden, seine Geheimniskrämerei. Anders Schikora. Der kam aus der Braunkohle, ein misstrauischer, wenig umgänglicher Mann, zu Wutausbrüchen neigend, die er durch übertriebene Freundlichkeit an den Betroffenen wiedergutzumachen suchte.
Das Hin und Her führe zu nichts, sagte Kosch, Zeit müsse man sich bei der Bodenerkundung schon lassen.
«Ja», sagte Schikora bissig, «Zeit, ein oder zwei Jahre pro Bohrung, wie's beliebt. Am besten holt ihr bloß noch euer Gehalt ab.»
«Davon ist keine Rede», sagte Kosch ruhig.
Sie könnten den Haufen Schrott liegenlassen, wo er läge, warf Laski ein, dort liege er gut.
«Zur Ausrüstung kommen wir noch», sagte Schikora. Auf seinen Wink fuhr Glücksmann fort, ihnen die neue Sache vorzutragen. Gnievotta schrieb mit und fing einen lauernden Blick Schikoras auf. Die Zeiten lagen kürzer als gewohnt. Nervös schob Schikora die Gegenstände auf seinem Schreibtisch hin und her, eine kleine Grubenlampe, Mineralbrocken, Schreibzeug.
Gnievotta fragte nach dem Stand der Vorarbeiten.
Die geophysikalischen Karten seien noch nicht da, sagte Schikora verdrossen, sie kämen aber rechtzeitig, wie er hoffe.
«Schlamperei», sagte Laski,
Schikora lief rot an, beherrschte sich aber und lenkte ein. Die Montagezeiten seien so berechnet, bemerkte er, dass sie mit der Geologenarbeit parallel liefen.
Gnievotta erklärte, auch sie brauchten Vorbereitungszeiten, wie Schikora ja gut wisse. Die Sache scheine am grünen Tisch gemacht, was ihm bei dem gründlichen Nowacki doch mehr als wundere.
«Der lässt sich nicht drängen», sagte Schikora.
Die drei saßen vor Schikoras Schreibtisch, in ihren Jacken und Cordhosen. In der Zimmerwärme blätterte der Dreck von den Gummistiefeln. Trotz der Enge schien Gnievotta das Barackenzimmer behaglich. Nicht, dass er sich solche Einrichtung gewünscht hätte, das nicht. Sie wäre draußen in vier Wochen hinüber gewesen, weil sich die Möbel entleimt haben würden. Aber sie machte ihm doch den Unterschied zwischen draußen und Zentrale deutlich.
«Der genaue Standort ist bekannt?», fragte Gnievotta, wissend, dass der Betriebsleiter diese Frage nicht beantworten konnte.
«Ungefähr nur», gab Schikora zu.
«Da hätten wir ja zu Hause bleiben können», sagte Kosch.
Solche Anordnungen, sagte Schikora wütend, träfe er ganz allein und nach eigenem Ermessen. Vor allem habe er mit Gnievotta zu reden. Kosch und Laski könnten gehen; vernünftig sei mit ihnen doch nicht zu verhandeln.
Als Kosch und Laski draußen waren, sagte Schikora, ihm läge daran, Gnievotta ernsthaft ins Gewissen zu reden. Von Mal zu Mal sänke die Leistung an seiner Anlage. Allgemein gesprochen, kämpfe der ganze Betrieb mit großen Schwierigkeiten, aber auf anderen Bohrplätzen kämen die Leiter weitaus besser zurecht. Eine solche Schluderei wie bei ihm, Gnievotta, sei sogar in seinem, Schikoras, Betrieb die Ausnahme. Ein für allemal wären die gemütlichen Zeiten vorüber, wo man ihnen als jungem Industriezweig manches nachgesehen, auch deshalb, weil Vergleichswerte gefehlt hätten. Geld verdienen, viel Geld verdienen, einverstanden, aber nicht ohne die entsprechende Leistung. Er sei auch bereit, für eigene Versäumnisse und Fehler einzustehen. Vieles würde er decken, aber nicht alles. Was Gnievotta darauf zu antworten habe?
Gnievotta redete von erschwerten Situationen, wetterbedingt oder nicht, von schleppenden Materiallieferungen.
«Wetter», sagte Schikora ironisch. «In Sibirien werden bei vierzig Grad minus Bohrungen niedergebracht.»
«Hier ist nicht Sibirien», erwiderte Gnievotta, «wir haben auch keine Leute mit fünfzigjähriger Erfahrung.» Weiter sagte Gnievotta, die Bohrköpfe, namentlich die Düsenrollenmeißel, würden zu schnell verschleißen. Ein Großteil der geplanten Standzeit werde für zusätzliche Reparaturen aufgewendet.
«Du hast den Reparaturplan selber ausgearbeitet», sagte Schikora, «nun arbeite auch damit.»
«Die Lage hat sich eben verändert», sagte Gnievotta, «Tiefbohrungen lassen sich nun mal nicht optimieren wie andere Produktionen.»
Abreibungen wie diese liebe er nicht, fuhr Schikora fort, aber es nutze ja nichts, Offenheit sei das Beste. Ob Gnievotta vielleicht selbst das Gefühl habe, seiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein? Da Gnievotta schwieg, verkündete Schikora, man könne Zielprämien stellen, den Wettbewerb organisieren, materielle Stimuli einsetzen, den Reparaturplan neufassen, mal wieder Lenin lesen. Überhaupt sei es eine politische Frage, wie alle Fragen. Gnievotta solle erst mal seinen Resturlaub nehmen, nicht erst zum Jahreswechsel, wenn die Arbeit da oben richtig losgehe. Da sei auch was eingerissen. Manche verteilten ihren Jahresurlaub so, dass aus drei möglichst sechs Wochen würden. Da könne plötzlich jeder rechnen. Das gehe natürlich nicht. Er hoffe, nach dieser Kopfwäsche werde sich Gnievotta wieder fangen.
Später, als Gnievotta mit Glücksmann allein weiter beriet, sagte der, er habe sich während des Studiums am wohlsten gefühlt. Da sei immer alles geregelt gewesen, anders als in dieser belämmerten Praxis. Er goss zwei kleine Gläser mit Weinbrand voll, trank und schüttelte sich. Wie Gnievotta mit Kosch und Laski, den beiden Querköpfen, zurechtkäme, fragte Glücksmann.
«Wir kennen uns lange», sagte Gnievotta.
«Es war auch nur laut gedacht», sagte Glücksmann.
«Steh gerade für das, was du laut denkst», sagte Gnievotta.
In der Kantine fand er Kosch und Laski; um einen kleinen Tisch herum saßen die Alten, rauchend und trinkend. Man sah sich ja nicht oft. Gnievotta legte Kosch die Hand auf die Schulter. «Trink nicht mehr», sagte er, «wir müssen zurück.»
«No», sagte Kosch, «wart noch einen Moment.»
Es wurde Abend, ehe sie loskamen. Wieder fuhr Laski den Wagen, und Kosch erzählte seine Abendgeschichte von dem Bergmann, der keiner war. Aus purem Mitleid habe er den Bengel nach Senftenberg mitgenommen. Der Junge habe was in den Schultern gehabt, was zu bestimmten Hoffnungen berechtigte. In der Tat sei es auch nach vielen Schwierigkeiten gelungen, aus der Lusche einen Menschen zu machen. Eine feine Frau habe er mitgebracht, damals, und trotzdem das Bocken nicht lassen können.
«Unter Tage ist er aber nie gewesen», sagte Laski.
«Allerdings nicht», sagte Kosch.
Also könne man auch nicht wissen, was für ein Bergmann er geworden wäre, sagte Laski.
«Auch das stimmt», sagte Kosch.
«Und er hat den Mund nicht aufgekriegt»; sagte Laski, «vorhin. Vor jeder Papiergröße geht er in die Knie, ein schöner Bergmann, pfui Deibel.»
Dieses Gerede wurde Gnievotta mindestens zweimal wöchentlich angeboten. Manchmal wehrte er sich dagegen, was die Fantasie der beiden erst recht beflügelte.
Während der Rückfahrt sang Kosch, Laski fiel ein, der Wagen schwankte von einer auf die andere Straßenseite.
«Halt sofort an», befahl Gnievotta.
«Stop», sagte Kosch, «der große Gnievotta will was zum Besten geben.»
Gnievotta setzte sich ans Steuer und hoffte; dass sie auf keinen Streifenwagen träfen. Es kam keiner, die Nacht war still, die Straßen so gut wie leer.