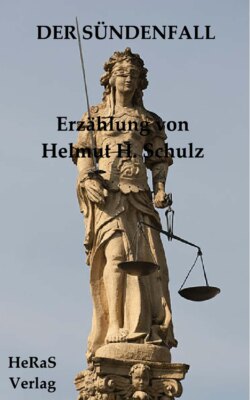Читать книгу Der Sündenfall - Helmut H. Schulz - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel I
ОглавлениеDie Gemeinde Groß-N. zählte 1945 etwa zweitausend Einwohner, soviel wie heute in einem großstädtischen Hochhauskomplex untergebracht werden können. Der Ort zerfiel räumlich und sozial in zwei Hälften, das Dorf und die Siedlung. Landwirtschaftliche Nutzflächen fehlten der Siedlung, dafür hatte sie die schönere Umgebung zwischen einem See und einem Fluss. Ein breiter Streifen Niederung, der seltenen Wasservögeln, Lurchen und Schlangen Lebensraum bot und den Fressern dieser Tiere - Storch, Weihe und Reiher -, machte sie zu einem malerisch schönen Ort. Die eigenartige Natur des Flussgebietes hatte die Siedlung überhaupt erst entstehen lassen. Anfang der dreißiger Jahre siedelten hier vereinzelt Großstädter, bauten Lauben und kleine Wochenendhäuser, zäunten Parzellen ein und verbrachten ihre freie Zeit in den Gärten und am See. Elektrisches Licht galt als Luxus und gutes Wasser, das aus kleinen Brunnen von Hand gepumpt wurde, als ein Segen.
Diese Verhältnisse blieben im Großen und Ganzen bis ins Jahr 1960 erhalten. Zwar wurde im Dorf eine Genossenschaft gegründet, aber nur wenige Bauern traten ihr bei; die Mehrzahl arbeitete in der herkömmlichen Weise, verkaufte Holz aus eigenen Wäldern, wenn die Ernte schlecht ausfiel, und züchtete Schlachtvieh.
Zwischen dem Dorf und der ungefähr zwölf Kilometer entfernten Kleinstadt verkehrte seit den zwanziger Jahren ein Autobus; zuerst ein postalischer, dann erhielt ein Fuhrunternehmer die Konzession. Der Autobus 7 transportierte Dörfler wie Siedler bis zur Bahnstation der Kleinstadt, von dort bestand eine Eisenbahnverbindung zur Großstadt R.
Die Flächenbombardements machten zahlreiche Menschen obdachlos. Wer konnte und schon vor dem Krieg hier Wochenendbehausungen besessen hatte, zog sich ganz nach Groß-N. zurück, um das Ende des Krieges abzuwarten. Die zur Arbeit Verpflichteten mussten allerdings weite Wege zu ihren Dienststellen in Kauf nehmen, ein Ausweg in auswegloser Lage. Die Zeit unmittelbar nach dem Kriege änderte diese von selbst entstandenen Bedingungen nicht sogleich, obschon viele der in Lauben und Holzhütten mehr schlecht als recht Lebenden gern wieder in die Stadt zurückgegangen wären; sie galten als Landbevölkerung, erhielten Lebensmittelkarten, aber die niedrigsten Rationen, und standen furchtbare Winter durch, ohne feste Häuser, ohne Kohlen, die der Landbevölkerung verweigert wurden. Wem es möglich war, der versuchte sich selbst zu helfen, fing an, den Garten besser zu bestellen, düngte, säte und pflanzte Kartoffeln, züchtete oder hielt zumindest Kleinvieh, Hühner, Kaninchen, Enten. Manch einer rang der Natur seinen Lebensunterhalt ab, aber ringen ist der falsche Ausdruck, die Natur spendete nach den ihr eigenen Regeln. Trockenheit, Kälte und Unwetter machten häufig alle Bemühungen zunichte. Andererseits gab es auch reiche Ernten. So wurden aus den Stadtflüchtlingen Sesshafte, die in der Umgebung Arbeit fanden. Später waren sie eine Bereicherung für die umliegenden Ortschaften, lebten nebeneinander und miteinander, in Frieden und Streit, und wenn es stimmt, daß in solch kleinen menschlichen Gemeinschaften alle Wege überschaubarer sind als in der Stadt, so war Groß-N. ein Beleg dafür.
Überschaubar ist das Leben in Dorf und Siedlung gewesen. Jeder wusste, was jeder tat, wovon und wie er lebte; Toleranz erzeugte diese Kenntnis aber nicht. Viel gefehlt hätte nicht, und die Bewohner der Gemeinde Groß-N. wären mit Axt und Schwert aufeinander losgegangen, wie in alten Zeiten, um ihre Konflikte zu lösen. Es geschah genug, was erzählenswert ist, so idyllisch fossil wie die Natur war auch die Menschenwelt dieser Gegend in der Zeit, in der unsere Geschichte beginnt.
In der Siedlung lebte ein Mann. Er war gegen Ende des Krieges in eines der Häuser gezogen, weil er seine Stadtwohnung verloren hatte. Von Beruf Handwerker, schon nicht mehr jung und schwer verwundet aus dem Krieg entlassen, musste er als Dienstverpflichteter in einer der nahe gelegenen Fabriken arbeiten. Nach dem Krieg änderte sich daran nichts, morgens fuhr er mit dem Bus, mit der Eisenbahn in den nun schon volkseigenen Betrieb, abends machte er dieselbe Tour zurück. Er bestellte seinen Garten, zog Kleinvieh, besserte an seinem Haus herum und reparierte nebenbei die Maschinen der Bauern. Diese mochten ihren Hermann Zander wegen seiner Gewissenhaftigkeit, seines Fleißes und seiner Erfindungsgabe. Leicht hätte er sich selbstständig machen können. Mit einem Reparaturbetrieb wäre er gut gefahren, zumal er bald nach dem Krieg eine Frau genommen hatte, die zu ihm passte wie keine Zweite. Eine ihm selbst nicht ganz erklärliche Furcht oder Zukunftsangst hielt ihn ab, seine sichere Stelle in der Fabrik gegen das unsichere Leben eines Selbstständigen einzutauschen. Es gab noch ein Hindernis. Gegen Ende des Jahres 1945 war Zander in die Kommunistische Partei eingetreten; er hatte geglaubt, in dieser Partei und mit ihr in eine bessere Zukunft zu marschieren, und darüber nachgedacht, ob und wie viel Schuld an der Hitlerherrschaft und am Krieg ihn traf, und war zu dem Schluss gekommen, daß die Kommunisten am saubersten dastanden. Wie die neue Welt, die sie versprachen, aussehen würde, das konnte sich Zander nicht ganz vorstellen. Zunächst tat er, was ihm die Partei sagte, ohne zu prüfen, wie viel daran richtig und wie viel falsch, wenn überhaupt etwas falsch war. Er trieb im Strom der Zeit mit denen, die auch entwurzelt waren und neuen Grund suchten.
Er kannte noch die Jahre der Weimarer Republik mit ihren Parteien und Auseinandersetzungen. Damals war er nicht auf den Gedanken gekommen, sich einer der Parteien anzuschließen. Ihn verwirrten das ihm unerklärliche Chaos in der Politik und die Gewalttätigkeiten. Die Krise 1929 machte ihn, den zwanzigjährigen Werkzeugmacher, nicht brotlos. Er hatte Glück, aber von der Sache selbst, der sozialen Katastrophe, der Massenarbeitslosigkeit, begriff Zander nicht viel. Mit der Regierung Hitler - es sind immer Namen, die im Gedächtnis bleiben, nicht die Systeme - sah Zander endlich Ordnung einziehen. Der Partei Hitlers trat er nicht bei, aber er hielt sich an diesen Reichskanzler. Im Krieg, der bald darauf ausbrach - für Menschen wie Zander bricht immer aus, was nicht vorhergesehen wird -, zog er nach Polen, trug als Dreißigjähriger sein Feldgrau nach Frankreich, wurde bei Kertsch schwer verwundet und nach langem Lazarettaufenthalt aus der Wehrmacht entlassen. Bald darauf kam er nach Groß-N.
Etwas tat er nicht, er nahm kein Land aus dem Bodenfonds, wie ihm geraten worden war, er lehnte es ab, Bauer zu werden. Zander fühlte sich als Handwerker, und er verfügte auch über alle guten Eigenschaften eines Handwerkers. Im Laufe der Zeit eignete er sich gleichsam nebenher Kenntnisse über landwirtschaftliche Maschinen an, baute um, konstruierte und erhielt am Leben, was ohne ihn auseinandergefallen wäre. Mitte 1950 entstand die Genossenschaft in Groß-N., Zander konnte kein Mitglied werden, dazu hätte er einen Anteil einbringen müssen, den er nicht besaß, aber er übernahm die Reparaturwerkstatt als Leiter. Für die bäuerlichen Genossenschaftler wie für die selbstständig gebliebenen Universalbauern - bis 1960 gab es noch welche in Groß-N. - war Zander unbezahlbar, denn es mangelte an allem, jede Schraube war kostbar, jeder Reifen eine Rarität.
In freien Stunden war Hermann Zander ein geselliger Mensch, der gern Leben um sich hatte, und gutmütig wie häufig in sich ruhende Leute mit beschränktem Aufnahmevermögen. Er wirkte männlich; bei den geltenden Wertvorstellungen auf dem Lande musste Zander auffallen. Körperbau und Gesichtsausdruck - Zander war groß und kräftig, hatte blaue Augen und dichte schwarze Brauen bei vollem, ergrautem Haupthaar - passten in die Vorstellungen der Bauern von einem Könner. Immer sauber gekleidet, mäßiger Trinker, war er auch von den Frauen geachtet.
Zanders erste Frau und seine beiden Kinder waren in der Stadtwohnung verbrannt; diese Nachricht erhielt er während seiner Genesung im Lazarett. Nach seiner Entlassung aus der Wehrmacht versuchte er gar nicht mehr, in der Stadt ein Quartier zu bekommen, sondern ging direkt nach Groß-N.; dort fand er seine zweite Frau unter den Flüchtlingen aus dem Osten. Das Dorf musste einige Familien aufnehmen, aber die Bauern wehrten sich jäh und oft erfolgreich gegen die unliebsamen Einquartierungen. Die leer stehenden Wochenendhäuser in der Siedlung boten denen eine notdürftige Bleibe, die anderswo nicht untergekommen waren. Zander nahm eine alte Frau und deren Tochter auf. Sein Haus hatte zwei Zimmer, eine Küche und eine Veranda, die im Winter eiskalt war. An Sachen besaßen die Frauen, was in einen Koffer und in einen Persilkarton hineinging. Die alte Frau lebte nur noch ein paar Monate; sie wurde auf dem Dorffriedhof beigesetzt. Kurz danach heiratete Zander die junge Frau. Georg wurde 1946 geboren, er blieb das einzige Kind dieser Ehe.
Maria Zander, geborene Klett, war etwas kleiner als ihr Mann, also von Mittelgröße. Ihr rundes weiches Gesicht wäre eines vom Dutzend gewesen ohne den Ausdruck heiterer Sinnlichkeit. Es ist schon vorstellenswert: Da lebte einer mit Frau und Kind so um die frühen Fünfziger in einer ordentlichen Welt, in der er sich als Herr fühlte. Frau und Sohn waren ihm zwar nicht untertan, standen aber seiner Anschauung nach in der Rangfolge unter ihm. Er herrschte; trotzdem waren sie glücklich oder doch zufrieden mit ihrem Leben. Es hätte ihnen schlechter gehen können, als es ihnen ging. Geld bedeutete beiden viel, aber nicht alles. Zu kaufen gab es ohnehin nichts. Er half, sie half, Freundschaft war noch nicht zur Beziehung verkommen, der Vorstufe zur Korruption. Sie brauchten nicht viel, wünschten nicht, was sie nicht haben konnten, und erwarben unter Anstrengung, was sie brauchten. Zum Beispiel bauten sie lange an dem Haus herum. Wem das Wort Glück zu abgegriffen ist oder unpassend für diese kümmerliche Eintracht, der möge ein anderes für den Zustand finden, in dem die Familie Zander lebte.
Mittelpunkt ihres Interesses wurde mehr und mehr Georg; das Bürschlein regierte in Haus und Garten, wie Spätgeborene und Einzige regieren. In althergebrachter Weise fürchtete die Mutter um seine Gesundheit, obschon es keinen Grund zur Besorgnis gab. Dem Vater lag die geistige, und das heißt hier die moralische Entwicklung des Jungen am Herzen. Er sollte nicht hinter dem zu fordernden Maß an Verstand, Geschicklichkeit, an Ehrgefühl und männlichem Mut zurückbleiben. Georg aß und trank und wuchs und lernte leicht, was ihm vom Vater gezeigt wurde. Allerdings war er ohne Konkurrenz im Wohnhaus und in der häuslichen Werkstatt und späterhin auch unter den Kindern des Dorfes. Nicht immer mag diese Art Erziehung anschlagen; trägere Kinder brauchen vielleicht andere Eltern.
Jedes Haar hat seinen Schatten, jede Ameise ihren Zorn. Daher war auch den ordentlichen Zanders kein ungetrübtes Glück beschieden, und da wir bei den Kernsprüchen sind, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn's dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ausgerechnet diesen Pedanten waren Nachbarn gegeben worden, die alle fünfe gerade sein ließen. Stand Zanders Haus sauber verputzt, mit neuen Schornsteinköpfen und weiß lackierten Fensterrahmen da, war der vordere Teil ihres Gartens immer gepflegt und der hintere wenigstens aufgeräumt, hielt sich das Zandersche Kleinvieh in Volieren und Ställen auf, so hing bei Behrends der Schornstein schief über dem Dachgiebel, senkte sich der Firstbalken, Ziegel lösten sich, Farbe blätterte von den Holzrahmen. Behrends Hühner suchten sich Schlupflöcher im Zaun und drangen in Zanders Garten ein; sie scharrten Pflanzen und Blumen heraus.
Behrend hatte es mit Frau und Kindern auf ähnliche Weise in die Siedlung verschlagen wie Maria Zander, allerdings etwas später. Der aus dem Sudetenland vertriebene Bauer bekam 1946 Land aus dem Fonds der Bodenreform, erhielt eine Kuh, etwas Hausrat und Gerät. Als Landwirt, als Neubauer, wurde ihm zunächst viel geholfen, mit Geld und Saatgut. Das aber hörte bald auf, und Behrend war nicht geschickt genug, nicht genug rechnender Bauer, um sich unter diesen Bedingungen selber aus dem Dreck zu ziehen. Er war ein knochiger, kleiner Kerl von sanguinischem Temperament, liebte Bier und Schnaps. Seine beiden Söhne leisteten ihm beim Trinken Gesellschaft, als sie das Alter erreicht hatten und dem Vater als Saufkumpane beistehen konnten.
Zuerst war die Reaktion der Zanders auf die Nachbarn nachsichtig. Dass die Hühner gelegentlich bei ihnen Schaden anrichteten, wollten sie nicht überbewerten. Zander sprach Behrend an, bat ihn, seinen Zaun zu reparieren oder die Hühner einzusperren. Behrend versprach es, lamentierte herum, er habe alles verloren und müsse sich erst wieder zurechtfinden; ihm, dem Heimatvertriebenen, fehle es an Werkzeug und Material, auch an Geld. Zander hörte sich dieses Gerede ruhig, nicht ohne Verständnis und Mitgefühl an und erbot sich zu helfen. Von gleich und sofort war bei Behrend keine Rede, dagegen viel von morgen und übermorgen. Aber er lud den Nachbarn zu einem Schluck ein, wenn man schon mal dabei war, Brüderschaft zu schließen. Es war ein Sonntag, und Zander wollte nicht für hochnäsig gelten; er trank aus der hingehaltenen Flasche. Dann wurden die Frauen gerufen. Bald aber ging jeder wieder in sein Haus. Bei den Zanders war man sich einig, daß dieser krumme Vogel nicht recht in die nördliche Gegend passe. Keineswegs könne von Freundschaft die Rede sein. Nicht von Freundschaft, aber auch nicht mehr vom Zaun wurde geredet, bis Zander eines Tages eine Rolle Draht nahm, Holzpfähle einbuddelte und die Seite zum Nachbarn sicherte. Mit Dank hatte er nicht gerechnet, war aber doch erstaunt, als sein Nachbar vieles daran auszusetzen fand, vor allem aber versicherte, er verfüge im Augenblick nicht über die Mittel, den Maschendraht zu bezahlen. Hierauf sagte Zander, er habe auch nicht mit Bezahlung gerechnet. Er lachte zwar über die Dummheit und Frechheit des kleinen krummen Kerls, aber er ärgerte sich doch und schwor sich, nie mehr in dieser Weise einzugreifen, wenn es sich vermeiden ließe.
Der Mangel an Können und Wissen, die innere Haltlosigkeit bei Behrend, gingen bis zur Unfähigkeit zu planen. Um seine Lage zu verbessern, erfand er immer neue Rezepte; mal züchtete er Tauben, die sich einem wilden Schwarm anschlossen und auf Nimmerwiedersehen verschwanden, ein andermal kaufte er Ponys, wollte die Nachzuchten an den Zirkus verkaufen, und Ähnliches mehr, was Anlass zum Spott gab. An und für sich waren manche seiner Unternehmungen wirklich gut und hätten Geld einbringen können, wäre Behrend geduldiger gewesen. Diesem kleinen Klaus Behrend misslang stets, was dem großen Klaus Zander Gewinn einbrachte. Behrend beklagte sich viel, und Zander konnte ihm auch nicht ausweichen, dazu war der kleine krumme Kerl einfach zu komisch. Die Familien redeten kein überflüssiges Wort miteinander, aber sie redeten das Notwendige unter Nachbarn.
Behrend trat sofort nach ihrer Gründung der Genossenschaft bei, schon deshalb, weil sie etwas Neues war und er überall mitreden wollte, aber seine Lage besserte sich vorerst nicht, es änderte sich nur etwas an dem Verkehr der Familien untereinander. Bislang hatte Zander seinem Nachbarn aus dem Wege gehen können, wenn er es wollte; ab jetzt traten die beiden in eine neue Beziehung zueinander. Was Behrend im Kleinen getan oder unterlassen hatte, das betrieb er jetzt im Großen. Nur, im Kleinen konnte Zander nachsichtig sein und die Sache mit einer Rolle Draht aus der Welt schaffen, im Großen bedeutete die Schlamperei eine schrottreif gefahrene Maschine, und da hörte für Zander der Spaß auf.
Behrend sagte, daß sein Nachbar ein schlauer Hund sei und sich hübsch von der Genossenschaft ferngehalten habe und die Bauern zahlen lasse. Denn Zander würde als Angestellter geführt und bekäme seinen Lohn in voller Höhe, gleich, ob die Genossenschaft verdiene oder zulege.
Plötzlich verschwand Behrend. Er versuchte in Hessen als Bauer Fuß zu fassen und scheiterte. Seine beiden Söhne verdingten sich als Knechte, er aber kehrte zurück und wurde als Lehrbeispiel für das westliche Bauernlegen in der Versammlung herumgereicht. Das viele Geschrei und das viele Bier hoben seine Stimmung. Er bekam sein Eigentum zurück und erneut eine Starthilfe.
Die Feindschaft zwischen den Männern hielt sich in Grenzen; es war eine, die sich hinter blanker Freundlichkeit versteckte. Trotz aller Beteuerungen brachten die Behrends nie ohne Mahnung etwas zurück, und dann war das Werkzeug verbogen, verrostet oder entzwei, was den gelernten Werkzeugmacher Zander besonders schmerzte. Schließlich hielt er sich für Behrend ein Lager ausrangierten Werkzeugs und Maria Zander verschenkte zuletzt lieber zehn Eier, als daß sie borgte und sich hinterher ärgerte, weil die Nachbarin nichts zurückgab. Es ging ja weder um Eier noch um Werkzeug, die Feindschaft hatte tiefere Ursachen. Sie lag im Hochmut der Zanders begründet, die sich für sauberer, redlicher und besser hielten als die Behrends, welche ihrerseits an der ihnen geläufigen Sorglosigkeit im Leben und einer gewissen Schlamperei festhielten. Bösartig oder berechnend war daran zunächst nichts. Alles wurde vom Augenblick dirigiert, allerdings vergaßen weder die Behrends noch die Zanders eine angetane Schmach. Sie waren beide nachtragend und von verletzbarem Stolz.
Noch spät war den Behrends ein Mädchen geboren worden, 1952, Barbara, im Suff gezeugt, behauptete Maria Zander. Wenn Barbara wirklich ein Unfall im Schnapsrausch gewesen sein sollte, so war ein Wunder geschehen. Das Ding stellte sich schnell auf eigene Füße, war lang bezopft, hatte Augen von der Farbe reifer dunkler Kirschen und einen beweglichen zierlichen Körper, wenn wir die Jahre ihrer Kleinkinderzeit überspringen. Allzu viel Sorgfalt wendeten die Behrends für ihre Erziehung nicht auf, aber Barbara dankte ihnen jeden trockenen Kanten Brot und jeden Katzenkopf mit blühender Frische.