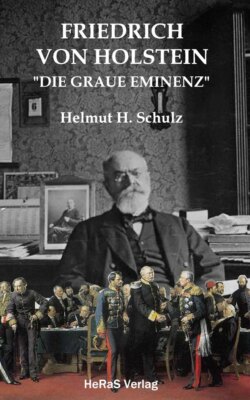Читать книгу Friedrich von Holstein - Helmut H. Schulz - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweiter Teil: DER UNTERNEHMER
Оглавление»Ich habe«, schreibt Holstein an seine Vertraute Helene, Frau von Lebbin, »den zweiten Teil des „Faust“ wieder einmal gelesen und bin frappiert über die Ähnlichkeit, die stellenweise zwischen dem dortigen Kaiser und unseren herrscht. - Unser behandelt das Regieren auch als Sport. Ob er wohl auf dem Thron stirbt? - Er ist nicht der richtige Mann, und es ist nicht die Zeit, um mit dem Volk wie mit einem Riesenspielzeug umzuspringen. Ich glaube eher an die, jetzt schon von Bismarck, vorbereitete Republik, als an den Zerfall des Reiches«. Anlass für diese Notiz war der Besuch Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. in Bonn, das heißt, dem Korpshaus der Verbindung der Borussen. Holsteins Gewährsmann, der dortige Pedell, berichtete ihm von einer Maskerade, an der Seine Kaiserliche Hoheit teilnahm, dass er in der Couleurjacke der Burschenschaft durch die Bonner Lokale zog, um einen Grafen Rex zu verabschieden und ihn an die Bahn zu geleiten. So geschehen 1891, dem Jahr der Entlassung Bismarcks. Und der Text, auf den Holstein anspielt, liest sich überraschend aktuell: »So sei die Zeit in Fröhlichkeit vertan! Und ganz erwünscht kommt Aschermittwoch an. Indessen feiern wir, auf jeden Fall, nur lustiger das wilde Karneval.« (Faust II. 5060) »Gestern in der Bierjacke, heute im Hermelin«, fügt Holstein lakonisch hinzu. Er hätte auch ein anderes Zitat finden können: »Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr«, so die Klage des Marschalk im Drama. Und der Schatzmeister sekundiert: »Die Goldespforten sind verrammelt, ein jeder kratzt und scharrt und sammelt und unsere Kassen bleiben leer.« (Faust II, 4850)
Soweit die Dichtung; zurück zur Wirklichkeit. Das Kaiserreich stand nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg ökonomisch besser denn je da. In dieser Periode, zeitlich sogar vor dem deutsch-französischen Krieg, hat Holstein versucht, sich in der Wirtschaft seinen Platz zu sichern. Es war vielleicht ein Versuch, der lästigen Beamtentätigkeit zu entrinnen, und es sollte bei nur einem Versuch bleiben. Er trat in den Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft, der Tauschifffahrtsgesellschaft, ein, setzte dabei allerdings, anders als manch einer seiner Kollegen in Amt und Würden, sein Privatvermögen aufs Spiel. Staatliche Mittel nahm er nicht in Anspruch; auf legalem Wege hätte er auch keine erhalten. Einst hatte die Familie Holstein bessere Tage gesehen und ein »großes Haus« in Berlin, in der Prachtstraße »Unter den Linden«, geführt. Friedrich, der Erbe musste es verkaufen und erhoffte sich nun durch die Geldanlage in einem Wirtschaftsunternehmen größere Unabhängigkeit; er blieb jedoch Beamter, vorläufig beurlaubt. Mit einem Rest an Möbeln aus dem Palais hatte er seine Mietwohnung in der Großbeerenstraße 40 ausgestattet. Um seinen Plan zu verwirklichen, musste sich der Legationsrat Friedrich von Holstein vom Amt freistellen lassen, zunächst für ein Jahr, um in dem Aufsichtsrat der oben erwähnten Gesellschaft tätig zu werden, wozu er die Erlaubnis seines Vorgesetzten einholen musste, also Bismarcks. Beraten von seinem Bankier Meyer-Cohn, legte er Geld an; spezielle technische Kenntnisse in Sachen Schifffahrt und Transportwirtschaft brachte er nicht ein. Die vorerst für ein Jahr ruhende Beratertätigkeit beim Außenministerium dürfte er doch nicht ganz eingestellt haben, wenn ihm auch seine Beamtenbezüge fehlten; er ging ein Risiko auf Zeit und auf gut Glück ein, aber er war keine Spielernatur und ihm fehlte auch das Zeug zu einem Kapitalisten. Geschäftsführer der Gesellschaft war der Bankier Meyer-Cohn. Kurz gesagt ging es bei dem Unternehmen um die Verbesserung der Rheinschifffahrt. Weshalb sich Holstein gerade für diesen Zweig der Transportwirtschaft entschied, darüber gab er keine Auskunft. Man kann aber vermuten, dass er als Kind in Schwedt die Kähne auf der Oder gesehen und beobachtet hatte, vielleicht war Zufall im Spiel, oder sein Bankier hatte ihm zu dieser Anlage geraten. Obschon er keine Ahnung von der Rheinschifffahrt besaß, versprach er sich offenbar auf längere Sicht Gewinn aus der Sache; es war kein Luftschloss, an dem er baute. Das im neumärkischen Schwedt an der Oder gelegene Gut Trebenow seines Vaters hat Holstein nicht bewirtschaftet; er war kein Landwirt, allerdings noch weniger Schiffer oder ein mit Wasserfahrzeugen vertrauter Techniker. Was Trebenow betrifft; die Rede ist von einer Schafherde, die bei einem Großbrand vernichtet wurde. In einer Lesart hat der junge Holstein in Berlin davon erfahren und immer die verkohlte Leiche seines Vaters vor Augen gehabt; nach anderer ist er selbst Augenzeuge der Brandkatastrophe gewesen. Der Leichnam des alten Holstein war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt, als er unter dem einstürzenden Dach des Brandes zu liegen kam. Die erste Version ist die wahrscheinlichere. Holstein erfuhr von dem tragischen Unfall als Student in Berlin. Die Mutter, eine geborene Brünnow, hatte ihrem Sohn wie schon erwähnt »Unter den Linden 3 a« ein ansehnliches Stadtquartier hinterlassen; ansehnlich ja, aber nur unter anderen Verhältnissen rühmens- und erhaltenswert. Holstein konnte das Haus nicht erhalten, sich aber wenigstens einer guten Erziehung erfreuen. Er war zum Juristen ausgebildet und für die Zeiten auch gebildet.
Am 04. April 1837 zu Schwedt an der Oder geboren, hatte er mit Lob und Anerkennung das Gymnasium absolviert. Dort waren ihm bescheinigt worden, erstens ungewöhnliche Kenntnisse in französischer und in englischer Sprache; er dürfte auch in den Altsprachen unterrichtet worden sein. Latein und Griechisch gehörten zu den Pflichtfächern einer humanen Bildungsstätte. Hervorgehoben wird zweitens, dass er sich schon als Schüler an die Übersetzung von Buchtexten aus dem Englischen ins Deutsche versuchte. Dies fand Anerkennung. Die französische Sprache soll er in hohem Maße beherrscht haben, in Wort und Schrift; französisch war die Diplomatensprache des Zeitalters. Auch wenn es unterdessen reformierte höhere Lehranstalten gab, die den technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs ausbildeten; Holstein war an einer der klassischen humanistischen Bildungsstätten auf das Leben vorbereitet worden. Dank seines Interesses für Geschichte konnte er sich ein Weltbild erarbeiten, das heißt, sich etliches Wissen in Universalgeschichte aneignen, wie ihm drittens bestätigt wurde. Was ist sonst noch über diese Zeit und über ihn bekannt? Nicht viel, man darf spekulieren. An dem jungen Pennäler wird die Revolution von 1848 nicht spurlos vorübergegangen sein; mehr als eine Warnung vor dem randalierenden Pöbel blieb nicht hängen. Bei den Märzereignissen in Berlin zählte er elf Jahre, als sich der preußische Konservative Otto von Bismarck der verwaisten preußischen Königin Augusta in Babelsberg als Helfer anbot und sich ihr zur Verfügung stellte, sollte die Monarchie in Gefahr kommen. Der Gatte Augustas, der spätere Kaiser, Wilhelm I., der Kartätschenprinz, weil er auf die berliner Rebellen schießen ließ, sodass er selbst in der Familie viel an Rückhalt verloren hatte, war flüchtig und galt vorerst als verschollen. Niemand wusste, ob und wann er je nach Preußen zurückkehren konnte, falls er nicht als Emigrant im Londoner Asyl blieb, das er auf einigen Umwegen, als Kaufmann getarnt, erreicht hatte. In der Tat beschäftigten sich die liberal gestimmten Kreise der Konservativen mit verschiedenen Entwürfen für eine Erneuerung des Regimes, vielleicht eine konstitutionelle Monarchie; so ist wenigstens für eine Minderheit der späteren »Neuen Ära« anzunehmen. Es kam anders; wie jede Revolution, verfehlte auch diese ihr ursprüngliches Ziel. Bei dem zwischen Verzweiflung und Hoffnung um Fassung ringenden Wilhelm IV. konnte niemand vorhersagen, bis zu welchen Zugeständnissen er gehen würde; mit der grimmigen Bürgerwehr vor dem Schloss, schien die Monarchie am Ende. Viele rechneten mit seiner Abdankung, mit seinem Thronverzicht und der Umwandlung Preußens in einen Staat nach englischem Vorbild, eine der heißesten Wünsche Augustas. Alles schien möglich, selbst die Republik; auch wuchsen die großdeutschen Vaterlandsträume wunderbar auf; das Frankfurter Vorparlament richtete sich in ein neues Kaisertum ein, unter Führung Preußens. Man hatte schon eine Verfassung, nur noch keinen Kaiser. Das ganze Deutschland sollte es sein! Wir sind ein edles Volk und verdienen alles Glück der Erde, schrieb man zu Frankfurt.
Bismarck-Schönhausen hatte zwar keine Träume, zählte aber zu denen, die den Kampf mit der Revolution bis aufs Messer durchfechten wollten. Augusta besaß im Kronprinzen das Faustpfand, den späteren Kaiser Friedrich I.; als Nachfolger seines Großvaters und Vaters besaß er einen erblichen Anspruch auf den Kornblumenthron Preußens. War es nun ein Gerücht, so plante die preußische Königin als Vormund des Prinzen, als ein weiblicher Lordprotektor oder als Prinzregentin die Herrschaft an sich zu reißen, bis zur Volljährigkeit des Kronprätendenten. Im Revolutionsjahr 1848 zählte der Kronprinz siebzehn Jahre, hätte also durchaus zum König gekrönt werden können, falls es die Verhältnisse zugelassen hätten. Nein, es war ein vages Gerücht, ein Gedankenspiel, kaum mehr. Dass sie sich mit einer Gruppe entschlossener Männer des Prinzen bemächtigt haben könnte und ihn zum König auszurufen, mit seiner Mutter als Regentin an seiner Seite; so weit ging die preußische Fantasie nicht. Dergleichen wäre in Frankreich oder in England denkbar gewesen, nicht aber in Berlin.
Immerhin aber war Augusta in Babelsberg geblieben und wartete ab, wie sich die Dinge entwickeln würden. Die Liberalen um den König herum hatten zwar einen gewissen Auftrieb bekommen und eine unbestimmte Hoffnung geschöpft. Sie hielten den, ob der Ereignisse zu einer energischen Handlung unfähigen König Friedrich Wilhelm IV. für erledigt, bedauerten ihn vielleicht, als einen der harmloseren Menschen und Zeitgenossen, aber sie hatten kein Konzept und keinen führenden Kopf, sahen ratlos angstvoll der Zukunft und der eventuell drohenden Republik entgegen und warteten ebenfalls ab.
Immerhin erzwangen die Revoluzzer vom Monarchen eine respektvolle Verbeugung vor den, im Schlosshof aufgebahrten Gefallenen, riefen laut: Den Hut ab; bis dass der arme König, vor der Kanaille erschrocken, sein Haupt entblößte. Dies nahmen sie für den Sieg der Revolution und gingen entweder zum Essen nach Hause, oder sie versammelten sich in den Caféhäusern und Lesestuben der Stadt, um die Erfolge der Revolution zu erörtern. Eine Bürgerwache wurde schließlich vor dem verwaisten Kronprinzenpalais »Unter den Linden«, das Haus des flüchtigen Wilhelm, postiert. Das war alles, es war die Revolution; ihre Opfer, 187 Tote, wurden am 22. März in Friedrichshain beigesetzt. Insgesamt wurden 254 Gefallenen gezählt, darunter acht Frauen und drei Kinder. Tatsächlich mochte Otto von Bismarck in Babelsberg nur sondiert haben, um zu hören, was die Königin im Schilde führte. Er konnte sich rasch davon überzeugen, dass von hier nichts zu befürchten war. Augusta dachte nicht daran, das Ruder zu übernehmen. Sie wäre in der Tat nur in die Abhängigkeit sich streitender Parteiführer geraten, hätte jedenfalls keinen fix und fertigen Staat übernommen. Es war die erste Begegnung Bismarcks mit seiner späteren Erzfeindin; sie misstraute ihm, wie er ihr. Um alle diese Spekulationen abzuschließen; Augusta besaß keine Hausmacht, keine männlichen Parteigänger, die sie motivierten und umgekehrt, wie Katharina in Russland oder Elisabeth in England, deren Machtwille die Dinge mächtig beeinflusst und sie vorangetrieben hatten. Die Herrin von Babelsberg war in Preußen und von Preußen nie akzeptiert worden. Die Duchesse von Bourbone hatte einst auf die Frage, weshalb Königinnen immer erfolgreicher seien als Könige, geantwortet, weil unter Königinnen Männer die Politik machen, indessen die Weiber unter einem Monarchen das Regiment innehaben.
Als Holsteins diplomatische Laufbahn gerade begann, war Bismarck also schon die zentrale Figur der nachrevolutionären Ära und eines sich allmählich findenden und konsolidierenden Preußen. Die Aussprache Bismarcks mit seinem König im Park von Babelsberg 1862 unter vier Augen ist hoffentlich so wahr, wie nachgereichte Geschichte nur sein kann. Der konservative Politiker redete seinem konservativen König zu, die geplante Abdankung aufzuschieben und ihm, Bismarck, alles Weitere zu überlassen. So wurde es denn gemacht; die vom preußischen Landtag zurückgewiesene Heeresvorlage, im Verein von Freisinn und Konservative abgelehnt, die dreijährigen Dienstzeit für alle einzuführen, mitsamt neuen Steuern, wird vom gerade ernannten, preußischen Kanzler mit der Entmachtung dieser Versammlung, dem preußischen Landtag, beantwortet. Kann er nicht mit dem Landtag regieren, dann ohne ihn, die Volksvertreter fügen sich nach einiger Aufregung und gehen wieder in eine der Lesestuben, um sich zu beruhigen. Wir werden noch einmal bei Erörterung des sogenannten Verfassungskonfliktes darauf zurückkommen.
Zu diesem Zeitpunkt ist Holstein etwa dreißig und besitzt schon einige Erfahrung in der Diplomatie; er ist nicht ohne Patriotismus, ist Preuße und er ist ein überzeugter Anhänger der energischen Politik des Kanzlers. In Preußen wurde seit 1849 das Abgeordnetenhaus nach dem sogenannten Dreiklassenwahlrecht gewählt. Vermutlich hätte Bismarck bei Neuwahlen also nicht viel aufs Spiel gesetzt, vielleicht einige Verschiebungen in der Sitzverteilung auf den Bänken der Parteien hinnehmen müssen, kaum mehr. Es waren nur zwei, jede untereinander zerstritten. Dieses viel verrufene Dreiklassenwahlrecht kam in Preußen ein Jahr nach der Revolution von 1848, am 30. Mai 1849 zusammen mit der Eröffnung des Landtages zur Anwendung. Es wurde im Großen und Ganzen für die erste Reichstagswahl übernommen, bestand mit einem Reformansatz mitten im Kriege, bis zum Ende des Kaiserreiches 1919. Erst in der Weimarer Republik wurde nach einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht votiert, ein Wahlrecht, dass schon in Frankfurt im Verfassungsentwurf beschlossen worden und also genau siebzig Jahre alt war. Der Wahlmodus entsprach im Jahre 1849 den ökonomischen und politischen Verhältnissen in Preußen, einem großen Agrarland, was man auch politisch dagegen sagen kann. Zwar hatte das Frankfurter Parlament in einem Verfassungsentwurf das allgemeine und gleiche Wahlrecht in Vorschlag gebracht, konnte es aber wie so manches andere, nicht durchsetzen. Das preußische Dreiklassenwahlrecht teilte die »Urwähler«, also alle Wahlberechtigten eines Kreises, in drei Klassen. Zur Ermittlung der Klasse wurde die Gesamtsumme des Steueraufkommens eines jeden Wahlbezirkes herangezogen und gedrittelt. Somit entfiel zwangsläufig die höchste Steuerklasse, die erste, auf die an Köpfen kleinere Gruppe, auf die Wohlhabenden und Besitzenden eines Wahlkreises. Die zweite und dritte folgten je nach Steuerleistungen. Festgelegt war demnach die Anzahl der Wahlmänner aus den Urwählern; es entfielen die gleiche Anzahl Wahlmänner auf jede der drei Klassen. Bei der ersten nach diesem Modus im Jahre 1849 durchgeführten Wahlen kamen laut Statistik auf die erste Klasse 4,7 %, auf die zweite 12,6 % und auf die dritte 82,6 % Urwähler. Die Wahlmänner, nach der Statistik je zehn pro Wahlkreis, wählten den Abgeordneten des Wahlkreises. Mit anderen Worten, die wenigen Reichen der höchsten Steuerklasse stellten genau so viele Wahlmänner, wie die Urwähler der beiden niedrigen Steuerklassen.
Auf dem Lande besaß der grundbesitzende Adel als erste und an Köpfen kleinste Klasse und Steuerzahler natürlich das Übergewicht, während die beiden anderen Gruppen, zwar an Kopfzahl größer, ja immerhin ebenfalls Wahlmänner aufboten. Die Abgeordneten, nicht direkt durch einfache Stimmenmehrheit ermittelt, sondern durch die Wahlmänner der jeweiligen Klasse berufen, zogen in den preußischen Landtag ein. Urwähler hießen alle männlichen Bewohner eines Wahlkreises, die im Besitz der Bürgerrechte waren und Steuern zahlten. Frauen zählten nicht zu den Urwählern, sie besaßen keine Bürgerrechte und entrichteten keine Steuern. Die Besitzenden der ersten Klasse errangen auf alle Fälle eine Mehrheit; in ländlichen Räumen der grundbesitzende Adel. Parteien wurde nicht gewählt; auf dem Lande gab es überhaupt nur eine, die konservative, wenigstens 1849; nur in den Städten hatte sich eine liberale Partei bilden können und Abgeordnete in den Landtag geschickt, deren Fraktion stark genug war, um das Etatrecht gegen König und Kanzler zu verteidigen. Insofern war die Revolution durchaus nicht ohne Resultat geblieben.
Von heute aus erscheint dieses Wahlsystem ungerecht gegenüber dem gleichen und geheimen Wahlrecht. Berücksichtigt man aber die soziale Zusammensetzung und die Ökonomie der ländlichen Kreise, dann hätte die Einführung des allgemeinen Wahlrechtes zu einem Chaos geführt. Jeder gewählte Abgeordnete musste für die Kosten seines Mandates im Landtag selbst aufkommen, wozu Tagelöhner und selbst Handwerker nicht in der Lage waren. Wer keine Steuern zahlte, konnte auch nicht Urwähler sein. Die Revolution brachte nur die Bürger in Stellung, wenngleich sie von den kleinen Leuten ausgefochten wurde. Hier wäre anzusetzen gewesen. Eine Reform hätte die gesellschaftliche Umgestaltung einleiten müssen. Die Presse schrieb über das Frankfurter Vorparlament, das rüstig tätig war, ahnungsvoll, neunundneunzig Professoren, Deutschland, du bist verloren! Fortschritte gab es dennoch, sogar eine Partei, die sich »Fortschrittspartei« nannte.
Im Roman »Der Stechlin«, dem Alterswerk Theodor Fontanes, ist das Wahlverfahren in der Grafschaft Ruppin, einem der Wahlkreise geschildert, allerdings aus der Zeit Kaiser Wilhelm II., als sich die Sozialdemokratische Partei bereits zur Wahl stellen konnte und besser gerüstete Abgeordnete bereit standen, dank der Agitation in den Arbeiterbildungsvereinen und der politischen Literatur. In diesem Falle war ein Mandat im Reichstag freigeworden und eine Nachwahl im Wahlkreis Ruppin fällig. Zwei Kandidaten standen zur Wahl, ein Altkonservativer, der Major von Stechlin von altem märkischen Schrot und Korn und ein sozialdemokratischer Arbeiter. Der Kandidat Dubslav von Stechlin äußerte über seine Kandidatur zweifelnd: »Übrigens gehe ich einem totalen Kladderadatsch entgegen. Ich werde nicht gewählt.« Pastor Lorenzen, verlegen: »Ihre Wahl, Herr von Stechlin, steht, glaube ich, fest; in unserer Gegend wenigstens. Die Globsower und Dagower gehen mit gutem Beispiel voran. Lauter gute Leute.« - »Vielleicht, aber schlechte Musikanten. Alle Menschen sind Wetterfahnen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.« (Der Stechlin. Aufbau Verlag. Seite 178 u.f.) Die Konservativen bringen den alten Stechlin gegen den Sozi Torgelow nicht durch; selbst im Modus des Dreiklassenwahlrechtes war also die SPD auch auf dem Lande erfolgreich. Fontane hat die Verhältnisse in der Grafschaft vielleicht erfunden, aber gekannt und die Teilnehmer am Bankett des Wahlabends, die konservativen Verlierer, ist eine Liste des Grundadels plus einem bürgerlichen Überläufer, der sich zwar konservativ geriert aber »freisinnig« wählt, aufgezählt. Drastischer schildert Heinrich Mann im Roman »Der Untertan« die Nachwahl eines Reichstagsabgeordneten in einem Nest namens Netzig; hier steht der Kandidat der Freisinnigen Partei gegen den Nationalen frischester Prägung; die Stichwahl kürt mithilfe des Nationalen paradoxerweise den sozialdemokratischen Arbeiter zum Sieger. Gewiss, eine Satire, aber eine mit Hintergrund. Die Vorgänge schildern Missbräuche, wie sie bis heute jedem anderen Wahlsystem eigen sind; auch in den entwickelteren Ländern, als dem Vorbild. In England und den Vereinigten Staaten von Nordamerika gab es kein allgemeines und gleiches, kein formales Wahlrecht, sondern ein Verhältniswahlrecht und bis heute wird in den USA mit Wahlmännern gewählt. Die Ruppiner Konservativen, der Adel der Grafschaft, regten sich auch nicht groß über den Wahlausgang, den Verlust eines Reichstagssitzes, auf. Sie fassten Tritt, machten eben den »Schritt in die richtige Richtung« auf den alle nach dem Fall Bismarcks und der Aufhebung des Verbotes sozialdemokratischer Organisationen, gewartet hatten. Der Reichstag wies später die sogenannte Umsturzvorlage ab, nicht weil die Liberalen, der Freisinn und das Zentrum, die soziale Revolution herbeisehnten, sondern weil sie die Kontrolle fürchteten, der sie sich mit Annahme dieses Gesetzes unterworfen hätten. An die Gefahr, die ihnen von der Sozialdemokratie drohte, die längst mehrheitlich im Reichstag saß, gezähmt und maßvoll kultiviert und mit Ämtern versorgt, das Zünglein an der Waage, dachten sie in zweiter Linie. Zurück zu Holstein.
Der konservative Friedrich von Holstein kannte Bismarck bereits aus einer gemeinsamen Tätigkeit an verschiedenen preußischen Gesandtschaften, der Reihe nach, St. Petersburg, Paris. Zuvor war der junge Referendar Holstein als Botschaftssekretär der Übung halber durch die Machtzentren der Welt gewandert, und er hatte sich den Ruf erworben, ein guter Beobachter, ein pflichtbewusster, zuverlässiger unbestechlicher Beamter zu sein. Paris kannte er sehr gut, das Paris des Staatsstreiches unter dem Kaiser Napoleon III., und die republikanische Metropole von 1871 und 1872 danach, unter Thiers und dem Botschafter des Reiches, Harry Graf von Arnim. Napoleon III., eine auffallende Erscheinung unter den neuen Monarchen, mit aufgewichster Barttracht, wurde in der Satire besungen; »das ist der Mann im Zylinder, mit dem schwarz lackierten Bart, das letzte Malheur der Familie, Napoleon Bonaparte«.
Das Jahrzehnt war reich an Ereignissen und Veränderungen. Soweit es Frankreich anging, lag Bismarck, dem inzwischen zum Reichskanzler aufgestiegenen Leiter der kaiserlichen Außenpolitik alles daran, mit der Französischen Republik in ein erträgliches Verhältnis zu kommen. Schwer genug hatte die dritte Republik für die Sünden des Kaiserreiches unter dem Napoleonspross zu büßen, mit hohen Kriegsentschädigungen und dem schmerzlichen Verlust Elsass-Lothringens. Bismarck hatte sich für maßvollere Kriegsentschädigungen eingesetzt, wie er auch die Niederlage Österreichs im sogenannten »Deutschen Krieg«, dem für Deutschland folgenreichsten dieser Periode, nicht zur Erpressung Wiens nutzte. Österreich musste keinen Fußbreit Boden abtreten und auch nicht eine Mark Entschädigungen leisten. Bismarck sah in unterlegenen Gegnern stets die potenziellen Verbündeten von morgen. Überdies war die Bevölkerung des Elsass mehr französisch als reichsdeutsch gestimmt, schon gar nicht preußisch. Die kaiserliche Verwaltung sorgte im Verein mit der Garnison dafür, dass sich daran nichts änderte.
Ein Licht auf die Verhältnisse warf die Reichstagsrede eines elsässischen Abgeordneten namens Röser in der Debatte vom 03. Dezember 1913, also mehr als vierzig Jahre nach dem Verlust der französischen Provinz an Deutschland. Die Deutschen aus dem »Altreich« benahmen sich gegenüber den »Anschlussdeutschen« wie Kolonialherren, betonten ständig ihre Überlegenheit und ihre Geringschätzung gegenüber den neuen Bürgern. Elsässer wurden als »Wackes« bezeichnet, was mundartlich einer Herabsetzung gleichkam oder von den Elsässern so empfunden wurde. An einem Sonntag hatte es in der elsässischen Stadt Zabern einen Auflauf, eine Missfallenskundgebung vor einer kaiserlichen Dienststelle gegeben. Es kam zu Zusammenstößen der Bevölkerung mit der Polizei, zunächst in den Gasthäusern, fortgesetzt auf den Straßen. Darauf ließ ein Leutnant von Forstner, Militär unter Waffen, mit scharfer Munition aufziehen und verhängte das Kriegsrecht. Die Sache eskalierte, alle Soldaten mussten sich in den Kasernen versammeln oder durften sie nicht verlassen. Den Abschluss der Zabern-Affäre bildete eine Grußadresse des Kronprinzen an den Standortkommandanten, von »Kamerad zu Kamerad«, wie der Kronprinz schrieb, in der er alle Maßnahmen des Militärs billigte. Umgekehrt richtete das französische Misstrauen gegen die Elsässer den jüdischen Artillerieoffizier Dreyfus beinahe zugrunde, der in den Verdacht der Spionage für das deutsche Kaiserreich geraten war.
Merkwürdigerweise fällt Holsteins Entschluss, sich versuchsweise aus der Diplomatie zurückzuziehen in die Phase der Zeit nach dem deutsch-dänischen Krieg. Die Transport- und Handelsgesellschaft, in die er mit einigem Kapital eintrat, wollte die Rheinschifffahrt durch ein System von Schleppstrecken und Schleppern verbessern und sicherer machen. Seit Nutzung der Dampfkraft zum Antrieb von Maschinen, zogen Schlepper die Lastkähne. Der Rhein war als Wasserstraße und Verkehrsweg für die Anliegerstaaten lebenswichtig. Ursprünglich mit von Handkraft bewegten Schleppkähnen befahren, manchmal durch Segel bewegt, bewirkten die Dampfschlepper einen Aufschwung im Güterverkehr. Bei der starken Strömung des Rheins, half der Fluss dem Talfahrer in Richtung Norden in die Niederlande; umso mühsamer war die Bergfahrt. Streckenweise wurden die Frachtkähne auf den Uferwegen getreidelt. Dass eine erhebliche Menge Güter schneller und kostengünstiger übers Wasser transportiert werden konnten, war auch für Preußen wichtig, die Handelswege in die westdeutschen Provinzen am Rhein führten übers Wasser, hätten führen können, muss es heißen, wären sie schon ausgebaut gewesen.
Die »Tauschifffahrtsgesellschaft«, wie sich das Unternehmen Holsteins nannte, war also ein neues zukunftweisendes Projekt, bevor die Eisenbahn den Transport von Gütern übernahm. Im Jahre 1868 hatte Holstein den Antrag gestellt, ihn zunächst für ein Jahr von seiner amtlichen Tätigkeit zu entbinden und ihm zu erlauben, private Dinge zu regeln. Bismarck genehmigte den Urlaub formal erst am 23. Dezember 1871, nach dem Sieg über Frankreich und der Proklamation des Kaiserreiches. Dem Eintritt Holsteins in den Verwaltungsrat der Rheintau-Gesellschaft wurde also spät stattgegeben. »In Erwiderung Ihres Gesuches ohne Datum will ich Euer Hochwohlgeboren nach Maßgabe der allerhöchsten Kabinettsordre vom 13. Februar 1839 die widerrufliche Erlaubnis zum Eintreten in den Verwaltungsrat der Rheintau-Gesellschaft und des Elb-Spree-Kanals hierdurch erteilen. Von Euer Hochwohlgeboren durch diese Nebenbeschäftigung etwa zufließenden regelmäßigen Einnahmen wollen Sie in Gemäßheit der oben angezogenen Bestimmungen zu den Akten Anzeige machen. Der Reichskanzler. Im Auftrage: Abeken.«
Da Holstein über Einnahmen aus seiner Tätigkeit bei der Gesellschaft Rechnung zu legen hatte, behielt das Ministerium auch die Kontrolle über das Unternehmen. Der Bau des Elbe-Spree-Kanals verband zunächst die Oder mit Havel und Elbe. Übrigens war Bismarck einmal in Schönhausen an der Elbe bevollmächtigter Deichgraf gewesen und zuständig für die nötigen Wasserbauten an diesem heiklen Strom, der im Sommer ganz trocken fallen kann, um im Frühjahr regelmäßig die Elbwiesen zu überfluten, was zwar dem Fischnachwuchs dient, weil es die Laichplätze stellt, nicht aber der Elbschifffahrt, der Anbindung an den Seehafen Hamburg und an die Nordsee. Zwischen Elbe und Rhein hätte ein Kanal die Verbindung all dieser Wasserwege herstellen können; der Mittellandkanal dürfte zumindest als größeres Bauvorhaben im Gespräch gewesen sein, wenn auch an einem solchen Projekt mehrere deutsche Bundesländer beteiligt werden mussten, die an dem Ausbau gar nicht interessiert waren. Um diese Betrachtung zu schließen; beschlossen wurde der Bau des Kanals mit dem Inkrafttreten des preußischen Wassergesetzes vom 1. April 1905. Im folgenden Jahr wurde der erste Bauabschnitt von Bergeshövede nach Hannover begonnen, und damit im Westen der Anschluss an den Dortmund-Ems-Kanal gegeben. Der Erste Weltkrieg verzögerte den Weiterbau merklich, trotzdem wurde der Abschnitt bis Minden, damals noch unter dem Namen Ems-Weser-Kanal 1915 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Seither wird im Grunde noch immer an diesem Kanal gebaut.
Die Rheinschifffahrtgesellschaft war in der Tat kein Luftschloss; 1905 war Holstein noch am Leben und wird die Entwicklung verfolgt haben. Der Rhein ist eine internationale Wasserstraße; den Anliegern fallen oder fielen zu: dem Reich 1.343, gefolgt von der Schweiz mit 683 und den Niederlanden mit 183 Stromkilometern. Frankreich war mit nur wenigen Kilometern der Letzte im Bunde. Somit hatte das Reich das größte Interesse an vertraglichen Regelungen. In der Tat war auch 1831 ein Rheinvertrag zustande gekommen, der die Anlieger zur Neutralität verpflichtete. 1868, also just im Jahr der Rheintau-Gesellschaft war ein erweiterter Rheinvertrag geschlossen worden. Die Gesellschaft mit ihrem jüdischen Geschäftsführer, dem Bankier Meyer-Cohn, der schon das Vermögen der Familie Holstein zu Lebzeiten des Vaters betreut hatte, besaß seinerzeit, seit 1855, Unter den Linden 11, Ecke Wilhelmstraße ein Bankhaus, vermutlich auch die Geschäftsadresse des Unternehmens. Die Gesellschaft goldenen Zeiten zuzuführen, gelang aber nicht. Meyer-Cohn ging in Konkurs, wurde flüchtig und die so vielversprechende Gesellschaft der Tauschifffahrt schloss mit einer negativen Bilanz. Spuren hat das Unternehmen kaum hinterlassen; andere haben sich nachhaltiger betätigt und die Rheinschlepper zogen ein Jahrhundert lang Lastschiffe oder auch riesige Holzflöße nach Norden.
Holstein hatte sein Vermögen eingebüßt und nahm das diplomatische Handwerk wieder auf. Hier sollte noch gesagt werden, dass die ihm später angehängten Vorwürfe, er habe mit Staatsgeldern und seinem politischen Wissen Börsenspekulation betrieben, ohne Beweise geblieben sind. Dass andere Diplomaten, dass selbst Minister über Mittelsmänner Spekulationsgewinne einheimsten, war indessen kein Geheimnis. Seit der französischen bürgerlichen Revolution waren die großen Börsen zu Schnittstellen zwischen Politik und Wirtschaft geworden; das Steigen und Fallen der Aktienkurse, von Angebot und Nachfrage, nach Brief oder Geld, standen in direkter Wechselwirkung zur Politik. Der preußische Ministerpräsident dieser Jahre, Otto von Manteuffel, hatte sich regelmäßig die Kursentwicklung an den jeweiligen Börsen mit Diplomatenpost oder per Kurier übermitteln lassen, um auf dem Laufenden zu sein, und um entsprechend seinem politischen Wissen den Kauf oder den Verkauf von Aktien zu ordern. Daran zu hindern war er nicht, es gab kein Gesetz gegen diesen Missbrauch; der Differenzhandel lebte und gedieh und sorgt auch heute für große Gewinne. Der Börsianer tätigt seine Geschäfte nur nicht mehr im »Parkett«, dem Börsenraum; die rasche Kursentwicklung wird inzwischen durch spezielle Computerprogramme kontrolliert, die Maschine ordert automatisch, ohne Mitwirkung des Anlegers. In Sekunden wandern große Vermögen um den Globus, werden kurzfristig mehrfach umgewechselt. Das Börsengeschäft im Computerhandel hat den kleinen Anleger ins Hintertreffen gedrängt. Zwar verabreden die Regierungen, gelegentlich dagegen vorzugehen; allein es sind zu viele Interessen berührt, als dass aus den Verabredungen etwas werden könnte.
Als Geschäftsmann taugte der Legationsrat Friedrich von Holstein also wenig; umso erfolgreicher war er als Diplomat und »Vortragender Rat« im Ministerium des Äußeren, wohin er denn auch bald zurückkehrte, um eine Erfahrung reicher und um sein Vermögen ärmer. Er übte das Amt als Botschaftssekretär des Kaiserreiches in Paris unter dem Gesandten Harry Graf von Arnim aus. Dieser Mann sollte zu seinem Schicksal werden und seinem Leben eine Wendung geben.