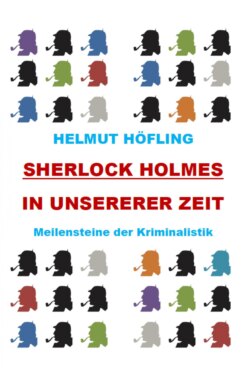Читать книгу Sherlock Holmes in unserer Zeit - Helmut Höfling - Страница 3
ОглавлениеVERBRECHEN SIND SO ALT WIE DIE MENSCHHEIT
Meisterdetektiv Sherlock Holmes und die Wirklichkeit
„Es ist nichts so fein gesponnen, dass es nicht kommt ans Licht der Sonnen.“ Schön wär’s, wenn dieses bekannte Sprichwort auch immer zuträfe. Leider aber sieht es in Wirklichkeit oft anders aus. Das gilt auch in hohem Maße für die Kriminalität, denn viele begangene Verbrechen werden erst gar nicht bekannt. So geschieht es immer wieder, dass der Arzt, der den Totenschein ausstellt, nicht die wahre Todesursache erkennt. Wo er einen natürlichen Tod annimmt, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Mord.
Bei einem alten Menschen liegt ohnehin die Vermutung nahe, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist –näher jedenfalls als bei einem jungen Menschen. Deshalb schöpft der Arzt, der dies bescheinigt, wohl kaum Verdacht, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Die Anzeichen oder Verdachtsmomente, die zum Beispiel auf einen Tod durch Erwürgen, Erdrosseln oder eine sonstige Art des Erstickens hinweisen, bemerkt er nicht. Erst Zufälle fördern den wahren Sachverhalt zutage. Gerüchte kommen auf, Nachbarn wundern sich, bis schließlich jemand die Kriminalpolizei verständigt und die Ermittlungen den Verdacht bestätigen.
Verdeutlicht wird dies durch die beiden folgenden Fallbeispiele:
Bei einem sechsundfünfzigjährigen Mann, der plötzlich gestorben war, bescheinigte der Arzt den Tod durch Alkoholvergiftung, verbunden mit einer Herzschwäche. Anderthalb Jahre später starb im gleichen Haus ein zweijähriges Mädchen, das Rotkohl aus dem Hundenapf gegessen hatte. Darin war Thallium gewesen, mit dem der Hund vergiftet werden sollte – nun aber war ein Kind das Opfer geworden. Durch diesen Unglücksfall tauchten erneut Zweifel an der Todesursache des Sechsundfünfzigjährigen auf. War er tatsächlich an Alkoholvergiftung und Herzschwäche gestorben – oder hatte man auch ihm Thallium ins Essen gemischt? Als die Gerüchte nicht verstummten, ging man ihnen nach und exhumierte den Toten. Die Untersuchung der Leiche bestätigte das Misstrauen der Nachbarn: Der Mann war nicht an einer Alkoholvergiftung gestorben, sondern mit Thallium vergiftet worden. Die Ehefrau wurde verhaftet und gestand, ihren Mann wegen dauernder Streitereien getötet zu haben. Er wollte, so erklärte sie, „die Giftkörner eben haben, und da hat er sie auch bekommen.“ Vor Gericht widerrief sie jedoch ihr Geständnis und behauptete, er habe sich selbst das Leben genommen.
Wie das Beispiel lehrt, waren hier Indizien verkannt worden. Denn da das zerrüttete Verhältnis der Ehegatten zueinander allgemein bekannt war, hätte man ihm Beachtung schenken und dem plötzlichen Tod misstrauisch gegenüberstehen müssen. Eine genaue Untersuchung der Leiche zwang sich hier geradezu auf.
Der zweite Fall hat sich 1966 in Holland ereignet. Der Kraftfahrer H. brauchte Fliesen für sein Haus. Zusammen mit seiner Frau und seinem Freund K., der als sachverständiger Berater beim Einkauf dienen sollte, fuhr er nach Sch., wo die Ware begutachtet, gekauft und schließlich aufgeladen wurde. Die Abenddämmerung brach bereits herein, als sie endlich mit hoch beladenem Wagen den Heimweg antraten. In einer Kurve, wo die Straße direkt auf einen Kanal zuführte, geriet H. mit seinem Fahrzeug ins Wasser. Schnell versank der Wagen. Hilferufend stand H. auf dem Dach des untergehenden Fahrzeugs. Als Einziger konnte er sich schließlich retten. Mit einem Nervenzusammenbruch wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau und sein Freund jedoch waren ertrunken.
Als ein reichliches Jahr später H. das Aufgebot bestellte, um die Witwe seines Freundes K. zu heiraten, brach der Dorfklatsch aus. Schon lange wussten die Nachbarn, dass H. mit der Frau seines Freundes K. ein Verhältnis hatte – nur den beiden anderen Ehepartnern war dies bis zu ihrem Tod im Kanal verborgen geblieben. Auch bei der Polizei war darüber nichts bekannt gewesen. Da jetzt jedoch immer offener über das frühere ehebrecherische Verhalten des Liebespaares gesprochen wurde, mussten auch die Strafverfolgungsbehörden davon Kenntnis nehmen. Als sie die Rekonstruktion des vorjährigen Verkehrsunfalls anordneten, stellte sich heraus, dass es sich nicht so ereignet haben konnte, wie H. damals angegeben hatte. Die Widersprüche veranlassten H. schließlich zu einem Geständnis. Er hatte den Wagen absichtlich ins Wasser gelenkt, um die beiden „Ehehindernisse“ zu ermorden. Sowohl H. als auch seine Geliebte wurden verhaftet und vor Gericht gestellt.
Für beide Fälle gilt dasselbe: Was zunächst so natürlich aussah, war in Wirklichkeit Mord. Konnten diese Verbrechen noch nachträglich aufgeklärt werden, so bleiben viele andere für immer unerkannt. Um zu unterstreichen, dass dies leider keine Seltenheit ist, hat ein bekannter Kriminalist einmal folgenden bildhaften Vergleich geprägt: Wenn man am Grab einer jeden Leiche, die durch ein unerkanntes Verbrechen umgekommen ist, eine Kerze anzünden würde, dann wäre der Friedhof hell erleuchtet.
Was ist der Grund hierfür? Fehlt es vielleicht in aller Welt an Detektiven von der Klasse eines Sherlock Holmes?
Als vor rund hundert Jahren in London der Roman „Eine Studie in Scharlachrot“ des schottischen Arztes Conan Doyle erschien, ahnte niemand, dass die Hauptfigur darin, der Meisterdetektiv Sherlock Holmes, jahrzehntelang für Millionen Menschen das Bild von Kriminalistik und Verbrechensuntersuchung bestimmen sollte. Der Haupttrick, mit dem der Autor seinen Romanhelden Sherlock Holmes immer wieder glänzen lässt, ist die Konstruktion einer vollständigen Personenbeschreibung des Täters aus irgendeiner Kleinigkeit am Tatort. Aus einem einzelnen Härchen, das er am Schauplatz des Verbrechens auf den ersten Blick entdeckt, leitet er Haarfarbe, Barttracht, Alter, Körpergröße, sämtliche Kinderkrankheiten und gegenwärtige Unpässlichkeiten des Täters ab. Eine mikroskopische und chemische Untersuchung des Schnurrbarthärchens liefert ihm ferner völlige Aufklärung über die soziale Klasse, den Beruf, die letzte Mahlzeit, den Friseur, den Geburtsort und die klimatischen und geographischen Verhältnisse der letzten Aufenthaltsorte des Verbrechers.
Sherlock Holmes entwickelt also aus einem Härchen das Bild und die Lebensgeschichte eines Menschen, indem er vor seinem ewig erstaunten Freund Watson im Lehnstuhl sitzt, die kurze Pfeife im Mund, die Augen geschlossen und die Fingerspitzen aneinandergelegt. Die Aufklärung eines Kriminalfalles ist für ihn eine Denksportaufgabe, zu deren Lösung er weder die Unterstützung der bei Conan Doyle stets dummen Polizei noch gar den Rat von Fachleuten braucht. Er allein weiß und kann alles wie ein Übermensch. Kein Wunder, dass ein solcher Meisterdetektiv schon bald zur mythologischen Figur wurde.
Superdetektive und Superkommissare vom Schlag eines Sherlock Holmes leben in unseren Tagen gleich scharenweise in der Massenproduktion gängiger Kriminalfilme und Fernsehserien fort. Mal lösen sie selbst den verwickeltsten Fall durch die kühle Denkarbeit ihres Superhirns, mal bringen sie den Gangster durch ihre überlegene Muskelkraft zur Strecke. Manchmal verfügen sie auch über beide Eigenschaften und vollbringen Spitzenleistungen, um die sie jedermann beneidet.
Immer wieder beliebt sind in Film und Fernsehen Verbrecherjagden, die dem Zuschauer endlich zum Schluss des Verwirrspiels verraten, wer der Täter war – etwa wie folgt:
Das Auto des Gangsters rast durch die nachtdunklen Straßen der Großstadt, biegt mit quietschenden Reifen haarscharf links um die Kurve, dann rechts herum, schießt trotz roter Ampel über die Kreuzung und taucht im gespenstischen, schummerigen Labyrinth der Hafenanlagen unter.
Der Verbrecher hat allen Grund zu dieser überhasteten Flucht, denn dicht auf den Fersen folgen ihm Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn. Werden sie ihn stellen – oder wird er ihnen wieder entkommen?
Plötzlich kracht es, das Auto des Gangsters ist gegen eine Wand gerast. Im nächsten Augenblick stoppen die Polizeiwagen hart an der Unfallstelle.
„Da vorn läuft er!“, ruft einer der Polizisten seinen Kollegen zu, die in Sekundenschnelle ins Freie stürzen.
„Halt! Stehen bleiben!“
Statt zu gehorchen, versucht der Verfolgte, sich mit ein paar Revolverschüssen seine Verfolger vom Leib zu halten.
„Werfen Sie den Revolver weg!“
Vergebliche Aufforderung – wieder Schüsse.
„Er flüchtet sich in die Lagerhalle!“, ruft der eine Polizist
„Los! Ihm nach!“
Der Gangster spürt die Gefahr im Nacken. Wenn er in dem Wirrwarr der aufgestapelten Kisten und Kasten die Polizisten nicht abschütteln kann, ist er verloren. Er stürmt die steile Eisentreppe hinauf, er hofft, vielleicht übers Dach zu entkommen. Wenige Sekunden lang haben ihn die Verfolger aus den Augen verloren, doch dann stutzt einer und blickt nach oben. Er hat die hallenden Schritte auf der Eisentreppe gehört.
„Da! Auf der Treppe!“, ruft er seinen Kollegen zu.
„Es ist aus, Meier!“, versucht der Kommissar dem Flüchtigen klarzumachen. „Die Lagerhalle ist umstellt!“
Wieder sind Schüsse die einzige Antwort.
Der Kommissar duckt sich blitzschnell. „Verdammt! Beinah hätt’s mich erwischt!“
„Stehen bleiben, oder ich schieße!“, fordert ein anderer den kaltblütigen Mörder auf.
Dem kurzen Schusswechsel folgt der lange Todesschrei des getroffenen Gangsters, der aus großer Höhe über das Treppengeländer in die Tiefe stürzt und hart auf dem Betonboden der Lagerhalle aufschlägt. Er rührt sich nicht mehr. Tot.
Wieder hat die Polizei einen Verbrecher zur Strecke gebracht, im Kampf erschossen. Wie oft enden so die gängigen Kriminalfilme!
Aber war der Gejagte wirklich der Mörder?
Im Film ja. Doch draußen, im wirklichen Leben, geht es meistens nicht so einfach zu. Vom ersten Verdacht bis zur Überführung ist es ein weiter Weg. Wie viel mühevolle Kleinarbeit muss die Kriminalpolizei leisten, bis der Staatsanwalt Anklage erheben kann! Und auch vor Gericht ist dem Angeklagten die Tat erst lückenlos nachzuweisen, ehe Schuldspruch und Urteil erfolgen können.
Im Krimi – ob Roman, Film oder Fernsehen – ist der Detektiv ein „Entdecker“, wie sein Name behauptet. Entweder vollbringt er wahre Wundertaten als Hellseher und genialer Kombinationsakrobat, oder der glückliche Zufall kommt ihm immer im richtigen Augenblick zu Hilfe. Gegen ihn wirken die normal sterblichen Kriminalbeamten, die „Bullen“, oft wie einfältige und einfallslose Bürokraten, die ihren Beruf verfehlt haben.
Doch dieses Bild vom Kriminalisten und seiner Arbeit, der Verbrechensbekämpfung, ist falsch. Kriminalistik ist kein nervenkitzelndes Abenteuer, keine Freizeitbeschäftigung für wohlbetuchte Denksportler und auch keine Tätigkeit, mit der man Millionen scheffeln kann, sondern mühselige, oft aufreibende und zermürbende Kleinarbeit. Traumtänzer und Revolverhelden sind für diese Knochenarbeit ungeeignet. Gute Kriminalisten sind Männer, die kühl, sachlich und beharrlich an ihre Aufgabe herangehen – in unseren Tagen für bestimmte Bereiche der Verbrechensbekämpfung auch Frauen.
„Allen Vorurteilen zum Trotz muss ich betonen, dass der Polizeibeamte – auf der Straße, im Büro, im Labor und im täglichen Leben, in Zivil oder in Uniform – ein Mensch wie alle anderen ist, nicht mehr und auch nicht weniger klug, nicht besser und nicht schlechter und ohne alle übernatürlichen Fähigkeiten.“ So hat sich einmal der frühere Generalsekretär der „Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission“ über seine Kollegen geäußert.
Werfen wir also das weit verbreitete, falsche Klischee vom allwissenden und unbesiegbaren Detektiv und Kommissar über Bord, und wenden wir uns statt dessen der realistischen Aufklärung von Verbrechen zu, dann gelangen wir zu der Erkenntnis: Was die Alltagskriminalisten, diese „Menschen wie alle anderen“, in aller Welt leisten, verdient im höchsten Grad unsere Bewunderung und Anerkennung.
Den stummen Tatort zum Sprechen bringen
Der schmächtige, blonde Mann lag vornüber auf den Teppich gestürzt, als die Mordkommission eintraf. Er war tot. Auf dem Revolver neben seiner rechten Hand entdeckte man nach eingehender Untersuchung die fünf Fingerabdrücke des Toten. Also Selbstmord? Nein. Den Technikern im kriminaltechnischen Labor war nämlich aufgefallen, dass an der rechten Hand des Toten Schmauchspuren fehlten, die ein Schuss hinterlässt. Daraus schlossen sie, dass ein anderer geschossen haben musste.
Die Laboruntersuchungen brachten weitere Feststellungen: ein schwarzes Haar, mit dem Haarpflegemittel Semiramis behandelt; winzige Flanellfaserteilchen, vermutlich von einer Hose; und schließlich Partikelchen der Schuhcreme Superglanz.
Das war aber noch nicht alles. In der Tasche des Toten steckte ein versengter Geldschein. Zwischen den Papierfasern enthüllte das Raster-Elektronenmikroskop in vielhundertfacher Vergrößerung eine winzige Metallperle. Elektronenstrahlen tasten die Perle ab und finden heraus, dass dieser Schein in einem Geldschrank gelegen haben muss, der aufgeschweißt wurde. Vermutlich handelt es sich um einen Geldschrank der Marke Secura. Ein Geldschrank dieser Marke war erst wenige Tage zuvor in Düsseldorf geknackt worden. War der Tote einer der Täter? Hatte einer seiner Komplizen ihn ermordet?
Die Fahndung läuft an. Polizeireviere, Grenzstationen und Flughäfen werden alarmiert.
Am Grenzübergang Basel fährt ein schwarzhaariger Mann vor, gibt seinen Reisepass ab und muss ganze acht Sekunden warten. Dann nimmt ein Beamter ihn fest.
Die Zeit genügte, um über das Terminal – ein Gerät zur Datenein- und –ausgabe, das mit einem zentralen Computer verbunden ist – die Daten des Passes aus der Fahndungskartei des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden abzufragen. Als Antwort erscheint auf dem Bildschirm: „Geldschrankknacker, tatverdächtig, bewaffnet, gefährlich, festnehmen.“
Der Mann trägt eine Flanellhose, sein Haar duftet nach Semiramis, seine Schuhe wurden vor ein paar Tagen mit der Creme Superglanz geputzt. Ein rascher Fahndungserfolg also!
Dieser Fall ist zwar nur erdacht, aber durchaus möglich. Erst die Umstellung der Fahndung Anfang der siebziger Jahre auf die elektronische Datenverarbeitung (EDV) machte diese Geschwindigkeit möglich. Vorher verstrichen Wochen zwischen Eingabe der Fahndungsdaten und ihrer Übermittlung an alle Polizeidienststellen und Grenzübergänge. Die elektronische Datenverarbeitung verringert den Vorsprung des Gegners ganz erheblich. Selbst eine Blitzfahndung, die ohnehin nur in Ausnahmefällen in Gang gesetzt wird, dauerte ohne Elektronik drei bis vier Stunden.
Das Zusammenspiel moderner kriminalwissenschaftlicher Methoden, Ermittlungstechnik, Fahndung und der elektronischen Datenverarbeitung „macht das Verbrechen, das mit den Methoden des 19. Jahrhunderts arbeitet, zunehmend chancenlos“, meinte vor Jahren der Präsident des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Nach seiner Ansicht werden die heutigen Mittel der Verbrechensbekämpfung es ermöglichen, die Kriminalität traditionellen Typs völlig in den Griff zu bekommen – bis auf einen unausrottbaren Bodensatz.“ Dabei darf man jedoch nicht übersehen, dass auch die Kriminellen bei der Ausführung ihrer Straftaten nicht im vorigen Jahrhundert stehen geblieben, sondern in zunehmendem Maße gleichfalls mit der Zeit gegangen sind und sich moderner Techniken bedienen. Als ein Beispiel von vielen sei hier nur die Computerkriminalität erwähnt. „Die Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient“, schrieb einst der französische Biologe Lacassagne. Danach „verdienen“ wir heutzutage die „Weiße-Kragen-Verbrecher“ sowie die internationalen Banden von Berufskriminellen und Terroristen. Es könnte jedoch noch viel ärger kommen, wie der amerikanische Politologe Zbigniew Brzezinski schon vor einem Jahrzehnt warnend erklärt hat: Gefahr drohe den modernen Industriegesellschaften nicht mehr von Kriegen, sondern von wachsender Anarchie, von den Privatkriegen einzelner Gruppen. Brzezinski befürchtet Verbrechen, durch Gruppen hoch intelligenter Menschen geplant, die sich, von keinem Gewissen gehemmt, aller, aber auch aller Mittel bedienen, die Wissenschaft und Technik bis heute erdacht haben.
Doch kehren wir von den Kriminellen zu den Kriminalisten zurück, von den modernen Verbrechensmethoden zur Verbrechensbekämpfung mit den neuesten naturwissenschaftlichen und technischen Hilfsmitteln. Heutzutage ist die Kriminaltechnik imstande, „den stummen Tatort zum Sprechen zu bringen“, und zwar in einem Umfang, den Sherlock Holmes oder Kommissar Maigret, als einer seiner zahlreichen berühmten Nachfolger, sich nicht hätten träumen lassen. Dafür sorgen die Großgeräte, an denen die Wissenschaftler, die sogenannten Detektive im weißen Kittel, in den physikalischen, chemischen und biologischen Labors der Kriminaltechnik arbeiten. Das Raster-Elektronenmikroskop etwa vergrößert bis zum Fünfzigtausendfachen und entwickelt außerdem eine ungewöhnliche, nahezu dreidimensionale Tiefenschärfe. Ultraviolette Spektrographie, Massenspektrometrie, Gaschromatographie können noch ein Millionstel Gramm eines Stoffrückstandes untersuchen. Ein in Wiesbaden entwickeltes System lässt anhand der Schmauchspuren auf den Zentimeter genau die Entfernung ermitteln, aus der ein Schuss abgefeuert wurde. Auch kann man beispielsweise an einem Handschuh den Abrieb eines Goldringes feststellen.
Jede Waffe hinterlässt eine individuelle Spur. Aus der Oberflächenstruktur winziger Lacksplitter lesen Kriminaltechniker das „Bild der Verwitterung“ ab, der ein Auto häufig ausgesetzt ist: Steht es im Schwarzwald oder in Stuttgart? In welchem Winkel hielt der Bauer – der selbst ungerührt von einem Unfall spricht – die Schrotflinte, mit der er seine Nachbarin erschoss? Mit welchen Werkzeugen wurde der Bombenschalter abgeschnitten? Aus welchem Land stammt das Haschisch?
Alle diese Fragen und noch viele andere kann die moderne Kriminaltechnik beantworten.
Neben Physik, Chemie und Biologie tritt die Daktyloskopie, deren Nutzen dank elektronischer Auswertung vervielfacht wird. Noch vor wenigen Jahren brauchten die Kriminalisten alle zehn Fingerabdrücke zur Identifizierung. Nach einem neuen Verfahren wird hingegen jeder Fingerabdruck einzeln für sich mithilfe einer Formel von rund hundert Zeichen beschrieben, das heißt in der Computersprache digitalisiert. Anhand nur eines einzigen Fingerabdrucks lässt sich so in Sekundenschnelle aus der Datenbank in Wiesbaden der Gesuchte aussondern. Gleichfalls nur Sekunden dauert auch die Überspielung vom Tatort auf den Bildschirm des Bundeskriminalamts.
Verbrechen ohne Spur gibt es nicht. „Da müsste schon ein Täter einem Engel gleich über den Tatort schweben“, wie es einmal der Präsident des Bundeskriminalamts ausgedrückt hat. Das gleiche schrieb auch der bekannte Lyoner Kriminalist Locard: „Es gibt keinen Rechtsbrecher, so gewieft er auch sein mag, der nicht unfreiwillige Spuren seines Auftretens zurücklässt. Diese Zeugen sind die Einzigen, die niemals lügen. Es sind Ankläger, die nicht zu schlagen sind.“
Wenn also Spuren nicht lügen, so schließt dies jedoch nicht aus, dass sie falsch gewertet werden. Der Fehler liegt dann aber nicht an der Spur, sondern am Menschen. Die Kriminaltechnik ist heute imstande, die verborgensten Spuren aufzudecken. Oder richtiger: Sie wäre imstande, gäbe es nicht menschliche Unzulänglichkeit.
„Es ist in der Organisation der Polizei begründet, dass nach Entdeckung eines schweren Verbrechens meistens nicht zuerst die Kriminalpolizei am Tatort erscheint, sondern Angehörige der uniformierten Polizei eintreffen. Ihre Hauptaufgabe ist die Sicherung des Tatortes vor Veränderungen durch Eingriffe Unberufener. Das liest sich in den Dienstanweisungen viel leichter, als es manchmal getan ist. Ein alter und erfahrener Berliner Kriminalbeamter, der jahrelang von Tatort zu Tatort eilte und sich als Mordkommissar einen Namen gemacht hatte, nannte einmal aus eigener Erfahrung mit Berliner Humor die Revierbeamten `die Kommission zur Vernichtung des objektiven Tatbestandes´.“
Aus diesen Worten des namhaften Fachautors und Kriminaldirektors F. Meixner in seiner zweibändigen „Kriminal-Taktik“ geht klar hervor, wie wichtig die Sicherung des Tatorts ist. Denn für den wissenschaftlich geschulten Kriminalisten ist er die ergiebigste Fundquelle der Spuren, die möglicherweise nicht nur zum Täter führen, sondern auch die Beweise seiner Schuld liefern. Unter Tatort ist nicht nur der eigentliche Schauplatz zu verstehen, an dem das Verbrechen begangen wurde, sondern alle mit ihm zusammenhängenden und verbundenen Räume – wie Flur, Zugänge, Nebengelasse -, da der Täter an allen diesen Stellen Spuren hinterlassen haben kann. Abdrücke der Schuhsohlen im Flur sind wesentlich aufschlussreicher als entferntere, da mit jedem Schritt etwa daran haftende Substanz abfällt. Auch ist es wahrscheinlich, dass der Verbrecher den höchsten Wachsamkeitsgrad am Tatort entwickelt, seine Aufmerksamkeit aber allmählich nachlässt.
Bis zum Anlauf der kriminaltechnischen Arbeiten sollte der Tatort daher ein Tabu sein, das erst mit dem Fortschreiten der einzelnen Untersuchungen abgebaut wird. Nicht immer kann auch der nähere oder gar der weitere Zugang zum Schauplatz des Verbrechens so weit und so wirksam abgeriegelt werden, dass von den dort feststellbaren „stummen Zeugen“ auswertbare „Aussagen“ zu erhalten sind.
„Fehlerquelle Nummer 1 ist der Beamte am Tatort“, wie ein Kriminologe in einem Gespräch erklärte. Er kann Spuren verwischen, zerstören, übersehen, unsachgemäß behandeln, durch Unaufmerksamkeit verändern.
„Einer von uns müsste immer dabei sein“, wünschen sich deshalb die Kriminaltechniker.
„Das erste, was wir in unserer Ausbildungszeit lernen“, erinnerte sich ein Kriminalbeamter, „wenn wir einen Tatort betreten: zuerst einmal Hände in die Hosentaschen.“
Viele halten sich jedoch nicht daran. Menschliche Fehler sind auch im Zeitalter der Elektronik kaum auszuschalten.
Sherlock Holmes wäre um vieles ärmer, hätte er nicht seinen Scharfblick und Scharfsinn bei der Entdeckung und Deutung von Spuren beweisen können. Sein Superinstinkt ist kein Zufall, denn die Spur gehört zu den Hauptbeweismitteln.
Die außerordentlichen Fortschritte von Naturwissenschaft und Technik haben das Spurenspektrum in der Vielfalt und Feinstrukturierung erheblich erweitert. Vieles ist inzwischen Spur geworden, was zu Conan Doyles Zeiten sein Meisterdetektiv Sherlock Holmes noch nicht erfassen konnte, da hierzu die Wissensgrundlagen und Methoden fehlten. „Diese Entwicklung hält weiter an und hilft vielleicht dazu mit, dass mancher auf sich allein gestellte Polizeibeamte sich von der Spurenlehre als einer Art Geheimwissenschaft fälschlicherweise ausgeschlossen fühlt. Die Gefahr ist latent vorhanden, dass man sich vom Sehen und Erkennen unbewusst ausschließt und allzu viel jenen, die es `wissen müssen´, überlässt“, heißt es dazu in einem Fachbuch, das sich nicht an die Beamten der Erkennungsdienste oder kriminaltechnischen Abteilungen richtet, sondern an den „normalen“ Polizeibeamten, der in der Regel als Erster am Tatort eintrifft und die ersten Entscheidungen treffen muss – und dessen „Spurenbewusstsein“ deshalb geschärft werden soll. „Gewiss geht es nicht ohne Spezialisten, aber das heißt nicht, sich gegenüber der Welt der Spur mehr oder weniger passiv zu verhalten. Am Tatort kann man nur richtig vorgehen, wenn man um die verschiedenen Arten der Spuren weiß und eine lebendige Beziehung zur Spur im Einzelnen und ihrer Vielfalt unterhält. Diese Beziehung zu schaffen ist von größter Wichtigkeit, denn die Spur hilft mit, das Tatgeschehen zu entschlüsseln und den Täter zu ermitteln.“
Befriedigt nimmt man einen raschen Erfolg der Kriminalpolizei zur Kenntnis, bei einem Fehlschlag aber ist man enttäuscht und sogar erzürnt. Allzu voreilig kreidet man es den Kriminalisten als Versagen an, wenn ihnen eine Panne bei der Ermittlung eines Kapitalverbrechens unterläuft oder wenn es dem Täter gelingt, bei der Verbrecherjagd zu entkommen.
Ein Musterbeispiel für vollendetes kriminalwissenschaftliches Können liefert der folgende Fall. Obwohl es sich um einen „Mord ohne Toten“ handelte und der Angeklagte bis zuletzt leugnete, war der wissenschaftliche Schuldbeweis lückenlos.
Ein „Mord ohne Toten“
Angeklagt war der fünfunddreißigjährige „Kaufmann“ Theodor Weber, den Wiener Kaufmann Gustav Eichenwald ermordet zu haben. Wo, wann und wie er dieses Verbrechen begangen hatte, ließ sich nicht ermitteln.
Der aufsehenerregende Mordprozess begann daher mit der formellen Feststellung, dass es weder einen Toten gab, noch der Tatort bekannt war. Das Mordopfer blieb unauffindbar. Da unter diesen Umständen natürlich auch Tatzeugen fehlten, war es von vornherein klar, dass die Indizien unerschütterlich sein mussten, sollten sie zu einer Verurteilung ausreichen. Mit Theodor Weber stand zum ersten Mal ein Angeklagter wegen Mordes, Raubes und anderer Nebendelikte vor einem schweizerischen Gericht, ohne dass der Staatsanwalt angeben konnte, an welchem Ort, zu welcher Zeit und auf welche Art das Opfer getötet worden war.
Begonnen hatte alles in einem Züricher Uhrenladen, von dessen Inhaber der Wiener Kaufmann Eichenwald laufend Ware bezog. Dort war eines Tages Eichenwald mit Weber, den er bis dahin noch nicht gekannt hatte, zufällig zusammengetroffen. Als Eichenwald merkte, dass Weber der eigentliche Lieferant des Geschäftsinhabers war, blinzelte er ihm verstohlen zu. Er hoffte, durch die unmittelbare Geschäftsverbindung mit Weber künftig die Provision des Züricher Zwischenhändlers sparen zu können. Weber verstand den Wink und wartete an der nächsten Straßenecke auf den Wiener Kaufmann. Eichenwald glaubte, ein gutes Geschäft gemacht zu haben, als der andere auf seinen Vorschlag einging. Er ahnte nicht, dass er dafür schon bald mit dem Leben bezahlen musste.
Bei den kleineren Abschlüssen, die zunächst zustande kamen, machte Weber seinen Partner, der stets gegen bar kaufte, mit angeblichen Uhrenfabrikanten bekannt. Das Geschäftsgebaren blieb zwielichtig, Unterlagen darüber gab es nicht.
Doch dann nahte der Tag, der Eichenwald zum Verhängnis werden sollte. Am 15. Oktober 1953 war er, aus Wien kommend, wieder einmal in Zürich eingetroffen und im Hotel Jura am Limmatquai abgestiegen. Ziemlich früh verließ er es am folgenden Morgen – und wurde nie mehr gesehen.
Als es schließlich im Hotel auffiel, dass er sich überhaupt nicht mehr blicken ließ, wurde die Kriminalpolizei verständigt. Da der Wiener Gast Gepäck und Pass im Zimmer zurückgelassen hatte, nahm man an, er habe vielleicht eine diskrete Vergnügungsfahrt unternommen, und wartete noch einige Tag ab. Als er jedoch nach dem Wochenende nicht zurückgekehrt war, begann die Polizei nach ihm zu fahnden. Die Ermittlungsarbeit brachte erstaunliche Ergebnisse, die der Bericht in nüchternen Worten wiedergibt:
Eine Rückfrage in Wien ergab, dass der Händler am 13.10. an Theodor Weber telegrafiert hatte, er würde am 15.10. in Zürich eintreffen.
Am 15.10. abends stieg Eichenwald im Hotel „Jura“ ab. Er führte mehrere Telefongespräche, darunter auch mit Weber, mit dem er sich für den 16. um 13.30 Uhr verabredete.
Am 16.10. verließ Eichenwald früh das Hotel, erledigte mehrere Besuche und begab sich zu einer Privatbank in der Pelikanstraße, wo er 130.000 Franken abhob. Der Kassierer, der ihm das Geld auszahlte, sah in Eichenwalds Aktentasche noch mehrere Bündel Banknoten, deren Wert er auf etwa 30.000 Franken schätzte.
Mittags um 13.30 Uhr wartete Eichenwald vor dem Lokal „Edoardo“. Ein Passant, der ihn kannte, sah ihn auf und ab gehen. Dies war die letzte Spur von ihm, die festgestellt werden konnte.
Theodor Weber wurde als ein siebenmal vorbestrafter Verbrecher identifiziert. Seine Verbindung mit Eichenwald ließ naturgemäß erhebliche Verdachtsmomente aufkommen, die allerdings zunächst nicht eindeutig festzustellen waren.
Offenbar stand Weber in Verbindung mit einem seiner Zuchthausgenossen, einem Mann namens Walter Stützle, der unter dem Namen Dreyer als Uhrenfabrikant auftrat.
Weber hatte am 14.10. einen Personenwagen gemietet, wofür kein plausibler Grund vorlag.
Weber kaufte am 15.10. eine automatische Pistole und dazugehörige Munition.
Zu einer Verhaftung reichten alle diese Feststellungen zwar nicht aus, wohl aber zu einer gründlichen Vernehmung. Im Auftrag der Züricher Polizei wurde Weber am 28. Oktober von einem Polizeikorporal in seinem Bieler Hotelzimmer abgeholt und über drei Stunden lang auf dem Polizeiposten verhört, vor allem über die „kritische Zeit“ am 16. Und 17. Oktober. Seine Angaben klangen echt, da er über den gesamten Zeitabschnitt ausführlich und erschöpfend berichtete. Einige „Fixpunkte“ darin ließen sich leicht überprüfen, die kurzen Pausen dazwischen konnten zu einem Raubmord und zur Beseitigung der Leiche nicht ausreichen. Als Zeugen für sein Alibi gab Weber seine Braut an sowie den gut beleumundeten Möbelhändler Scheidegger in Nidau und einen Uhrenfabrikanten in Biel. Das Verhör endete schließlich mit seiner Entlassung.
Kurz danach wurde dem Polizeikorporal in der Uhrenfabrik versichert, Weber habe in Begleitung eines Direktors Dreyer am Nachmittag des 16. Oktober die Firma besucht. Auch Webers Braut bestätigte seine Angabe. Als der Polizeikorporal schließlich noch den Möbelhändler Scheidegger in Nidau anrief, um sich eigentlich nur zu erkundigen, ob er im Betrieb sei, erhielt er schon gleich am Telefon die Auskunft, Weber habe mit seiner Braut Möbel kaufen wollen und wiederholt die Musterschau besucht, so auch vormittags am 17. Oktober.
Da das Verbrechen höchstwahrscheinlich zwischen dem Mittag des 16. und dem Mittag des 17. Oktober begangen worden sein musste, schied Weber somit als Täter aus: Alle drei Zeugen hatten sein Alibi bestätigt.
Trotz dieser Ermittlung des Bieler Polizeikorporals blieb die Züricher Polizei misstrauisch, denn immerhin war Weber bereits siebenfach vorbestraft. Nicht auszuschließen war ein Rechenfehler bei der knapp bemessenen Tatzeit. Jedenfalls hielt man es für ratsam, Weber auch weiterhin zu beobachten, denn wenn er der Mörder war, hatte er die Summe von mindestens 170.000 Franken erbeutet, die Eichenwald zuletzt in seiner Aktentasche mit sich geführt hatte. Erfahrungsgemäß kann ein Verbrecher nach einiger Zeit der Verlockung nicht widerstehen, mit den Tausendern nur so um sich zu werfen. Aber weder Weber noch ein anderer verriet sich durch solche Prasserei. Hinweise, dass der Mann, der die Uhren über die Grenze geschmuggelt hatte, in einem Abnehmerland hinter dem Eisernen Vorhang verhaftet worden war, halfen auch nicht weiter.
Dennoch waren Polizeileutnant Pfister und Bezirksanwalt Dr. Huggenberger noch nicht bereit, den Fall Eichenwald als unlösbar aufzugeben. Im Stillen ermittelten sie weiter, bis es ihnen schließlich fünfzehn Monate nach dem geheimnisvollen Verschwinden des Wiener Händlers gelang, in Webers scheinbar stichhaltigem Alibi eine Lüge zu entdecken.
Bei einer Befragung gab der Bieler Polizeikorporal zu, den Möbelhändler nicht in Nidau aufgesucht und mit ihm von Angesicht zu Angesicht, sondern nur telefonisch gesprochen zu haben. Was er versäumt hatte, holte Leutnant Pfister jetzt nach. Versuchte Scheidegger anfangs noch, seine früheren Angaben aufrechtzuerhalten, so gestand er schließlich, er habe Weber gefällig sein wollen, um ihn nicht als Kunden zu verlieren. Es habe sich ja nur um eine geringfügige Übertretung der Vorschriften im Straßenverkehr gehandelt, wie ihm Weber versichert hatte, eine Kleinigkeit also, nicht der Rede wert.
Bei der nochmaligen Befragung der Geschäftsleitung stellte sich heraus, dass Weber am späten Nachmittag des 17. Oktober nicht selber in der Uhrenfabrik erschienen war. Vielmehr hatte er seine längst fällige Schuld von32.300 Franken durch einen gewissen „Direktor Dreyer“ bezahlen lassen – und zwar in bar. Als man sich in der Geschäftsleitung darüber wunderte, erklärte „Direktor Dreyer“, das Geld stamme aus einer gleichfalls gegen Kasse verkauften Uhrenlieferung.
Am 22. Januar 1955 betraten Bezirksanwalt Dr. Huggenberger und Polizeileutnant Pfister in Biel das Hotel, in dem Weber wohnte. Als sie an seiner Zimmertür anklopften, dauerte es eine Weile, bis er verschlafen und ahnungslos öffnete. Nicht die geringste Unsicherheit verriet ihn, denn er war fest davon überzeugt, ein perfektes Verbrechen begangen zu haben. Niemand konnte ihm etwas beweisen, und deshalb, so glaubte er, konnte man ihm auch nicht den Prozess machen.
Noch ahnte er nicht, wie sehr er sich täuschte!
Acht Monate waren vergangen, als Oberrichter Dr. Gut am 17. September 1955 die Sitzung des Geschworenengerichts in Zürich eröffnete. Die Anklageschrift des Staatsanwalts gegen Theodor Weber enthielt eine ganze Reihe von Straftaten: Betrug, Hehlerei, Urkundenfälschung, Anstiftung zur Begünstigung, versuchte Anstiftung zu falschem Zeugnis, qualifizierter Raub und Mord. Unwichtig sind hier die Nebentatbestände, entscheidend dagegen ist der Indizienbeweis im Bereich der Hauptanklage. Darin wurde Weber beschuldigt, „am 16. Oktober abends oder in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober an einem nicht bekannten Ort in der Schweiz, vermutlich im Jura, auf der Fahrt nach einem unbekannten Ziel dem im Auto sitzenden Gustav Eichenwald mit der Waffe, das heißt durch Schüsse oder Schläge oder auf andere Weise, derart schwere Verletzungen beigebracht zu haben, dass Gustav Eichenwald verschied, worauf er, Weber, zusammen mit Walter Stützle – alias Dreyer – die Leiche des Opfers an einem unbekannten Ort so beiseite schaffte, dass sie nicht mehr gefunden werden konnte.
In der Anklageschrift folgte sodann der Tatbestand des qualifizierten Raubes „in einem unbestimmten, zwischen 134.000 und 200.000 Franken liegenden Betrag“.
Wie schon bisher leugnete Weber sowohl den Raub als auch den Mord und erklärte sich für nicht schuldig. Laut Bericht konnte ihm darauf vorgehalten werden:
Er kannte Eichenwald und stand mit ihm in ständiger Geschäftsverbindung.
Er brachte seinen Zuchthausgenossen Walter Stützle – der noch vor der Verhandlung starb – als „Uhrenfabrikdirektor Dreyer“ ins Spiel.
Er hatte nach Erhalt des Telegramms, das Eichenwalds Ankunft ankündigte, einen Revolver und Patronen gekauft. Die Waffe konnte nicht gefunden werden. Weber lieferte vier verschiedene Versionen über die Revolverkauf und das Verschwinden der Waffe. Er konnte keine beweisen.
Es war ihm gelungen, den Möbelfabrikanten Scheidegger durch Vorspiegelungen zur Bestätigung eines falschen Alibis zu bewegen.
Er hatte sich, zwei Tage bevor Eichenwald vermutlich ermordet worden war, einen Personenkraftwagen geliehen. In diesem war er mit Stützle am 17.10. vormittags bei Scheidegger in Nidau vorgefahren. Er erzählte, der Wagen sei arg verschmutzt, da sich Stützle erbrochen habe. Er wollte das Fahrzeug also reinigen. Später änderte Weber diese Erzählung und behauptete, unterwegs ein Reh überfahren zu haben, das er aus Angst vor einer Anzeige wegen Wildschadens oder verkehrswidrigen Fahrens in den Wagen nahm. Später gab er an, das blutende tote Tier sei im Kofferraum des Autos verstaut worden. Jedenfalls sollten in Nidau alle Spuren verwischt werden, woher immer sie rühren mochten.
Weber und Stützle bedienten sich eines Kessels, dessen Herkunft ungeklärt blieb, um aus einem Nachbarhaus des Möbelhändlers heißes Wasser zu beschaffen, mit dem sie den Wagen gründlich wuschen. Das Innere des Autos bearbeiteten sie mit Putzmitteln, Lappen und Bürsten. Den Bodenbelag, die Teppichmatten und die Überzüge lösten sie von ihren Halteklammern los und wuschen alles in einem Trog im Keller Scheideggers, wobei das Wasser sich rötlich färbte, was Weber mit dem Blut des überfahrenen Wildes erklärte. Mit ebenso großer Sorgfalt wurde der Kofferraum des Leihwagens ausgewaschen. Auch die Blutspuren dort stammten, nach Webers und Stützles Darstellung, von dem ausblutenden Reh.
Als Weber feststellte, dass einzelne Beläge durchgescheuert waren und ausgefranste Stellen einige darunter offenliegende Metallflächen zeigten, ließ er die beschädigten Matten durch völlig neue ersetzen. Die blutdurchtränkten verbrannte er im Ofen des Möbelhändlers. Denselben Weg gingen auch Schuhe und Kleidungsstücke Stützles, die verschiedene dunkle Flecken aufwiesen.
Alle Zeitangaben Webers über die Stunden, in denen diese Vorfälle sich abspielten, erwiesen sich als falsch. Seine Versuche, die Autofahrt mit dem Zwischenfall – dem Erbrechen Stützles oder dem Überfahren des Wildes – in sein Alibisystem einzubauen, misslangen. Für die ganze wahrscheinliche Tatzeit besaß Weber keinerlei beweisbares Alibi.
Weber befand sich bis zum 17. Oktober in einer verzweifelten wirtschaftlichen Lage. Er war erheblich verschuldet, konnte auch kleine Beträge nicht zurückzahlen und musste sich die notwendigsten Existenzmittel durch dunkle Geschäfte – hart am Rand des Strafgesetzbuches – beschaffen.
Nach dem 17. Oktober verfügte Weber über sehr erhebliche Geldmittel. Er zahlte fällige Rechnungen in Höhe von über 100.000 –Franken. Für private Käufe, meist von Luxusartikeln und Einrichtungsgegenständen, sowie für Vergnügungsfahrten und für ein Luxusauto gab er mindestens weitere 30.000 bis 40.000 Franken aus. Wahrscheinlich erreichte der Gesamtbetrag eine höhere Summe.
Auch Walter Stützle, der vor dem 16. Oktober mittellos war, besaß danach erhebliche Geldbeträge. Er schickte seiner von ihm geschiedenen Frau längst fällige Unterhaltsbeträge und deponierte bei einem Züricher Rechtsanwalt 25.000 Franken in bar. Die wichtigsten Zahlungen Webers und Stützles erfolgten in Tausender-Banknoten. Auch das Bargeld, das Eichenwald abgehoben hatte, war in Tausender-Banknoten ausbezahlt worden.
Webers sieben frühere Verurteilungen ließen stets dieselbe Taktik der Verdunkelung erkennen, die er im Mordprozess anzuwenden versuchte. Er hatte eine Reihe von kleineren Delikten begangen, wie Urkundenfälschung, Betrug, Hehlerei, Anstiftung zur Begünstigung und Versuch der Anstiftung zu falschem Zeugnis. Neben der Anklage wegen Mordes und Raubes traten die anderen Delikte in den Hintergrund. Sie konnten einwandfrei bewiesen werden und rundeten damit das Gesamtbild des Angeklagten – nicht zu seinem Vorteil – ab.
Das Belastungsmaterial in der Anklage der Staatsanwaltschaft war zwar erdrückend, es fehlten ihr aber noch die entscheidenden Beweismittel:
Sie konnte nicht beweisen, dass überhaupt ein Verbrechen begangen worden war.
Sollte aber das Gericht zur Annahme des Kapitalverbrechens gelangen, so fehlte der Nachweis der Tatzeit; ebenso gab es keinerlei greifbaren Anhaltspunkt über den Tatort; es gab keine Mordwaffe; und es gab, trotz aller Fahndungen und Suchaktionen, auch keinen Toten.
Der Ankläger befand sich also in einer schwierigen Lage. Um den mutmaßlichen Täter eindeutig zu überführen und so einen Schuldspruch zu erwirken, musste erst ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verschwinden Eichenwalds und den Handlungen Webers bewiesen werden. Aber wie? Stützle, den man als Mitfahrer Webers hätte befragen können, war inzwischen verstorben. Andere Tatzeugen gab es nicht. Es ließ sich noch nicht einmal feststellen, ob der Mörder sein Opfer – also Weber den Wiener Uhrenhändler – getroffen hatte, nachdem Eichenwald den hohen Geldbetrag bei der Bank abgehoben hatte.
Nach der Überzeugung des Staatsanwalts war der Tathergang folgender: In Zürich war Eichenwald in das von Weber gemietete Auto gestiegen, um mit ihm nach Biel zu fahren. Dort wollte der Mitreisende „Direktor Dreyer“ – alias Stützle – dem Wiener Geschäftspartner angeblich wohl einen größeren Bestand von Uhren zu einem besonders günstigen Preis übergeben. Irgendwo auf dieser Strecke ist Eichenwald dann ermordet und beraubt worden.
Wenn das wirklich stimmte, dann musste sich die Bluttat durch Spuren im Wagen beweisen lassen. Leider aber waren diese Spuren durch die sorgfältige Reinigung mit chemischen Putzmitteln und heißem Wasser vernichtet worden. Außerdem lag der Raubmord an jenem verhängnisvollen 16. Oktober bereits zwei Jahre und vier Monate zurück, als der Mietwagen schließlich mit kriminalwissenschaftlichen Hilfsmitteln untersucht werden konnte. Was viele für ausgeschlossen gehalten hatten, geschah dennoch: Allen Zweifeln zum Trotz lieferte Dr. Max Frei-Sulzer, der Leiter des wissenschaftlichen Dienstes der Züricher Stadt-Kriminalpolizei, dem Staatsanwalt den entscheidenden Beweis für das Verbrechen. Als Sachverständiger führte er vor Gericht aus:
„Zunächst hatten wir den Wagen auf etwaige Spuren jenes Unfalls untersucht, bei dem der Angeklagte angeblich ein Reh überfahren haben will. Als das erfolglos blieb, überprüften wir den ganzen Boden – sowohl den Belag als auch die darunterliegenden Blechflächen – durch den Benzidin-test. Mit dieser Methode lassen sich nämlich Blutspuren auch dann noch feststellen, wenn sie mehrfach und gründlich abgewaschen oder ausgelaugt worden sind. Natürlich bleibt die Reaktion hierbei begrenzt. Bei unserem Test zeigten sich deutliche Spuren von an sich unsichtbaren Blutflecken, und zwar am Blech vor den Vordersitzen und in besonders starker Testfärbung an den Geweben unterhalb der Sitze. Wie wir einwandfrei feststellten, war Blut in die Juteverkleidung der Vordersitzpolster eingesickert. Weitere noch beweiskräftige, wenn auch geringere Spuren entdeckten wir in der Filzzwischenmatte auf dem Fußboden, ferner an den Bezügen der Rücklehne und an der Oberseite der Vordersitze. Schwache Benzidinfärbung zeigte sich auch am Blechboden vor den Sitzen im Fond, wo die Beläge erneuert und das Blech sehr nachhaltig abgewaschen worden war. Die stärksten Blutspuren ließen sich jedoch im Kofferraum nachweisen, besonders an den Seitenverschalungen und in den Tiefen der inneren Ecken.“
Entscheidend aber war, wie der Sachverständige betonte, eine Blutkruste am Unterteil des Vordersitzes. Mit bloßem Auge ließ sie sich zwar nicht erkennen, desto klarer jedoch in der wissenschaftlich-technischen Prüfung. Sie befand sich am Jutegewebe, das die Polsterung gegen die Querträger der Federn abschirmte.
„Für uns kam es nun darauf an, festzustellen, ob die Substanz Stärke enthielt. Denn wie ja der Angeklagte behauptet hat, rührten die Blutspuren angeblich von dem Mageninhalt her, den sein Mitfahrer erbrochen hatte. Falls das zutraf, mussten zersetzte Stärkekörner analytisch nachzuweisen sein, selbst bei geringsten Mengen. Für uns war deshalb diese Untersuchung ausschlaggebend. Aus diesem Grund wandten wir außer den üblichen Testmitteln auch noch das Chlorverfahren an. Es ist so außerordentlich empfindlich, dass sich damit auch im winzigsten Brotkrümel die chemische Zusammensetzung des Salzes ermitteln lässt, das der Bäcker dem Teig beigemengt hat. Am Ende unserer Versuchsreihe stand für uns unumstößlich fest: Die Blutkruste stammt unmöglich aus erbrochenem Mageninhalt!
Da es sich hierbei einwandfrei um das Blut eines Menschen und nicht eines Tieres handelte, war bereits zu diesem Zeitpunkt die Behauptung des Angeklagten widerlegt, er habe ein überfahrenes Reh in seinem Mietwagen transportiert.
Doch wenn die Blutspuren weder von Stützle noch von einem Reh stammten – von wem dann? Zwar stand nun fest, dass Webers Ausreden erlogen waren, aber wir hatten immer noch nicht bewiesen, dass es sich um Eichenwalds Blut handelte.
Wir waren uns also im Klaren darüber, dass die bisherigen Indizien bei weitem noch nicht ausreichten, den Angeklagten zu überführen. Das sollte uns jedoch mithilfe eines einzigen Härchens gelingen, das wir mit verschiedenen anderen Haaren beim Durchkämmen des Wageninnern gesammelt hatten. Wie wir wussten, pflegte Eichenwald sein Haar zu färben. Deshalb schieden alle nicht gefärbten sowie andersfarbigen Haare aus, ebenso natürlich auch die Haare von Frauen. So blieben schließlich noch vier Haare übrig, wovon aber nur ein einziges Härchen wirklich wichtig war. Es hatte sich nämlich in der Blutkruste unterhalb des Vordersitzes befunden.“
An diesem Haar hing Webers Schicksal. Das wurde den Geschworenen immer klarer, je überzeugender ihnen der Sachverständige in seinem Vortrag die kriminalwissenschaftliche Bedeutung von Haaren erläuterte:
„Nach internationalen Normen werden die menschlichen Haare zunächst nach ihrer Farbe in zehn Kategorien eingestuft. Davon ist jede Kategorie wiederum nach den verschiedenen Haardurchmessern in zehn Hauptgruppen unterteilt. Für Merkmalunterschiede besonderer Art gibt es weitere Aufgliederungen, so für die Sichtbarkeit des Haarmarks, seine etwaige Verdeckung, die Dichte der Verteilung, die Proportion zwischen dem Haar und dem Mark. Weiterhin unterscheidet man die Pigmentstruktur, woraus sich allein schon über 50.000 Haartypen ergeben. Doch nicht genug damit! Die modernen chemischen und physikalischen Hilfsmittel ermöglichen eine weitere Zerlegung in noch wesentlich feinere Merkmale, die zu mehreren hunderttausend Varianten führen. Je vollständiger also die Aussonderung nach einer maximalen Zahl von Unterscheidungszeichen ist, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Haare mit derselben Struktur nicht von einem einzigen Menschen, sondern von zwei Individuen stammen.“
Wie Dr. Frei-Sulzer vor Gericht weiter ausführte, hatte er das winzige Haar unter dem von ihm entwickelten Vergleichsmikroskop eingehend untersucht und war daher zu dem aufschlussreichen Ergebnis gelangt:
„Dieses Haar war weder ausgefallen noch ausgerissen, sondern einwandfrei abgequetscht worden – und zwar durch Druck an der Hautansatzstelle.
Natürlich gingen wir auch der Frage nach, ob dieses Haar vielleicht schon von früher her im Behälter unterhalb der Vordersitze gewesen und erst später durch einen Luftzug oder einen anderen mechanischen Vorgang in die Blutkruste gelangt sein könnte. In diesem Fall hätten sich nämlich damals Unreinheiten aller Art an der Oberfläche angesammelt. Da wir das Haar aber völlig staubfrei aus der Substanz entfernt hatten, schied diese Möglichkeit aus. Damit steht fest: Das Haar ist unmittelbar nach der Abquetschung, sozusagen körperfrisch, in das Blut geraten, das dann später austrocknete und die Kruste bildete.“
Zusammen mit dem Haar aus der Blutkruste legte nun der Sachverständige dem Gericht andere Haare Eichenwalds vor. Die Wiener Kriminalpolizei hatte sie in der Wohnung des Verschwundenen auf verschiedenen Kleidungsstücken gefunden und nach Zürich gesandt. Wie jedermann sich nun überzeugen konnte, gab es dabei nicht den geringsten Zweifel, dass das Haar aus der Blutkruste von dem Wiener Uhrenhändler stammte. Außer der völligen Übereinstimmung selbst der kleinsten Unterscheidungsmerkmale waren die Vergleichshaare und das aus der Kruste gelöste Einzelhaar mit demselben Farbstoff getönt, den Eichenwald zu benutzen pflegte.
Von wem aber rührte das Blut her?
Zu dieser Frage nahm nun ein anderer Sachverständiger vor Gericht Stellung. Mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden und Apparaturen hatte der Oberarzt am Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Zürich die Blutkruste untersucht. Bei diesen eingehenden Bluttesten ließ sich zwar das Alter der eingetrockneten Substanz, die zweifellos von Menschenblut herrührte, nicht mehr genau ermitteln. Sie war jedoch, wie er betonte, „mindestens mehrere Monate alt, wahrscheinlich noch wesentlich älter“. Da mit dem Ablauf der Zeit die Differenzierungssubstanzen zurückgehen, ließ sich die Blutgruppe nur schwer bestimmen. Nicht mit absoluter Gewissheit, jedoch mit ausreichender Wahrscheinlichkeit handelte es sich um die Blutgruppe 0, der auch Eichenwald angehört hatte. Von Walter Stützle jedenfalls konnte die Blutkruste nicht herrühren, da er nachweislich die Blutgruppe A besessen hatte.
Zusammen mit anderen schwerwiegenden Indizien lieferte also ein einziges Haar den ausschlaggebenden Beweis für die Schuld des Angeklagten: nämlich das Härchen Eichenwalds in einer Blutkruste unterhalb der Vordersitze des Wagens, den Weber zwei Tage vor dem Verschwinden des Wiener Uhrenhändlers gemietet und tags darauf mit allen erdenklichen Mitteln von Blutspuren zu säubern versucht hatte. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu lebenslänglichem Zuchthaus.
Verbrechen sind nicht immer und überall Verbrechen
Wie der gerade geschilderte Kriminalfall lehrt, spricht die Spur ihre eigene Sprache. Die vorerst unverstandene Spur zu entschlüsseln ist eine allgemeine kriminalistische Aufgabe. Wird eine Straftat begangen, so entstehen in der Regel Spuren. Eine „Spur“ kann schlechthin alles sein, winzig klein oder groß, lebend oder tot. Das Spurenspektrum ist unermesslich. Sogar ein Erpressungsversuch über das Telefon hinterlässt eine Spur, nämlich die Stimme des Erpressers. Man kann sie konservieren und stimmspektrographisch auswerten.
Die Spur ist der stille Zeuge der Tat. Sie trägt mit dazu bei, den Tatablauf zu entschlüsseln. Nur wenige Spuren führen direkt zum Täter, aber viele weisen in seine Richtung. Der Spur muss und kann nicht immer alles erbringen. Gleichwohl hat die geringste Spur, die den Tathergang zu enträtseln hilft oder in Richtung Täter weist, ihren Wert.
Durch den Einsatz der Naturwissenschaften und deren erstaunliche Fortschritte – sowohl was die Erkenntnisse als auch die Methoden zur genauesten Erfassung kleinster Substanzmengen betrifft – hat der Sachbeweis und mit ihm die Spur in den letzten Jahrzehnten außerordentlich an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung hält immer noch an. In vielen Fällen vermag der Sachbeweis den Verdächtigen zu überführen oder auch vom Tatverdacht zu entlasten. Zusätzlich lässt sich durch diesen Beweis die Zuverlässigkeit von Geständnissen und Zeugenaussagen überprüfen.
Wie berichtet hat sich der Fall Weber in den fünfziger Jahren zugetragen. Jahrzehnte zuvor hätte man den Verdächtigen wohl kaum mit dieser naturwissenschaftlichen Exaktheit überführen können – Jahrzehnte danach sind die Instrumente und Methoden der Kriminalistik noch viel weiter entwickelt und wirksamer geworden.
Von der Verbrechensbekämpfung früherer Zeiten bis in unsere Tage war es ein weiter Weg. Seit ihren Anfängen kennt die menschliche Gesellschaft Handlungen, die wir „Verbrechen“ nennen. Derartige Verhaltensweisen stehen auch seit langem im allgemeinen Erkenntnisinteresse, wie wir dies beispielsweise dem Codex Hammurabi, dem Alten Testament oder der antiken Tragödie entnehmen können. Dabei galten und gelten Verbrechen nicht immer und überall als Verbrechen. Doch in unserer Zeit scheinen Rechtsnorm und Rechtsbruch als besonders fragwürdig empfunden zu werden. Erst die moderne Industriegesellschaft empfindet die Kriminalität als Herausforderung, ja als „die Frage des Jahrhunderts“.
Andere Zeiten – andere Verbrechen. Diebe, Räuber, Mörder, wie wir sie aus klassischen Kriminalromanen kennen, werden von Wirtschaftsverbrechern im „weißen Kragen“ und hoch organisierten, in Banden auftretenden Berufsverbrechern abgelöst. Einige Banden planen außergewöhnlich sorgfältig, handeln geradezu als kommerzielle Unternehmen, sind international verzweigt, versuchen ein Minimum an Risiko mit einem Maximum an Gewinn zu verbinden. Dabei werden Spezialisten – Killer, Techniker, Anwälte und Wissenschaftler – eingespannt.
Geschichte und Völkerkunde lehren, dass die Vorstellungen darüber, was denn überhaupt kriminell sei, höchst unterschiedlich sind. Was in einem Land und zu einer Zeit als Verbrechen galt, ging anderswo und zu anderer Zeit straffrei aus – sogar Raub und Mord. Ein bestimmtes Verhalten ist nicht von Natur aus oder durch Anlage kriminell, vielmehr werden die Normen des Strafbaren durch die jeweilige Gesellschaft geschaffen. Unser Strafrecht ist am Eigentum und seiner Sicherung ausgerichtet. Andere sozialschädliche Handlungen bestraft es dagegen gar nicht oder nur ungenügend, wie beispielweise Umweltverseuchung, Wucher und Spekulation.
Das Bild der Kriminalität wird durch die Kriminalstatistik verfälscht, da ihr, grob wie sie ist, jede Differenzierung fehlt. Unter Eigentumsdelikt fällt danach das Stehlen einer Schallplatte ebenso wie der Diebstahl eines Diadems. Indem die Statistik Straftaten schlicht über den gleichen Leisten schlägt, verzerrt sie die Größenordnungen.
Jahr für Jahr bleiben Millionen Fälle unbekannt, weitaus mehr als bekannt werden. Warum Straftaten nicht gemeldet werden, dafür gibt es zahllose Gründe: aus Unwissen, Furcht vor Vergeltung, Scham, Scheu vor der Öffentlichkeit, Misstrauen gegenüber der Polizei, Gleichgültigkeit, Trägheit, weil man keine Umstände haben will, sowie vieles andere mehr. Gleich massenweise und formularmäßig erstatten Großfirmen Betrugsanzeigen – alte, kranke, hilflose Leute dagegen so gut wie keine. Verkäuferinnen und Detektive in Warenhäusern ertappen täglich Tausende von meist kleinen Dieben, deren Zahl sich in der Statistik niederschlägt und die Aufklärungsquote der Polizei aufbläht.
Schon wiederholt ist bisher von Kriminalistik und verwandten Begriffen die Rede gewesen. Da sich das gesamte Buch damit befasst, sollen hier die wichtigsten Bezeichnungen kurz erläutert werden.
Abgeleitet von dem lateinischen Wortstamm crimen = Verbrechen sind alle mit „kriminal“ gebildeten Wörter, also auch die Kriminalwissenschaft, zu der Kriminalistik und Kriminologie gehören, Wissensgebiete, die sich mit dem Verbrechen befassen.
Unter Kriminalistik versteht man die Lehre von den Mitteln und Methoden der vorbeugenden (präventiven) und der strafverfolgenden (repressiven) Verbrechensbekämpfung.
Kriminologie dagegen ist – kurz gesagt – die Wissenschaft vom Verbrechen. Anders ausgedrückt heißt dies: Kriminologie ist alles, was sich mit den Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen des Verbrechens befasst. Sie ist also die geordnete Gesamtheit des Erfahrungswissens über das Verbrechen, den Rechtsbrecher, die negative soziale Auffälligkeit und über die Kontrolle dieses Verhaltens.
Die Kriminalistik ist wiederum in die Teilbereiche Kriminaltaktik, Kriminaltechnik und Kriminaldienstkunde gegliedert:
Mit Kriminaltaktik bezeichnet man die taktisch-logische Kriminalistik: das geschickte, folgerichtige Vorgehen bei der Verbrechensbekämpfung.
Kriminaltechnik nennt man die technisch-naturwissenschaftliche Kriminalistik: den Einsatz technischer Mittel und naturwissenschaftlicher Methoden bei der Suche, Sicherung, Untersuchung und Auswertung von materiellen Spuren im Rahmen der Verbrechensbekämpfung.
Kriminaldienstkunde ist die formelle Kriminalistik: die Anwendung von Dienstvorschriften bei der Verbrechensbekämpfung.
Selbstverständlich ist die Terminologie der Kriminalwissenschaft damit nicht erschöpft, doch soll dies vorerst genügen.
In scharfem Gegensatz zu diesen wissenschaftlichen Begriffen stehen volkstümliche Vorurteile, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Wer sie als naive und unwissenschaftliche Irrtümer erkennt, spart Zeit, Kraft und Geld.
Zu den bekanntesten Vorurteilen gehört die Behauptung, dass der Mörder immer wieder zum Tatort zurückkehrt. Was in einigen Fällen tatsächlich vorkommt, darf man nicht verallgemeinern. Meistens sind die Polizeibeamten enttäuscht, die manchmal tagelang den Tatort beobachten, um auf die Rückkehr des Täters zu warten.
In die gleiche Richtung zielt auch die Behauptung: „Die Sonne bringt alles an den Tag!“ Schön wär’s, aber leider ist in Wirklichkeit die Zahl der ungelösten Verbrechen erschreckend hoch. So werden beispielsweise viele Morde erst nach Jahren entdeckt – wie viele aber bleiben unentdeckt, weil man eine natürliche Todesursache annimmt!
Wenn die volkstümlichen Vorurteile beim Verhalten des Mörders nicht stimmen, gelten sie dann vielleicht für den Ermordeten? Sicherlich wird niemand bestreiten, dass ein toter Mann ein stummer Mann ist. Oft aber kann ein Toter eine beredte Sprache sprechen. Wie viel er verrät, hängt mit dem Geschick der Kriminalisten und der Detektive im weißen Kittel zusammen. Auch trifft es nicht zu, dass sich der Ausdruck der Überraschung, der Furcht oder anderer heftiger Gemütsbewegungen auf dem Gesicht des Opfers ausprägen. Vielmehr entspannen sich – von wenigen Fällen abgesehen – im Allgemeinen die Muskeln. Völlig unsinnig dagegen ist die Behauptung, im Auge des Toten sei das Bildnis seines Mörders zu sehen. Das ist Aberglaube ohne jede wissenschaftliche Grundlage. In diesen Bereich gehört auch die leider immer noch dann und wann angewandte Methode, Hellseher, Wahrsager und Medien bei der Aufklärung von Verbrechen heranzuziehen. Natürlich wäre es ideal, den Geist des Ermordeten zu zitieren und für die Entlarvung seines Mörders einzusetzen, aber bis jetzt hat man damit noch in keinem einzigen Fall wertvolle Aufschlüsse erhalten.
Kann eine Fotografie lügen? Ein weit verbreitetes Vorurteil lautet: Nein, nie! Doch auch das wird durch die Praxis widerlagt, denn viele Umstände können eine Fotografie beeinflussen und dadurch einen falschen Eindruck vermitteln: so unter anderem der Gebrauch einer bestimmten Optik, die Aufnahmeperspektive, die Filmart oder die Entfernung vom Objekt. Verzerrte oder schlecht belichtete Aufnahmen verwirren die Untersuchungsbeamten nur, statt ihnen bei der Aufklärung zu helfen.
Ein bekanntes, aber völlig abwegiges Vorurteil ist auch die Annahme, ein Schuss durchs Herz bewirke den sofortigen Tod. Vielmehr gibt es Menschen, die nach einem Herzschuss noch Erstaunliches geleistet haben. Falsch ist ferner der volkstümliche Glaube, ein Ertrinkender tauche zweimal auf, bevor er dann endgültig untergehe. In Wirklichkeit kann eine ertrinkende Person sofort in der Tiefe verschwinden, jedoch den Todeskampf noch beträchtliche Zeit fortsetzen, bis sie schließlich bewusstlos wird.
Bekanntlich findet Wachstum nur dann statt, wenn die Zellen durch den Blutkreislauf mit Nahrung und Sauerstoff versorgt werden. Ohne Herzschlag gibt es also auch keinen Nachschub mehr. Einige Zellen leben zwar länger als andere, aber nach kurzer Zeit stirbt das gesamte Leben aller Zellen. Bei einem Toten kann demnach keine Art von Wachstum mehr stattfinden.
Dennoch hält sich hartnäckig das Vorurteil, noch nach dem Tod würden die Haare und Nägel eines Toten weiter wachsen. Der Grund hierfür ist wohl in einer optischen Täuschung zu suchen: Der Haut eines Toten wird nämlich Feuchtigkeit entzogen, sie schrumpft. Dadurch treten Teile der Nägel und Haare hervor, die bisher von Haut bedeckt waren, und erwecken so den Eindruck eines Wachstums nach dem Tode.
Im Allgemeinen ist Mord ein nicht schwer zu verübendes Verbrechen. Da der Mensch äußerst verwundbar ist, kann man ihm auf sehr viele und sehr einfach Art das Leben nehmen. Aber kaum hat der Mörder den Mord begangen, da stellt sich ihm die Frage: Wohin mit der Leiche? Wie oft schon hat sich ein Mörder den Kopf zermartert, wie er die Leiche seines Opfers beseitigen könne. Gewiss ist es nur allzu vielen geglückt, dieses Problem zu lösen; aber die Zahl derer, die daran gescheitert sind, ist auch sehr hoch. Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen Substanzen, von denen einige – wie Zähne und Knochen – äußerst dauerhaft sind. Andere wiederum, mit denen der Mörder ein leichtes Spiel zu haben scheint, bleiben erhalten, wie sehr er sich auch bemüht, die Spuren seines Verbrechens zu beseitigen. Immer noch glauben einige Täter, man könne eine Leiche sehr schnell durch ungelöschten Kalk zerstören. Doch auch das ist ein irriges Vorurteil, denn ungelöschter Kalk ätzt zwar ungemein stark, zerstört aber einen Körper nicht, sondern konserviert ihn sogar. Er geht nämlich mit dem Fettgewebe eine Verbindung ein, die der Einwirkung von Insekten und der normalen Fäulnis widersteht.
„Denn Mord, hat er schon keine Zunge, spricht mit wundervollen Stimmen“, lässt Shakespeare seinen tragischen Prinzen Hamlet einmal sagen und glauben, es sei das Gewissen, das den Mord herausschreie. Der Mord gesteht sich also selbst. Was in der Dichtung unser Gefühl für Gerechtigkeit so beruhigend befriedigt, trifft im wirklichen Leben leider nur selten zu. Denn das Gewissen der meisten Mörder ist so stark verkümmert, dass die abgebrühtesten unter ihnen oft ihr ganzes Leben lang stumm bleiben wie das Grab. Nicht das Gewissen verrät den Schuldigen, sondern vor allem die Leiche seines Opfers.
Schätzungsweise zwanzig Prozent aller Menschen sterben unter Umständen, die eine amtliche Untersuchung der Todesursache erfordern. Hierbei handelt es sich um Fälle, bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, oder bei denen der hinzugerufene Arzt eine sichere Todesursache nicht angeben kann: War es Mord oder Totschlag, Tötung auf Verlangen oder Selbstmord, Körperverletzung mit tödlichem Ausgang oder Tötung in Notwehr, Unfall oder fahrlässige Tötung? Welcher Tod liegt vor – und wie ist es geschehen? Die richtige Beantwortung dieser entscheidenden Fragen stellt höchste Anforderungen an die untersuchenden Beamten – vor Ort und im Labor. Aus Tausenden von Steinchen muss ein Mosaik zusammengesetzt werden, das die Tat darstellt. Welche Steine zu verwenden sind, welche nicht in dieses Bild passen, an welcher Stelle welcher Stein einzusetzen ist – das entscheidet allein der Kriminalist. Ein Selbstmord kann vorgetäuscht oder als Mord „frisiert“ sein, ein Unglücksfall als Mord erscheinen oder ein Mord als Unglücksfall; möglich ist auch, dass ein natürlicher Tod nur geschickt vorgespiegelt ist oder den Eindruck erweckt, als sei der Tote durch fremde Hand ums Leben gekommen. Von der sorgfältigen Arbeit der Untersuchungsbeamten hängt es ab, ob ein Sachverhalt geklärt wird oder nicht. Ihre Verantwortung ist groß, denn Fehler und Irrtümer haben verhängnisvolle Folgen. Wird zum Beispiel ein Todesfall fälschlicherweise auf eine natürliche Ursache zurückgeführt, obwohl eigentlich ein Unfall vorliegt, dann verlieren die Angehörigen oft hohe Ansprüche, die der Verstorbene vielleicht unter großen Opfern für ihren Lebensunterhalt sichergestellt hatte. Wenn dagegen ein natürlicher Todesfall als Mord „geklärt“ wird, so kann ein Unschuldiger seelisch und materiell aufs schlimmste gefährdet und geschädigt werden. Um solche Fehlerquellen in immer höherem Maße auszuschalten, ist die Verbrechensbekämpfung im Lauf der Jahrhunderte ständig weiterentwickelt worden. Im 19. Jahrhundert hat sich dann durch vermehrtes Benutzen wissenschaftlich fundierter Untersuchungsmethoden und die häufige Einschaltung von Sachverständigen in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern die Lage so entscheidend verändert, dass man von der Geburtsstunde der modernen Kriminalistik sprechen kann.