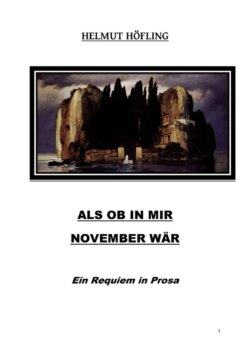Читать книгу Als ob in mir November wär - Helmut Höfling - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie Bank war leer.
Schon von weitem sah er es durch die Sträucher mit ihrem welken Laub.
Die Bank war leer.
Wie lange war es bereits her, dass sie dort gesessen hatte, Seite an Seite mit ihm.
Eine Woche…?
Einen Monat…?
Ein Jahr…? Oder zwei… oder drei…?
Die Bank war leer.
Und sie würde auch leer bleiben. Heute… morgen… für immer…
Weißt du noch, wie ich mit dir dort gesessen habe? Es waren die letzten warmen Tage im Oktober. Früher waren wir oft an dem Gelände vorbeigekommen, das einmal ein Park für den Landgrafen gewesen war. Mit seinem Tod war auch dieses Kleinod der Gartenbaukunst gestorben. Tod… sterben… Ich hatte es nur als verwildertes Grundstück kennengelernt, von Park keine Spur mehr, bis es dann in unseren Tagen als Kleiner Tannenwald zu neuem Leben erweckt wurde, sozusagen auferstanden von den Toten...
Auferstehung… Es gibt so viele, die daran glauben… an die Auferstehung von uns Menschen. Wenn es doch so wäre! Ich kann es nicht… mir fehlt der Glaube.
Die Bank ist leer.
Mein Herz ist schwer.
Mir ist, seit du gegangen bist, als ob in mir November wär.
Weißt du, früher sind wir zu Fuß dorthin gegangen, ein kleiner Spaziergang rund um „die vier Ecken“. Aber seit deiner schweren Erkrankung habe ich dich dorthin gefahren. Am Parkeingang habe ich dich in den Arm genommen und zur nächsten Bank geleitet, hundert Meter oder zwei… Und dann hast du jedes Mal gesagt: „Lass uns noch ein Stückchen weitergehen… zur Bank dort hinten, am Teich, in der Sonne…“ Du hast geschnauft, bei jedem Schritt, aber du hast dich nicht unterkriegen lassen, du hast gekämpft. Und ich…?
Weißt du noch, was ich immer zu dir gesagt habe, wenn wir nachher wieder zu Hause waren und du von den paar Schritten vom Auto ins Haus so erschöpft warst, dass du gleich aufs Sofa gesunken bist, noch im Mantel…? „Du hast mir heute wieder eine große Freude gemacht!“, habe ich dann gesagt. Ja, es war wirklich so! Noch ein paar Jährchen zuvor sind wir durch die Welt gereist, es war wunderschön! Aber diese paar Schritte zur Bank und wieder zurück – diese “kleine Reise“ war die schönste von allen!
Jetzt ist auch diese Reise zu Ende, die letzte „kleine Reise“, seit du auf die letzte „große Reise“ gegangen bist. Ohne mich. Warum eigentlich? Ich habe bei dir gelegen, bevor du aufgebrochen bist, habe dich gehalten, in der Hoffnung, dich halten zu können, dich nicht zu verlieren. Es war eine trügerische Hoffnung. Du lagst in meinen Armen, Seite an Seite, und warst doch auf einmal nicht mehr da. Wer soll das begreifen…! Was hast du denn falsch gemacht, dass du nicht mehr sein kannst? Nicht mehr die sein kannst, die du dein Leben lang gewesen bist? Nicht mehr dort sein kannst, wo du hingehörst? Wo du all die Jahre warst… bei mir… in mir…! Gottes Wege sind unergründlich, sagen die einen und gestehen sich damit ein, dass sie auch nichts wissen. Ein von Menschen erdachter Trost. Ein schwacher Trost, der wenigstens ihnen hilft, nicht zu verzweifeln. Aber kein Trost für mich.
Die Bank ist leer.
Es ist jetzt Mai. Und doch November. Für mich, nur für mich. November in mir.
Wie oft haben wir eigentlich dort gesessen? Nicht oft, ein Dutzend Mal vielleicht oder auch zwei. Im Frühjahr hatten wir damit angefangen. Im Sommer waren wir zu Hause im Garten geblieben. Und dann im Herbst wolltest du wieder in den Park auf “deine“ Bank.
Erinnerst du dich noch an die brütende Ente hoch im Baum? Ja, es war wirklich eine Entenmutter in der weiten Höhle des Baumstamms. Ein normaler Vogel war es nicht mit dem breiten Entenschnabel. Und zu Hause haben wir dann im Lexikon gelesen, dass Mandarinenten, die ursprünglich aus Ostasien stammen. hoch oben in Baumhöhlen nisten. Jedes Mal, wenn wir zu unserer Bank kamen, haben wir dorthin geschaut, ob die Jungen vielleicht schon geschlüpft seien. Aber den Tag des neuen Lebens, an dem dein Leben schon begonnen hatte, dich zu verlassen, haben wir leider nicht mehr erlebt.
Ein Leben erleben… Erlebt man auch den Tod…? Ja, so sagt man, aber eigentlich klingt es sonderbar: den Tod erleben… Ist doch ein Widerspruch.
Ach, da kommt er schon wieder. Ausgerechnet in diesem Augenblick – der junge Mann, der hinter unserer Bank aus dem Seitenweg hervorschießt, lautlos, und dann an uns vorbeihastet im Dauerlauf, am See entlang, um nach der Biegung im Wald zu verschwinden. Jeden Nachmittag war es so, erst jeweils nur einmal, in letzter Zeit aber immer zweimal. Was soll das bedeuten? Bedeutet es überhaupt etwas…? Ich meine, er laufe jedes Mal dichter an uns vorbei. Oder ist es nur Einbildung? Wird er demnächst dreimal seine Runden drehen? Vielleicht schon heute? Wer ist er überhaupt? Wirklich ein junger Mann…? Ein alter bestimmt nicht, so locker, wie er läuft. Aber man weiß es nicht genau, sein Kopf ist stets von der schwarzen Kapuze an seinem Pulli bedeckt, so dass selbst sein Gesicht von der Seite nicht zu erkennen ist. Und wenn er an uns vorbeihastet, ist es schon zu spät, ihm ins Gesicht zu schauen. Überhaupt schwarz… Nicht nur die Kapuze ist schwarz. Alles an ihm ist schwarz wie bei den Krähen auf dem Friedhof.
Wieso komme ich plötzlich auf den Friedhof…?
Dein Platz ist leer.
Mein Herz ist schwer.
Mir ist, seit du gegangen bist, als ob in mir November wär.
Sicherlich hängt es damit zusammen. Du musst rausgehen, sagen die einen, unter Menschen. Was verloren ist, bleibt verloren. Man kann die Vergangenheit nicht zurückholen. Nichts. Gar nichts.
Ach ja, die Leute haben gut reden. So was sagt sich so leicht dahin, wenn man in einer anderen Haut steckt. Mein Verstand sagt mir das gleiche, aber mein Gefühl… Man kann mit einem Menschen zusammenleben, weil es verschiedene Vorteile bringt, so sagt es der Verstand. Und es lässt sich auch verstandesgemäß begründen. Man kann aber auch mit einem Menschen zusammenleben, selbst wenn es verschiedene Nachteile mit sich bringen sollte. Warum? Weil das Gefühl stärker ist als der Verstand. Weil dieses Gefühl Glück bedeutet, und dieses Glücksgefühl, das zwei Menschen verbindet, währt über den Tod hinaus. Je stärker das Glücksgefühl war, desto größer ist der Schmerz für den, der übrig geblieben ist. So ist es, nicht zu ändern, nie mehr, so sagt mir der Verstand, aber gerade darum ist der Schmerz so grausam. Wer kann das begreifen? Ein anderer bestimmt nicht, auch wenn er das Gegenteil beteuert.
Ich weiß, du verstehst mich. Bei uns war es Verstand und Gefühl: zwei Menschen, die ihre Partner verloren hatten und sich nun gegenseitig zu helfen versuchten. In einem Alter, in dem viele nicht mehr die Kraft aufbringen, noch einmal von vorne anzufangen.
Aber jetzt…?
Dein Platz ist leer.
Die Kraft dahin… Die Zukunft… Vorbei, alles vorbei. Leer. Alles leer.
Mir ist, seit du gegangen bist, als ob in mir November wär.
Wie lange soll das so weitergehen? Kann ich das überhaupt noch ertragen? Andere müssen es auch. Ja, ich weiß. Ein Los, das jeden trifft. Aber wo bleibt da Gott, der gütige Vater, der uns erst in diese irdische Welt geworfen hat, um uns dann in sein himmlisches Reich zu rufen? Woher wissen das überhaupt die Leute, die das behaupten? Weil sie es wissen wollen, obwohl sie es gar nicht wissen, nicht wissen können. Warum hat er uns eigentlich erst in dieses Jammertal geschickt? Hätte er uns nicht gleich im Paradies leben lassen können? Was sich die Menschen nicht alles ausdenken, um sich über die Ungereimtheit des Lebens, die Ungerechtigkeiten, den Schmerz hinwegzutrösten. Wo bleibt da die Logik? Nebelkerzen über Nebelkerzen, die Priester und Menschen werfen, um die Wirklichkeit nicht sehen zu müssen.
Weißt du noch, wie ich dich in die Universitätsklinik gefahren habe? Wann und wie oft? Deine Augen, es ging um deine Augen, du drohtest zu erblinden. Ich sehe dich noch vor mir, als der Professor dir das sagte. Nichts hast du dir da anmerken lassen, noch nichts. Erst als wir draußen vor dem Portal standen, wo das Leben pulsierte, da kamen dir die Tränen. Das Leben der anderen, die nicht zu erblinden drohten, machte dir klar, dass du schon bald davon ausgeschlossen sein würdest. „Da müssen wir unbedingt etwas machen“, hatte der Professor entschieden. Das hieß Operation, erst das eine Auge, dann das andere. Und was würde dann übrig bleiben an Sehkraft…? Nur noch zwanzig Prozent, wie wir bald wussten. Aus mit dem Lesen von Büchern! Zeitung nur hin und wieder, kurze Berichte im elektronischen Lesegerät, was dich jedoch zu sehr angestrengt hat. Aber Hörbücher…! Ja, Hörbücher hielten jetzt Einzug ins Haus. Es war eine Freude, dir zuzuschauen, wie du auf dem Sofa lagst, die Stöpsel in den Ohren, und an deiner Miene ablesen zu können, wie ergreifend die Geschichte war, wie heiter oder auch traurig.
Kannst du dich noch an den Nachmittag nach der ersten Operation erinnern? Es war Ende März, ein ungewöhnlich milder Tag wie im Vorfrühling. Wir sind zusammen ins Freie gegangen, nach draußen in die parkähnliche Anlage des Universitätsgeländes. Viele Studenten, die gerade keine Vorlesung hatten, lagen im Gras, die einen lasen, die anderen redeten und lachten mit ihren Freunden. Wir beide saßen auf einer Bank, froh, dass alles so glimpflich verlaufen war, und voller Hoffnung. Wir waren schon an die Achtzig, ein altes Paar unter jungen Menschen, die unsere Enkel hätten sein können. Leise Wehmut keimte in mir auf: „Man müsste noch mal zwanzig sein…“ Nein, das waren wir nicht mehr, aber „und so verliebt wie damals…“, das waren wir schon. Wenn wir uns auch nicht wie die Pärchen öffentlich abgeknutscht haben. Es war anders. Tiefer. Eine enge Verbundenheit, wie sie durch Schicksalsschläge zustande kommt, wenn einer am Leid des anderen so leidet als sei es sein eigenes Leid. Länger als eine Stunde haben wir da gesessen und zugeschaut, wie plötzlich von jenseits der Klinikgebäude ein Enterich angeflogen kam und auf dem kleinen Teich landete. Aufgeregt schnatternd paddelte er auf dem Wasser umher, auf der Suche nach einer Gefährtin, bis er dann schließlich die Suche enttäuscht aufgab und als Junggeselle wieder davonflatterte.
Deine Augen…! Anfangs haben wir gedacht, es reicht jetzt, mehr braucht nicht dazu zu kommen. Ich hatte ja noch gesunde Augen. Augen, die jetzt für dich mitsehen mussten. Beim Einkaufen, beim Kochen, beim Überfliegen der Nachrichten in der Zeitung. Und der Todesanzeigen… Standen bekannte Namen darin…? Kam er näher – der Tod…?
Wäre es doch nur bei den Augen geblieben! Wie glücklich wären wir gewesen!
Aber kein Glück währt ewig. Und auf den ersten Schlag folgt meist auch der zweite.
„Ihre Frau ist mein Sorgenkind“, sagte die junge Ärztin, die in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr Notdienst hatte. Lungenentzündung lautete die Diagnose, sogar eine schwere Lungenentzündung. Wie immer waren wir auch diesmal in unsere Oberstdorfer Zweitwohnung gefahren, in unser verschneites Paradies, um dort die Festtage zu verbringen, als es dich niederwarf. Du wolltest noch nicht sofort kehrtmachen, erst nach Weihnachten warst du dazu bereit. Wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen so lagst du mehr als du saßt auf dem Beifahrersitz, als wir über die Autobahn rasten. Du wolltest nach Hause zur Ärztin, die dich seit Jahren kannte, aber sie war nicht da, in Urlaub. Drei, vier schwere Wochen hattest du zu überstehen, Aber du hast sie überstanden – und ich glitt gleichsam in deine Pflege hinein, ungewohnt für mich, denn all die Jahre warst du nie bettlägerig gewesen. „Was für ein Glück, dass es dich gibt!“, hast du immer wieder zu mir gesagt. Dabei war es doch selbstverständlich, was ich getan habe. Hattest du mir nicht auch jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, wenn ich krank war? Ist nicht der eine für den anderen da…?
Ach, warum erzähle ich dir das alles, du weißt doch, was du erlebt und erlitten hast. Und auch, dass du nach Wochen wieder gesund warst. „Gesund“, so hieß es jedenfalls. Aber du spürtest etwas anderes und beharrtest auf einer gründlichen Untersuchung. Und du hattest recht. Leider. Nie zuvor hatte ich mir so gewünscht, dass du diesmal Unrecht hättest. Von der Krankheit, die in dir steckte, hatten wir noch nie etwas gehört. Mir schien sie nicht so bedrohlich. Dass du nicht mehr dieselbe sein würdest wie noch kurz zuvor, was soll’s…! Ich übrigens auch nicht. Man passt sich an, der eine an den anderen. Hauptsache, man hat sich noch.
Gerade als es bei dir aufwärts zu gehen schien, ging es mit mir bergab. Eine schwere Gürtelrose warf mich nieder. Starke Schmerzen quälten mich Tag und Nacht. Wochenlang. War es die Reaktion auf die Befürchtungen, die ich bei deiner Krankheit hatte? Nur nicht schlappmachen, hatte ich damals gedacht, sie braucht dich, deine Kraft und Fürsorge. Doch als ich sah, dass es dir besser ging, brach meine Kraft zusammen. Es war wie Höllenfeuer unter der Haut. Ein Wüten an den Nerven. Wenn ich jetzt sterben könnte, hätte ich nichts dagegen. So habe ich oft gedacht. Doch du warst dagegen. Immer wieder warst du da, wenn ich Zuspruch brauchte, deine Hilfe, deine Pflege. Und dass wir zur Erholung verreisen würden, sobald ich dazu in der Lage sei.
Ach, was rede ich von mir! Ein Klacks gegen das, was dich erwartete. Sollte ich einfach nur verstehen lernen, wie es ist, wenn man sich sterbenselend fühlt? Wenn man nichts dagegen hat, die Augen für immer zu schließen, weil alles, weil das Leben nur noch eine Last ist? Und wie man sich dennoch dagegen stemmt, weil man glaubt, für den Partner weiterleben zu müssen, damit er nicht wieder einsam ist, nicht verzweifelt wie schon einmal zuvor, vor Jahren.
Denn wie das ist, wenn der Partner plötzlich nicht mehr da ist, das hatten wir beide ein Vierteljahrhundert zuvor erleben müssen. Wenn man das Gefühl hat, aus der Zeit gefallen zu sein und nie mehr festen Grund unter den Füßen zu spüren. Und wie man dann plötzlich wiederauflebt, neue Kraft spürt und glaubt, die Welt aus den Angeln heben zu können wie ein Junger, voller Tatkraft und Zuversicht, wenn man in einem anderen Menschen – in dir! - einen festen Halt gefunden zu haben glaubt! Ja, wie ein Junger…, dabei waren wir beide schon über sechzig. Das Leben blühte noch einmal auf. Wie im Sturm zog der Frühling in uns ein, nichts konnte uns aufhalten, kein Hindernis war unüberwindbar, die Welt stand uns offen, weit über den Horizont hinaus, für uns gab es keine Grenzen, Land für Land haben wir erobert – und fühlten uns überall geborgen, weil der eine immer bei dem anderen war. Am schönsten aber waren unsere Reisen zu zweit, besonders nach Frankreich, wochenlang ins Blaue hinein, nie kam man sich irgendwo fremd vor, im Gegenteil immer so geborgen wie zu Hause, weil wir beisammen waren. Tag und Nacht schien für uns die Sonne, und ewig hätte es so weitergehen können.
Doch nichts währt ewig – am wenigsten das Glück. Aus heiterem Himmel kam der erste Schlag und traf deinen Sohn. Tot. Ganz unerwartet, ohne jede Ankündigung, mitten in der Blüte seines Lebens. Wie kann ein Kind nur vor der Mutter sterben! Ist das gerecht? „Ohne dich hätte ich das nicht überlebt“, hast du damals zu mir gesagt, „ohne deine Ruhe, deinen Halt.“
Dann traf es mich: Krebs. Ich sehe dich noch vor mir, die Angst in deinen Augen am Vorabend der Operation. Der Arzt im Krankenhaus hatte uns die lange Litanei vorgelesen, was dabei alles passieren könne, und mich dann unterschreiben lassen, dass ich trotz allem mit der Operation einverstanden sei. Bis zum Parkplatz habe ich dich hinausbegleitet. Erst als wir uns zum Abschied umarmten - ich zuversichtlich, ja sogar locker in der Erwartung, dass am nächsten Tag um diese Zeit längst alles überstanden sei – erst beim Abschied spürte ich deine Angst, deine Angst um mich. Ein flüchtiger Kuss, fast scheu, kein Wort mehr, du bliebst stumm. Den Blick abgewandt, drehtest du dich rasch um, damit ich nicht sehen sollte, was in dir vorging, und fuhrst überstürzt davon, dass die Reifen quietschten. Ich hatte verstanden, und Tränen trübten meine Augen, als ich dir nachschaute, Tränen des Glücks. Und Tränen des Glücks liefen mir auch immer wieder die Wangen hinunter, wenn ich mit erstickter Stimme unseren Freunden diesen Abschied schilderte und dabei stets betonte: „Das werde ich ihr nie vergessen!“
Und ich habe es nie vergessen. Wie könnte ich auch! Nie zuvor hatte ich deine Liebe so stark und tief empfunden. Konnte dieses Gefühl noch wachsen, noch stärker, noch tiefer werden? Ja, es konnte, wenn auch unter Umständen, die ich uns lieber erspart hätte.
Zunächst ging alles seinen gewohnten Gang, Jahr für Jahr, und nichts deutete an, dass es nicht immer Jahr für Jahr so weitergehen könne. Gut, die Reisen führten nicht mehr gerade bis ans Ende der Welt, das Alter schlich sich ein, vor allem bei dir, und forderte seinen Tribut: die Augen, die Ohren, die Gelenke. Was soll’s…? Man stellt sich darauf ein und rückt den üblichen Beschwerden mit Kuren auf den Leib… Die Langsamkeit hat auch ihre Reize. Man tritt eben kürzer wie alle anderen auch. Dir aber fiel es schwer, im Alltagsleben nicht mehr die volle Leistung bringen zu können. Deine Bekannten aus fernen Kindertagen, an Jahren so alt wie du, waren dennoch schon älter. „Das kann ich nicht mehr“, so hieß es, „und jenes auch nicht.“ Du aber hieltest die Zügel noch fest in der Hand und schmisst den Laden wie eh und je – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem in der Uni-Klinik die Diagnose festgestellt wurde, die den Anfang vom Ende einläutete. Die Krankheit sei noch zu wenig erforscht, die Ursachen weitgehend unbekannt, und deshalb gebe es auch noch kein wirklich heilendes Medikament. Aber man arbeite daran, überall in vielen Ländern, und um den Ursachen auf den Grund zu gehen, überredete man dich, ein paar Tage dort zu bleiben, um Gewebeprobe entnehmen und untersuchen zu können. Vielleicht stoße man bei dir auf eine der wenigen von den vielen Varianten, über die man schon einige Kenntnisse habe. Und als du mit deiner Zustimmung zögertest, meinte der noch sehr junge Assistenzarzt: „Ich kann Sie nicht zwingen, aber es hängt von Ihnen ab, ob Sie noch ein Jahr zu leben haben oder fünf.“ Am liebsten wäre ich ihm an die Kehle gesprungen, aber wie ich an deiner Reaktion bemerkte, hattest du in deiner Aufregung die Worte gar nicht richtig mitbekommen, und außerdem dachte ich schon im nächsten Augenblick, sie seien nur so dahergeredet und nicht ganz ernst zu nehmen, denn was es eigentlich mit der Krankheit auf sich hatte, wussten wir beide damals noch nicht.
Heute ist das alles anders: Er hatte recht. Leider!
Leider brachte die Gewebeprobe auch kein erfreuliches Ergebnis: Deine Variante der Krankheit gehörte zu den vielen noch unbekannten Arten, die man mit Cortison zu bekämpfen versuchte, ohne sie heilen zu können, mehr ein Hinauszögern, eine Verlegenheit aus Mangel an wirksamen Medikamenten. Du konntest die Tabletten ohnehin nicht nehmen, da du sie nicht vertrugst.
Ich sehe noch die vielen Patienten in der Klinik mit Sauerstoffgeräten herumlaufen – oder besser: herumschleichen -, die beiden Enden des Schlauchs in der Nase, und ich dachte, hoffentlich bleibst du davon verschont. Aber nein, du bekamst auch so ein Gerät, ein Standgerät, das dich nachts mit Sauerstoff versorgen sollte. So fing es an… und dann…