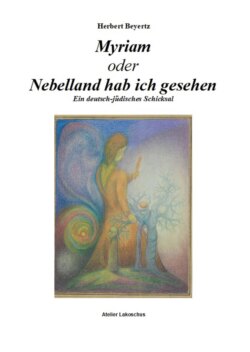Читать книгу Myriam oder Nebelland hab ich gesehen - Herbert Beyertz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wellmahr II Wellmahr
ОглавлениеIhm war die Gabe der Zungenschwere verliehen.-
Boris Pasternak
Es ist Schnee gefallen – eine immer junge Verheissung: erster Schnee! Die Srassen mit ihren langsameren Mobilen laden Geheimnis auf. Alle Passanten, besonders aber die Kinder, empfangen Heiterkeit als Geschenk. Sie versuchen zu glitschen – fallen sie hin, bedanken sie sich dafür lachend. Oder sie formen im Aufstehn Schneebälle, und jetzt ist in Wurfnähe kein Mensch mehr sicher, sich mit Gelächter dafür bedanken zu müssen, getroffen zu werden.
Da es Abend, wird man Schlitten nicht mehr zu sehen bekommen, auch geht ein scharfer, wirbelnder Wind, der nicht lange verweilen lässt. Ein kleiner Hund hastet verstört die Marktstraße hinunter, die wenigeren Fussgänger haben es fast schon ebenso eilig, während die Autos um so behutsamer über die weisse, kaum gespurte Fahrbahn ziehn.
Im Zentrum der Unterstadt und um den Bahnhof herum füllen sich die Kinos Dank des überraschenden Schneefalls mehr als gewöhnlich an diesem Sonnabend, wenn die weihnachtlichen Geschäftsstrassen oft noch Promenaden gleichen. Geboten wird in ihnen eigentlich genug, wie es braucht, um mit offenen Augen in die entzückendsten Illusionen zu entschlafen! Und so wird auch in den Kinos gelacht. Aber hört man einmal genauer hin, so ist es ein etwas anderes Lachen als das der Kinder draussen angesichts des ersten Schnees. Im Düstern rings ein seltsam düsteres Lachen.
Doch wie selten die Stimmen, die von Herzen kommen! Wie mühsam die Schulmorgende, in Bewölkung fahl! Immer noch früher sind dumpfe Motoren erwacht – unverständlich, zu welchen Zielen!-
Auf dem Weg zum Gymnasium: eine alte kleine Frau vor einer Schaufensterscheibe, mit ihrem eignen Spiegelbild in angstvoll aufgeregter Zwiesprache – hörbar den Vorübereilenden: „Was sollen wir bloss machen…“ Da Holger stehen bleibt, wendet sie sich sogleich ihm zu, fragt nach einem Bus, den sie schon mehrmals verpasst hat. Kaum dass der Gymnasiast mit der Linken nach einem sich nähernden weist, dreht sie sich mit heftigem Winken, das Trottoire verlassend, dem zu. Während aber der Linienbus ohne anzuhalten vorüberbraust, fällt ihr nichts besseres ein, als weiter Leute zu befragen und Verwunderung zu erregen. Sie hat einen raschen, leichtfüssigen, ungewöhnlichen Schritt – fast fliegt sie! denkt Holger Ley mit einem düsteren Lächeln.
Ja, die ist nur noch halb von dieser Welt.
Winter in Wellmahr. Wieder schneit es, aber zugleich strahlt die Sonne über den Dächern, färbt Firste und Balkonwände und vergisst selbst die paar Tauben nicht, die durch Flockenfall und Sonnenstrahl noch wie selig Verirrte ihre Kreise ziehn.-
„Holger, der Vater hat anrufen lassen, Isgard war am Telefon. Er liegt in Salzufeln im Krankenhaus – wollen wir ihn besuchen fahren?“
„Ist es – ernst?“
„Sie weiss noch nichts Genaues. Doch wie er aussah, neulich…“
Immer die weissen Dächer! Aber ein grünklarer Himmel hebt an und leuchtet von einer solchen Fata Morgana der Stille, wie sie niemand so leicht mehr unter den oft wie in Albträumen oder in Spitälern Wandelnden erwartet hätte.-
In Isgards Studio lag aufgeschlagen ein Buch zwischen zwei Notenstapeln. Holger hatte etwas zu warten, er sollte Bach-Noten für die Mutter abholen. Als seine Tante mit einer Schülerin erschien und ihn darin lesen sah, sagte sie: „In deinem schwierigen Alter wäre es vielleicht eine Lektüre wert, nimm es nachher mit.“ Die Cello-Schülerin, eine ihrer begabtesten, lachte ihn an, obwohl sie das Letzte vielleicht nicht mit bekam:
„Aber bitte keine Eselsohren darin.“
Zuhause las er wieder und wieder diese Stelle:
„Hier wohnt der uneigentliche Mensch, der homo mutabilis unter der Grundstimmung der Melancholie. Er ist gekennzeichnet durch den Verlust seiner kreatürlichen Bestimmung, durch sein Versagen im Wort, sein Verwirken im Werk. Geworfen in eine schiffbrüchige Welt, lebt er in Angst, immerfort am Kreuzweg der Sorge.“
Mit den Tauben ist dann auch die Sonne verschwunden. Und sie soll nun ersetzt werden durch die Illuminationen der Strassen und jener Bauten, sofern sie „öffentlichen Sorgen“ dienen. Es ist, als hätte die Erde schneller zu kreisen begonnen, ja, zu schlingern vor aller Geschäftigkeit! Es ist die Stunde, da Hupen und Martinshörner zum Tanz aufspielen.
Ihn trugen die Busse über die Lichterstrasse, vom Bahnhof zum Alten Markt und wieder hinunter, mehrere Male. Ihn vereinnahmte der eintönige Rhythmus so sehr, dass er, indem er seinen Eigenwillen lähmte, seine Einsamkeit unter all den einsamen Menschen grösser zugleich und erträglicher machte.- „Role over Beethoven – “ schallte es aus einer Eckkneipe der Unterstadt, wo er seinem Bus zum letzten Mal entstieg. Holger Ley fühlte das Fieber einer Grippe, das Sprechen mit rauhem Hals fiel ihm schon schwer, als er eintrat und sich einen heissen Grog bestellte. Dichter als der Nebel um den Geroweiher stand der Zigarettenrauch in der gespickt vollen Kneipe. Hier kannte er niemand, so weit wenigstens seine Sicht reichte. Da die Musikbox nach Chuck Berry stumm blieb, war ihm das Kleingeld, das er auf sein Fünf-Mark-Stück zurück bekam, gerade recht, um selbst die Box in Gang zu setzen. Er wählte die alte Rock’n-Role-Nummer noch zweimal.
Ihm war jetzt gewiss nicht nach Rock’n Role, obwohl der Grog gut tat. Es war aber der Name, der als fernes Echo noch Funken schlug in der Verjazzung. Ein Taschenbuch mit Texten Leonard Bernsteins, eine Woche zuvor gekauft, hatte ein altes Feuer wieder anzufachen vermocht. Da hiess es: „Beethovens Musik spielen heisst, sich ganz dem Kindergeist anvertrauen, der in diesem grimmigen, unbeholfenen, gewalttätigen Mann lebt.“ Wem immer seine Musik zum Erlebnis würde – das fühlte er wieder und glaubte es mit Lenny –, der könnte sich nicht verloren geben.-
In der Nacht dann wurde ihm folgender Traum. „Roger, Roger!“ Immer wieder hörte er den Ruf, der wie die Stimme eines Bordfunkers aus einem Raumschiff seinen Schlaf durchtönte. Dazu grosses Rauschen, Möwenschrei und das Rollen von Wogen gegen eine Klippe, auf der er sich selber stehend fand. Das ist der Atlantik! war sein erster Gedanke beim Erwachen.
Mit dem Schweiss der Nacht hatte sich das Fieber verloren, und da er zum Frühstück die Küche betrat, vernahm er Taubengurren, tief und melodisch, vom gekippten Fenster her. Bevor sie zur Arbeit fuhr, hatte die Mutter ihnen Sonnenblumenkerne gestreut.
Dämmerungen, die heute nicht mehr den Himmel räumen. Nicht deuten den Horizont die vertrauten Schornsteine, von denen sich nur vermuten lässt, daß sie (Fabriken ohne Sabbath) auch an diesem Samstag qualmen. Rauchgrau die Luft – ein ständiges Gebraus erfüllt sie, das so eintönig ist, weil es es sich fortwährend dem Lauschenden wieder vergisst. Doch wie das passt zu der Eintönigkeit einer grossstädtischen Landschaft! Und wenn sich die Laternen zu einem Zeitpunkt, der ganz zufällig scheint (weil man nicht einsehen kann, warum sie nicht schon in derselben Dämmerung des Vormittags angingen), entzünden, lassen sie sichtbarer nur Zwielicht und Nässe werden. Darum ist es auch vergebens, auf ein Glockenzeichen, ein Angelus-Läuten zu warten. Ungemahnt löst Tag sich in Nacht auf.-
Wie viele dann werden es noch sein, die angetreten waren, die Vermauerungen einer immer automatenhafteren Gesellschaft nicht einfach hinzunehmen – oder wie wenige, die aus der korrespondierenden inneren Vermauerung die Lehre zogen (so las es Holgers in Isgards Buch) „aus der schattenhaften Wahrnehmung voneinander und der schattenhaften Wahrnehmung von uns selbst.“
Um Mitternacht kam Holger Ley die Strasse zu den Häuserblocks des Blasenberg hoch. Er hatte Myriam zur Strassenbahn gebracht, mit der letzten der Linie „9“ würde sie in einer Stunde in Helau sein. Einer Band aus Holland, den Kabauters, war im Keller von Yellow Submarine ein solcher Street Fighting Men gelungen, dass sie beschlossen, sie noch einmal zu erleben. „Das war gross!“ Seltsam genug, eine Myriam das sagen zu hören – entsprechend ihr Abschied an der Strassenbahnhaltestelle.
„Revolution Nine, wilde Myriam! Damit fährst du, und damit kehrst du Freitag zurück.“-
Als er in die Gasse zu seinem Block einbiegt, gewahrt er einen Hund – dunkel, riesig –, der ihn augenblicks anfällt. Holger reisst sich los und flüchtet in den nächsten Hauseingang. Dort drückt er alle vorhandenen Klingelknöpfe, ohne jemand an die Sprechanlage zu holen. Inzwischen wird ihm klar: der Hund ist weg, und spurtet über die zweihundert Meter nach der eigenen Wohnung. Kaum oben, schaltet er jedes Licht in jedem Zimmer ein und bestellt per Telefon ein Taxi.
Es graupelte, als ihn der Merzedes aufnahm.Von dem Dobermann war auf der langsamen Hinfahrt zum Krankenhaus nichts mehr zu sehen. In Maria Hilf begleitete ihn eine bejahrte Schwester zur Ambulanz und stellte dort zunächst seine Personalien fest. Etwas später setzte ein junger schwarzäugiger Arzt, dessen Deutsch mehr als nur gebrochen klang, ihm eine Tetanus-Spritze. Er betrachtete mit derselben Gelassenheit Holger Leys geringe Verletzung, mit der er den Bericht der Schwester über eine junge Frau entgegennahm, einer Spanierin, die bei einer Festlichkeit plötzlich umgefallen und noch nicht wieder zu sich gekommen sei.
Unvermutet war es Holger, da sei von jemand ihm Nahestehenden die Rede. Auch die erwähnten Umstände, soweit er sie verstand, wollten ihn dunkel und peinlich an ein altes Versäumnis erinnern. Doch eine Frage zu stellen, dazu fehlte ihm (oder gerade deswegen) der Mut.
Durch einen endlosen Korridor und über zwei Stationen gelangte er auf einem anderen Weg zum Pförtner wieder. Die bestehende Sorge, dem Doberman noch einmal zu begegnen, liess ihn erneut ein Taxi wählen. Die Schwester hatte es ihm selbst anheimgestellt, die Polizei zu benachrichtigen, aber der Taxifahrer riet es ihm nun:
„Wenn der Köter nun mal tollwütig ist…“ Und begann eine Geschichte vom Westend, von der Siedlung bei den Schrebergärten.
„Mein Nachbar war schon immer ein bisschen bekloppt mit seinem Hundefimmel. Es stand auch in der Zeitung, habt ihr's nicht gelesen? Seine Frau war jedenfalls nicht mehr zu retten.“
So meldete Holger von zuhause seinen Fall einem Wachtmeister vom Dienst. Wie viel hätte er nun dafür gegeben, Furcht und Verstörung einem geduldigeren Wesen verständlich zu machen, als es der Beamte sein konnte. Doch scheint niemand nahe zu sein.
Spät in der Nacht läutete das Telefon. Es war Isgard.
„Na endlich! Du bist also zuhaus. Deine Mutter wird das Wochenende bei mir verbringen. Mehrmals hat sie am Abend versucht, dich zu erreichen, nun schläft sie.“
Und bei dieser ruhigen, nicht den Hauch eines Vorwurfs andeutenden Stimme, löste sich in Holger etwas, und er erzählte ihr sein Erlebnis. Sie unterbrach ihn kaum einmal. Und weil es nicht ihrem Wesen entsprach, mit leichten oder billigen Sprüchen (das kann nicht so schlimm sein, mach dir keine Sorgen) ihren Neffen zu trösten, sagte sie am Ende nur:
„Schlafen wirst du in dieser Nacht nicht. Habt ihr die Cello-Sonate in A-Dur?“
„Beethoven! Natürlich – du hast sie doch selbst geschenkt.“
„Ach ja, zu Elsas Fünfundfünfzigsten… Soll ich ihr von dem, was passiert ist, berichten?“
„Bitte nicht, sie hat genug am Hals.“
„Gute Nacht.“
Beethoven, ein Knabe von zwölf Jahren, stundenlang am Dachfensterchen seines Vaterhauses hockend mit dem Blick auf den winterlichen Rhein...
Fidelio. Der Anfang der Leonoren-Ouvertüre (bei Gustav Mahlers Inszenierung vorm Zweiten Akt im verdunkelten Orchesterraum) klang einer Isgard so, „als wäre auf dem Grunde des Kerkers das Meer erreicht.“-
Im äusseren Leben gescheitert, taub, durch und durch krank – aber was macht er daraus? Das JA, die Freude, abgerungen einem beinah unmöglichen Leben.
„Dämonen der Finsternis kommen zu Wort, die sich auch bei hellstem Tageslicht nie ganz zurückscheuchen lassen.“-
Der hundert Tode starb. In seinen letzten Werken alle Phasen (wie Ärzte sie bei Sterbenden feststellen) der Resignation, des Aufbäumens, der Hoffnungslosigkeit, der Erlöstheit am Ende.
„Es gibt kein Instrument, wird es nie geben, das die Dynamik wiedergeben könnte, die sich Beethoven in seiner stummen Welt vorstellte.“ Ingmar Bergman in seiner Autobiographie.
Zum Rock-Festival hatte man die Brauerei Zur Uell verwandelt in eine Höhle ohne Winkel und Fenster. Davor geparkt ein gelber mittlerer Lkw, gross beschriftet: „Drahtlose Personen-Suchsysteme“ – sowie: „Kommunikation eine Lebensfrage“.
Innen, in einem Drittel der neuen Höhle, bereitet sich der Medizinmann vom Mount Whitney für seine Seance vor. Myriam liest einen Flyer, der auf allen Stühlen liegt: „Erst war das Meer da, das Meer war überall, denn es war die Mutter. Sie ist zugleich der Geist von allem, was einmal werden soll – wir nennen sie Aluna … Gefällt dir das, Holger?“
„Es gefällt. Aber bevor seine Seance beginnt, würd ich noch gern an die Musikbox.“ Der vorüber eilende Kellner: „Kein Problem, der braucht noch eine halbe Stunde.“
Als Holger Ley sich zurück zu Myriam begibt, singt Donovan von Atlantis.
Endlich der Medizinmann der Sierra Nevada… Im Dunstkreis der Joints der Kinder von Karl Marx und Coca Cola: herabgestiegen durch seine Trommel, spricht er mit den Ahnen seines Volkes. Und Holger denkt: Jetzt ist er – wie Florestan – am Grunde eines tiefen Meers.
Ein von der Maas an den Tiber verschlagener Niederländer, der Dreiviertel des Tags sich auf dem Palatin herumtrieb, in einer Januarnacht plötzlich seine Pension an der Porta Pia verliess, um Roms grosse Mauer Kilometer um Kilometer abzuschreiten. Im östlichen Bezirk erstmals von Hunden verbellt, gelangte er zur Cestius-Pyramide und auf den protestantischen Friedhof. Samuel Tempes suchte alle Gräber ab, bis er den Spruch, mehr ratend als lesend (um den er jetzt einzig aufgebrochen schien) auf Keats Grab gefunden hatte:
„Here lies a man whose name was written on water.”
Auf einmal war die Sonne da. Amseln im Gesträuch der Parkwege nehmen sie als erste wahr, sie hüpfen hinaus auf die Wiese, unbekümmert um die Spaziergänger mit ihren leinegeführten grossen und kleinen Pissern.
Auf einem Rasen nahe der Ausfallstrasse, die nach Holland führt, steht ein Mädchen in weissem Kommunionkleid, in der Hand ein Schwirrholz an der Schnur. Ein etwas älterer Junge mit Schultasche erkundigt sich vom Rand her verwundert: „Hast du Geburtstag?“ Da scheint das Mädchen auf einmal furchtbar verlegen, als würde es erst jetzt der vielen Fussgänger und Radfahrer gewahr. Das Spielzeug ruht im Gras.
Holger Ley folgt noch eine Weile der Ringstrasse, bis er in eine stillere in Richtung Nordfriedhof kommt. Parkschöne Bäume und bereits blühende Azaleen vor Villen, an deren Gartentoren sich die edlen Schnauzen Deutscher Schäferhunde präsentieren – er liest und ist beeindruckt: „Ich halte Wacht.“
Ein anderer: „Hier wohnt ein pflichtbewusster Hund.“
Da kommt von der Friedhofsallee ihm Myriam entgegen. Vor zwei Wochen wurde ihre Mutter zu Grabe getragen. Noch bevor sie ihn mit dem Zeigefinger zum Grusse anstubst und er ihre Hand einen Moment in seiner Faust verschwinden lässt, weist er nach dem nächsten der Hundeportraits:
„Schau mal: My home is my castle, my business to protect… Wenn schon die Hunde anfangen, sich englisch zu äussern, wirst du bald die schwarzen Schwäne auf unserm Weiher Rock’n Role tanzen sehen.“
Sie lächelt ein Weilchen vor sich hin, so gehen sie zusammen stadteinwärts. Von Myriam ein Lachen zu erwarten, wäre ein bisschen viel verlangt, aber sie lächelt, und dieses Lächeln war ihm schon immer Goldes wert.
„Deinem Vater geht es besser, wie ich höre, ich meine, ich habe ihn auch wieder mit dem Auto gesehen.“
„O das ist ein Pilot, der fällt immer wieder auf die Füsse.“
„Warum so hart? Uns ist er ein lieber Nachbar gewesen, beinah ein Freund...“
Holger, stehenbleibend, fasst Myriam am Ärmel, schaut sie an, so bedrückt wie versonnen. Sie befinden sich, wo der Bunte Garten beginnt mit einzelnen Grabsteinen in einer gepflegten Anlage – dies war einmal der alte Friedhof der Stadt.
Am Parkrand eine Vogelstation, ein kleiner Zoo exotischer Vögel, ein paar Bänke drumherum… Aus seiner Kordjacke zieht er eine gefaltete Seite der Bildzeitung hervor. „Hör dir das an, Myriam: Der Mensch stammt vom Bären ab – was sagst du jetzt?“
„Wie bitte? Na, setzen wir uns.“
„Wenigstens behauptet das ein italienischer Wissenschaftler.“ Womit er denn dem allgemeinen Affenglauben eine beherzigenswerte Alternative anbiete. Ein Grosswildjäger aus Hagenbecks Stadt soll sich sehr befriedigt dazu folgendermassen geäussert haben – liest Holger weiter vor:
„Die Türken und Armenier lehnen die Bärenjagd völlig ab. Sie sagen: In jedem Bär steckt ein Mensch.
Wer schon einmal wie ich einen Bär…“ Holger unterbricht sich: „Will sagen, einen versteckten Menschen – erlegt hat, ist vom Anblick eines solchen Wesens erschüttert. Ohne Haut und Krallen sieht eine Bärenpfote aus wie ein Menschenfuss.“
Einen winzigen Augenblick blickt Myriam entsetzt auf den, der ihr da so schalkhaft vorliest. Ob man ihm nicht irgendwann selbst die Haut abgezogen hat? Doch gleich wieder lächelt sie, nestelt an den Knöpfen ihrer schönen, selbstgestrickten Jacke und flüstert mehr als sie sagt:
„Nichts mehr zum Spielen, nichts mehr für Kinder, da wär ich doch besser in Amsterdam.“ Dass sie dabei errötete, schien er nicht zu bemerken.
Holger Ley träumte stets von Sachen, die ihm das Leben nicht so ohne weiteres zu gönnen schien. Zwar seine Bilder fanden bisweilen Beachtung, selbst Myriam schätzte sie. Aber ein holländischer Verwandter, Samuels Vater, als er so eine kolorierte Zeichnung einmal betrachtete, fasste sich an den Kopf:
„Heerlijk! Das sieht ja aus wie Sodom und Gomorrha. Hat sie einen Titel?“
„Labyrinth, Onkel Jelle.“
„Aha, aha… Und das da,“ auf die ungefähre Mitte des Blattes deutend, „das soll der Minotaurus sein. Aber er ist nicht allein! Das Figürchen neben dem Ungeheuer, ist das etwa ein Engel?“
„Der den Minotaurus am Bändel führt.“
Da lachte er, der Onkel Zahnarzt. „Pardon, du solltest auf die Akademie, bei uns natürlich, in Amsterdam, oder…“ Damit heftete sich sein Auge auf ein anderes Bild. „Und das ist sicher die Fortsetzung von dem. Nicht mehr ganz so… Aber doch – sein Titel?“
„Le Pont du Nord… Nach einem Film, der hier neulich im Kino lief.“
Le Pont du Nord. Ein weiblicher Engel mit Namen Baptiste, auf vier Tage zugange im Labyrinth Paris – Schauplatz eines „Gänsespiels“…
Noch in derselben Nacht nach dem Kinobesuch (einiges würde sich auf seiner Labyrinthtafel wieder finden) hatte er den denkwürdigen Traum von einem ähnlichen Wesen wie in jenem französischen Film. Wunderlich genug, auf einmal schien es Myriam zu sein, allerdings viel älter, schon als eine Frau in mittleren Jahren. Sie schritten zusammen durch eine Halle, von der man nicht sagen konnte, war sie unter oder über der Erde. Schienen von Loren und Strassenbahnen, aus ihrer Verankerung gerissen, stapelten sich hier kreuz und quer. Vor einer Wendeltreppe, die sie allein betreten würde, wandte sich Myriam noch einmal um. Sie schüttelte ihre dunklen Locken über ihn mit einem Lächeln voller Schwermut und schenkte ihm eine Uhr – eine goldene Uhr, als wäre er ein Kommunionkind!-
Erwacht, erinnerte Holger das Gänsespiel im Dorf ihrer Kindheit, Myriam war dann immer dabei. In diesem Spiel der Dorfkinder lebte ein uralter Tanz, ein Ritus des alten Europa, fort. Auf Kreta war es „der Tanz der Kraniche“, wo die Kranich-Menschen Hand in Hand einer geheimnisvollen Mitte zuschritten, die „das Meer“ genannt wurde.
Beflaggt sind noch die Altstadtgassen. Hunderte Wimpel überflattern die unabsehbare Menge teils hektischer, teils vergnüglicher Fussgänger. Wer aber vermag die zahllosen Winke zu verstehen, die mit den dunkleren Wolken immer noch aufgeregter, noch dringlicher werden? Der betrunkene Stromer, die Selbstmörderin, der zur Statue erstarrte Fixer auf der Rathaustreppe? Im wachsenden Zwielicht wächst die Erwartung namenlos und glühen die Blicke der Verzweifelten und Ekstatischen, als könnten sie finden Les Îles Fortunées in den Wolken!
In ihrem ersten Jahr als Schülerin des Lizeums und sie sich seltener sahen, traf Holger einmal nur Mutter Rachel am Nachmittag in ihrer Wohnung an. Sie lud ihn ein, auf ihre Tochter zu warten. Dabei entfiel ihr ein Wort, das ihm wie ein unter dem Siegel der Thora gegebenes unverlierbar blieb.
Rachel stand am Fenster ihres Wohnzimmers, wie stets mit besorgtem Blick, der aber unverhofft, ihr gleichsam selber zum Staunen, von einer freudigen Gewissheit zu leuchten schien. Nie vorher konnte er es an ihr bemerkt haben. Sie strich sich über die schon grauen Haare, und mit einem Siegerblick, der noch lange auf Holger ruhte, sagte sie:
„Weisst du, Myriam hat einen Engel, ich habe ihn schon einmal gesehen.“
Da stehen sie noch einmal auf dem Nordfriedhof unter tief schattenden Kastanien und blicken auf ein frisches Grab. Rachel Schwartz hatte getauft den Holocaust überlebt, nach Kriegsende noch Jahre in einem Schrebergarten Berlins gehaust, wo sie auch Myriam zwischen Netzen, Körben und Anglergerät geboren hatte. Mitte der Fünfziger, nach dem Aufstand in Berlin, war sie in den Westen gekommen, an den Rhein.
„Ich wurde als Zwilling geboren, wusstest du das? Doch das Brüderchen wollte nicht zum Vorschein kommen, nicht in die kalte, helle Welt. Der Kaiserschnitt geschah zu spät, die Gute hier überstand die schwere Geburt auch nur mit einem Schaden, du hast sie ja gekannt. Nun ist es dem Mütterchen leichter, o leichter,“ und mit gesenkter Stimme:
„Letzte Nacht sah ich sie wieder im Traum. Sie wirkte so verändert. Niemals hätte meine Fantasie das selbst erdacht, so sie zu sehen. War das wirklich meine Mutter, frage ich mich schon den ganzen Tag: so strahlend, so erlöst – oder war es ihr Engel? Glaubst du an Engel?“
Sie bückte sich, um einer Vase mit gelben Rosen etwas Wasser zuzuschütten. Als sie sich wieder erhob, zeigte ihre Hand in die Krone der nahen Kastanie.
„Siehst du die zwei Eichhörnchen da? Wahrhaftig, diese alten Bäume, die gute Ruhe hier – für die Tierchen rings muss es ein Garten Eden sein.“
Ein Düsenjäger – schallmauerbrechend – holte Myriam zurück in dieses Land, das sie nie als ihr Vaterland empfinden würde. Ja, und dies verband sie mehr, als es ihnen zu dieser Stunde bewusst sein konnte.
„Die Phantomjäger, Myriam, wie sie uns ihren Donner hinterlassen – jeden Tag, oder fast: ob die nicht, unbewusst natürlich, auf Dauer prägen? Und damit aufzuwachsen: könnte es späteren Bombenbastlern nicht so etwas wie eine Vorgabe sein, solche Mauern, die unsere herrlichen Wohlstandsjahre errichtet haben zwischen den Menschen, zu durchbrechen, wie auch immer?“
Myriam hatte ihre Hand auf seine Schulter gelegt, ein unauslöschliches Gefühl blieb ihm, als sie diese Hand wieder fort nahm, lächelnd.
„Wann fährst du, Myriam?“
„Mit dem Nachtzug, ich schlafe gern im Zug. Ich liebe das monotone Pochen der Schienen. Rachel wäre wohl auch zurück an die Spree gekehrt. Die Freunde, die sie durch den Krieg gerettet haben, hat sie nicht mehr gefunden.“
Entwurzelte! Im Mahlstrom einer Zeit, die wie noch keine an Jobsiaden reich und Geschichten von Leuten in Fischen und Feueröfen. In der Auflösung der Vaterländer, der Städte und Landschaften, werdet ihr immer flüchtiger über die versinkende Erde getrieben: aus demselben Grunde, mit demselben Schmerz.
Zugvögel flogen – viele Hunderte – über Wellmahr eine Nacht lang. Ab und an ein lauter, triumphierender Schrei. Wildgänse!