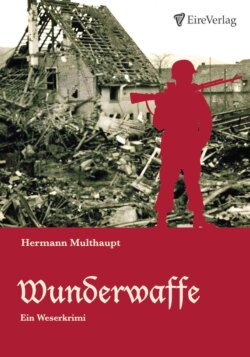Читать книгу Wunderwaffe - Hermann Multhaupt - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеBürgermeister Haferstroh, der einer Wesergemeinde vorstand, erhielt im Frühherbst 1944 das Schreiben einer NS-Zentrale, in dem ihm die bevorstehende Ankunft eines hohen Parteifunktionärs angekündigt wurde. Bürgermeister und Ortsgruppenleiter hätten Sorge für dessen Aufnahme und standesgemäße Unterbringung zu tragen. Wenn sich keine passende Unterkunft anbiete, müsse notfalls ein Haus beschlagnahmt werden. Der Gast leiste einen wichtigen Beitrag für die Vorbereitung auf den Endsieg.
Haferstroh hatte erhebliche Zweifel an dem Auftrag des Mannes. Ein Haus zu beschlagnahmen kam schon gar nicht in Frage. Schließlich hockten die meisten Menschen schon auf engstem Raum, beherbergten Ausgebombte und Evakuierte. Hinzu kamen polnische und russische Fremdarbeiter, die den Bauern auf den Feldern zur Hand gingen oder in Fabriken am Fließband standen. Es kam nur der auf einer leichten Anhöhe gelegene Gasthof „Zum Femegericht“ infrage. Er lag oberhalb des Dorfes, das aus einer einzigen Hauptstraße und mehreren Sträßchen und Gassen bestand. Die idyllische Lage hatte dem Dorf in Friedenszeiten im Juni, Juli, August und September einige Sommerfrischler beschert, meist pensionierte Beamte, die die Ruhe der Wälder schätzten, starke Buchen- und Eichenbestände, durch die sich ein Netz von Wanderwegen zog. Zahlende Übernachtungsgäste kamen derzeit allerdings so gut wie nicht mehr. Und so war die Auswahl an Zimmern unbegrenzt.
Nachdem die Frage der Unterbringung geklärt war, fuhr an einem der folgenden Abende ein Horch Pullmann mit Bosch-Tarnvorrichtung RL 3 vor. Die Scheinwerfer ähnelten in ihrer Verdunkelung den Augen eines Insekts. Der Herr, der dem Wagen entstieg, war allein. Er trug die braune Parteiuniform und die Hakenkreuzarmbinde. „Kriegskreisleiter Müller!“, schnarrte er und hob die rechte Hand.
Wirt Meinolf Engelhardt, Mitte Fünfzig und wegen eines Beinleidens vom Militärdienst befreit, hatte bereits eine Weile auf der Lauer gelegen und trat jetzt vor, hieß den Gast mit dem Deutschen Gruß willkommen und rief nach Hugo, seinem Knecht, das Gepäck ins Haus zu schleppen. Es waren zwei Koffer und zwei Kisten. Das Auto fand unter der Remise Platz. Den angebotenen Begrüßungstrunk lehnte Müller nicht ab. Er ließ sogar nachschenken.
„Vorzüglicher Kognak“, lobte er, „und das auf dem Lande. Wohl noch Vorkriegsware, was?“
Er lachte plump. Man sah dem Parteifunktionär an, dass er keine Not gelitten hatte. Die Uniformjacke spannte; das Koppel verhinderte, dass ein Knopf absprang. Noch bevor er sich die beiden für ihn reservierten Zimmer zeigen ließ, fragte er, was es abends zu essen gäbe. Der Wirt zählte auf, was auf der dürftigen Speisenkarte handgeschrieben verzeichnet stand. Offensichtlich überzeugte die Auswahl nicht.
Der Kriegskreisleiter schüttelte den Kopf. „Kein Rindersteak, kein Schweinsbraten, schön gepfeffert, mit Rosenkohl und Salzkartoffeln? Und als zweiten Gang Pommersche Gänsekeule in Backpflaumensauce? Schließlich ,Liegnitzer Bombe‘ zum Nachtisch?“
„Sie wissen, Herr Kriegskreisleiter, dass es ein Schlachtverbot gibt.“
„Aufgehoben, solange ich hier bin, verstanden?“
Engelhardt wollte „Zu Befehl!“ rufen und salutieren, doch besann er sich und sagte: „Sehr gern.“ Noch am späten Abend setzte er sich mit seinem Schlachter in Verbindung und trieb am übernächsten Morgen eine fette Sau aus dem Stall.
Was der Kriegskreisleiter in den oberen Räumen tat, blieb dem Wirt und seiner Frau verborgen. Antonie Engelhardt war erst einen Tag nach dem Einzug Müllers von einem Besuch bei ihrer Schwester in Gelsenkirchen zurückgekommen. Die Bahnfahrt hatte wegen der Luftgefahr einen Tag und eine halbe Nacht gedauert. Als die Wirtin beim Frühstück davon erzählte, wurde der Kriegskreisleiter wütend. In diesen Tagen, in denen Deutschland im Abwehrkampf gegen feindliche Eindringlinge stehe, müsse jeder Opfer bringen und auch einmal ein paar Stunden Verzögerung in Kauf nehmen. Darauf untersagte er der Wirtin jede weitere Kommentierung ihrer Reise und verbot ihr auch, die von ihm angemieteten Räume zu betreten.
„Habt ihr denn überhaupt schon über die Miete gesprochen?“, fragte Antonie Engelhardt ihren Mann, als sie sich von diesem Schock erholt hatte.
„Er sagt, dafür sei die Parteizentrale zuständig“, erwiderte der. „Nur welche, bleibt in diesem Chaos undurchsichtig.“
„Nicht, dass wir auf den Kosten sitzenbleiben.“
„Nein, nein. Irgendwie bringe ich die Sache ins Reine.“
„Irgendwie, ja …“
Antonie Engelhardt war in den Dreißigern eine Schönheit und bis zum Kriegsausbruch Teilhaberin eines Modegeschäftes in Berlin gewesen. Sie hatte es sogar einmal bis auf Seite 3 einer Modezeitschrift gebracht. Manchmal zog sie das zerknitterte Heft hervor, um es den Gästen zu zeigen oder um ihrem Mann, den sie erst vor wenigen Jahren geheiratet hatte, in Erinnerung zu bringen, dass sie eine Modeschöpferin und keine gewöhnliche Wirtin war. Goebbels war sogar einmal in ihrem Geschäft gewesen. Ob seine Begleiterin etwas gekauft hatte, wusste sie nicht mehr. Vor lauter Aufregung hatte sie die Tasse Kaffee, die sie den Herrschaften anbieten wollte, verschüttet.
Antonie stammte ursprünglich aus dem Rheinischen, entsprechend lebhaft war ihr Gemüt. Die Einheimischen liebten sie nicht, sagten ihr sogar nach, sie sei Ensemblemitglied eines zweifelhaften Varietétheaters gewesen, sei wie ein Hecht im Karpfenteich, bringe Unruhe ins Dorf und halte ihren Mann auf Trab. Meinolf hatte Antonie auf einer Reise des Gaststättenverbandes nach Berlin in einem Restaurant kennengelernt und sich in sie verliebt. Er erzählte ihr von dem gutgehenden Gasthof „Zum Femegericht“ mit seinen zahlreichen Sommergästen und dass er große Pläne für den Ausbau des Fremdenverkehrs habe. Diese Aussicht weckte Antonies Organisationstalent. Doch dann hatte der Krieg alle Ausbaupläne vereitelt. Kinder hatten sie nicht.
Antonie war vor allem den Frauen ein Ärgernis: Weil sie sich „schön machte“ und schminkte, nach der letzten Mode kleidete, sofern in diesen Kriegstagen überhaupt neue Kleidung auf den Markt kam, und damit gern auf der Dorfpromenade einherstolzierte. Nein, diesen Fummel konnten sich die einheimischen Frauen nicht leisten. Antonies Kommentar war gleichfalls nicht auf Aussöhnung angelegt: „Die laufen herum in Sack und Asche.“
Die wechselnden Militärs am Ort gingen dem Kriegskreisleiter aus dem Wege. Außer der vorgeschriebenen Begrüßung enthielten sie sich jeden weiteren Kommentars. Mancher hatte das Gefühl, dass der „Braune“, wie sie ihn nannten, froh war, wenn die Soldaten wieder abzogen.
Gerda, die Hausangestellte, die sonst während der Saison als Zimmermädchen arbeitete, durfte nur jeden zweiten Tag und stets in Anwesenheit des Gastes das Bett aufschütteln oder den Papierkorb leeren. Staubwischen war auf ein Mindestmaß beschränkt. Es war offensichtlich, der Kriegskreisleiter wollte, nein, musste allein sein, um an den Plänen für den Endsieg zu arbeiten …
„Der Feind zwingt uns dazu, unsere Pflicht dezentralisiert zu tun“, erklärte er einmal, nachdem er drei Schoppen „Pfälzer Roten“ auf Kosten des Hauses genossen hatte. „Wir haben die Büros aufgelöst, weil sie, wie alles, was deutsch ist, das Ziel der angloamerikanischen Flugzeuge sind. Dennoch arbeiten wir effektiv. Wir sind durch Kuriere miteinander verbunden. Die Kradfahrer kommen anonym. Wir treffen uns kurz an verschiedenen Plätzen zum Informationsaustausch. Sie werden kaum etwas mitbekommen. Den Fernsprecher benutzen wir nicht, Sie wissen, Herr Wirt: Feind hört mit!“
Wirt Engelhardt legte sich zweimal auf die Lauer – einen Kradfahrer entdeckte er nicht. Auch versuchte er einmal heimlich, den Inhalt des Papierkorbes vor der Entleerung in die Weser zu inspizieren, was der Gast stets persönlich besorgte; vergeblich. Er fand nur Schnipsel mit Zahlen vor, auf die er sich keinen Reim machen konnte. Allerdings verließ Müller einige Male spätabends das Haus – zum Spaziergang, wie er sagte. Engelhardt war zu müde, um ihm nachzuschleichen.
Zwei, drei Wochen vergingen. Der Tag des Kriegskreisleiters brachte nur wenig Änderung in inzwischen eingespielte Gewohnheiten. Einige Male suchte er das Postamt auf, um eingeschriebene Briefe zu expedieren. So hinterlistig einige Dorfbewohner auch darauf drangen, die Empfänger der Nazi-Botschaften in Erfahrung zu bringen – die Beamtin, eine säuerliche Jungfer, deren Verlobter im Ersten Weltkrieg gefallen war, hielt sich an ihre Diskretionspflicht und beantwortete die Fragerei mit mürrischem Schweigen. Sie hatte ohnedies nur Tarnadressen vor sich. Einige Male verfolgte der Kriegskreisleiter auch die Luftlagemeldungen im Büro des Femewirtes; dort stand das Radio, das über Feindeinflüge ins Reich informierte.
„Das ist eine zwiespältige Sache“, meinte er einmal. „Die feindlichen Verbände können die Funkwellen als Orientierungshilfe nutzen.“
Er war äußerst zufrieden, wenn die Sender vorübergehend den Sendebetrieb über Funk einstellten und zum Drahtfunk übergingen, dessen Mitteilungen über das Telefon kamen.
Als Bürgermeister Haferstroh dem hohen Partei-Bonzen seine Aufwartung machen und ihn im Namen der Dorfgemeinschaft begrüßen wollte, erhielt er eine Abfuhr. Wichtige Geschäfte hinderten ihn, den Bürgermeister persönlich zu empfangen, ließ der Kriegskreisleiter dem im Gastraum wartenden Dorfoberhaupt mitteilen, er danke jedoch für die Aufmerksamkeit. „Heil Hitler!“
Einmal nahm Müller die Hausangestellte Gerda beiseite.
„Mich wundert“, sagte er, „dass ein so fesches Mädel wie Sie hier in einem abgelegenen Gasthof Dienst tut. Haben Sie nie nach Höherem gestrebt?“
„Was nennen Sie denn Höheres, Herr Kriegskreisleiter?“
„Nun hören Sie mal!“, fuhr Müller auf, „das mindeste wäre doch eine Funktion in der NS-Frauenschaft, wenn Sie die Zeit für eine Tätigkeit im Bund Deutscher Mädel schon verschlafen haben.“
„Verschlafen?“ Gerda holte tief Luft. „Ich habe nichts verschlafen. Ich bin nur geradezu immer in Deckung gegangen, wenn etwas auf mich zukam, das ich nicht wollte.“
Kriegskreisleiter Müller stemmte die Fäuste in die Seite. „Was soll das! Das müssen Sie mir erklären!“
Gerda lehnte sich an das Treppengeländer, als handele es sich um eine leichte, erfrischende Konversation.
„Der Gedanke, zu heiraten, ist mir noch nicht gekommen. Dann müsste ich dem Führer ja ein Kind schenken, eins für den Krieg oder eins für den BDM oder die Frauenschaft oder weiß der Kuckuck für wen. Mir macht die Arbeit hier Spaß und ich bin zufrieden.“
Müller lag eine harsche Erwiderung auf den Lippen, doch er sagte nichts, sah Gerda nur wütend an und stapfte wutschnaubend in seine Zimmer hinauf. Gerda war eine entfernte Verwandte Engelhardts. Sie hatte den Gymnasialbesuch abbrechen müssen, um zur finanziellen Versorgung ihrer kranken Mutter beizutragen. Ihr Vater, ein lutherischer Pfarrer, war wegen regimekritischer Predigten ins KZ Dachau eingeliefert worden. Er hatte beispielhaft von einem Grubenunglück in Frankreich erzählt, bei dem eine Schicht von Bergleuten eingeschlossen worden war. Die französische Seite verfügte nicht über die Rettungsmaßnahmen, die die deutsche Seite bereits besaß. Der Schlagbaum hinderte einen freien Grenzverkehr. Man stellte sich vor, wie sich die Angehörigen am Schacht versammelten und nach ihren Angehörigen fragten, wie Mütter um ihre Söhne, Frauen um ihre Männer bangten. Da entschlossen sich die deutschen Kumpels, den französischen Kollegen zur Hilfe zu kommen. „Wir Bergleute holen sie da heraus!“, entschieden sie, und vollzogen einen Akt der Menschlichkeit, der ihnen Sympathien, dem Prediger jedoch bei der Parteizentrale Ärger und die Einlieferung ins Konzentrationslager einbrachte.
Gerda hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, schüttelte den Kopf und zog sich in die Küche zurück.