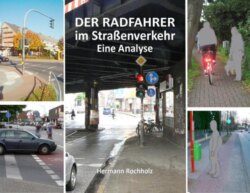Читать книгу Der Radfahrer im Straßenverkehr - Hermann Rochholz - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Abb. 1.1: Radweg, bis 2003 benutzungspflichtig (Norderstedt)
Auf vielen Wegen in deutschen Großstädten mit dem Fahrrad erlebte ich eigenartige oder gefährliche Situationen. Dabei bewegte ich mich zügig, aber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sofern dies möglich war). Diese Vorkommnisse bilden die Grundlage für eine Analyse dieser Situationen. Deshalb wird im Wesentlichen der Verkehr innerhalb geschlossener Ortschaften betrachtet, zumal dort Fahrräder am häufigsten eingesetzt werden.
Einem Nichtradfahrer die Schwierigkeiten eines Radfahrers klarzumachen ist schwierig. Beispielsweise nimmt ein Kfz-Fahrer (oder auch Fußgänger) von Blättern überdeckte Längsrillen nicht wahr. Ein erfahrener Radfahrer registriert sie: Insbesondere nasse Blätter haben eine Konsistenz ähnlich wie Schmierseife und es ist klar, dass dies für einspurige Verkehrsmittel eine Gefährdung darstellen kann. Fakten dieser Art werden exemplarisch dargestellt. Beispielsweise ist in ein bis zum Jahr 2003 benutzungspflichtiger Radweg dargestellt.
Die Benutzungspflicht (mehr dazu später) wurde zwar aufgehoben,1 aber die Ausweisung als Radweg war noch nie korrekt, was (denke ich) offensichtlich ist. Wie kann es sein, dass jemand diesen Radweg als „benutzungspflichtig“ deklariert, obwohl sofort zu erkennen ist, dass dieser viel zu schmal ist: Die Radwegbreite sollte 1,5 m sein, die reale Breite beträgt ca. 50 cm (der Faktor 3). Zudem weiß jeder, dass sich ein Fahrrad in Kurven legen muss und man als Radfahrer wahrscheinlich den hinteren schief stehenden Baum touchiert.
Vorgehensweise in diesem Buch
Zu Beginn werden die Grundlagen des Radfahrens im Verkehr dargelegt. Dazu werden die physikalischen Grundlagen erläutert. Um die Fakten verständlicher zu gestalten, werden Vergleiche mit Kraftfahrzeugen angestellt. In den meisten Fällen funktionieren diese relativ gut.
Diese Vergleiche sollen dazu beitragen, im Verkehr mehr Toleranz walten zu lassen. Manche Dinge können auf den ersten Blick kleinlich klingen. Aber schon das erste Bild zeigt, dass diese Grundlagen fehlen oder ignoriert werden. Auch der Einband dieses Buches gibt hierzu Hinweise. Die Intention dieses Buches ist es weiterhin, alle Aspekte der Bewegung auf einem Fahrrad zu erfassen.
Zusätzlich wird dargestellt, dass Dinge, die häufig als „irrelevant“ abgetan werden, mehr Auswirkungen haben können, als ein Nichtradfahrer denkt. Final zeigen diese „Nahezu-Belanglosigkeiten“, mit wie viel Kleinkram sich Radfahrer herumärgern und gefährden lassen müssen. Wobei das „Herumärgern“ auch darin bestehen kann, sich das Fahrrad beschädigen zu müssen.
Im Vergleich mit Kraftfahrzeugen (Kfz) werden Berechnungen durchgeführt. Damit wird evaluiert, welche Auswirkungen sie auf das System des Fahrradfahrers im Verkehr haben.
Zielgruppe
Zielgruppe dieses Buches sind:
Radfahrer, die auf Fallen hingewiesen werden und denen vielleicht Unannehmlichkeiten erspart werden.
Kfz-Fahrer, die hoffentlich erkennen, dass es Radfahrer manchmal nicht so einfach haben, wie sie glauben und Radwege in den meisten Fällen nicht der Weisheit letzter Schluss sind.
Die Presse, die durch teilweise inkompetente Berichterstattung Radfahrer und Kfz-Fahrer regelrecht gegeneinander aufhetzt.
Juristen, die bei dem einen oder anderen Sachverhalt feststellen, dass ihre Juristerei der Physik widerspricht. Was einer vernünftigen Rechtsprechung nicht förderlich sein kann.
Straßenplaner und Personen, die Baugenehmigungen erteilen. Diese werden hoffentlich dazu angehalten, Radfahrer in ihrer Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
Polizisten. Auch bei der Exekutive scheinen bei einigen Individuen Tendenzen vorhanden zu sein, Verkehrsteilnehmer unterschiedlich zu behandeln.
Hinweis: In jeder Personengruppe, auch bei Radfahrern, existieren Individuen, die sich über geltende Regeln, Gesetze und Richtlinien hinwegsetzen. Dieses Buch soll keinen Freispruch einer Gruppe darstellen. Radfahrer dieser Art, die Kfz-Fahrer nerven, gefährden nämlich in anderen Situationen Radfahrer. Die Individuen sind meist identisch.
Der Kfz-Fahrer wird kritisch bemerken: „Da gibt es doch viele, die beispielsweise beim Abbiegen keine Handzeichen machen, was aber Vorschrift ist“. Fakt ist, dass bei Beachtung dieser Regel häufig ein Sturz einprogrammiert wäre: Denn insbesondere im Abbiege- bzw. Kreuzungsbereich ist der Fahrbahnbelag des Radweges oder die Verkehrsführung so uneben, dass Radfahrer beide Hände aus Selbstschutzgründen am Lenker lassen müssen.
Für die Instandhaltung von Radwegen wird als Letztes Geld ausgegeben. Zusätzlich ist der Aufbau (also die Lagen der Fahrbahn übereinander) von Radwegen billiger und deshalb einfacher als der von Straßen. Daraus resultiert, dass Fahrbahnschäden (bspw. Wurzeln) häufiger sind und früher auftreten. Durch Wurzeln beschädigte Straßen sind ist im Gegensatz dazu selten.
Auch die Presse verhält sich nicht neutral: Die Neueröffnung von Radwegen zieht bspw. in Lokalblättern meist ein Presseecho nach sich. Die Presse berichtet dabei, wie toll der neue Radweg sei. Dabei ist das „toll“ lediglich damit verbunden, dass der Radweg korrekt angelegt wurde. Bei einer Straße für Kfz ist dies eine Selbstverständlichkeit. Diese unvollständige Information des Lesers geschieht wahrscheinlich nicht vorsätzlich. Es zeigt sich hier jedoch, dass der Presse als Teil der Öffentlichkeit Fachwissen fehlt und dadurch eine neutrale, sachlich korrekte Berichterstattung nicht möglich ist. Da Städte und Gemeinden stolz darauf sind, geschätzt 25 % der Radwege korrekt anzulegen, wird dem Leser des Lokalblattes dies genau so vermittelt. Zudem eine Pressemitteilung „Fünfundzwanzig Prozent der Radwege in der Kommune XXX entsprechen mittlerweile den geltenden Regeln und Richtlinien“ der Karriere des Journalisten ein Ende bereiten würde.
1Nachdem juristische Mittel angedroht wurden