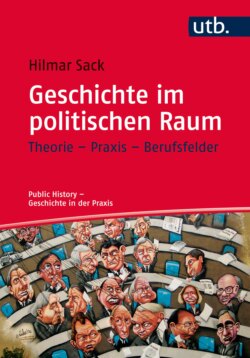Читать книгу Geschichte im politischen Raum - Hilmar Sack - Страница 10
2.5 Kein Recht auf Vergessen? Und wo bleibt die Zukunft?
Оглавление„Das Zukünftige nimmt ab, das Vergangene wächst an,
bis die Zukunft verbraucht und das Ganze vergangen ist.“
(AugustinusAugustinus, Bekenntnisse XI)
Das VergessenVergessen hat gegenwärtig keinen guten Leumund. Doch das war nicht immer so. „Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, sondern auch Dunkel gehört“, schreibt Friedrich NietzscheNietzsche, Friedrich (1844–1900) in seiner für die Gedächtnisforschung inspirierenden Abhandlung „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ (Nietzsche 1893, 209). Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden wollte, wäre dem ähnlich, „der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde, oder dem Tiere, das nur vom Wiederkäuen und immer wiederholtem Wiederkäuen leben sollte“ (ebd. 212). Das berühmte Philosophen-Fazit lautet deshalb: „Es ist möglich, fast ohne Erinnerung zu leben, ja glücklich zu leben, wie das Tier zeigt; es ist aber ganz und gar unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben“ (ebd.).
Erinnern und VergessenVergessen sind zwei Seiten der gleichen Medaille. NietzschesNietzsche, Friedrich Einwand antizipiert ein Unbehagen, das sich gegenüber dem dominierenden Erinnerungsimperativ zu regen beginnt: Gibt es nicht auch das Recht, vielleicht sogar die Notwendigkeit zu vergessen? Mit Blick auf zahlreiche historisch aufgeladene Konflikte formuliert Jan AssmannAssmann, Jan einen naheliegenden Gedankengang (ohne ihn sich gemein zu machen): „Allen wäre geholfen, wenn die Vergangenheit begraben, ein Schlussstrich gezogen und endlich eine gemeinsame Zukunft gefunden werden könnte. […] Die Vergangenheit hat uns im Griff, sie verengt unseren Blick für die Zukunft und beschränkt unsere Handlungsfreiheit. In solchen Fällen wäre mit Vergessen viel zu erreichen“ (Assmann 1999a, 25). Der Althistoriker Christian MeierMeier, Christian hat dazu unter dem Titel „Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns“ einen anregenden Essay vorgelegt (Meier 2010). Seine Untersuchung zum öffentlichen Umgang mit „schlimmer Vergangenheit“ bürstet das gegenwärtige Erinnerungsdogma gehörig gegen den Strich. Meier zeichnet nach, dass die Menschheit über Jahrtausende auf das Vergessen und gerade nicht das Erinnern setzte, um den gestörten Frieden untereinander wiederherzustellen. Von der Antike über das MittelalterMittelalter bis zur Neuzeit enthielten die Verträge nach Kriegen und Bürgerkriegen Bestimmungen, vergessen zu sollen, es regierte Amnestie und Amnesie. Erst das 20. Jahrhundert räumte welthistorisch neuartig mit dieser Praxis auf, beginnend mit der AufarbeitungVergangenheitsbewältigung des Ersten WeltkriegsErster Weltkrieg. Auschwitz schließlich habe die völlige Abkehr vom Gebot des Vergessens bewirkt. Meier schildert diesen Wandlungsprozess nicht allein deskriptiv-chronologisch, er bindet das Erinnern und Vergessen zugleich normativ an die Forderung nach Gerechtigkeit und die Notwendigkeit zum Frieden (ebd. 9ff., 81ff.). An diesen zwei konfliktreichen Alternativen haben sich Gesellschaften in der „Konfrontation mit schlimmer Vergangenheit“ abzuarbeiten – und es bedarf keiner expliziten Erwähnung, in welche Richtung sich die Waagschale in Deutschland neigt. Dabei hat sich heute weitgehend die Erkenntnis durchgesetzt, „dass es keinen wirklichen Frieden geben kann, solange nicht den Opfern, ihren Angehörigen und Nachkommen Gerechtigkeit widerfährt, im Erinnern an das, was tatsächlich geschehen ist.“ (Norbert Lammert, BT-Plenarprotokoll 18/101, S. 9653)
Und die Zukunft? Wo bleibt bei all den Vergangenheitsbezügen der Gegenwart, dieser „Übersättigung einer Zeit in Historie“ (Friedrich NietzscheNietzsche, Friedrich), eigentlich die Zukunft? Der Philosoph Sir Karl Raimund PopperPopper, Karl Raimund (1902–1994) hat gegenüber teleologischen Ansprüchen der Geschichtsphilosophie proklamiert: „Die Zukunft hängt von uns selbst ab, und wir sind von keiner historischen Notwendigkeit abhängig“ (Popper 1945, 5). Gegenüber dieser normativ gesetzten Freiheit des Menschen, seine Zukunft selbst zu gestalten, betont das Erinnerungsparadigma unsere Abhängigkeit von der Vergangenheit – überlagert sie unsere Zukunftsvorstellungen inzwischen bereits? Der Befund ist nicht eindeutig. Der Publizist und frühere Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Joachim FestFest, Joachim (1926–2006) urteilte noch 2004 über das deutsche GeschichtsbewusstseinGeschichtsbewusstsein: „Deutschland hat einerseits Angst vor dem Neuen, und andererseits ist es völlig geschichtslos. Das Gestern hat in Deutschland keine Anwälte, nicht erst seit HitlerHitler, Adolf. Die Deutschen haben sich stets in irgendwelche Zukünfte hineingeträumt, aber die sind ihnen durch den Zusammenbruch der Ideologien und Utopien genommen. Jetzt leben sie nur noch in der Gegenwart“ (Amend 2004). Und „Die Zeit“ konstatierte ein Jahrzehnt später: „Alles, wirklich alles dreht sich zurzeit um die Zukunft der Herkunft! Das heißt aber: Wir sind dabei, den Begriff der Herkunft inflationär zu verwenden. Tag für Tag verliert er an Wert. Bald wird er weiter nichts sein als ein Gespenst der Vergangenheit“ (Das kommt davon. In: Die Zeit, 11.12.2014). Auch der Sozialpsychologe Harald WelzerWelzer, Harald (2012, 34f.) sieht in der deutschen ErinnerungskulturErinnerungskultur die Tendenz zu „einer ‚Memorymania‘ (A. Assmann), in der Vergangenes nicht auf seinen Gebrauchswert hin befragt, sondern an sich für erinnernswert gehalten wird.“ Diese „Zukunftsvergessenheit“ definiert Welzer als „eine seltsam indifferente Haltung allem gegenüber, was Zukunftsbewältigung sein könnte“. Die Vergangenheit bekomme demnach ein solches Gewicht, dass sie – im Sinne des Eingangszitats von AugustinusAugustinus – die Gegenwart dominiere und die Zukunft dezimiere.
Gewarnt wird also nicht nur vor der banalisierenden Aushöhlung des Vergangenheitsbezugs, beklagt wird auch der zunehmende Verlust an Fortschrittsglauben und Utopien. Der Kulturhistoriker Thomas MachoMacho, Thomas fragt angesichts der Gedächtniskonjunktur, wie viel Zukunft wir eigentlich überhaupt noch der Zukunft geben: Was wird kommen, was bringt die Zukunft? Diese Fragen würden wir gar nicht mehr stellen, während sich alle Kulturen stets auch in ihrem Umgang mit der Zukunft konstituiert hätten: durch ihre Techniken der Voraussage, der Planung, der Prognostik (Macho 2007; siehe auch Mayer/Pandel/Schneider 2000, 260–269). Der Historiker Paul NolteNolte, Ernst (2003, 28) empfahl deshalb bereits Anfang des Jahrtausends, als der gesellschaftliche Reformstau der Nachwende-Ära die Debatten prägte, der übermäßigen Historisierung Grenzen zu setzen und sich, statt Vergangenheit als Zukunft zu präsentieren, wieder dem Gegenwartsprojekt der Gesellschaftsreform zuzuwenden. Diese Mahnung von Wissenschaftsseite hat die Politik erreicht. 2014 eröffnete BundespräsidentBundespräsident Joachim GauckGauck, Joachim den 50. Historikertag mit der bemerkenswerten rhetorischen Frage, ob die Geschichte nicht dabei sei, über die Gegenwart und über die Zukunft zu siegen? „Wo ist nur die Zukunft hin?“, fragte ein angesichts der unaufhörlichen Konfrontation mit der Geschichte, mit Jubiläen, Gedenktagen, Erinnerungen, Denkmälern oder Denkmalplanungen verunsicherter Bundespräsident in seinem eindrücklichen politischen Plädoyer dafür, sich nicht nur der Vergangenheit zu stellen, sondern auch die Zukunft zu gestalten (Gauck 2014). Doch ein Ende des Vergangenheitsbooms ist nicht in Sicht, im Gegenteil.
Weiterführende Literatur
Dimbath/Wehling 2011: Oliver Dimbath/Peter Wehling (Hrsg.), Soziologie des VergessensVergessen: Konturen, Themen und Perspektiven (Konstanz 2011).
MeierMeier, Christian 2010: Christian Meier, Das Gebot zu VergessenVergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit (München 2010).
NietzscheNietzsche, Friedrich 1893: Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. In: Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen (Berlin 20143) 59–118 [Erstdruck: Leipzig 1893].