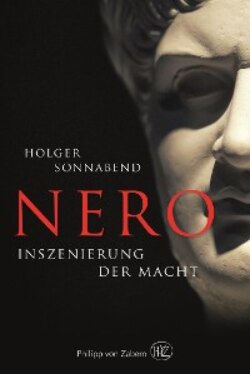Читать книгу Nero - Holger Sonnabend - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Nero Suetons
ОглавлениеMüssen wir dasselbe auch für die zweite Hauptquelle annehmen? Hat der berühmte Kaiserbiograf Sueton sich seine Kaiser so gezeichnet, wie er sie haben wollte (im positiven wie im negativen Sinn), oder hielt er sich bei seiner Darstellung an die Fakten? Ist sein Nero der „richtige“ Nero? Suetons Biografien sind in jedem Falle die wichtigsten Quellen für die Kenntnis der römischen Geschichte im 1. Jahrhundert, auch wenn man ihn wegen der Art und Weise seiner biografischen Arbeit immer wieder heftig kritisiert hat. Die offenkundige Freude des Autors an Klatsch, Anekdoten, Gerüchten und Intimitäten, seine Vorliebe für die Schlüsselloch-Perspektive und der Anspruch, Kaiser so zu zeigen, wie sie keiner kannte, schmälert seinen Wert als historische Quelle nicht. Es kommt entscheidend darauf an, wie man mit dem, was er bietet, umgeht. Auf jeden Fall stellt sein Werk einen instruktiven Kontrast zum Schaffen des Tacitus dar. Dieser beschrieb die frühe Kaiserzeit in der schon etwas angestaubten Tradition der senatorischen Geschichtsschreibung nach dem annalistischen Schema, das heißt, er berichtete, was Jahr für Jahr passiert war, stellte die Ereignisse vor die Personen. Sueton orientierte sich zeitgemäßer und moderner an den Viten der Protagonisten; zeitgemäßer deshalb, weil sich das Lesepublikum der Kaiserzeit weniger für Abläufe als vielmehr für das Leben der diese Abläufe lenkenden Protagonisten interessierte. So entstand eine höchst anschauliche Sammlung von zwölf Biografien, von Iulius Caesar, dem Ahnherrn der iulisch-claudischen Dynastie und Wegbereiter der römischen Monarchie, bis Domitian, den Tacitus in seinem Agricola so |20|heftig kritisiert hatte. Wer sich in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts über römische Geschichte der jüngeren Vergangenheit informieren wollte, hatte also zwei Optionen. Entweder griff man zu den Annalen oder auch zu den früher verfassten, jedoch die spätere Zeit nach Nero thematisierenden Historien aus der Feder des Tacitus, in der man die konservative Sicht des Senators vorgeführt bekam. Oder man las Sueton, der die Zeit nach Kaisern geordnet und mit dem Fokus auf das Biografische präsentierte. Aus Tacitus sprach der Senator, aus Sueton der Hofbeamte.
Gaius Suetonius Tranquillus, wie der komplette Name dieses Klassikers der biografischen Literatur lautete, wurde um das Jahr 70, also zwei Jahre nach dem Tod Neros, geboren. Gestorben ist er um das Jahr 130. Seine Heimat war aller Wahrscheinlichkeit nach das römische Nordafrika, mutmaßlich die Stadt Hippo Regius im heutigen Algerien. Sueton war, anders als Tacitus, kein Politiker und Senator. Erst war er in Rom Rechtsanwalt, bald aber wandte er sich, von Hause aus begütert, der Schriftstellerei zu. Unter Kaiser Traian trat Sueton um 100 in die kaiserliche Kanzlei ein und bekleidete dort verantwortungsvolle Ämter. Für seine Tätigkeit als Kaiserbiograf entscheidend war die Tätigkeit als ab epistulis. In dieser Eigenschaft war er für die gesamte amtliche Korrespondenz des Kaisers mit den Städten, Statthaltern und sonstigen Funktionsträgern zuständig. Der ab epistulis entwarf die Briefe, der Kaiser leistete seine Unterschrift. Häufig war es notwendig, zur Beantwortung von Anfragen oder für die Formulierung kaiserlicher Richtlinien die Archive zu konsultieren, um nach entsprechenden Fällen aus der Vergangenheit zu forschen. Dabei stieß er auf viele Informationen auch aus dem Privatleben der Kaiser, wie Briefe und Akten. Auf diese Weise dürfte auch der Entschluss gereift sein, dem römischen Publikum das Leben der Kaiser in leicht verständlicher Form zu beschreiben. Die Möglichkeit dazu hatte er bis 121, als er, angeblich im Rahmen einer Hofaffäre mit Intrigen und Verleumdungen, seinen lukrativen Posten räumen musste. Bis zu seinem Tod widmete er sich einer Tätigkeit als Privatgelehrter.
Die berühmten Kaiserbiografien sind unter dem originalen Titel De vita Caesarum (Über das Leben der Caesaren) überliefert. Es sind insgesamt zwölf Persönlichkeiten, deren Biografien Sueton in seinem Sammelwerk vereinigt hat und die in chronologischer Vorgehensweise, Kaiser für Kaiser, abgehandelt werden. Diese Kaiserbiografien haben einen außerordentlich hohen Stellenwert. Sueton saß sozusagen an der Quelle und |21|verfügte daher über Informationen, die selbst einem gut instruierten, aber eben nur senatorischen Historiker wie Tacitus verschlossen blieben. So kann man gegenüber seinem Werk viel Kritisches vorbringen, sich über seine Vorliebe für Klatsch und Anekdoten beschweren – nicht vorwerfen kann man Sueton auf jeden Fall, kein erstklassiges Material zur Verfügung gehabt zu haben.
Archivstudien des Sueton verdankt man beispielsweise Originalzitate aus Briefen, die Augustus an seinen späteren Nachfolger Tiberius geschrieben hat. Das war Material, an das der Normalhistoriker erst gar nicht herankam. Die Verfügungsgewalt über das kaiserliche Archiv versetzte Sueton auch in die Lage, in historischen Streitfragen einen Wissensvorsprung in die Waagschale zu werfen. Ein Charakteristikum seiner Biografien ist die bis ins Alltäglichste und Privateste gehende Detailkenntnis. Auch hier hat er von seinem freien Zugang zum kaiserlichen Archiv profitieren können. Diese Detailkenntnis bezieht sich nicht nur auf die Kaiser selbst, sondern auch auf viele namhafte und namenlose Römer, mit denen die Kaiser zu tun hatten. Dem Leser wird ein kultur- und sittengeschichtliches Kaleidoskop der frühen römischen Kaiserzeit, insbesondere, was die Verhältnisse in der Hauptstadt Rom betrifft, präsentiert. So war Sueton nicht nur ein Kenner der Kaiser, sondern auch ein Experte bezüglich stadtrömischer Skandalchroniken.
Im Gegensatz zu Tacitus hat Sueton kein literarisches Kunstwerk schaffen wollen. Und anders als sein griechischer Kollege, der Biograf Plutarch, der etwa zur selben Zeit seine Parallelbiografien von großen Griechen und Römern vorlegte, schrieb er auch nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger. Seine Biografien sollten die Menschen nicht besser, sondern informierter machen. Mit Wertungen hält er sich normalerweise zurück. Der Biograf versorgt den antiken und damit auch den modernen Leser mit historischem Rohmaterial, das eine umfassende, vom Autor aber nicht in jedem Fall vorinterpretierte historische Deutung ermöglicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass er völlig auf subjektive Aussagen verzichtet. Er lässt durchaus erkennen, wen er für einen guten oder schlechten Kaiser hält, und er zeigt auf, welche Handlungen er als vorbildlich oder kritikwürdig ansieht. Caligulas Biografie etwa besteht aus zwei Teilen, von Sueton mit den Worten voneinander separiert: „Soviel vom Kaiser Caligula, im folgenden haben wir vom Scheusal zu sprechen“3. Auch von Nero hat er eine dezidierte Meinung, dementsprechend setzt er wie |22|bei Caligula eine deutliche Zäsur: „Das, was teilweise überhaupt keine Kritik, teilweise sogar ausgesprochen deutliche Anerkennung verdient, habe ich in einem Kapitel zusammengefasst, um es klar von seinen Schandtaten und Verbrechen zu trennen, über die ich jetzt sprechen werde.“4
Ist für Tacitus der Maßstab bei der Verteilung guter oder schlechter Noten an die Kaiser deren Umgang mit dem Senat und den Senatoren, so bei Sueton offenbar, auch wenn er sich in dieser Hinsicht nicht dezidiert äußert, das Vorbild zweier Herrscher: zum einen Augustus, der das Principat gründete und eine stabile neue Ordnung schuf, zum anderen Hadrian, unter dessen Herrschaft die meisten der Kaiserbiografien entstanden sind. So wie Augustus sich trotz vieler Kriege, die er führte, als Friedensfürst zu stilisieren wusste, verstand es Hadrian, der das Römische Reich zwischen 117 und 138 führte, als Garant von Ruhe und Ordnung im Reich aufzutreten. Anders als sein Vorgänger Traian, der viele militärische Unternehmungen gestartet hatte und unter dessen Regierung das Römische Reich seine größte Ausdehnung erreichte, setzte Hadrian auf Konsolidierung und Sicherung der bestehenden Grenzen. Bei Sueton findet diese Politik insofern ihre Resonanz, als er Kriege nicht zu den Faktoren zählte, die in den Leistungsbilanzen der Kaiser ganz oben angesiedelt waren. Das ist auch der Grund dafür, dass er die relative Zurückhaltung Neros bei kriegerischen Aktionen noch zu dessen positiven Eigenschaften zählte: „Er hatte niemals vor, das Reich noch weiter über seine Grenzen auszudehnen, noch versprach er sich etwas davon. Er hatte sogar daran gedacht, das Heer aus Britannien abzuziehen“5.
Bedeutsam für die Einschätzung Suetons als Quelle für die römischen Kaiser und insbesondere auch für Nero ist dessen Praxis, seine Biografien nach einem bestimmten, immer wiederkehrenden Schema aufzubauen.6 Die Darstellung beginnt chronologisch, mit Angaben über Herkunft, Familie, Geburt, diese in der Regel begleitet von ominösen Phänomenen, mit meist knappen Informationen über die Zeit bis zum Regierungsantritt. Dann wechselt Sueton die Darstellungsweise und geht systematisch vor. Leben und Taten der Kaiser werden in einzelnen Rubriken geschildert: Kriege, Gesetze, Finanzen, Verwaltung, Bautätigkeit, positive und negative Charaktereigenschaften. Das sind die Schubladen, auf die er sein reichhaltiges Material verteilt. Danach kommt der Tod, inklusive der diesen ankündigenden Vorzeichen, der immer sehr ausführlich geschildert |23|wird, möglichst auch mit den letzten Worten des Kaisers, und das Begräbnis. Den Schluss bilden in der Regel Angaben über die äußere Erscheinung des Kaisers und über testamentarische Verfügungen.
Diese Kombination von Chronologie und rubrizierender Systematik hat Sueton selbst, in einer Art interner Regieanweisung, so beschrieben: „Nachdem ich so gewissermaßen einen Überblick über sein Leben (des Augustus) gegeben habe, will ich jetzt einzeln die Abschnitte behandeln, allerdings nicht zeitlich, sondern thematisch geordnet, damit die Darstellung und das Verständnis umso klarer werde.“7 In der Caesar-Vita unterbricht er sich selbst, als er chronologisch bei dem Tod des Diktators angelangt ist: „Doch bevor ich darüber spreche, wird es nicht unpassend sein, in aller Kürze seine Gestalt, sein Äußeres, seine Bildung, seinen Charakter und seine Fähigkeiten als Politiker und Soldat darzustellen.“8 In der Augustus-Vita leitet er eine Zäsur in der Darstellung mit den Worten ein: „Da ich nun dargelegt habe, welche charakterlichen Merkmale Augustus als Inhaber von militärischen und zivilen Ämtern und als Herrscher über ein Weltreich im Krieg und im Frieden gezeigt hat, will ich nun über sein Leben im häuslichen und familiären Bereich berichten: nach welchen Grundsätzen und unter welchen Verhältnissen er zu Hause und mit den Seinen von der Jugend bis zum letzten Tag seines Lebens gelebt hat.“9 Den Wandel des Tiberius von einem verantwortungsvollen Herrscher zu einem, nach seiner Ansicht, debilen Wüstling leitet er mit der Bemerkung ein: „Über diese Sünden will ich im folgenden berichten, Laster für Laster, von Anfang an.“10 Auf den Tod Neros kommt Sueton in folgender, dezidierter Weise zu sprechen: „Einen solchen Herrscher hatte die Welt nicht ganz 14 Jahre ertragen, dann endlich war Schluss damit. Den ersten Schritt dahin taten die Gallier unter der Führung des Iulius Vindex.“11
Das Verfahren, die Leistungen und Taten der Kaiser in Rubriken unterzubringen, dient Sueton also, in Abkehr von seinem sonstigen Bemühen um Neutralität, auch dazu, sie negativ oder positiv zu klassifizieren. Und für eine historische Auswertung birgt das Zettelkastenverfahren zudem eine Reihe von Gefahren. Das Hauptproblem besteht darin, dass auf diese Weise historische Zusammenhänge getrennt werden. Das zeigt sich in aller Deutlichkeit bei dem Brand von Rom im Jahre 64, der als einer der herausragenden und bekanntesten Vorfälle aus der Regierungszeit Neros gelten kann. Ein Vergleich zwischen den diesbezüglichen Angaben Suetons mit denen des Tacitus ist sehr aufschlussreich. Der Historiker Tacitus |24|berichtet über dieses Ereignis in den Annalen getreu seiner Devise, die Dinge in ihren chronologischen Zusammenhang zu setzen.12 Das Feuer bricht aus. Als Gerüchte aufkommen, dass Kaiser Nero das Feuer selbst gelegt oder zumindest den Befehl dazu gegeben habe, sucht dieser, so Tacitus, nach Schuldigen und findet sie in den Christen der Stadt Rom, die er daraufhin grausam töten lässt. Sueton ordnet die Nachrichten nach seiner Schubladentechnik und hebt dabei den Zusammenhang zwischen dem Brand von Rom und den Christenverfolgungen auf, indem er an zwei ganz verschiedenen Stellen darauf zu sprechen kommt. Im 16. Kapitel der Nero-Vita, noch unter der Überschrift „gute Taten Neros“, heißt es kurz und bündig: „Über die Christen, Menschen, die sich einem neuen und gefährlichen Aberglauben ergeben hatten, wurde die Todesstrafe verhängt.“ Von dem Brand ist hier keine Rede, man erfährt nichts über den Grund der Sanktionen gegen die Christen, und den will Sueton hier auch gar nicht mitteilen, nur das seiner Meinung nach Nero günstig charakterisierende Faktum wird erwähnt. Positiv ist seine Handlungsweise für Sueton deswegen, weil er das von einem Hofbeamten erwartete harte Vorgehen gegen angeblich konspirative, den Staat gefährdende Kräfte unter Beweis stellt. Als Ordnungsstifter ist der Kaiser bei ihm positiv konnotiert. Die Nachricht über den Brand findet sich in Kapitel 38 der Nero-Vita, diesmal platziert unter der Kategorie „Nero, der Verbrecher“: „Unter dem Vorwand, die Hässlichkeit der alten Gebäude und die Enge und Gewundenheit der Straßen beleidige sein Auge, steckte er Rom in Brand.“An dieser Stelle fehlt nun wiederum jegliche Anspielung auf die Christen, weil dieser Aspekt Sueton in dem Zusammenhang nicht interessierte. Theoretisch wäre es denkbar, dass Brand und Verfolgung der Christen tatsächlich in keiner Verbindung standen. Jedoch sind die Aussagen des Tacitus und anderer Quellen eindeutig. So hat Sueton von sich die wahren Abläufe nicht gänzlich verfälscht, wohl aber in ihrer Relation verändert. Die Verfolgung der Christen war gut, der Brand von Rom schlecht, also mussten sie getrennt voneinander geschildert werden.