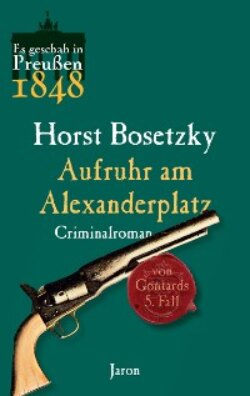Читать книгу Aufruhr am Alexanderplatz - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 6
Zwei
ОглавлениеAn diese Marie Engels musste Gontard unwillkürlich denken, als er zehn Jahre später, am 10. Februar 1848, mit seinem Freund Dr. Friedrich Kußmaul schon am Vormittag im Café Stehely saß und der Arzt von den Schriften eines gewissen Friedrich Engels zu erzählen begann. »Kennst du den?«, fragte Kußmaul, als er Gontard ein wenig spöttisch lächeln sah.
»Na sicher. Er war bei der Garde-Artillerie-Brigade hier in Berlin, wo er seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger absolviert hat. Und an der Universität hat er auch noch Vorlesungen besucht, in Philosophie, glaube ich. Aber eigentlich wollte ich den Namen Engels ein für alle Mal aus meinem Gedächtnis gelöscht haben. Zu schrecklich war das damals mit dem Schießunfall in der Wahner Heide, bei dem die Marie ums Leben gekommen ist, die Bäckerstochter, in die ich mich ein bisschen verguckt hatte.«
»Die werden doch nicht miteinander verwandt sein, die Marie Engels und der Friedrich Engels«, nahm Kußmaul an.
»Ich weiß nur, dass Friedrich Engels aus Barmen kommt – das liegt bekanntlich nicht weit entfernt von Wahn – und einen ganzen Haufen von Brüdern und Schwestern hat.« Gontard hielt inne und überlegte. »Aber wenn die Marie mit ihm verwandt gewesen wäre, hätte sie mir doch von ihm erzählt.«
»Warum sollte sie das tun?«, fragte Kußmaul. »1838 hat ihn doch noch niemand gekannt.«
»Gut, lassen wir das Thema.« Gontard wies auf die Zeitungen, die an der Wand am Haken hingen und die er noch nicht studiert hatte. »Was gibt’s denn Neues in Berlin und anderswo?«
»Im Augenblick nicht viel, aber das könnte sich in Bälde ändern.«
»Wieso denn das?«
»Ich habe einen Patienten, der gerade aus Paris gekommen ist – und da soll es mächtig gären.« Kußmaul senkte die Stimme. »Der Thron des französischen Königs Louis-Philippe wackelt beträchtlich. Das Bürgertum ist enttäuscht von ihm, weil er dem Adel die Rückeroberung seiner Privilegien beschert hat, und die Arbeiter stöhnen über ihre verzweifelte Lage und sind nahe daran, erneut auf die Barrikaden zu gehen.«
»Selbst wenn es in Frankreich wieder eine Revoluton gäbe, würde sich hier bei uns nichts ändern – so wie 1789.« Gontard gab sich in dieser Hinsicht keinerlei Illusionen hin. »Weder der Weberaufstand in Schlesien noch Bettina von Arnims sozialkritische Schrift Dies Buch gehört dem König haben hierzulande irgendjemanden aus seiner wohligen Lethargie gerissen.«
»Nun ja …« Kußmaul wusste nicht richtig, wo er ansetzen sollte. »Neulich habe ich in der Jung’schen Apotheke, an der Ecke Neue Königstraße und Barnimstraße, ein wenig mit dem Apotheker Fontane geplaudert, und der meint, dass die meisten Bürgersleute die politischen Verhältnisse satthätten. Nicht, weil sie sonderlich unter ihnen leiden würden, nein, sondern weil in Preußen alles so furchtbar antiquiert sei, als habe man am Hofe und in seiner Umgebung das letzte halbe Jahrhundert verschlafen.«
Gontard schüttelte den Kopf. »Auch im Adel gibt es genügend Menschen, die darunter leiden, dass wir keine Pressefreiheit haben, von einer liberalen Verfassung ganz zu schweigen, und dass wir von der Politischen Polizei auf Schritt und Tritt bespitzelt werden. Die Armut nimmt nie gekannte Ausmaße an. Nahrung und Wohnraum werden immer teurer, und schon ein Viertel aller Berliner ist so arm, dass man sie von der Mietsteuer befreien muss.«
Kußmaul zog seine Taschenuhr hervor. »Entschuldige, ich muss in die Sprechstunde. Meine Patienten warten schon.«
»Henriette wird auch schon ungeduldig sein, weil ich noch nicht zu Hause bin.« Damit erhob sich auch Gontard.
Als sie auf den Gensdarmen-Markt herausgetreten waren, verabredeten sie sich für den Abend, dann strebte Kußmaul seiner Ordination entgegen und Gontard dem häuslichen Herd in der Dorotheenstraße. Nach seiner Beförderung vom Major zum Oberst-Lieutenant – pünktlich zu des Königs Geburtstag – hatte er das Haus, in dem er bislang nur Mieter gewesen war, gekauft und seine Frau und die beiden Kinder endgültig vom Gut Wutike nach Berlin geholt. Es war auch höchste Zeit gewesen, denn Henriette war ihm immer fremder geworden, und die Kinder, Ferdinand und Luise, hatten ihn mehr als Onkel denn als Vater gesehen.
Mit sich und der Welt weithin zufrieden, schlenderte Gontard die Friedrichstraße hinauf und kam, nachdem er die Behrenstraße gekreuzt hatte, von der Friedrichin die Dorotheenstadt.
Die Dorotheenstraße, benannt nach der Kurfürstin Dorothea, reichte vom Kupfergraben bis zur Casernenstraße am Rande des Thiergartens. Gontard genoss es, in dieser Straße zu wohnen, in der sich ein ansehnliches Haus an das andere reihte, und erzählte Ortsfremden immer mit einem gewissen Stolz, welche Geistesgrößen hier in den letzten zwei Jahrzehnten Quartier genommen hatten. Zu ihnen gehörten der berühmte Arzt Christoph Wilhelm Hufeland und der Philosoph Arthur Schopenhauer, beide noch zu Zeiten hierher gezogen, da die Dorotheenstraße den Namen Letzte Straße getragen hatte, weil sie die letzte Straße in der Dorotheenstadt nach Norden hin war. Außerdem hatten hier der Apotheker und Chemiker Andreas Sigismund Marggraf gewohnt, dem Europa die Entdeckung des Zuckers in der Runkelrübe verdankte, und Enrique Gil y Carrasco, ein spanischer Schriftsteller, der mit Wilhelm und Alexander von Humboldt befreundet gewesen war und mit seinem romantischen Roman Der Herr von Bembibre einiges Aufsehen erregt hatte.
Vor seinem Haus angekommen, fand Gontard seine Tochter und seinen Sohn mit den Nachbarskindern in einen heftigen Streit verwickelt. Sie hatten sich darauf gefreut, die Schlacht von Waterloo nachzuspielen, aber nun wollte niemand der Napoleon sein.
»Soll ich Bonaparte sein?«, fragte Gontard.
»Nein, Papa!«, erregte sich sein Ferdinand. »Das geht doch nicht, du bist zu stark, dich kann keiner besiegen.«
Die Bewunderung, die sein 14-Jähriger ihm entgegenbrachte, freute ihn. Doch dann brach der Pädagoge in ihm durch, schließlich war er schon seit Jahren Lehrer an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule, und er erklärte den Kindern, dass sie es wie die Schauspieler sehen müssten. »Wer auf der Bühne einen Mörder spielt, kann doch im wirklichen Leben ein herzensguter Mensch sein, der keiner Fliege etwas zuleide tut, und wer im Königlichen Schauspielhaus den Napoleon gibt, der ist im wirklichen Leben vielleicht ein glühender preußischer Patriot. Und jeder gute Schauspieler reißt sich um die Rolle des Napoleon, weil es sich um einen interessanten Charakter handelt.«
Nun wollten auf einmal alle der Napoleon sein, und Henriette, die alles vom Fenster aus verfolgt hatte, klatschte Beifall. »Ich bewundere dich, Christian, wie du alle Probleme im Handumdrehen lösen kannst«, rief sie nach unten.
»Hm, ja …« Nun konnte er seine Autorität als Königlich Preußischer Oberst-Lieutenant nutzen und von sich aus den Napoleon bestimmen – oder aber die Kinder losen lassen. Aber eigentlich hätte er, der sich so sehnsüchtig ein Parlament nach amerikanischem Muster wünschte, alle des Längeren diskutieren und dann abstimmen lassen müssen. Dies alles zu bedenken erforderte einige Zeit. Zu viel Zeit, meinten seine Kinder und ihre Freunde.
»Papa, dann spielen wir lieber, wie Königin Luise stirbt!«, rief seine Tochter gleichen Namens, nun auch schon zwölf Jahre alt.
»Ja, eine wunderbare Idee!« Da sie das einzige Mädchen war, gab es bei diesem Spiel sicher keinen Streit um die Rollenverteilung. Um aber seine Tochter nicht leblos auf einem Katafalk, sprich ihrem Handwagen, liegen zu sehen, machte er, dass er ins Haus kam.
Gontard trat in den Flur und eilte in die erste Etage hinauf, wo ihn seine Frau erwartete. Dabei rief er: »O was macht doch mein Herz für einen Sprung, wenn ich dich nur sehe!« Das war eine Anspielung darauf, dass seine Henriette eine geborene von Herzsprung war.
»Herr Oberst-Lieutenant belieben zu schmeicheln.«
»Wenn, dann nur in der Absicht, Euch zu verführen, liebste Baroness.«
»Das wird Euch nicht leichtfallen …«
Doch Gontard gelang genau dies, ehe ihre Mamsell vom Einkaufen zurück war. Bis zum Mittagessen konnte er sich nun ein wenig erholen, danach hatte er zu seiner nachmittäglichen Lehrveranstaltung in den Hörsaal zu eilen. Die Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule war 1816 gegründet worden und hatte 1823 Unter den Linden No. 74, an der Ecke zur Wihelmstraße, ein repräsentatives Hauptgebäude bekommen. In einjährigen Kursen wurden hier die Lieutenants ausgebildet, die bereits auf einer Kriegsschule gewesen waren und danach zwei oder drei Jahre Dienst bei der Truppe geleistet hatten. Das Curriculum beinhaltete nicht nur die Fächer Artillerie- und Ingenieurwissenschaften, sondern auch Mathematik, Geographie, Geschichte, Deutsch und Französisch.
Was ihn an seiner Tätigkeit reizte, waren nicht nur der Umgang mit jungen Menschen und das Dozieren, sondern auch das tägliche Gespräch mit Kollegen, die aus zivilen Berufen kamen. So freute er sich, heute am Eingang der Schule Gotthilf Hagen zu treffen, einen geborenen Königsberger, der Dozent für Wasserbau war. Er war Mitglied der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und Ehrendoktor der Universität Bonn.
Gontard liebte es, den ernsthaften Hagen dadurch zu verwirren, dass er einen heiteren Ton anschlug. »Wissen Sie eigentlich, dass die Berliner schon 1448 eine große Tat der Wasserbaukunst vollbracht haben?«
Der Ingenieur überlegte. »Hier an der Spree hat es doch nie richtige Deiche gegeben, und an die wasserwirtschaftlichen Regulierungen im Oderbruch und im Rhinluch war 1448 noch lange nicht zu denken.«
»Nein, aber 1448 haben die Berliner einen Damm zur Spree durchstochen und die Baugrube des Schlosses unter Wasser gesetzt. Sie wollten keine Zwingburg der Hohenzollern an dieser Stelle.«
»Ja, der Berliner Unwille«, brummte Hagen. »Ich hoffe nur, dass die Berliner vierhundert Jahre später nicht wieder unwillig werden. Man hört da so einiges munkeln …«
Was dies betraf, hielt sich Gontard lieber bedeckt, und er brachte das Gespräch wieder auf Hagens Fachgebiet.
»Die Preußen beklagen schon lange, dass sie keinen Nordseehafen haben, und es heißt, sie wollen nun am Jadebusen ein Stück Land kaufen und dort einen errichten …«
»Das sind wohl alles nur Träume von Prinz Adalbert von Preußen. Aber wenn es tatsächlich so weit kommt, dann hoffe ich schon, dass man mich ruft, um diesen Hafen zu bauen«, erklärte Hagen.
Damit verabschiedeten sie sich voneinander, und Gontard machte sich auf den Weg zum Hörsaal. Beim laufenden Jahrgang hatte er vertretungsweise das Fach Kriegsgeschichte übernommen und dies auch nicht bereut, denn die Herren Lieutenants waren wesentlich aufmerksamer, wenn man über große Schlachten sprach und ihnen nicht die mathematischen Formeln zum Berechnen der Flugbahn von Granaten beizubringen versuchte.
»Kommen wir heute zur zwölften Schlacht des Siebenjährigen Krieges, nämlich zu der von Zorndorf, nordöstlich von Küstrin, am 25. August 1758. Bei Zorndorf gibt es eine teilweise sumpfige Niederung mit dem Galgen- und dem Zaberngrund, verschiedenen Tümpeln und kleinen Gehölzen, die eingebettet ist in eine weiträumige Heidelandschaft.« Gontard ging an die Tafel, skizzierte die Stellungen der Russen und der Preußen und erklärte den Schlachtverlauf. »Die Russen unter General Wilhelm von Fermor kommen von Küstrin her, das sie mit der Artillerie beschossen haben, und erwarten hier bei Zorndorf die Preußen unter Friedrich dem Großen. Der hat 36 800 Mann aufzubieten, die Russen 44 300. Bei Sommerhitze wird den ganzen Tag über erbittert gekämpft. Der preußischen Infanterie gelingt es nicht, eine Bresche in die gegnerischen Stellungen zu schlagen, und schließlich muss der linke preußische Flügel zurückweichen. Da passiert etwas höchst Beachtliches: Der König selbst steigt vom Pferd, ergreift die Fahne des Infanterieregiments No. 46, das General von Bülow befehligte, und bringt seine fliehenden Soldaten dazu weiterzukämpfen. Das nützt aber nichts, die Niederlage scheint sicher, zumal der Reitergeneral Friedrich Wilhelm von Seydlitz, der mit seinen fünfzig Schwadronen auf dem rechten Flügel steht, entgegen dem ausdrücklichen Befehl des Königs nicht eingreift. ›Er haftet mit Seinem Kopf für die Bataille!‹, ruft der König aus. Doch Seydlitz’ Erfahrung, seine Intuition und seine einzigartige Fähigkeit, eine Schlacht zu lesen, sagen ihm, dass der richtige Zeitpunkt für eine Kavallerieattacke noch nicht gekommen ist, und so wartet er ab. Erst als die Russen, die weit in die preußischen Stellungen eingedrungen sind, ihm den Rücken zuwenden, entscheidet er die Schlacht zugunsten Preußens mit einer fulminanten Kavalkade.«
Hurra-Rufe erklangen im Hörsaal, und nun wurde darüber diskutiert, ob es klug war, dass der König mit seinem Eingreifen sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte und ob sich Kaiser und Könige überhaupt mitten auf dem Schlachtfeld aufhalten sollten. Eine andere wichtige Frage war, ob man Seydlitz wegen Befehlsverweigerung vor das Kriegsgericht hätte stellen sollen oder er als der eigentliche Sieger von Zorndorf auf einen Denkmalssockel gehörte.
»Das ist ja das Thema von Kleists Prinz von Homburg!«, rief einer der Lieutenants.
Gontard nickte. »So ist es, nur mit dem Unterschied, dass Friedrich dem General Seydlitz noch auf dem Schlachtfeld dankte und nicht wie der Große Kurfürst das Kriegsgericht bemühte.«
Darüber wurde noch eine Weile diskutiert, dann war die Stunde zu Ende, und Gontard konnte sich wieder auf den Heimweg machen. So ließ sich das Leben genießen, sogar in dem großen Gefängnis namens Preußen. Gerade war er wieder auf die Straße Unter den Linden getreten, da lief er Julius Hitzig in die Arme.
Der stammte aus der Hofjudenfamilie Itzig, war aber 1799 zum Christentum konvertiert und hatte ein H vor seinen Namen setzen lassen. Hitzig betätigte sich als Jurist und Verleger. Er war 1815 Criminalrat in Berlin geworden, und 1827 hatte man ihn zum Director des Inquisitoriats sowie zum Mitglied im Criminal-Senat ernannt. Seit 1835 befand er sich allerdings im Ruhestand. Er hatte strafjuristische Fachzeitschriften begründet, war aber dem breiteren Publikum vor allem durch die Sammlung Der neue Pitaval bekannt geworden, die er zusammen mit Willibald Alexis herausgab und in der in regelmäßiger Folge Bände mit aufregenden Criminalfällen erschienen.
»Na, mein lieber von Gontard, von Ihnen war in letzter Zeit ja wenig zu hören. Haben Sie es aufgegeben, die Fälle unseres wackeren Criminal-Commissarius Werpel zu klären?«
»Mitnichten, aber seit dem Mamsellenmörder und dem Mord an Oberst-Lieutenant von Streyth hat es keine Fälle mehr gegeben, die mich hätten interessieren können. Und wenn Sie mich dazu animieren möchten, wieder einmal eine Tat aufzuklären, dann müssten Sie schon selbst den perfekten Mord begehen.«
Hitzig kam nicht umhin, Gontards besondere Leidenschaft von der moralischen Seite her zu betrachten.
»Sehnsüchtig auf den nächsten Mord zu warten erscheint mir doch ein wenig zweifelhaft.«
Gontard lachte. »Das Publikum will es so. Es liebt das Erschaudern, und jeder ist glücklich, dass es ihn nicht getroffen hat. Außerdem eint das Verbrechen die aufrechten Gemüter im Abscheu vor Tat und Täter und macht dem Volke, wenn der Täter erst einmal am Galgen hängt, klar, dass sich das Morden nicht lohnt.«
»Ach Gontard, jetzt weiß ich endlich, dass ich nicht vergebens gelebt haben werde!«, rief Hitzig, um sich dann zu verabschieden und seinen Weg in den Thiergarten fortzusetzen. »Also, hoffen wir auf den nächsten schönen Fall!«
Gontard liebte sein Zuhause, seine Frau und seine Kinder, doch den ganzen Tag dort zu verbringen langweilte ihn. So hatte er sich auch für den heutigen Abend mit Friedrich Kußmaul verabredet, um durch Berlin zu streifen und zu hören, was im Volke so geredet wurde. Sie hatten vereinbart, dass Gontard in die Ordination kommen sollte, da nie ganz genau vorherzusagen war, wann der letzte Patient gegangen war. Also machte sich Gontard auf zum sogenannten Löben’schen Haus, das an der Ecke Leipziger und Jerusalemer Straße gelegen war. Früher war hier das Hauptritterschaftskreditkollegium untergebracht gewesen, jetzt gab es in dem vierstöckigen Eckhaus Privatwohnungen, und Kußmaul hatte sich auf der ersten Etage seine Praxis eingerichtet.
Bei der letzten Volkszählung vom 3. Dezember 1846 hatten 408 502 Menschen ihren Wohnsitz in Berlin gehabt, und inzwischen mochten es noch ein paar mehr geworden sein, so dass Gontard eigentlich damit rechnen konnte, Unter den Linden, in der Friedrich oder der Mohrenstraße einen Verwandten oder einen lieben Freund zu treffen, doch der Zufall war heute gegen ihn. Dafür lief er auf dem Hausvogteiplatz Waldemar Werpel in die Arme.
Der Criminal-Commissarius gab sich übertrieben freundlich. »Nun, verehrter Herr Oberst-Lieutenant, wie ist das werte Wohlbefinden?«
»Danke für die Nachfrage, lieber Werpel. Ich möchte sagen, schlecht, denn schon allzu lange haben wir beide zusammen keine Bluttat mehr aufklären können.«
Werpel kniff die Augen zusammen. »Ich dachte, der Innenminister habe Ihnen das ausdrücklich untersagen lassen …«
Gontard lachte. »Nein, das hat Herr von Bodelschwingh nicht getan.« Am liebsten hätte Gontard hinzugefügt: Schließlich schätzt er mich als einen Liberalen und ist mit seinem König alles andere als d’accord. Aber das brauchte er Werpel nicht auf die Nase zu binden. »Ich hätte zu gern einmal gewusst, wer sich an den Minister gewandt hat. Haben Sie da einen Verdacht?«
Werpel drehte sich um. »Meine dienstlichen Pflichten gestatten mir leider keine längere Plauderei. Adieu, Herr Oberst-Lieutenant!«
Gontard sah dem Criminal-Commissarius schmunzelnd hinterher. Irgendwie tat er ihm leid. Zu oft hatte er ihm den Sieg beim Kampf gegen das Verbrechen weggeschnappt. Andererseits wäre Werpel sicherlich schon längst in die tiefste ostpreußische Provinz versetzt worden, wenn er nicht auch von Gontards Erfolgen profitiert hätte.
Nachdenklich, aber doch bestens gelaunt stieg er dann zu Kußmauls Praxis hinauf. Er freute sich schon darauf, im Wartezimmer in den ausgelegten Journalen zu blättern. Doch als er eingetreten war, erstarrte er. Denn wer dort saß und in der Vossischen Zeitung las, war keine andere als … Flora Morave. Bevor er Henriette kennengelernt hatte, hatte er viele Amouren mit Tänzerinnen und Schauspielerinnen gehabt, und Flora hatte zu seinen Favoritinnen gehört. Und er wäre jetzt auch nicht derart in Panik geraten, wenn zu dieser Zeit nicht gerade eine gewisse Lola Montez, auch eine Tänzerin, das gesamte bayerische Königreich durcheinandergewirbelt hätte. Die Dame hatte eine Affäre mit Ludwig I. und von diesem Verhältnis finanziell bereits erheblich profitiert. Er hoffte inständig, dass Flora ihn nach rund fünfzehn Jahren nicht wiedererkennen würde – oder nicht wiedererkennen wollte. Doch seine Hoffnung war vergebens.
In ihrem Gesicht arbeitete es einen Augenblick, dann lächelte sie, leicht maliziös, wie ihm schien, stand auf und streckte ihm ihre Hand entgegen. »Oh, que c’est beau de vous voir encore une fois, mon ami une fois tant aimé .”
Gott sei Dank hatte sie das auf Französisch gesagt, und die anderen im Wartezimmer Sitzenden verstanden es offenbar nicht. Nur der Junge, der neben ihr saß, grinste anzüglich.
»Auch für mich ist es ein Vergnügen, Ihnen, Mademoiselle Flora, in diesem Leben noch einmal zu begegnen.« Gontard küsste ihr die Hand.
Sie wies auf den grinsenden Jungen. »Darf ich vorstellen? Mein Sohn Jean-Paul.«
Gontard erschrak, denn er hatte schnell zurückgerechnet. O nein, diese Ähnlichkeit! Aber wenn Jean-Paul wirklich sein Sohn war, warum hatte sich Flora nie gemeldet? Und jetzt? War sie etwa aus Paris zurückgekommen, um ihn, wie die Berliner sagten, auszunehmen wie eine Weihnachtsgans? O Gott, der Skandal, wenn Henriette davon erfuhr! Und all die preußischen Beamten, die ihn wegen seiner liberalen Tendenzen schon lange im Visier hatten! Plötzlich hatte er eine Schreckensvision vor Augen: Flora wurde in Berlin ermordet – und für Werpel wie auch den Polizeipräsidenten von Minutoli gab es da nur einen möglichen Täter, nämlich ihn. Ihm wurde siedend heiß. Was tun? Fliehen oder standhalten?
Wer ihn rettete, war sein Freund, denn gerade in diesem kritischen Augenblick öffnete Kußmaul die Tür zum Sprechzimmer und erfreute die Wartenden mit der Aufforderung: »Der Nächste bitte!«
Da sprang Gontard vor, drängte einen Rentier zur Seite, presste die rechte Hand auf den Unterbauch und stöhnte: »Herr Doktor, mein Blinddarm! Ich sterbe!«
Dr. Kußmaul ahnte natürlich nichts von den Zusammenhängen, begriff aber sofort, dass Gontard in Not war, und ließ ihn an sich vorbei ins Behandlungszimmer schlüpfen, wo er dann auch über alles aufgeklärt wurde.
»Was nun, Fritz?«, fragte Gontard, nachdem er seinem Freund die Geschichte erzählt hatte.
Der Arzt musste nicht lange überlegen. »Ich lasse dich jetzt durch die Hintertür entkommen, und du gehst rauf zu meiner Frau und lässt dir einen Baldriantee aufbrühen.«
Der tat dann auch bald seine Wirkung, aber noch mehr half Gontard der Trost, den ihm Luise Kußmaul zuteilwerden ließ. »Deine Henriette hat ein großes Herz, und sie wird es hinnehmen, dass du noch ein drittes Kind gezeugt haben könntest – es war ja alles vor ihrer Zeit.«
»Aber was ist, wenn Flora Geld von mir haben will, viel Geld, und damit droht, sonst einen Riesenskandal zu entfesseln?«
»Dann hast du uns an deiner Seite, und du kennst selbst eine Menge einflussreicher Leute. Was soll da schon passieren?«
Gontard war verzweifelt. »Falls sie umgebracht wird, werde ich als ihr Mörder verdächtigt werden.«
Luise Kußmaul sah ihn verständnislos an. »Warum sollte sie denn umgebracht werden?«
»Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl …«
Und von diesem Gefühl kam er auch am Abend nicht los, als er mit Kußmaul durch Berlin streifte, um herauszufinden, ob es irgendwo Anzeichen für ein bevorstehendes politisches Erdbeben gab. In Mailand, Palermo, Neapel und Padua hatte es schon Unruhen gegeben. Breitete sich die Revolte von dort nach Norden aus? Wurde München, wo Lola Montez weiter für Aufregung sorgte, als erste deutsche Stadt erfasst? Dies alles fragten sich die Berliner, insbesondere die Intellektuellen, die im Roten Salon des Lesecafés Stehely oder im Lese-Cabinet der Berliner Zeitungs-Halle am Gensdarmen-Markt beisammensaßen und diskutierten. Zeitungen mussten in Preußen von der Zensur genehmigt werden, aber viele ausländische Blätter wurden im Reisegepäck nach Berlin geschmuggelt. Besonders begehrt waren die aus der Schweiz, wo das liberale Bürgertum gerade einen grandiosen Sieg errungen hatte. Wer eine der raren Zeitungen aus Zürich oder Bern ergattert hatte, stellte sich oft auf einen Stuhl und las den anderen laut daraus vor. Diesmal erlebten Gontard und Kußmaul den Tierarzt Friedrich Ludwig Urban in dieser Rolle. Es hieß, Urban sei prädestiniert dafür, das Volk anzuführen, wenn es in Berlin zu einer Revolution kommen sollte.
»Gott«, murmelte Gontard, »einen preußischen Danton oder Robbespierre hätte ich mir anders vorgestellt. Dieser Urban ist doch nur eitel und geltungssüchtig und viel zu romantisch und gefühlsselig, als dass er die Massen mitreißen könnte.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, widersprach Kußmaul ihm.
Wesentlich besser gefiel Gontard später der Kellerhalsredner Heinrich Carrenzien, den sie in der Weinmeisterstraße erlebten. Kellerhalsredner hießen Leute wie er bei den Berlinern, weil sie auf den niedrigen, überdachten Treppen standen, die in die Kellerlokale führten, und von dort aus zu den anwesenden Gästen sprachen.
»Ihr Männer alle«, rief er mit Stentorstimme, »erhebt euch, um für das zu kämpfen, was für euch am wichtigsten ist: das Recht auf Arbeit! Fordert die Einrichtung von Nationalwerkstätten, wo man euch mit gemeinnützigen Arbeiten beschäftigt und gut entlohnt. Das sichert euer Überleben und den allgemeinen Wohlstand.«
»Dann soll der Carrenzien mal den Karren ziehn«, reimte Kußmaul. »Und zwar aus dem Dreck.«
Sie hätten ihm gern noch länger zugehört, doch hinter ihnen gab es einen kleinen Auflauf. Zwei Männer waren in eine heftige Schlägerei geraten. Offenbar ging es um ein auffallend schönes Mädchen. Wie Gontard und Kußmaul den Zurufen der Umstehenden entnehmen konnten, handelte es sich bei den Herren um den Arbeitsmann Ferdinand Dünnebier und den Tischlergesellen Gottlieb Letschinski und bei der Dame um eine gewisse Auguste Gärtner, offenbar eine Dienstmagd. Jeder drohte dem anderen, ihn auf der Stelle umzubringen.
»Dir is wohl schon lange keen blutijet Ooge übers Chemisett jekullert!«
»Dir hau ick uff ’n Kopp, dette in keen Sarg mehr passt!«
»Een Schlag, und deine Neese sitzt hinten!«
»Ick schmeiß dir an de Wand, dette kleben bleibst und der Criminal-Commissarius dir abkratzen muss!«
Kußmaul wandte sich an Gontard. »Da scheint es endlich mal einen Fall für dich zu geben.«
Gontard wehrte ab. »Nicht doch, du beleidigst mich. Wer da der Täter ist, findet sogar Werpel auf Anhieb heraus, das ist weit unter meinem Niveau.«