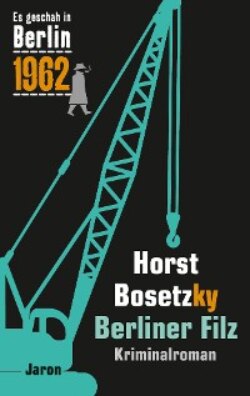Читать книгу Berliner Filz - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 6
EINS
ОглавлениеER ZIELTE LANGE und sorgfältig. Nicht auf eine normale Scheibe, wie man sie bei Wettbewerben mit der Luftdruckpistole benutzte, sondern auf ein selbstgebasteltes Ziel, das dem menschlichen Körper nachempfunden war. Der erste Schuss musste sitzen. Mitten ins Herz hinein. Auf seiner Abschussliste standen einige Namen – die von Männern, die ihm gefährlich werden konnten.
Otto Kappe hatte schon seit Jahren Hobbys, wie man Freizeitbeschäftigungen neuerdings nannte, das Kegeln und den Faustball. Der Donnerstagabend war für den Kegelsport reserviert. Gertrud erinnerte ihn beim Abendbrot daran.
«Iss nicht so viel, sonst kommt dir nachher alles wieder hoch, und eure Bahn muss extra wegen dir gesäubert werden!»
«Dann darfst du mir nicht so viel Schokolade zum Naschen aus der Firma mitbringen.» Gertrud arbeitete schon seit Jahren als Kontokorrentbuchhalterin bei Sarotti in Tempelhof.
«Warum gehst du nicht zum Bowling, wo du doch so gerne Bowle trinkst?», fragte sie.
Otto Kappe seufzte. «Weil wir bei uns im Vereinslokal nur eine Bohlebahn haben.»
«Na, dann mal los auf die vorderen Damen!» Gertruds Chef war auch Kegler und hatte ihr den sogenannten Kegelstand aufgezeichnet. Hatte man die Raute mit den neun Kegeln vor Augen, dann war der erste Kegel das Vorderholz und der letzte das Hinterholz. Die Kegel zwei und drei waren die vorderen Damen und die Kegel sieben und neun die hinteren Damen. Zwischen ihnen stand der König, und die Kegel ganz außen waren die Bauern.
Otto stand auf und küsste seine Frau. «Du bist und bleibst für mich immer die vorderste Dame!»
Pünktlich um halb acht traf man sich in einem Lokal in der Bismarckstraße. Nach kurzer Begrüßung ging es hinunter in den Keller, wo die Kegelbahn aufgebaut war. Noch immer gab es keine automatische Kegelaufstellanlage. Die war dem Wirt zu teuer. Lieber bezahlte er weiterhin einen Kegeljungen. Peter Kappe, Ottos Sohn, hatte sich auf diese Weise sein erstes Taschengeld verdient.
Los ging es. Man spielte in die Vollen, das heißt, es gab kein Abräumen, sondern es wurden alle Kegel, die ein Spieler beim ersten Wurf getroffen hatte, für den nächsten Versuch wieder aufgestellt. Jubel brandete immer dann auf, wenn «Alle Neune!» geschrien wurde oder aber – falls die Kugel in der sogenannten Fehlwurfrinne landete –«Wieder eine Ratte!».
Heute Abend hieß der Rattenkönig Otto Kappe. Er hatte zu oft zu viel riskiert. Wollte man nämlich alle neun Kegel beim ersten Wurf umwerfen, musste man die Kugel mit Drall und schräg oben ankommen lassen, und das ging manchmal schief, obwohl die Bahn gekehlt war. Von der Aufsatzstelle der Kugel bis zum Vorderholz waren es immerhin über zwanzig Meter. Otto Kappe nahm den Titel des Rattenkönigs gelassen hin, obwohl alle spotteten, dass er auf dem Schießstand der Polizei das Zielen doch eigentlich hätte gelernt haben müssen.
Nach Hause ging er zusammen mit Herrn Dr.-Ing. Eduard Dankert. Der kam natürlich sofort auf seinen Beruf zu sprechen. «Na, wieder ’n Mörder zur Strecke gebracht, Herr Kommissar?»
Otto Kappe lachte. «Nein. Wo kein Ermordeter ist, kann es auch keinen Mörder geben.»
«Gestern hätte ich fast gedacht, wir haben was für dich», sagte Eddie, der zurzeit mithalf, die Stadtautobahn Richtung Norden zu verlängern. «Bei der Ausfahrt Spandauer Damm meinten wir, wir hätten einen Toten gefunden, doch es war nur eine alte Schaufensterpuppe, die jemand auf die Baustelle geworfen hatte. Aber ich habe neulich einen amerikanischen Krimi gelesen, darin lässt der Boss einen Arbeiter, der seine krummen Machenschaften anzeigen will, erschießen und im Fundament eines Hauses einbetonieren. Derlei könnte hier auch mal passieren, so mafiös, wie es in der Baubranche zugeht.»
«Danke für die Warnung!»
Im Jahre eins n. M., das heißt nach dem Mauerbau, hatten es viele West-Berliner noch schwer, sich mit der neuen Situation abzufinden. Wohin man auch fuhr oder ging, früher oder später stieß man auf die «Schandmauer» oder zumindest auf einen schwerbewachten Grenzzaun mit Todesstreifen und Beobachtungsturm.
Froh über den Mauerbau waren aber etliche «Republikflüchtlinge», denn nun war klar, dass der Ostblock es aufgegeben hatte, West-Berlin zu schlucken oder, wie das Chruschtschow-Ultimatum von 1958 hatte befürchten lassen, zur «politisch selbständigen Einheit WB» zu machen. Hatten die Ex-DDR-Bürger vordem noch die Einnahme West-Berlins durch die Nationale Volksarmee gewärtigen müssen und sich selbst schon in Bautzen gesehen, so durften sie nun aufatmen. So auch Lothar Laukisch.
Ein Journalist des Telegraf hatte jetzt schon zwei Stunden lang mit Laukisch geredet und seinen Notizblock vollgeschrieben. «Ich fasse noch einmal zusammen … Sie sind am 27. April 1929 in Berlin-Lichtenberg als Lothar Tandler auf die Welt gekommen und haben in der Sowjetischen Besatzungszone und später der DDR als Journalist für verschiedene Blätter und das Fernsehen gearbeitet. Sie betätigten sich aber nicht nur offiziell für die Wochenpost und die Adlershofer, sondern auch im Geheimen für den UFJ, den Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen, und den Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS. Die Stasi ist dahintergekommen, und Sie haben eine schreckliche Zeit in Bautzen verbracht. Nachdem Sie entlassen wurden, gingen Sie nach West-Berlin, dort heirateten Sie 1956 die Blumenhändlerin Uta Laukisch und nahmen deren Nachnamen an, um Bautzen und die DDR zu vergessen. Dann hat sich Ihre Frau von Ihnen getrennt, und Sie erkrankten …»
Laukisch nickte. «Das stimmt alles.» Als Uta sich von ihm getrennt hatte, weil es mit ihm nicht mehr auszuhalten war und er immer neue psychotische Schübe bekam, wurde er im September 1961 in die Karl-Bonhoeffer-Heilstätten eingeliefert. Er hörte Stimmen, die ihm sagten, er solle alle Menschen umbringen, denn alle Menschen sind schlecht, alle Menschen sind Verbrecher und müssen ausgerottet werden – durch dich!
«Im Februar 1962 wurden Sie entlassen, inzwischen leben sie als Sportjournalist in der Boppstraße nahe dem Kottbusser Damm.»
«Genau so ist es, am sogenannten Zickenplatz.» Er kam aber nicht von seiner geschiedenen Frau los. Die wohnte jetzt bei ihrem neuen Lebensgefährten in Hermsdorf, in der Frohnauer Straße. Oft strich er dort herum.
«Sie sollen im Jahre 1956 auf einen Mann geschossen haben, den Sie für einen Stasi-Mitarbeiter hielten», fuhr der Mann vom Telegraf fort. «Das Verfahren ist aber eingestellt worden.»
«In der Tat.» Das war lange her, und Lothar Laukisch sprach nicht gern darüber, auch musste er dem Zeitungsmann nicht unbedingt auf die Nase binden, dass er ständig eine alte Wehrmachtspistole bei sich trug, eine Mauser C96, denn auf seiner Abschussliste standen etliche Namen. Konrad Habedank hatte er ganz besonders auf dem Kieker. Immer wieder gingen seine Gedanken in die Jahre 1954 und 1961 zurück …
Wer 1954 durch die Fruchtstraße, die spätere Straße der Pariser Kommune, ging, sah, dass der Krieg von deren Häusern nicht viel übrig gelassen hatte. Die Fruchtstraße nahm ihren Anfang am Ufer der Spree, unterquerte am Ostbahnhof die Gleise der Stadtbahn und lief über die Stalinallee hinweg zum Friedhof der Parochial- und St.-Petri-Gemeinde hinauf, wo sie in die Friedenstraße überging. Die Trümmer waren weithin abgeräumt worden, und in Bälde würden hier DDR-typische Plattenbauten emporwachsen. Am Franz-Mehring-Platz, wo früher im Gebäude eines alten Bahnhofs das «Varieté Plaza» Tausende angelockt hatte, sollte einmal das Neue Deutschland, die größte Tageszeitung der DDR, ihren Sitz haben. Nur vor der Kreuzung mit der Stalinallee waren einige Altbauten stehen geblieben, und in einem dieser Häuser wohnte Lothar Laukisch mit seiner Freundin Gisela, die bei der HO eine Filiale für Industriewaren leitete und SED-Mitglied war.
Natürlich hörte er beim Frühstück den RIAS. Schon deshalb, um mitzubekommen, was er selbst dem Sender aus den einzelnen Bezirken Ost-Berlins zugetragen hatte. Zumeist ging es um Versorgungsengpässe und die Festnahme von Regimegegnern.
«Muss das schon wieder sein!», rief Gisela, als sie in die Küche kam, und drehte so lange an der Skala, bis sie einen DDR-Sender gefunden hatte.
Er wählte seine übliche Verteidigungsstrategie. «Ich muss doch wissen, was der Klassenfeind über uns denkt!»
Sie tippte sich gegen die Stirn. «Ja, denkste!»
Noch war ihre Liebe stärker als die ideologischen Gegensätze. Er wäre am liebsten in den Westen gegangen, sie wollte am Aufbau des Sozialismus teilhaben und träumte von einem Sitz in der Volkskammer.
«Fährst du heute wieder zum Recherchieren nach West-Berlin rüber?», fragte sie. Das klang harmlos, aber sie ahnte schon lange, dass er sich nicht mit einem alten Schulfreund traf, um den über Skandale beim Senat auszuhorchen, sondern mit einem Mann vom Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen.
«Ja, ich wollte mit Peter essen gehen.» Der war Senatsrat beim Innensenator am Fehrbelliner Platz.
Sie lachte. «Na, solange der Peter keine Petra ist – oder der Heinz Petruo.» Das war ein Sprecher beim RIAS.
Nun wurde ihm der Boden langsam doch zu heiß. «Du, ich muss los!»
Von der Fruchtstraße aus war seine Arbeitsstelle in Adlershof auch ohne Wartburg leicht zu erreichen: Er brauchte nur zum Ostbahnhof zu laufen und sich in die S-Bahn zu setzen. Im Juni 1950 hatten sie in Adlershof mit dem Bau des Fernsehzentrums Berlin begonnen, und am 21. Dezember 1952, dem 74. Geburtstag Stalins, war das «öffentliche Versuchsprogramm» des Deutschen Fernsehfunks (DFF) mit zwei Stunden Sendezeit täglich gestartet worden. Zwei Jahre später war Lothar Laukisch zur Nachrichtenredaktion gekommen.
Da er Englisch, Französisch und Spanisch sprach, gehörte es zu seinen Aufgaben, die Presse der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Spaniens und verschiedener kleinerer Staaten hinsichtlich ihrer Berichterstattung über die DDR auszuwerten.
Daneben blieb ihm genügend Zeit, sich umzusehen und umzuhören. Als er ein Papier über die Einführung einer einjährigen Arbeitsdienstpflicht für Studienbewerber aus dem Funkhaus schmuggeln wollte, erwischte ihn ein Kollege, der Zuträger der Stasi war. Damit nahm das Drama seinen Lauf. Erst kam er in das Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit in Hohenschönhausen, dann, nach seiner Verurteilung zu achtzehn Monaten Haft, nach Bautzen.
Nachts brachten sie ihn in einem verschlossenen Kleintransporter in die Oberlausitz.
«Tandler, Sie haben Ihren Namen ab heute zu vergessen! Sie sind 44/57, basta! Über sich und Ihr Urteil dürfen Sie mit keinem anderen sprechen, klar?»
«Ja.»
Tag für Tag Gitterstäbe vor den bis auf einen kleinen Schlitz zugemauerten Fenstern, Stacheldraht und stählerne Türen. In der Zelle eine Holzpritsche mit einer dünnen Decke. Täglich musste er Demütigungen ertragen. Das Essen, dieser Fraß, war eine zusätzliche Strafe. Zum klitschigen Graubrot gab es ein paar Gramm Margarine, dazu jeden zweiten Tag eine Scheibe Leber- oder Blutwurst, immer von der gleichen Sorte. Die Suppe war besseres Abwaschwasser.
«44/57, singen Sie die Nationalhymne!»
«Jawoll, Genosse Wachtmeister!» Dass der Mann, der ihn ständig quälte, Konrad Habedank hieß, hatte er schon herausbekommen. Zu recherchieren war schließlich sein Beruf. Nach einer kleinen Pause begann er zu singen: «Einigkeit und Recht und Freiheit / für das deutsche Vaterland! / Danach lasst uns alle streben / brüderlich mit Herz und Hand!»
«Unsere Hymne, Mensch!»
«Das ist doch unsere …»
Daraufhin wanderte er in eine besondere Zelle für den verschärften Arrest, die nicht beheizbar war. An der Decke baumelte eine nackte Vierzig-Watt-Glühlampe, die aber nur alle halbe Stunde kurz eingeschaltet wurde – wenn die Aufseher durch den Spion in die Zelle sahen. Einen Monat lang blieb er dort.
Obwohl die schreckliche Zeit in Bautzen bereits Jahre zurücklag und er längst im Westen lebte, wurde Lothar Laukisch 1961 in die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik eingeliefert, in «Bonnies Ranch», wie sie im Berliner Volksmund hieß. Er war ein gebrochener und schwer traumatisierter Mann.
«Sie waren bei der Wehrmacht, Herr Schultz?», fragte er einen Mitinsassen.
«Ja, als General.»
«Gestern erzählten Sie, Sie seien nur Gefreiter gewesen.»
Sein Zimmernachbar war mit der ungewissen Diagnose Schizophrenie eingeliefert worden und hörte, obwohl im Raum absolute Stille herrschte, ein pausenloses Flüstern, Sprechen, Wehen, Rasseln und Läuten, schließlich auch ein Donnern und Schießen. «Das kommt alles aus der Hölle», versicherte er den Ärzten.
Im Nebenzimmer litt ein Mann unter der Krankheit, die von den Psychiatern Katalepsie genannt wurde. Eine Stunde lang stand er jeden Tag auf den Zehenspitzen des rechten Fußes am Fenster und hielt das andere Bein wie ein Hürdenläufer mit der Hand waagerecht in die Höhe.
«Ich will raus hier!», schrie Lothar Laukisch nach einiger Zeit. «Sonst werde ich noch völlig verrückt!»
Aber man ließ ihn noch lange nicht gehen.
Hermsdorf war ein Ortsteil des West-Berliner Bezirks Reinickendorf und zählte im Jahre nach dem Mauerbau über 15 000 Einwohner. Seine wichtigsten Straßen waren im Westen der Hermsdorfer Damm, der es mit Tegel verband, der Falkentaler Steig, über den man ins Dominikus-Krankenhaus gelangte, die Burgfrauenstraße und die Heinsestraße mit Einkaufszentrum und S-Bahnhof. Ebenso wie durch die S-Bahn-Trasse wurde Hermsdorf vom Tegeler Fließ durchschnitten, das sich hier zu einem kleinen See ausweitete. Hermsdorf hatte eine weit zurückreichende Geschichte. Ende des elften Jahrhunderts war es als slawische Siedlung entstanden, später von den Deutschen übernommen und erstmals 1349 als Hermanstorp urkundlich erwähnt worden. Max Beckmann und Erich Kästner hatten in Hermsdorf gelebt.
Und nun, 1962, wohnte hier offenbar auch der Bauunternehmer Konrad Habedank, wie Lothar Laukisch einem Artikel des Tagesspiegel entnommen hatte. Das war der Anstoß für Laukisch gewesen. Seitdem streifte er durch Hermsdorf, um die Adresse Habedanks herauszufinden. Er wollte ihn niederschießen, aus Rache für das, was der ihm in Bautzen angetan hatte. Die Rache ist mein; ich will vergelten.
Irgendwo hier musste das Schwein doch wohnen, verdammt noch mal! Laukisch war nicht mit der S-Bahn gekommen, denn die war nach dem Boykottaufruf vom August 1961 noch immer ziemlich leer. Deshalb hatte er Angst gehabt aufzufallen und war mit dem 25er Bus aus Tegel gefahren. An der Kreuzung Falkentaler Steig, Hermsdorfer Damm und Heinsestraße war er ausgestiegen, und nun durchkämmte er vom Bahnhofsvorplatz aus systematisch das Schachbrettmuster der in Richtung Südwest abgehenden Straßen: der Fellbacher Straße, bis vor Kurzem noch Kaiserstraße genannt, der Heidenheimer, der Schramberger, der Backnanger Straße und wie sie alle hießen. Meist gaben ihm die Namensschilder Auskunft, die neben den Klingelknöpfen angebracht waren, manchmal erfuhr er auch nur die Initialen der Mieter und Hausbesitzer. Nach Konrad Habedank zu fragen, wagte er nicht. Nur keine Spuren hinterlassen! Dass Habedank in dieser Gegend von Hermsdorf wohnte, wusste er, seit er einmal in einer Taxe einem von Habedanks Firmenwagen gefolgt war. Leider hatte er den wegen einer roten Ampel aus den Augen verloren. Heute aber musste es klappen!