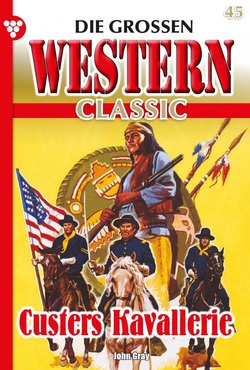Читать книгу Die großen Western Classic 45 – Western - Howard Duff - Страница 3
Оглавление»Glaubst du, dass sie uns aufhängen werden?«, fragte Pitter. »Sie peitschen uns die Haut von den Knochen«, sagte Hammon.
»O nein.« Pitter strich sich über die stoppelbärtigen Wangen. Seine Hände zitterten. »Nicht auspeitschen – ich habe noch nie Schmerzen aushalten können.«
»Vielleicht hängen sie uns auch auf«, sagte Hammon. »Ich habe gehört, dass Custer früher schon Deserteure erschossen hat.«
»Erschießen ist besser als hängen«, sagte Pitter. »Mich kriegen sie nicht«, sagte Hammon und reckte den Kopf. Unvermittelt sprang er auf.
»Warte auf mich!« Pitter folgte ihm.
Sie liefen geduckt, im Schutz von dichtem Weidengehölz, zum Fluss hinunter. Das Abendrot spiegelte sich im Missouri. Eine Reihe von Frachtsteamern dampfte den Strom hinunter. Rechts und links vom Bug glühten die Feuerkörbe. Die heiseren Rufe der Lotsen hallten durch den Abend.
Donnernder Hufschlag. Pitter schrie: »Sie sind schon da! Sie kriegen uns!«
Hammon drehte sich abrupt um und stürmte auf ein dichtes Gehölz zu. Pitter stolperte und stürzte der Länge nach hin. Seine Hose zerriss über den Knien. Er stemmte sich hoch und tastete nach seinem Revolver im Gürtel. Da sah er die Reiter, die am Fluss entlangjagten…
Sie trugen blaue Uniformen. Voraus ritt ein lederhäutiger, sehniger Sergeant.
Als Pitter sich umdrehte, bemerkte er einen zweiten Trupp, der den Fluss noch nicht erreicht hatte.
Pitter rannte. Er war jung, noch keine zwanzig. In diesem Moment fragte er sich, wieso er in die Armee geraten war, noch dazu in das 7. Regiment, diesen rauen, bösen Haufen.
Die blaue Uniformbluse war plötzlich schwer wie ein Kettenhemd. Die Angst schnürte Pitter die Kehle zu. Er hielt seinen Revolver in der Faust, aber wagte nicht, stehenzubleiben und ihn zu benutzen.
Hammon hatte das Waldstück erreicht. Pitters Füße wurden immer schwerer. Er konnte kaum noch atmen.
Hammon kauerte am Waldrand und winkte ihm zu.
Pitter taumelte zwischen den Bäumen hindurch, ging in die Knie und keuchte: »Ich kann nicht mehr!«
»Du kannst«, sagte Hammon. »Du brauchst bloß an den Galgen zu denken.«
»Wir hätten nie fortlaufen dürfen«, sagte Pitter.
»Du Scheißer!« Hammon packte Pitter am Kragen der Uniformbluse, riss ihn auf die Beine und schüttelte ihn hin und her. »Wer hat mir Tag und Nacht die Ohren vollgejammert, dass er es nicht mehr aushält? Den Drill, den schlechten Fraß, die verlausten Quartiere, dieses ganze verfluchte Leben in der Armee? Ich wäre auch allein abgehauen. Du wolltest, dass ich dich mitnehme. Jetzt habe ich dich wie ein Klotz am Hals.«
»Dann lass mich doch liegen!« Pitters Stimme schnappte fast über. Hammon klatschte ihm die rechte Handfläche auf den Mund und presste seine Kiefer mit der Wucht eines Schraubstocks zusammen, dass Pitter fast die Augen aus dem Kopf quollen.
»Damit die Patrouillen dich finden und du sie auf meine Spur bringst, Wil?«
»Das würde ich niemals tun, niemals, ich würde …«
»Die brauchen dir nur ein Bajonett auf den Bauchnabel zu setzen, dann singst du wie eine Zikade. Du reißt dich jetzt zusammen und rennst, bis du die Lunge ausspuckst!«
»Die kriegen uns sowieso«, sagte Pitter. »Vermutlich sind noch mehr Patrouillen unterwegs.«
»Du wirst tun, was ich dir sage!« Hammon ließ Pitter los. Er spähte in den Abend. Die Patrouillen hatten sich am Fluss getroffen. Der sehnige Sergeant und ein drahtiger Corporal sprachen miteinander. Sie beratschlagten. Der Sergeant hob den rechten Arm und deutete auf das Waldstück.
»Los jetzt!« Hammon packte Pitter am Arm und zerrte ihn mit. Sie rannten durch das Unterholz. Die Düsternis umgab sie wie ein Netz. Sie stolperten und strauchelten. Tiefhängende Zweige streiften sie oder klatschten ihnen ins Gesicht.
Pitter wimmerte leise, während er vorwärtstaumelte. Hammon beachtete ihn nicht.
Der Wald lichtete sich vor ihnen. Sie hielten an und hockten sich hinter dorniges Strauchwerk.
»Jede Woche laufen Soldaten weg«, sagte Hammon. Er beobachtete das hügelige Grasland seitlich des Flusses. »Custer hat anderes zu tun, als ganze Kompanien abzukommandieren, die Deserteure jagen. Die Patrouillen kehren nach kurzer Zeit um, das garantiere ich dir.«
»Vielleicht aber auch nicht.«
»Custer hat etwas Großes vor«, sagte Hammon. »Hast du nicht die vielen Kuriere gesehen, die in den letzten Tagen hin und her geritten sind? Er hat Scouts nach Westen geschickt. Ich sage dir, es steht ein Feldzug bevor. Er kann es sich gar nicht leisten, hinter ein paar Deserteuren herzujagen.«
»Es kann aber auch bedeuten, dass er jeden Mann braucht.«
»Uns nicht.« Hammon starrte Pitter an. »Mein Gott, wie bist du bloß in die siebte Kavallerie geraten?«
»Wir hatten eine Farm in Illinois. Wenn meinem Vater etwas nicht passte, hat er uns grün und blau geprügelt. Er hatte jeden Tag Grund dazu. Meinen jüngeren Bruder hat er fast zum Krüppel geschlagen. Ich hatte irgendwann die Nase voll und bin abgehauen. In einem Saloon in St. Louis hat mich ein Mann beschwatzt und zu einem Armeebüro geschleppt.«
»Hast du dein Handgeld empfangen?«
»Ich habe keinen Cent erhalten.«
»Dann hat der Kerl dein Handgeld eingesteckt. Wer weiß, wie oft er das noch angestellt hat. Ein gutes Geschäft.« Hammon schüttelte den Kopf. »Du bist dein Leben lang bloß weggelaufen, Pitter. Erst vor deinem Alten, jetzt vor Custer. Und so einen Grünschnabel muss ich mir an den Rockzipfel hängen.«
»So kannst du nicht mit mir reden«, sagte Pitter weinerlich. »Du bist auch desertiert.«
»Ich hatte nie vor, bei der Armee alt zu werden«, sagte Hammon. »Ich brauchte einen Platz, um unterzutauchen. Die Armee ist das beste Versteck, das es für einen Mann gibt, der gesucht wird. Alle tragen die gleiche Uniform, alle sehen gleich aus. Niemand fragt nach dem richtigen Namen. Man hat seine Unterkunft, sein Essen, und man wird viel herumgeschickt, sodass die Spur sich verliert.«
»Du bist gesucht worden?«
»In Texas«, sagte Hammon ungerührt. Er blickte Pitter dabei fest in die Augen. »Wegen Mordes.« Um seine Mundwinkel zuckte es. »Das war vor einem Jahr. Ich wäre vielleicht noch ein bisschen länger bei der Armee geblieben, wenn ich nicht so ein dumpfes Gefühl hätte, dass es gesünder wäre, sich jetzt einen anderen Platz zu suchen. Ich sagte doch: Custer hat etwas vor. Ich habe aber nicht die Absicht, ein Held zu werden. Ich habe Custer in den letzten Monaten beobachtet. Der Mann ist gefährlich. Nicht nur für die Rothäute, auch für sich selbst und für sein Regiment. Als es vor ein paar Wochen so aussah, als würde Washington ihn aus dem Verkehr ziehen, dachte ich, es sei doch ganz vernünftig, noch eine Weile zu bleiben. Aber seit er wieder da ist, wird mir der Boden unter den Füßen zu heiß.«
»Du bist – wirklich – ein – Mörder?«
»Hast du noch nie jemanden umgelegt?«
»Nein.«
»Es ist gar nicht so schwer«, sagte Hammon. »Es war nicht der erste Mann, aber der falsche. Wir hatten zusammen gepokert, und er hatte mich betrogen. Er hat sogar zuerst zum Revolver gegriffen. Mein Pech war, dass er Steuereinnehmer der Militärregierung war. Der Bürgerkrieg ist zehn Jahre vorbei, und die Sitten haben sich etwas gelockert. Aber die kleinen Militärkommandanten in den Counties spielen noch immer eine große Rolle, und ein Steuereinnehmer ist ein wichtiger Mann …«
Pitter zog ein Gesicht, als müsse er sich gleich übergeben.
Hammon grinste ihn an: »Du weißt wohl nicht mehr, für was du dich entscheiden sollst: Entweder Custers Patrouillen schnappen dich, oder ich bringe dich um.«
Pitter schwieg. Hammon wandte sich nach vorn. Unvermittelt waren die Reiter da. Sie lenkten ihre Pferde vom Fluss hoch. Das breite Band des Missouri glitzerte im Abglanz des vergehenden Tages wie Kupfer.
»Sie haben uns gefunden!« Pitter warf sich herum. Hammon stieß einen Fluch aus und schlug zu. Seine Faust streifte Pitter am Kopf. Pitter stürzte. Hammon richtete sich auf und hastete durch das Waldstück auf den Fluss zu. Hinter ihm drangen die Soldaten ins Unterholz ein. Hammon riss sich seine Uniformbluse vom Leib und stürmte in das Uferwasser. Unter seinen Stiefeln spritzte es hoch auf. Er rutschte auf dem schlammigen Grund aus, riss die Arme hoch und stürzte der Länge nach hin. Er versank in den schmutzigen Fluten des Missouri und richtete sich prustend wieder auf. Er zog seinen Revolver.
Hinter ihm sprengten die Jäger heran. Die Hufe ihrer Pferde schleuderten das Wasser gischtend in die Höhe. Der Sergeant beugte sich weit aus dem Sattel und schwenkte seinen Sharps-Karabiner wie eine Keule.
»Du Schwein!«, schrie Hammon.
Er drückte ab. Der Hahn seines Revolvers klickte auf eine Kammer. Hammon fluchte laut. Er drückte wieder ab und noch einmal – die Ladungen waren feucht geworden. Es löste sich kein Schuss.
Der Schlag mit dem Gewehrkolben traf ihn voll gegen die Brust und warf ihn rücklings ins Wasser. Der Schmerz, der ihn durchflutete, war so stark, dass sein Bewusstsein schwand. Als das kühle Wasser über ihm zusammenschlug, war er wieder klar, aber die Schmerzen lähmten ihn, sodass es ihm kaum gelang, sich wieder aufzurichten. Wasser drang durch Mund und Nase ein. Er schluckte eine Menge davon, verlor seinen Revolver und schlug mit beiden Armen wild um sich, um an die Oberfläche zu gelangen.
Er sank nach vorn auf die Knie. Das Wasser reichte ihm jetzt bis zur Brust. Hammon krümmte sich zusammen und übergab sich. Er rang nach Luft. Halbblind, da ihm das nasse Haar strähnig ins Gesicht fiel, bemerkte er zwei Reiter, die ihre Pferde durch das Uferwasser auf ihn zutrieben.
Unfähig sich zu rühren, kauerte er da und wurde brutal gepackt. Er hörte das Johlen und Brüllen der Soldaten, die ihn hochrissen und wieder ins Wasser schleuderten. Er ging unter. Nackte Verzweiflung erfasste ihn. Von panischer Angst erfüllt, kämpfte er sich wieder hoch. Ein Stiefel setzte sich auf seine linke Schulter und drückte ihn wieder nach unten. Er umklammerte das Bein, das ihn niederhielt, zog fast den Reiter aus dem Sattel und gelangte wieder nach oben.
Ein anderer packte ihn an den Haaren und schleifte ihn hinter sich her. So zerrten sie ihn an Land, wo er wieder strauchelte und zu Boden stürzte. Halb bewusstlos blieb er liegen.
»Der andere muss oben am Waldrand sein!«, rief eine Stimme.
Hufschlag donnerte erneut auf. Die zweite Patrouille näherte sich. Schreie ertönten.
Hammon hob den Kopf. Jetzt jagten sie Pitter, diesen Idioten. Pitter war überhaupt an allem schuld. Hätte er sich ruhig verhalten, wären sie von den Häschern nicht entdeckt worden. Hätte er nicht so viel Angst gehabt, wären sie schneller vorwärts gelangt.
Ein Schuss krachte. Pitter rannte am Fluss entlang. Er schoss mit seinem Revolver, ohne einen der Reiter zu treffen. Sie holten ihn ein. Der Corporal beugte sich aus dem Sattel, packte Pitter am Kragen und hob ihn einfach ein Stück hoch. Pitter verlor den Boden unter den Füßen und stürzte im nächsten Moment knallhart nieder. Er überschlug sich. Bevor er sich benommen wieder aufrichten konnte, waren zwei Soldaten über ihm, rissen ihm die Arme auf den Rücken und banden seine Handgelenke zusammen, dass Pitter vor Schmerzen aufkreischte.
Er wurde zurückgeschleppt, bis er neben Hammon stand, den sie auf die Beine gezerrt hatten.
»Du Scheißkerl«, sagte Hammon.
»Halt die Klappe!«, schrie der Sergeant, holte aus und schlug Hammon mit dem rechten Handrücken ins Gesicht. Hammons Oberlippe platzte auf. Sein Kopf flog zur Seite. Er taumelte.
»Ihr habt uns eine schlaflose Nacht gekostet, ihr Dreckskerle«, sagte der Sergeant. »Glaubt ihr, dass es ein Spaß ist, sich den Hintern wund zu reiten, um euch wieder einzufangen.«
»Warum hast du es dann nicht gelassen?«, sagte Hammon. Er lispelte wegen seiner aufgeschlagenen Oberlippe.
Der Sergeant schlug wieder zu. In Hammons Augen glühte Hass auf.
»Dir wird das große Maul noch gestopft werden«, sagte der Sergeant. »In Fort Lincoln wird abgerechnet.«
»Ich wollte nicht desertieren!« Pitters Stimme kippte fast um. Er flog am ganzen Leib. »Ich war von Anfang an dagegen. Er hat mich dazu überredet, weil er nicht allein los wollte. Ich wäre nie weggelaufen, wenn er nicht …«
»Dir drehe ich den Hals um, du feiges Schwein!«, brüllte Hammon. Er stürzte sich auf Pitter und umschloss mit beiden Fäusten dessen Hals. Sie fielen beide zu Boden. Mehrere Soldaten warfen sich auf sie und trennten sie. Sie zerrten den tobenden Hammon zurück und banden ihm die Arme auf dem Rücken zusammen.
»Nur keine Sorge«, sagte der Sergeant. »Ihr empfangt beide, was ihr verdient.«
»Kassierst du Prämien dafür, dass du für Custer den Kopfjäger spielst?«, fragte Hammon. »Dieser Kerl verheizt uns alle. Der denkt nur an sich und daran, möglichst schnell wieder die Generalssterne zu ergattern. Wer sein Hirn noch im Schädel hat, der verschwindet, solange noch Zeit dazu ist.«
»Du bist zur Armee gegangen, mein Freund«, sagte der Sergeant ungewöhnlich mild. »Aus freiem Willen und bei vollem Verstand. Die Armee ist kein Geschäft, in das man einsteigt, wenn es einem passt, und aus dem man wieder aussteigt, wenn man schlecht geschlafen hat. Ihr tragt die Uniform und reißt eure Zeit ab wie wir alle.« Er wandte sich um und stieg in den Sattel. »Nehmt sie mit!«, befahl er.
Die Soldaten legten Hammon und Pitter Stricke um die Hüften. Als sie anritten, zogen sie die Männer hinter sich her. Sie mussten laufen, wenn sie nicht umgerissen und mitgeschleift werden wollten.
»Ich hoffe, dass sie dich am Flaggenmast in Fort Lincoln hochziehen«, presste Hammon zwischen seinen zerschlagenen Lippen hervor. »Wenn nicht, dann sollen sie dir die Haut herunterpeitschen, bis du den Tag deiner Geburt verfluchst.«
»Ich habe es nicht so gemeint«, keuchte Pitter. Das Entsetzen hatte seine Züge verzerrt. »Glaub mir doch, ich – ich weiß nicht, warum ich …«
Ein Schlag traf ihn von hinten über der rechten Schulter. Er taumelte nach vorn und konnte sich mit Mühe auf den Beinen halten.
Die Dunkelheit hüllte den Missouri ein. Das Tröten einer Dampfpfeife klang hinter den Soldaten her, die die staubige Overlandstraße ansteuerten, die zum Fort Abraham Lincoln führte.
*
Arthur Ridgely ritt aus den Badlands heran, ein hagerer, sich stets etwas nach vorn gekrümmt bewegender Mann, staubbedeckt wie sein Pferd. Er trug ein indianisch gegerbtes Wildlederhemd mit Fransen an den Nähten. Sein dunkelbraunes Haar fiel in weichen Locken bis auf seine knochigen, gleichwohl breiten Schultern und umrahmten ein schmales, hohlwangiges Gesicht mit tiefliegenden dunklen, immer etwas melancholisch blickenden Augen. Im Gürtel trug er rechts einen großkalibrigen Smith & Wesson-Revolver und links ein Bowie-Messer mit langer Klinge. Am Sattel hatte er einen Pfeifentomahawk hängen sowie einen Scabbard mit einem Spencer-Karabiner.
Art Ridgely war anzusehen, dass er einen sehr langen Ritt hinter sich hatte, aber er wirkte nicht erschöpft, und wer ihn sah, gewann den Eindruck, dass dieser Mann seine Kräfte sehr gut einzuschätzen und einzuteilen wusste.
Er folgte seit einiger Zeit dem Bett des Sweetbriar Creek, das fast ausgetrocknet war. Vor ihm war Rauch in der Luft. Als er endlich das Feuer in der Ebene entdeckte, lenkte er sein Pferd darauf zu. Er veränderte seine Haltung nicht, aber er registrierte mit unauffälliger Wachsamkeit alles, was von Wichtigkeit war.
Neben dem Feuer vor ihm standen drei Wagen. Bei dem einen handelte es sich um einen Frachtwagen, dessen Ladung von einer grauen Plane verdeckt wurde. Die anderen waren flache, leichte Fahrzeuge, wie sie auf Farmen gebraucht wurden. Sie waren offenbar nur mit wenigen Werkzeugen und Vorräten beladen. Ridgely entdeckte Goldwaschpfannen, Siebe, Spitzhacken, Schaufeln, Töpfe, Kannen, Konserven und anderes.
Die Männer am Feuer waren schwer einzuschätzen. Vier sahen aus, als hätten sie geradewegs das letzte Dampfboot von St. Joseph in Bismarck verlassen. Ihre Kleidung wirkte noch etwas städtisch. Zwei andere trugen derbe Baumwollhemden, Levis-Hosen und Revolvergürtel. Der siebte Mann war untersetzt und kräftig, hatte einen struppigen Kinnbart und war braungebrannt. Trotz seines grauen Stadtanzugs sah er nicht wie ein Mann aus dem Osten aus.
Sie unterbrachen ihr Gespräch, als Ridgely sich näherte. Der Reiter zügelte sein Pferd unweit des Feuers.
»Einen Schluck Wasser?«, fragte er.
Einer der Männer am Feuer richtete sich auf, schöpfte mit einem Blechbecher eine dunkle Flüssigkeit aus einem Kessel und brachte ihm den Becher. Er sagte: »Ist Kaffee recht?«
»Kaffee ist immer recht«, erwiderte Ridgely und trank mit kleinen Schlucken. Er hatte lange keinen Kaffee gehabt.
»Trapper?«, fragte der bärtige braungebrannte Mann.
»Scout«, antwortete Ridgely. »Fort Abraham Lincoln. US-Kavallerie. Mein Name ist Ridgely.«
»Es wird Zeit, dass die Armee endlich etwas unternimmt«, sagte der Mann, der ihm den Kaffeebecher gebracht hatte.
»Was soll die Armee unternehmen?«, fragte Ridgely.
»Sie soll die Rothäute endlich zum Teufel jagen.«
»Seid ihr auf dem Weg in die Black Hills?«, fragte Ridgely. »Goldsucher? Dann müssten wir euch zum Teufel jagen.«
Ridgely trank den Becher leer und warf ihn neben das Feuer.
»Wie meinen Sie das?«, fragte der bärtige Mann.
Ridgely beachtete die Blicke der anderen nicht, die feindselig geworden waren.
»Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es einen Vertrag zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und den vereinigten Stämmen der Sioux, Cheyenne, Arapaho und anderer Indianernationen gibt. Er wurde vor einigen Jahren in Fort Laramie geschlossen. Die Zeitungen waren damals voll davon.«
»Ich erinnere mich«, sagte der bärtige Mann. »Ich bin damals dabei gewesen. Ich bin Reporter, Mister Ridgely, und schreibe für die Bismarck-Tribune.«
»In diesem Vertrag sind den Stämmen bestimmte Gebiete zugesichert worden. Unter anderem die Black Hills, in denen die Kulturstätten der Stämme liegen. Dort ist die Große Medizin, das größte Heiligtum.«
»Humbug!« Der Mann, der Ridgely den Kaffee gebracht hatte, ging zum Feuer. »Ein Haufen Wilder, die mit dem Land, das ihnen gegeben worden ist, nichts anzufangen wissen.«
»Würden Sie das auch sagen, wenn in den Black Hills kein Gold gefunden worden wäre?«, fragte Ridgely.
»Ich denke, Sie arbeiten für die Armee?«
»Muss ich deshalb blind und taub sein?« Ridgelys Haltung blieb entspannt, aber er registrierte, dass einer der Männer sein Gewehr heranzog. »Was hier stattfindet, ist einer der größten Vertragsbrüche, die ich miterlebt habe. Und das nur wegen Leuten wie Ihnen. Die Regierung war durchaus willig, den Vertrag zu halten – bis die Zeitungen die Nachricht von den Goldfunden hinausposaunten und Tausende von Diggern anrückten. Die ersten schickten wir zurück, aber als es immer mehr wurden, mussten wir die Grenzen der Reservation öffnen. Jetzt haben wir den Ärger mit den Indianern.«
»Sie bestreiten also das Recht amerikanischer Bürger, sich in ihrem eigenen Land zu bewegen, wie es ihnen gefällt?«
»Die Black Hills sind Indianerland«, antwortete Ridgely. »Würde es Ihnen gefallen, wenn sich jeder hergelaufene Tramp in Ihrem Vorgarten einquartiert und ihre Blumenbeete auseinandernimmt, weil er glaubt, dass er darunter ein paar Nuggets findet?«
»Diese Rothäute wissen nicht, was eigenes Land und was ein Vertrag ist.«
»Glauben Sie? Ich glaube fast, dass viele Leute im Osten davon keine Ahnung haben, sonst würden sie nicht immer wieder Verträge schließen und dann brechen.«
»Hauen Sie ab, Mann!« Der Bursche, der sein Gewehr herangezogen hatte, richtete es jetzt auf Ridgely. »Ich sollte Sie wie einen räudigen Hund aus dem Sattel schießen.«
»Nimm das Gewehr weg, Freundchen«, sagte Ridgely. »Der Letzte, der ein Gewehr auf mich gerichtet hat, liegt am Powder River begraben.«
In seiner Stimme war Eis.
»Wir sind sieben«, sagte der Mann, aber er schluckte. Unter dem harten Blick des Scouts war ihm nicht wohl zumute.
»Sechs«, sagte der Bärtige. »Mit mir sollten Sie nicht rechnen.« Er richtete sich auf und entfernte sich vom Feuer.
»Lass ihn in Ruhe reiten«, sagte ein anderer nervös. »Was geht es uns an, was der Mann redet.«
»Er ist Scout der Armee. Die Armee soll uns beschützen. Ich lasse mir von so einem Bastard nicht sagen, dass ich ein Landräuber sei.«
»Du bist noch was viel Schlimmeres, mein Junge«, sagte Ridgely. »Du bist der größte Idiot, den ich je gesehen habe. Du wirst keine drei Monate dort, wo du hinwillst, überleben. Wer ein Gewehr auf einen anderen Mann richtet, sollte nicht lange fackeln, sondern gleich abdrücken. Weil nämlich jeder, der eine Waffe auf sich gerichtet sieht, selbst gleich schießt.«
Ridgely lehnte sich nur ein wenig zurück. Seine Rechte bewegte sich kaum. Er drückte auf den Griff des langläufigen Smith-&-Wesson-Revolvers, sodass das Holster hochschwang, und schoss durch den offenen Holsterboden.
Die beiden ersten Kugeln schlugen direkt vor dem Mann mit dem Gewehr in den Boden. Dreckfontänen flogen in die Höhe. Grasfetzen trafen den Mann ins Gesicht. Sein Gewehr schwenkte herum. Er zog den Kopf ein und ließ das Gewehr fallen, um die Hände vor das Gesicht zu schlagen. Gleichzeitig stieß er einen hellen Schrei aus.
Die dritte Kugel traf mitten in die Feuerstelle. Brennende Scheite und glühende Asche wurden hochgeschleudert. Ein flammendes Holz traf einen der Männer ins Gesicht. Ein anderer, der dichter am Feuer gesessen hatte, wurde von glühenden Ascheteilchen überschüttet. Er warf sich schreiend ins Gras und schlug sich mit den flachen Händen immer wieder auf den Kopf, während ein Teil seines Haars weggesengt wurde.
Die Detonationen verhallten im Hügelland. Ridgelys Gesicht blieb unbewegt. Er sagte: »Kehrt um und fahrt wieder nach Hause. Wenn ich gewollt hätte, hätte jeder von euch jetzt eine Portion Blei im Leib. Der nächste, mit dem ihr es zu tun kriegt, wird nicht so rücksichtsvoll sein. In den Goldgräbernestern in den Black Hills herrschen andere Gesetze. Wenn ihr es überhaupt bis dahin schafft. Die Indianer sind nämlich auch unterwegs und schnappen sich, wen sie kriegen können.« Der Scout ließ den Revolvergriff los und fügte hinzu: »Falls es einem von euch einfallen sollte, mir in den Rücken schießen zu wollen, soll er sich das lieber dreimal überlegen. Beim nächsten Mal schieße ich nicht ins Feuer.«
»Einen Moment, Mister Ridgely, Sir!« Der Bärtige, der abseits gestanden hatte, näherte sich. »Sie reiten doch nach Fort Abraham Lincoln. Zu General Custer.«
»Richtig.«
»Ich möchte mich Ihnen anschließen.«
»Sie wollten doch ursprünglich in die Goldfelder.«
»Da kann ich immer noch hin. Ich habe das Gefühl, dass es in der Umgebung von General Custer interessanter ist. Ich meine, Sie sind gewiss nicht zu Ihrem Vergnügen im Westen gewesen und reiten jetzt nach Fort Lincoln, um Custer zu sagen, dass das Wetter in den Badlands gut ist.«
»Ich kann Sie nicht hindern, nach Fort Lincoln zu gehen, Mister.«
»Kellogg«, sagte der andere. »Mark Kellogg. Bismarck Tribune.«
»Custer mag Reporter«, sagte Ridgely. Er schaute zu, wie Kollegg zu den Pferden hinüberhastete, seine Habseligkeiten zusammenraffte und in den Sattel stieg, ohne sich weiter um seine bisherigen Reisegefährten zu kümmern.
»Sie nicht?«, fragte ihn Kellogg.
»Nein«, sagte Ridgely.
»Vielleicht ändert sich das, wenn Sie mich näher kennen.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Ridgely und ritt an. Aus den Augenwinkeln beobachtete er die anderen Männer. Keiner rührte sich. Jene, die von den umherfliegenden Brandscheiten getroffen worden waren, hatten ohnehin mit sich genug zu tun.
*
»In Bismarck kursieren Gerüchte, dass ein Feldzug bevorstehe«, sagte Kellogg. »General Alfred Terry soll eine große Kampagne einleiten. General Crook befindet sich doch bereits in Montana, oder bin ich falsch informiert?«
»Fragen Sie Custer«, sagte Ridgely.
Sie ritten nebeneinander her. Vor ihnen tauchte der Missouri auf. Ein Fracht-Steamer zog stampfend vorbei, mächtige Rauchwolken aus den Zwillingsschloten ausstoßend.
»Ich frage Sie, Ridgely. War das, was Sie vorhin gesagt haben, ernst gemeint? Ich meine, über die Verträge und das Land der Indianer?«
»Natürlich.«
»Warum arbeiten Sie dann noch für die Armee?«
»Eine gute Frage, Kellogg. Diese Frage habe ich mir auf dem Weg hierher auch immer wieder gestellt. Vielleicht steckt man manchmal schon zu tief in einer Sache drin, als dass man noch aussteigen kann, selbst wenn man nicht mehr davon überzeugt ist.«
»Eine schlechte Antwort, Ridgely.«
»Vielleicht. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist meistens kompliziert.«
»Es stimmt, dass die Regierung den Zugang zu den Black Hills für Goldsucher erst einmal gesperrt hatte«, sagte Kellogg. »Aber doch nur, weil sie einen neuen Vertrag mit den Sioux abschließen und ihnen die Black Hills für ein Butterbrot abkaufen wollte. In Washington hat doch kein Mensch auch nur eine Sekunde daran gedacht, den alten Laramie-Vertrag zu halten und auf das Gold in den Black Hills zu verzichten.«
»Sie wissen gut Bescheid, Kellogg.«
»Das ist mein Job, Ridgely. Deshalb weiß ich auch, dass General Crook schon seit dem Winter als Speerspitze im Sioux-Land unterwegs ist, mit sehr unbefriedigendem Ergebnis. Die siebte Kavallerie unter Custer ist doch nicht zur Sommerfrische nach Fort Lincoln verlegt worden. Dieses Regiment hat einen ganz bestimmten Ruf. Custer hat einen bestimmten Ruf. Dieser Mann ist geschickt worden, um die Sioux und Cheyenne in ihre Schranken zu weisen.«
»Fragen Sie ihn«, erwiderte Ridgely noch einmal.
»Sie machen mir meinen Job nicht gerade leicht.«
»Dazu bin ich nicht da. Ich bin Scout. Fragen Sie Custer.« Ridgely wandte den Kopf. In seinen Augen blinkte es. »Vergessen Sie aber niemals, ihn als General anzureden. Auch wenn er nur die Sterne eines Lieutenant Colonels auf den Schulterstücken trägt.«
»Er ist doch aber General.«
»Im Bürgerkrieg war er General«, entgegnete Ridgely. »Das ist zehn Jahre her. Der jüngste General der US-Armee. Aber es war nur ein Titelrang. Dem Titel nach hat es am Ende des Krieges jede Menge Generale gegeben. Jetzt ist Custer Lieutenant Colonel, aber er brennt darauf, es noch einmal zu schaffen und diesmal richtig General zu werden, nicht nur dem Titel nach. Er will auf den Stuhl von General Sheridan, vielleicht sogar noch höher.« Ridgelys Stimme wurde kälter. »Vergessen Sie, dass ich Ihnen das gesagt habe.«
»Es ist allgemein bekannt, dass Custer ein Mann von großem Ehrgeiz ist. Man sagt, dass er ein Schlächter sei, stimmt das?«
»Er ist ein Mann, der viel vom Leben verlangt und sich holt, was er nicht kriegt. Ein solcher Mann tut das, was ihm gerade nützlich erscheint. Sie werden feststellen, dass er eine Menge über die Indianer weiß und vielleicht sogar Sympathien für sie hat. Er hat ein Buch geschrieben. Haben Sie es gelesen?«
»Ja«, sagte Kellogg. »Seitdem brenne ich darauf, ihn kennenzulernen. Ein bemerkenswerter Mann.«
»Zweifellos. Aber wenn es um seine eigenen Interessen geht, dann denkt er nur noch an sich.«
»Tun wir das nicht alle?«
»Nicht auf diese Weise«, erwiderte Ridgely.
»Ich habe gehört, dass er kürzlich aus der Armee entlassen werden sollte.«
»Er hatte Ärger«, gab Ridgely zu. Die Fragen des Reporters wurden ihm lästig. Ridgely war kein Mann, der viel redete. Heiß brannte die Sonne. Über dem Schilf am Ufer des Missouri tanzten Mückenschwärme.
»Ärger mit Präsident Grant?«, fragte Kellogg.
»Man beschuldigt nicht ungestraft den Bruder des Präsidenten, dass er in schmutzige Geschäfte verwickelt sei, wenn man es nicht beweisen kann.«
»Ganz so gerissen scheint Custer demnach auch nicht zu sein.«
»Immerhin hat es ihm Schlagzeilen in der Presse eingebracht.«
»Aber auch beinahe seine Entlassung.«
»Ich bin nicht Custer«, sagte Ridgely. »Ich bin nur ein Scout.«
»Warum waren Sie im Westen, Ridgely?«
»Die Lage ist sehr gespannt«, entgegnete Ridgely. »Die Armee muss wissen, was vorgeht. In den Black Hills treiben sich inzwischen Tausende von Goldsuchern herum, die alles um und um wühlen.«
»Die Digger sind Ihnen egal, Ridgely. Der wahre Grund ist, dass Sie wissen wollten, was die Indianer vorhaben.«
»Warum kehren Sie nicht um und reiten mit den Goldsuchern weiter?«
»Weil ich mir immer sicherer darüber bin, dass es im Indianerland bald eine Explosion gibt und Custer die Lunte in der Hand hat.«
»Das haben Sie nicht von mir, Kellogg.«
»Nein, das habe ich von mir selbst«, sagte Kellogg. »Aber es ist doch so: Die Rothäute fühlen sich betrogen. Die Häuptlinge, die schon damals den Vertrag von Laramie nicht unterschrieben haben, führen jetzt das große Wort. Die waren schon damals für Krieg. Jetzt haben sie den besten Grund dazu. Kennen Sie Sitting Bull?«
»Hunkpapa Medizinmann«, sagte Ridgely.
»Er hat viel Einfluss?«
»Eine Menge Häuptlinge hören auf ihn.«
»Was hat er in letzter Zeit getan?«
»Die Sioux und Cheyenne haben ihre Reservationen verlassen, weil sie auf Bisonjagd gehen wollen. Das ist alles.«
»Auf Bisonjagd oder auf die Jagd nach Goldgräbern?«
»Jeder, der in die Black Hills geht, weiß, dass er sich im Indianerland befindet.« Ridgely zuckte mit den Schultern.
»Aber den Indianern ist es verboten, die Grenzen ihrer Reservation zu überschreiten. Habe ich recht?«
»Verdammt, Kellogg, was fragen Sie mich? Ich bin weder Offizier noch Beamter des Büros für Indianerangelegenheiten und auch kein Politiker. Ich bin nur ein Scout und im Übrigen ein Mann, der in diesem Land zu überleben versucht wie jeder andere auch.«
»Falsch, Ridgely. Gerade weil Sie kein Blaurock, kein Bürohengst und kein Politiker sind, ist Ihre Meinung wichtiger. Sie kennen sich aus. Sie wissen nicht nur, was wirklich los ist und der Öffentlichkeit verschwiegen wird. Sie sind an Ort und Stelle gewesen und wissen, was die beste Lösung des Problems wäre.«
»Schmieren Sie mir keinen Honig ums Maul, Kellogg«, sagte Ridgely schroff. »Sie wollen mich aushorchen. Aber Sie können meine Meinung erfahren: Es gäbe keine Probleme, wenn man nicht immer wieder unnötigerweise welche schaffen würde. Die Indianer sind im Grunde einfach zu verstehen. Sie sagen, dass sie seit langen Zeiten in diesem Land leben und wir später gekommen seien. Folglich gehört das Land ihnen. Sie haben nichts dagegen, das Land mit uns zu teilen, aber sie wollen, dass wir ihre älteren Rechte respektieren. Sie haben längst begriffen, dass wir die Stärkeren sind und die besseren Waffen haben. Der Indianer ist ein Krieger. Er versteht die Sprache des Krieges. Aber er kämpft in erster Linie für die eigene Ehre, für den Ruhm. Er versteht nicht, dass man sich wegen eines Stück Lands gegenseitig ausrottet. Denn für den Indianer gehört das Land nicht den Menschen, der Mensch gehört dem Land. Die Erde ist ewig – der Mensch ist sterblich. Und der Indianer erwartet, dass Verträge eingehalten werden. Das ist doch ganz einfach, oder? Kompliziert wird es erst, weil viele von uns glauben, dass ein Vertrag mit einem Indianer nicht viel wert sei, weil der Indianer ein Wilder sei und man Versprechungen, die man ihm gegeben habe, deshalb jederzeit brechen könne.«
»Es gibt Leute, die sagen, dass die einzige Lösung ein großer Krieg gegen die Rothäute sei.«
»Der ist leider längst in vollem Gang.« Ridgely zuckte mit den Schultern. »Aber ich prophezeie Ihnen, dass die Indianerkriege keine Lösung sind. Sie schaffen nur neue Probleme.«
»Warum hört man nicht auf Leute wie Sie?«
»Weil ich in den Augen der Bratenröcke aus Washington auch ein halber Wilder bin.« Ridgely lächelte freudlos. »Ich werde verschwinden, die Indianer werden verschwinden, aber auch Leute wie Custer werden am Ende nicht mehr da sein. Dafür wird das ganze Land mit Schreibtischen überzogen werden. Überall wird Aktenstaub die Luft verpesten. Wir werden das nicht mehr erleben, aber irgendwann wird es so sein. Doch bis dahin wird noch eine Menge Blut fließen.«
»Sie finden also, dass man das Gold dort lassen sollte, wo es jetzt liegt?«
»Gold hat noch niemanden richtig glücklich werden lassen.«
»Nur jene, die es haben.« Kellogg lachte.
Ridgely blickte ihn starr von der Seite an. »Gold schafft Unfrieden. Hier draußen im Westen können Sie damit nicht viel anfangen. Sie müssen in die Städte, um es auszugeben. Es gibt Wichtigeres.«
»Keine Spur Goldfieber, Ridgely?«
»Nein.«
»Sie sind ein ungewöhnlicher Mann«, sagte Kellogg.
»Das liegt nur daran, dass inzwischen zu viele andere Männer in den Westen gezogen sind. Früher gab es nur Männer wie mich hier.«
»Die Zeit bleibt nicht stehen.«
»Nichts bleibt stehen«, sagte Ridgely. »Alles ändert sich. Aber kaum etwas wird besser.«
»Ich glaube an die Zukunft im Westen Amerikas«, erklärte Kellogg.
»Diesen Satz sollten Sie in Ihrer Zeitung schreiben«, sagte Ridgely höhnisch. »Mit General Custers Bild daneben.«
»Warum nicht? Die meisten Leute wollen gar nicht so genau wissen, wie die Wirklichkeit aussieht. Sie wollen an etwas glauben. Sie wollen, dass man ihnen Mut macht. Die Wahrheit ist oft zu kompliziert.«
Art Ridgely schwieg eine Weile. Nachdem sie auf einen staubigen Wagenpfad gestoßen und auf ihn eingeschwenkt waren, sagte er: »Custer wird Ihnen gefallen.«
Vor ihnen tauchten die Palisaden von Fort Abraham Lincoln aus der Prärie auf. Über einem der wuchtigen Wachtürme flatterte das Sternenbanner im Wind. Eine Kavallerie-Patrouille verließ die Garnison durch das Haupttor. Eine Frachtwagenkolonne fuhr von Bismarck herauf. Unten an den hölzernen Anlegern des Stroms wurden zwei Flachboote beladen.
»Es sieht sehr friedlich aus«, sagte Kellogg.
»Warten Sie’s ab.« Ridgelys Stimme klang düster.
*
Pitter war wahnsinnig vor Angst. Er flog am ganzen Leib und konnte nicht mehr auf den Füßen stehen. Die Posten hatten ihn rechts und links an den Armen gepackt und trugen ihn über das weite, sandige Rund des Exerzierplatzes. Seine Füße schleiften über den Boden.
Hammon ging allein. Er hatte den Kopf trotzig hochgereckt, aber seine Züge wirkten verkniffen, und in seinen Augen flackerte Verzweiflung.
Die Kompanien waren in Reih und Glied angetreten. Der dumpfe Klang einer Trommel dröhnte durch die Garnison. Ein scharfer Befehl ertönte.
Pitter und Hammon wurden zu den Holzböcken geschafft, die unweit des Fahnenmastes mitten auf dem Exerzierplatz standen. Außer ihnen wurden noch vier andere Soldaten gebracht. Einer stieß helle Jammerlaute aus.
Ridgely zügelte sein Pferd am Tor und schaute zu dem Posten hinunter.
»Ist der General da?«
»Er steht am Fenster und schaut zu.« Der Soldat äugte skeptisch zu Kellogg hoch. »Ihr müsst warten, bis es vorbei ist.«
»Es hat sich also nichts geändert«, sagte Ridgely.
»Das ist die dritte Vollstreckung in dieser Woche.« Der Posten wirkte gelangweilt.
Ridgely stieg ab. Kellogg rutschte ebenfalls aus dem Sattel. Sie führten ihre Pferde durch das Tor und blieben neben den Stallgebäuden, seitlich der angetretenen Mannschaft, stehen.
»Was geht hier vor?«, fragte Kellogg.
»Deserteure«, sagte Ridgely. »Es sieht aus, als sei ich nie fortgewesen. Jede Woche versuchen ein paar Männer, sich abzusetzen. Manche schaffen es. Andere werden geschnappt. Es sind ständige Patrouillen unterwegs, die Deserteure jagen.«
Auf dem Exerzierplatz wurden den Männern vor den Holzböcken die Uniformblusen heruntergezogen, sodass sie mit bloßem Oberkörper dastanden. Unvermittelt schlugen die Posten, die sie gebracht hatten, mit Gewehrkolben zu.
Sie trafen die halbnackten Männer ins Kreuz. Brüllend stürzten sie nach vorn und streckten unwillkürlich die Arme aus. Sie fielen gegen die Holzböcke. Dort standen andere Soldaten, die nach den vorgereckten Armen griffen und sie blitzschnell über die oberen Balken der Böcke zogen, sodass die Männer hilflos auf dem Holzgestell hingen. Von hinten wurden ihnen die Beine langgezogen, sodass sie nahezu bewegungsunfähig waren.
Corporals traten neben die Böcke und schwangen Büffelpeitschen. Auf einen scharfen Befehl hin begannen sie zu schlagen. Die Lederriemen durchschnitten sirrend die Luft und trafen klatschend auf die Rücken der Delinquenten.
Pitter kreischte wie am Spieß. Sein Rücken wölbte sich hoch. Die Muskeln an seinen Schultern und Armen spannten sich, als er sich losreißen wollte. Seine Arme bogen sich über dem Oberbalken des Bocks. Da traf ihn schon der zweite Hieb, und er heulte erneut auf.
Einer der anderen Deserteure schrie auch, aber nicht so ausdauernd. Hammon ertrug die Schläge mit verbissenem Schweigen. Er hatte seine Zähne in die Unterlippe gegraben. Bei jedem Hieb quollen ihm fast die Augen aus den Höhlen. Es zuckte in seinem Gesicht, aber er schrie nicht. Er wollte keinem der Zuschauer diese Befriedigung gönnen.
Der Corporal hinter ihm schlug mit aller Kraft zu, um Hammons Zähigkeit zu brechen. Zweimal klatschte der Lederriemen über Hammons Schultern, drei- oder viermal schnitt die Peitschenschnur um seinen Oberkörper herum, und die scharfe Spitze des Riemens traf seine Brust. Aber Hammon blieb stumm. Nicht einmal ein Stöhnen oder Wimmern, wie bei den anderen, drang über seine Lippen.
Am Rande des Exerzierplatzes zählte ein Sergeant die Hiebe mit. Er zählte bis dreißig. Eine scheinbar unendlich lange Zeitspanne. Quälend lang. In steifer Haltung schauten die Soldaten des Regiments zu. Mit jedem Peitschenhieb ertönte auch ein dumpfer Schlag der Trommel.
Dann war es vorbei: Die Lederriemen hatten die Rücken der Männer an den Böcken zerfleischt. Die Peitschen sanken herab. Als die Delinquenten losgelassen wurden, stürzten sie in den Staub. Von den Ställen näherten sich Soldaten mit Eimern, die brackiges Wasser über die reglosen Gestalten am Boden schütteten. Zwei oder drei bäumten sich jetzt noch einmal auf, die anderen rührten sich trotz des Wassers nicht.
Ridgely stieß seinen Hut in den Nacken und drehte sich zu Kellogg um. Der Reporter war grün im Gesicht.
»Sie werden doch nicht etwa kotzen, Kellogg«, sagte Ridgely.
Kellogg hob den Kopf. Er dachte, Ridgely würde ihn spöttisch ansehen, aber Ridgelys Augen waren kalt, sein Gesicht war ohne Ausdruck.
»Wieso?« Kelloggs Stimme klang gepresst.
»Weil Sie aussehen, als sei Ihnen übel«, sagte Ridgely.
Er pfiff nach einem Stallburschen und warf ihm die Zügel der Pferde zu. Er ging mit Kellogg über den Exerzierplatz. Im Sand neben den Holzböcken waren einige dunkle Flecken. Kellogg schluckte.
Sie stiegen die Stufen der Kommandantur hoch. Die Tür stand offen. Die Ordonnanz, ein lederhäutiger Corporal, schaute nur kurz auf, als sie eintraten. Er musterte Kellogg prüfend und sagte: »Der General hat Sie schon gesehen, Ridgely. Gehen Sie nur durch.«
Das Office des Kommandanten war schmucklos und spartanisch: schlichte Möbel, harte Stühle, an den Wänden ein Sternenbanner, eine Landkarte, die die Black Hills zeigte, ein Bild von Präsident Grant. Auf einer Kommode lagen mehrere Revolver, darüber hingen zwei Gewehre und ein Säbel. Auf dem Schreibtisch standen zwei Fotografien in Silberrahmen: eine zeigte Libby Custer, die Frau des Generals, die andere zeigte ihn zusammen mit dem russischen Großfürsten während einer Bisonjagd durch den Westen.
Custer saß entspannt zurückgelehnt hinter dem Schreibtisch. Er hatte einen Steingutkrug mit geeister Zitronenlimonade vor sich stehen. Er war ein großer, schlanker, sehniger Mann. Markant war sein Kopf: schmal, ein scharf geschnittenes Profil mit kühn gewölbter Nase, energischem Kinn und vollen Lippen, die zum Teil von dem buschigen, sichelförmigen Schnauzbart überwölbt wurden. Die Augen waren von klarer Bläue und falkenhafter Schärfe. Das dunkelblonde Haar wallte in dichten Locken über den Kragen seiner Uniformbluse bis auf seine Schultern.
»Nur herein, Ridgely.« Er deutete auf den Krug mit der Limonade. »Wir kriegen einen heißen Sommer. Mögen Sie Limonade?«
»Warum nicht? Ich habe eine Menge Staub geschluckt.« Ridgely nahm den Hut ab und zog sich einen Stuhl heran. Er deutete auf Kellogg.
»Ein Zeitungsschreiber, der darauf gebrannt hat, Sie kennenzulernen, General.«
»Mark Kellogg, Bismarck Tribune«, sagte Kellogg. »Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, General.«
»Sind Sie hier, um eine Geschichte über mich zu schreiben, Mister Kellogg?« Custer rief nach der Ordonnanz und ließ noch zwei Gläser bringen. Er schenkte selbst die Limonade ein. »Ich glaube, es gibt nichts aus meinem Leben, was nicht schon in den amerikanischen Zeitungen gestanden hat.«
»Ihre Person ist immer interessant, General.« Kellogg setzte sich. »Aber ich möchte auch gern über die Situation im Indianerland schreiben.«
»Da hätten Sie Mister Ridgely befragen sollen«, sagte Custer. »Im Gegensatz zu mir ist er in diesen Dingen Experte.«
»Er hat mir geraten, mit Ihnen zu sprechen.«
»Hat er das?« Custer zog die Augenbrauen hoch. »Sie überraschen mich, Ridgely.«
»Man hört viel über eine große Kampagne der Armee gegen die Sioux und Cheyenne«, sagte Kellogg. »Das interessiert mich. Außerdem möchten viele Leute etwas über die siebte Kavallerie lesen, die hier im Westen für unsere Sicherheit sorgen soll.«
»Das Regiment ist in blendender Verfassung.«
»Und die – Auspeitschungen …«
»Soldaten sind ein harter Menschenschlag, Mister Kellogg. Man muss mit eiserner Faust durchgreifen, um sie unter Kontrolle zu halten. Deserteure gibt es in jedem Regiment. Glauben Sie mir: nach so einer Lektion sind diese Männer die besten Soldaten, die man sich wünschen kann.«