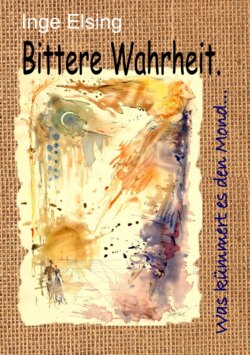Читать книгу Bittere Wahrheit… - Inge Elsing-Fitzinger - Страница 4
Es war vor etwa drei Monaten.
ОглавлениеStundenlang saßen Bernard und Alain schon beisammen. Ein Wochenende, das ausführlichen, geschäftlichen Gesprächen gewidmet wurde, welches Marie, wie meist in letzter Zeit, ihren ausschweifenden Vergnügungen widmete. Keine Telefonate, keine lästigen Zwischenmeldungen, keine Hiobsbotschaften. Es wurden einige Gläser erlesenen Whiskys geschlürft, der nur Bernards besten Freunden vorbehalten blieb. Alains Kopf umnebelte sich. Alles um ihn herum begann sich zu drehen. Das Zimmer, die Papierbögen auf dem Tisch, die Blumenstöcke, die Bilder. Langsam, dann immer schneller. Reichlich verwirrend rauschten Bernards komplizierte Gedankenflüge an ihm vorüber. Er ließ sich bewusst voll laufen, in letzter Zeit immer häufiger.
Heimlich hoffte der väterliche Freund, der Junge würde ihm sein Herz ausschütten. Vieles in seiner Ehe war nicht in Ordnung, das spürte er. Sein untrüglicher Instinkt täuschte ihn nicht. Doch bisher schwieg sein geliebter Schützling beharrlich. Der strahlende Sonnenhimmel hatte sich verzogen. Dicke Wolken versetzten den Raum in diffuses Dämmerlicht.
„Die ideale Spiegelung meines verpfuschten Innenlebens“, lallte Alain kaum verständlich. Schwere Tropfen klatschten an die riesigen Fenster. Dröhnen an den Scheiben. Dröhnen in seinem Kopf. Diesen trostlosen Zustand verspürte er immer öfter, und immer seltener konnte er dagegen ankämpfen. Hatte er genug Alkohol intus, entschlummerte er meist schlagartig. Keine quälenden Gedanken mehr, die ihn im Wachzustand zermürbend folterten.
„Ich habe das eigentliche Ziel völlig aus den Augen verloren“, lallte er kaum verständlich. „An alledem ist nur dieses verrückte Weib schuld, das mich andauernd managt, mir vorschreibt wohin ich zu gehen habe, mit wem ich mich treffen muss, was ich tun soll. Die Tragik daran ist, dass dieses Biest verdammt wichtige Leute kennt, und diese Treffen meist auch noch ein positives Ende finden.“ Ein Hilfeschrei aus tiefster Seele. Nicht selbst diese Verbindungen angeleiert zu haben, zermürbte ihn. Marie bestimmte stets mit wem er verhandeln sollte. Marie, dieses noch immer abgöttisch geliebte Ekel.
„Ich bin verzweifelt und glücklich, traurig und froh“, stöhnte er triefend vor Selbstmitleid. Bernard ließ ihn reden. Fetzen, bruchstückhafte Wahrheiten würden hoffentlich ans Licht kommen, eine Hilfestellung endlich möglich machen.
„All diese Gedanken verfolgen mich in meinen schlimmsten Wachträumen. Ich fühle mich grenzenlos gleichmütig, gleichzeitig maßlos erregt. Ich fühle das Fieber, die angespannte Hoffnungslosigkeit. Die Leidenschaft eines Glückspielers, der weiß, dass er verlieren muss, und nicht die Kraft besitzt, rechtzeitig aufzuhören. Von Zeit zu Zeit bleibt mein Herz fast stehen, doch ich reagiere völlig unkontrolliert unter einem unerklärbaren Zwang, einem riesigen Hass auf mich selbst.“ Seine Stimme bekam einen weinerlichen Klang.
„Ich habe das Gefühl, meine Liebe zu Marie-Louise ist nur mehr eine Sehnsucht nach dem Paradies, in dem wir einst alle Hochgenüsse auskosten durften. Aus welchem man uns zwar nicht vertrieben hat, aus dem wir aber selbst geflohen sind. Meine himmelstürmenden Vorstellungen vom Glück. Ein Fiasko. Eine erbärmliche Niederlage. Sie geht über Leichen. Womöglich sogar über meine.“
Alains Glas war zum x-ten Mal leer getrunken. Trotzdem schenkte er sich wieder nach. Nach Hause wollte er nicht. Bernard machte keinen Versuch, ihn an seinem Besäufnis zu hindern. Leise Musik von Col Porter klang durch den Raum. Alain summte unverschämt falsch mit. Irgendwann schlief er schlagartig ein.
Als er erwachte strahlte ihm der Mond mitten ins Gesicht. Zahllose Sterne standen am schwarzen Firmament. Seine Füße waren steif, sein Rücken schmerzte. In seinem Schädel rumorten schlagende Wetter. Leicht schwankend kroch er unter die kalte Dusche. Bernard lag verkrümmt in seinem Fauteuil. Die Brille baumelte absturzbereit am offenen Hemdkragen.
„Blödmann“, grunzte Alain halblaut, „charakterloser Versager ohne Disziplin und Verantwortung. Nicht einmal dir selbst gegenüber.“
Sein Lachen klang süffisant. „Kaum musst du dich vor deiner Frau behaupten, wirst du zum unterwürfigen Zwerg, der es nicht wagt seine Meinung zu äußern. Du bist ein ausgewachsener Depp, mon cher ami.“ Gierig griff er nach einem halbvollen Glas „Merde, schmeckt das schale Zeug ekelhaft.“
Alain spie die gelbe Flüssigkeit auf den schönen Teppich, den Bernard wie seinen Augapfel hütete. Griechische Handarbeit aus vergangenen Tagen. Ein Erinnerungsstück, über dessen Herkunft er sich beharrlich ausschwieg.
„Dann eben nicht“, säuselte Alain vor sich hin, „soll er doch sein Geheimnis haben. Er steuerte auf den großen Fensterflügel zu, riss ihn weit auf. Ernüchternde Kühle traf seinen erhitzen Körper.
„Eine herrliche Stadt, die ich mir da ausgesucht habe!“ Ergriffenheit übermannte ihn. In der Ferne Stufen, die in den Himmel zu führen schienen. Darüber ein im Dunst schwebender Sakralbau aus weißem Stein. Die Silhouette von Sacre Coeur. Verspielte Kuppeln und Türmchen, Bäume rundum. Wie oft war er dort hinaufgerannt, wenn sein Herz zu schwer wurde. In letzter Zeit immer öfter. Eine Stadt pulsierenden Lebens, mit allem Schönen und Hässlichen, allem Guten und Bösen, bei Licht und im Dunkeln. Er hatte unendlich viele Erfahrungen gemacht, hatte mit Menschen verschiedenster Nationen diskutiert, ihre Charaktere studiert, wurde ein tüchtiger, gewiefter Geschäftsmann.
„Bei Gott, ich habe mir ehrlich Mühe gegeben. Und was ist jetzt aus mir geworden? Ein abhängiges, willenloses Kind, das ängstlich nach der schützenden Hand des Vaters greift.“ Kindheit ist das, was du für den Rest deines Lebens zu überwinden versuchst, hatte Bernard einmal zu ihm gesagt. Würde er es jemals schaffen?
„Ich brauche dich Bernard, lass mich bitte nicht allein!“ Unvermittelt sank er auf die Knie, umarmte den väterlichen Freund. Herzzerreißendes Schluchzen erfüllte den Raum. Erschrocken fuhr Bernard hoch.
„Mein Gott Junge, komm, steh auf. Jetzt wird alles wieder gut.“ Wenig später erfüllte frischer Kaffeeduft den Raum.
Heilfroh, hier und nicht daheim aufgewacht zu sein, schlürfte Alain Bernards Spezialgetränk, das Tote wieder zum Leben erweckte. Langsam wurde es hell.
Sonntag. Kirchenglocken. Friede breitete sich über der Stadt und in Alains Herzen aus. Die aufgehende Sonne ließ den Himmel golden strahlen. Die braunen Möbel schimmerten beinahe orange. Rasch zog er sich um, stand dann wieder beim offenen Fenster, ließ sich von der kühlen Brise durchblasen. Bernards starker Arm lag auf seiner Schulter.
Gleich groß waren die Männer. Der eine etwas korpulenter, mit leichtem Bauchansatz, den er aber geschickt zu kaschieren verstand. Mit seinen maßgeschneiderten Anzügen wirkte Bernard schon seit Jahren gleich bleibend jugendlich. Seine Augen blitzten, sein Haar war immer noch dicht, von Silberfäden durchzogen. Er hatte die Gelenkigkeit einer Katze, konnte sich auch wie ein solche lautlos bewegen. Und er war die Güte in Person, zumindest was Alain betraf. Gütig waren seine Augen, die Züge seines Mundes, der Klang seiner Stimme, jede seiner Gebärden.
„Ob ich dir je ähnlich werden kann?“, stammelte Alain zögernd. „Ich will es jedenfalls versuchen. Dein Selbstvertrauen, deine Rechtschaffenheit, deine Größe. Ich verehre dich wie ein Sohn und bin dankbar, dass du mir das Gefühl gibst, ein solcher zu sein!“
Mutig begann Alain wenig später teils sich selbst anzuklagen, andern teils über Marie-Louise herzuziehen. Doch in all seinen Klagen und Beschuldigungen klang unmissverständlich durch, wie viel Liebe er immer noch für seine Frau empfand.
„Ich bringe einfach nicht die Kraft auf, mich von ihr zu trennen, oder wenigstens meine seelische Unabhängigkeit zu finden“, würgte er heraus.
„Du zerfließt in Selbstmitleid, mein Junge. Glaubst jämmerlich, schwach, ja klein geworden zu sein. Steh wieder auf beiden Beinen. Frauen verfügen ganz einfach über eine höhere emotionale und soziale Kompetenz, sind daher anspruchsvoller als der Rest der Welt. Das hat nichts mit der Vergänglichkeit ihrer Schönheit zu tun, oder mit der Hysterie, die sie provokant einsetzten, um uns Männer zu willenlosen Scharlatanen zu machen. Ein süßes Betthupfern am Polster lässt Herzen schmelzen. Frühstück im Bett – Orangensaft, Toast und eine rote Rose sagen mehr als tausend Worte. Wahre Liebe ist, wenn sie dir die Krümel aus dem Bett fegt!
Nimm dein Schicksal selber in die Hand. Tritt deinem holden Weib als Mann entgegen. Genieße ihre profitablen Geschenke gelassen und mach für dich das Beste daraus. Was im Leben wirklich zählt ist diese wahre Liebe. Von der hast du noch reichlich, das habe ich jetzt erkannt. Es gibt keine Zufälle. Alles ist vorherbestimmt. Das Leben läuft nach einem unverrückbaren Plan ab, den wir kaum beeinflussen können. Alles was in dieser Schöpfung passiert, ist determiniert. Du lebst mit Marie, weil es so sein soll – sei es nun zum Guten oder zum Schlechten, auch das ist bereits festgelegt. Vertrauen ist die Oase deines Herzens, in der die Karawane deines Denkens niemals ankommen wird. Komm, nimm noch einen Schluck Kaffee!“
Bernard war zurückgetreten und blickte sehnsuchtsvoll versonnen auf eine Photographie an der Wand. Ein Bild, das schon immer dort hing, dem Alain kaum Beachtung geschenkt hatte. Es zeigte Bernard mit einem anderen jungen Mann und einer zauberhaften schwarzhaarigen Schönheit. Eine große Segeljacht zwischen wilden Klippen, irgendwo in Griechenland. Alle drei sahen so unbeschwert und glücklich aus.
„Glaubst du tatsächlich, du bist der Einzige, der Probleme mit sich herumschleppt. Es geht keinem besser. Nur verkraftet es der eine besser, der andere schlechter. Zeit heilt viele Wunden, doch der Schmerz bleibt. Man verdrängt Schicksalsschläge, wenn man sie auch nie vergisst. Man versteht immer erst dann, was man an jemandem hat, wenn er plötzlich weg ist.“ Verstohlen wischte er sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
Unvermittelt begann Bernard aus seiner Vergangenheit zu erzählen, die heute, aus einer Laune des Zufalls an die Oberfläche katapultiert wurden, die er nie wieder in Worte fassen wollte.
Traurige Erinnerung
„Meine Mutter war Jugoslawin. Eine kleine, sanfte, unendlich ernsthafte Frau. Wie viel Schönes hätte sie möglicher Weise erfahren können, wenn dieser zarte Vogel nicht die Tochter eines Fischers gewesen wäre, der seiner sechs Kinder wegen die Älteste als Dienstmädchen an eine reiche Herrschaft verschacherte. Die einzige Herrlichkeit die sie solcher Art erfuhr, waren abgelegte Kleider der Gnädigen, die sie aber so zu tragen vermochte, dass die jeweiligen Männer der diversen Damen plötzlich zu sehr Gefallen daran fanden, und sie am nächsten Ersten wieder kündigen musste. Von ihrem Lohn kaufte sie eines Tages ein Ticket ins Elsass. Dort schuftete sie wie ein Kuli, sieben lange Tage in der Woche. Nie wieder zog sie Kleider irgendeiner Gnädigen an. Dann wurde sie schwanger. Nach anfänglichem Entsetzen ließ die Herrschaft sie weiter ihren Dienst verrichten.
Die bescheidene Hochzeit mit dem Kutscher des Hauses wurde vollzogen. Fleißig rackerten Beide und sparten jeden Sou, um irgendwann einmal ein unabhängiges Leben führen zu können.“ Bernard verlor sich in Erinnerungen. Immer noch starrte er auf die Fotografie.
Ich war der Vierte von neun Söhnen, die sie gebar. Not und Elend waren vorprogrammiert. Sechs meiner Geschwister starben. Mutter überlebte die neunte Geburt nicht. Vater war eines Tages spurlos verschwunden. Wir wurden bei Pflegefamilien untergebracht. Ich hatte Glück bei wohlhabenden, kinderlosen Leuten unterzukommen. Mit acht Jahren erlebte damals mein erstes Bad.“ Jetzt lachte er herzlich auf, nahm einen Schluck Rotwein. Alain starrte ihn unverwandt an. Noch nie hatte er den väterlichen Freund so enthusiastisch gesehen.
„Bis jetzt meist notdürftig in einem hölzernen Zuber abgeleckt, wurde ich von einem dienstbaren Geist in einer Keramikwanne mit duftendem Wasser übergossen. Meine Proteste, mich nicht nackt vor der Frau auszuziehen, wurden kaltschnäuzig abgewimmelt. Kein Zetern, kein Heulen half. Wasser rauschte in meinen Ohren. Die geschlossenen Augen verrieten nichts mehr. Es gelang mir tatsächlich, vorübergehend so einsam zu werden, wie ich es brauchte, um die Wohltat voll auszukosten. Ich ließ mich tief in die Wanne gleiten, um meine Nacktheit zu verbergen, und sie rubbelte und schruppte. Später wurden wir Freunde. Ich durfte alleine baden.
Eines Tages lauschte ich an der angelehnten Tür. Meine Ziehmutter verkündete mit Freude, guter Hoffnung zu sein. Dieses Ereignis bedeutete für mich größte Gefahr. Alles in mir bäumte sich auf. Ich fürchtete ehrlich um den Fortbestand meiner Anwesenheit in dieser mittlerweile sehr lieb gewonnene Familie. Eine Fehlgeburt nach wenigen Wochen ließ mich wieder hoffen.
Nach dem Baccalaureat durfte ich das Studium fortsetzen. Mein Ziehvater unterstützte mich großzügig. Auf der technischen Hochschule in Strassburg lernte ich Aristo kennen, den Sohn eines griechischen Reeders.“ Jetzt deutete Bernard begeistert auf das Foto. „Mein neuer Freund hatte Geld wie Heu, wohnte in einem, für meine Begriffe sündteurem Appartement und ließ die Puppen tanzen, dass mir schwindelig wurde. Aristo sah aber auch verdammt gut aus. Der fleischgewordene Traum aller Schwiegermütter“, schmunzelte er amüsiert.
„Wir schafften beinahe Gleichzeitig unseren Abschluss. Er hatte die letzen Semester in Thessaloniki absolviert. Unseren Sieg wollten wir gemeinsam feiern. Ich wurde nach Athen eingeladen, von der Familie begeistert aufgenommen, und verliebte mich zum ersten Mal. Meine Angebetete war Aristos Schwester Anastasia. Eine Traumfrau, wie du sehen kannst. Rassig, vollbusig, mit blauschwarzem Haar und einem himmlischen Körper. Wir liebten einander mit hingebungsvoller Leidenschaft.“
Alain saß mit offenem Mund da. Er konnte nicht fassen, den eingefleischtesten Junggesellen aller Zeiten mit solcher Inbrunst und Erregung über ein weibliches Wesen sprechen zu hören.
„Ich blieb sechs Wochen als Gast bei der Familie Karikiades, wurde verwöhnt und geliebt, wie ein Sohn. Vor meiner Abfahrt hielt ich um die Hand der wunderbaren Anastasia an. Überrascht, doch wohlwollend wurde mein Antrag angenommen. Papa erteilte uns seinen väterlichen Segen, Mama war aufgelöst in einem Tränenmeer. Ein halbes Jahr später heirateten wir. Ana erhielt eine stattliche Mitgift, die wir in den Aufbau einer Firma in Paris investierten. Auch meine Zieheltern waren von dieser Verbindung sehr angetan.
Das Glück schien vollkommen, als sich nach wenigen Monaten Zuwachs ankündigte. Hektik und Aufregung in Frankreich, wie in Griechenland. Telegramme flogen täglich hin und her, die Telfonleitungen liefen heiß. Anas Familie war in den letzten Wochen der Schwangerschaft herübergeflogen, um nur keinen Augenblick des großen Ereignisses zu versäumen. Auf den Tag genau machte der neue Erdenbürger seine Ankunft mit heftigen Schmerzen und stundenlangen Wehen deutlich, fast vierundzwanzig Stunden lang. Verzweifelt klammerte sich Ana an mich, hielt mich fest, krallte ihre Nägel in meine Haut, schrie.
„Machen sie sich keine Sorgen“, hörte ich die verbindliche Stimme des Arztes. „Es wird zwar eine schwere Geburt, doch wir schaffen das gemeinsam. Sie müssen sich nur etwas gedulden. Bleiben sie bei ihrer Frau, das wird ihr alles erleichtern.“ Bernards Gesicht wurde unendlich traurig. Die Stimme versagte für Augenblicke.
„Ana wurde bewusstlos. Unerträgliche Schmerzen hatten sie überwältigt. Plötzlich schien Eile geboten. Ein Stab von Ärzten stob um ihr Bett, drängte uns aus dem Raum. Unter einem Beatmungsgerät wurde sie in den OP gebracht. Anas Mutter erlitt einen Nervenzusammenbruch. Die Sorge um meine geliebte Frau trieb mich fast zum Wahnsinn. Es war kurz nach Mitternacht. Der Chefarzt, seine ernste Miene. Mit gesenktem Haupt und verzweifelter Gestik sprach er aus, was ich in den letzten Stunden immer wieder heftig zu verdrängen suchte.
„Wir konnten nichts mehr tun. Ihre Frau und das Baby sind vor wenigen Minuten verstorben.“
Bernard konnte kaum weiter sprechen. Seine Stimme brach, Tränen flossen über sein Gesicht. Starr und bleich saß er da, durchlebte diesen schrecklichsten Moment seines Lebens ein zweites Mal.
„Ich wollte diesem Stümper an die Gurgel. Aristo hielt mich mit fester Hand zurück. Vater Karikiades fragte übermenschlich gefasst: „Wie konnte das geschehen. Beide waren doch nach Ansicht der Ärzte in bestem Gesundheitszustand?“
„Vielleicht gerade deshalb. Wir waren überzeugt, einer natürlichen Geburt stünde nichts im Wege.“ Die Wehen hatten das Kind bereits zu tief in den Mutterhals gedrückt. Auch ein Kaiserschnitt konnte keine Lösung mehr bringen. Wir haben wirklich das Menschenmöglichste getan, sie zu retten!“
„Erfolglos, wie man sieht, ihr Stümper. Ihr Mörder. Ihr habt mir das Liebste auf Erden weggenommen. Einfach geraubt.“ Mit meiner Beherrschung am Ende, brüllte ich all meine Verachtung, meinen Hass auf dieses Unglück, meine Verzweiflung heraus, wie ein weidwundes Tier.“ Bernard schritt langsam zum Fenster, versuchte die Fassung wieder zu erlangen.
„Begreifst du jetzt, warum ich nie ein Wort darüber gesprochen habe? Vielleicht war es gut, all das noch einmal durchzuleben, zu erzählen, meinem Herzen die Möglichkeit zu geben zu verzeihen. Es war ein Gott gewolltes Schicksal, das mich in diese Seelenpein getrieben hatte. Seit damals haderte ich mit diesem Herrn über Leben und Tod. Ein törichtes Unterfangen, das weiß ich jetzt selbst. Aber die Verzweiflung hielt mich in ihren Fesseln gefangen. Ich dachte sie nie wieder loszuwerden. Jetzt geht es mir besser, ich fühle es.“
Wortlos lagen sich die beiden Männer in den Armen.
Bernard fasste sich ziemlich rasch wieder.
„Als Ehrenmann fühlte ich mich verpflichtet Anas Mitgift zurückzugeben. Dass damit meine neu gegründete Existenz, meine gesamte Zukunftsplanung über den Jordan ginge war mir klar, aber mein Gewissen verlangte es.
Fast gleichzeitig fingen der verzweifelte Vater und ich zu sprechen an.
„Du behältst die Mitgift. Ich war sehr stolz auf dich und deine Entscheidung, den Betrieb aufgemacht zu haben. Dieses Werk soll erhalten bleiben. Wir lieben dich doch wie einen Sohn.“
Ich ließ die bereitgestellte Summe in ein Darlehen umwidmen. Sobald es meine Mittel erlaubten, zahlte ich alles zurück.
Ja, so war das damals, mein Junge. Ich schuftete wie ein Besessener, versuchte meinen Schmerz mit Arbeit zu kompensieren. Wie wir jetzt dastehen, brauche ich dir nicht zu erläutern. Das weißt du besser als jeder andere. Übrigens, mit Aristo Karikiades bin ich immer noch in enger Verbindung. Es wurde eine Freundschaft fürs Leben, die uns beiden sehr wichtig ist.“ Bernard lehnte sich zurück, hing seinen Gedanken nach.
„So mein Junge, geh jetzt nach Hause. Versuche dein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Zum wirklichen Leben gehört absolute Aufrichtigkeit.“
„Aufrichtigkeit?“ stammelte Alain zweifelnd. Sein Blick war forschend, die Pupillen plötzlich ganz dunkel.
„Planen wir nicht, werden wir verplant. Kümmern wir uns nicht, dann verkümmern wir. Im Glück wie in der Trauer, in der Niederlage wie im Erfolg, ist die persönliche Aktivität ausschlaggebend für deine Gefühle. Du musst dich selbst einbringen um zu leben, letztendes um zu überleben.“ Vertrauensvoll klopfte Bernard seinem Schützling auf die Schulter.
„Du schaffst das schon. Übrigens“, fügte er noch rasch hinzu, „was ich dir heute erzählt habe bleibt unter uns. Kein Mensch weiß davon, nicht einmal deine Mutter. Dein Vater hatte es gewusst. Adieu mein Junge, bis Morgen. Mit neuem Tatendrang, neuem Mut, wie es sich für einen Mann gehört!“
Dieses Gespräch hatte vor einigen Wochen stattgefunden. Getröstet und voll Optimismus durchlebte Alain eine beglückende Wandlung seiner selbst. Darum stimmte er auch dem Vorschlag Marie-Louises letztendes zu, das kommende Osterfest noch einmal auf Schloss Vallouchon zu verbringen. Hier wollte er, wie ein Jahr zuvor, ihrer beider Liebe neu entfachen, die altvertraute Leidenschaft anheizen, seiner Marie all ihre schnöden Spielchen verzeihen, schlichtweg glücklich sein.
Das Schicksal hatte es anders gewollt. Marie-Louise verfiel in Gesellschaft der leichtsinnigen Freunde blitzartig in ihr gewohntes Fahrwasser. Sie flirtete, ließ sich ungeniert eindeutige Avancen machen. Sie kompromittierte Alain auf verletzende Weise. Er war geflohen und hatte Isabelle getroffen.
„Wenn es den Schmerz nicht gäbe, könnte man die Freude nicht schätzen.
Vier Jahre später in Wien.
Seit Stunden schon irrte Isabelle in dem kahlen Haus umher. Leere Gardinenstangen, kahle Wände, matte Parkettböden. Vorhänge und Teppiche waren in der Reinigung, Möbel auf kleinstem Raum zusammen geschoben, mit Tüchern und Packpapier abgedeckt. In der weitläufigen Diele hatten die Maler am Vormittag Leitern und Farbtöpfe abgestellt. Morgen sollte mit der Renovierung begonnen werden.
Schweren Herzens hatte sie das elterliche Haus mitsamt Inventar, Ordination- und Privaträumen, an einen jungen Arzt vermietet. Ein Entschluss, den sie bis zum letzten Moment hinausgezögert hatte. Unmittelbar bevorstehende Ereignisse erforderten durchgreifende Maßnahmen. Ein großes Schild prangte an der Eingangspforte. „Neueröffnung der Ordination in zwei Monaten!“
Ob der „Neue“ wohl so tüchtig sein würde wie einst Dr. Steiner, ihr Vater? Sie kannte den jungen Arzt kaum, hatte lediglich einige Male mit ihm telefoniert, ihm dann bei einem kurzen Abendessen den Mietvertrag unterfertigen lassen.
Jetzt zupfte sie an lose hängenden Tapeten, wischte mit einem Lappen über die Glasflügel der großen Wohnzimmertüre, betrachtete mit starren Augen die dunklen Risse im Parkett. Immer wieder kehrte sie in ihr vertrautes Kinderzimmer zurück, wo sie zufrieden und froh war, weil niemand sie störte. Die letzten Jahre hatte sie hier glücklich gelebt.
Seit frühester Kindheit hegte Isabelle den Wunsch, ebenfalls Ärztin zu werden. Der Vater, ein in Wien anerkannter Internist und Diagnostiker, lebte ihr selbstlose Menschlichkeit vor, die Mutter mit Verständnis und Geduld mehrte. Vater meldete häufig Bedenken an.
„Arzt sein ist ein Beruf voll Aufopferung und Selbstaufgabe. Möglicher Weise musst du auf eine Familie, auf Kinder verzichten.“
All diese wohlgemeinten Einwände konnten Isabelle von ihrer vorgefassten Leidenschaft nicht abbringen. Das Lernpensum der Maturaklasse erledigte sie mit Mindestaufwand. Das war auch nötig bei all den Aktivitäten, die sie sonst noch verwirklichen wollte. Ihr Terminkalender glich dem eines Managers. Montag hatte sie seit ihrem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht. Später studierte sie auch Gesang. Dienstag und Freitag wurde geritten. Pferde waren Isabelles zweite große Leidenschaft. Mit sieben Jahren hatte sie bereits begonnen. Um Mutters Ängste zu beruhigen, wenn die temperamentvolle Tochter stundenlang durchs Gelände streifte, kaufte sich Papa auch ein Pferd. Er begleitete sie, wann immer es seine Zeit erlaubte. Tosender Applaus bei Wettkämpfen, wenn sie wagemutig über Hindernisse setzte. Angst kannte sie nicht. Mutter meinte bisweilen etwas geschockt. „Ich wäre sehr froh, du würdest dich einmal fürs Schachspielen interessieren!“
Isabelle liebte nun mal das Außergewöhnliche. Mittwoch und Donnerstag jobbte sie mit Eifer. Sie gab Nachhilfestunden, und unterstützte die Freundin ihrer Mutter bei der Aufzucht ihrer vier Sprösslinge. Knochenarbeit, die sie ebenfalls mit bestem Erfolg absolvierte. Immerhin konnte sie sich einen Gutteil ihrer reichlich teuren Reitstunden damit selber finanzieren.
Die Wochenenden waren ausgefüllt mit Lernen, Kuchenbacken und sonstigen Annehmlichkeiten, wie Geburtstagspartys, später Tanzkränzchen beim Hübner im Stadtpark. Nach bestens bestandener Matura schrieb sie sich auf der medizinischen Fakultät ein. Vom ersten Augenblick an war sie eine begeisterte Hörerin, die allen Schwierigkeiten mit Bravour trotzte. Sie büffelte viele Nächte lang, wollte ihrem Vater absolut keine Schande machen.
„Ich habe es geschafft Papa! Du kannst stolz auf dein Mädchen sein“, flüsterte sie jetzt mit tränenerstickter Stimme.
Das Medizinstudium hatte ihr wenig Freiraum gelassen. Vorlesungen bis spät in die Nacht. Anatomie, Biologie, Chemielabor, Physikalisches Institut. Sie war von einer Vorlesung zur anderen geschwirrt, hatte besessen geschuftet, war brillant vorangekommen. In kürzest möglicher Zeit hatte sie ihre Prüfungen abgelegt. Jetzt famulierte sie im AKH, dem größten Krankenhaus Wiens, verbrachte viele Nächte dort. Das Haus stand also wirklich sehr oft leer. Warum überkam sie heute solch entsetzlicher Abschiedsschmerz. Etwas unerklärbar Endgültiges.
Leere Kartons warteten geduldig mit Habseligkeiten vollgefüllt zu werden. Nichts geschah. Ihr Hirn war ausgebrannt, die Glieder unendlich schwer. Warum tat sie sich das an? Sie wollte die Städte ihrer Kindheit doch gar nicht verlassen. Trotzdem schien alles seinen Lauf zu nehmen, unabänderlich, vorprogrammiert.
Schätze aus längst vergangenen Kindertagen, Spieldosen, Puppen, Teddybären, Bilder an den Wänden, all das sollte für immer verloren sein? Sie liebte jedes einzelne Stück, verband unauslöschliche Erinnerungen mit ihnen. Hier war sie zufrieden, unbeschwert, bis zu diesem Herzzerbrechenden Augenblick vor vier Jahren, als zwei Polizisten vor der Tür standen, mit ernster Miene das Schreckliche vermeldeten.
„Ihre Eltern sind heute Morgen bei einem Verkehrunfall auf der Autobahn verunglückt. Ihr Vater starb noch an der Unfallstelle. Ihre Mutter wurde ins Allgemeine Krankenhaus gebracht!“ Ungläubig hatte sie die beiden Männer angestarrt. Sie wollte die Tür zuschlagen, alleine sein. Doch der ältere meinte, man würde sie ins Krankenhaus bringen, wenn sie das wolle. Sie war mitgefahren.
Mutter lag in Verbände gewickelt unter einem Sauerstoffzelt. Zischen und Klopfen erfüllte den Raum. Ein Gewirr von Schläuchen. Lebenserhaltende Infusionen, hoffte Isabelle. Unablässig streifte sie über die blasse Hand der sterbenden Frau. Kalt lag sie regungslos auf dem Laken.
„Mutter, kannst du mich hören. Ich bin es, deine Isabelle. Komm mach die Augen auf, schau mich einen Moment lang an, bitte Mutter!“
Schluchzend wandte sie sich an den eintretenden Arzt. „Wird sie überleben? Mutter ich brauche dich! Lass mich nicht allein!“
Stunden waren vergangen. Isabelle war auf dem unbequemen Stuhl eingenickt. Monotone Signale der Apparaturen. Irgendwann, nach Mitternacht schreckte sie auf.
„Isabelle“, hörte sie die flüsternde Stimme.
„Mutter, bist du wach. Kannst du mich hören?“
Sie blickte in gebrochenen Augen einer sterbenden Frau. Die Lider flatterten. Mühsam hob Mutter die blasse Hand an die Wange ihrer geliebten Tochter, lächelte. Ihre Finger berührten sich erst zaghaft, dann immer heftiger. Ein verzweifelter Kampf. Sie fühlte, dass Mutter ihr etwas sagen wollte. Die Lippen formten sich zu Worten, kaum hörbar, schließlich doch verständlich.
„Isabelle, du musst stark sein. Du schaffst es mein Kind. Paris. Suche Marie-Louise de Valloir. Sie ist…. «
Kraftlos sank die sterbende Frau in die Kissen zurück. Nach wenigen Augenblicken erfüllte ein starrer Pfeifton den Raum. Fassungslos starrte Isabelle auf den Monitor.
„Jetzt bin ich alleine, habe keinen Menschen mehr, der mich liebt“, wimmerte sie kaum hörbar. In ihrem Kopf hämmerte Enttäuschung, Kummer, Verzweiflung. Ein heftiger Schmerz erfüllte ihre Brust, breitete sich langsam in ihrem ganzen Körper aus. Regungslos starrte sie aus dem Fenster. Der Mond stand am tiefblauen Himmel, tröstend, unbeirrbar.
Ein entsetzlicher Schock
Nachdem der erste Schmerz etwas nachgelassen hatte, beauftragte Isabelle einen Detektiv, sich nach besagter Marie-Louise de Valloir zu erkundigen. Der Mann wurde tatsächlich fündig. Ein ausführlicher Bericht folgte.
„Marie-Louise Dubois, geborene de Valloir, stammt aus adeligem Hause. Eltern bewohnen ein wunderbares Anwesen in der Nähe von Paris. Die genaue Adresse war angegeben. Seit vierzehn Jahren mit einem gewissen Alain Dubois, Oberprokurist der Firma Bernard Villot, verheiratet. Wohnadresse und einige Photos lagen bei. Zum Abschluss standen noch andere Namen und Adressen. Freunde oder Bekannte der Dame. Bei diesen Leuten verkehre sie regelmäßig.
Wer war diese Frau? Was meinte Mutter mit ihren letzten Worten. Noch nie hatte sie diesen Namen vorher gehört. Neugierig durchstöberte sie den Sekretär des Vaters. In einem, mit zusätzlichem Schlüssel versperrtem Fach, fand sie schließlich ein versiegeltes Kuvert.
Ich, Marie-Louise de Valloir, gebe mein Kind unmittelbar nach der Geburt zur Adoption frei. Vater unbekannt. Vor dem Pflegschaftsgericht bestätige ich, dass mein Kind von dem Ehepaar Dr. Anton Steiner und Frau Regine Steiner adoptiert wird. Jede Menge Stempel und Unterschriften besiegelten den Vertrag.
Erschüttert, völlig verwirrt, las Isabelle damals diese Zeilen immer und immer wieder. Warum hatten ihr die Eltern nie ein Wort gesagt? Hofften sie, sie würde es nie erfahren? Wollten sie ihr diesen Schmerz nicht antun, der sie nun mit doppelter Wucht traf. Nächtelang lag sie wach, fühlte sich verraten, im Stich gelassen, betrogen. Kein Mensch war da, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Keiner der zahlreichen Bekannten, der vermeintlichen Freunde ihrer Eltern, hätte für ihr seelisches Dilemma Verständnis gehabt.
Langsam realisierte sich der Plan. Sie musste nach Paris reisen, musste die Person kennen lernen, die sie damals vor mehr als achtzehn Jahren buchstäblich verschenkt hatte, wie ein Schachtel Bonbons, ein wertloses Spielzeug.
Vielleicht würde sie ja jetzt, nach so langer Zeit, eine vernünftige Frau antreffen, mit der sie eine neue Lebensplanung ausarbeiten könnte. Vielleicht würde sie nach Paris übersiedeln, um an der Sorbonne ihre Studien zu beenden. Wer weiß, was das Schicksal möglicher Weise alles mit ihr vorhatte.
So war sie damals vor vier Jahren nach Paris gefahren, hatte eher zufällig von dem Osterfest bei den Montinacs auf Schloss Vallouchon erfahren. Als Aushilfsküchenhilfe war sie ohne Probleme eingestellt worden, brauchte nur mehr zu warten, bis die Gäste eintrafen. Dann hatte sie ihre leibliche Mutter zum ersten Mal gesehen. Anfänglich von ihrem entzückenden Äußeren begeistert, konnte sie kaum an sich halten sich ihr zu nähern. Doch schon nach kürzester Zeit erkannte sie, dass diese Frau mit ihren glorifizierten Vorstellungen soviel gemeinsam hatte, wie ein Riesenkrake mit einem Schoßhündchen. Marie-Louise war der Inbegriff eines männermordenden Ungeheuers. Ihr Ehemann hingegen war reizend, charmant und mehr als zuvorkommend. Er schien Höllenqualen zu leiden neben diesem zauberhaften, zierlichen Vamp, der Männer jeder Altersklasse zum Frühstück, zum Mittagmahl und zum Abendessen verschlang, wie luftiges Parfait. Isabelle hatte Mitleid mit dem liebenswürdigen, geduldigen Mann, wenngleich sie ihn für einen ziemlichen Waschlappen hielt, der eigentlich überhaupt keine Gnade verdiente. Die sogenannte Mutter hatte sie bereits nach den ersten vierundzwanzig Stunden wieder seelisch entsorgt. Doch Alain wollte sie unbedingt näher kennen lernen. Womöglich war er ihr Vater, oder wusste zumindest irgendetwas, was ihr auf die Sprünge helfen konnte. Denn medizinisch gesehen war es nun einmal eindeutig. Sie wurde gezeugt, von wem auch immer. Eine unangefochtene Tatsache.
„Was macht diese Person in meinem Haus! Kannst du mir das erklären!“ Um elf Uhr morgens, am Dienstag nach Ostern, war Marie-Louise damals plötzlich mitten im Wohnzimmer gestanden, hatte Alain mit funkelnden Augen angekeift.
„Du hast dich ja schnell getröstet, mein teurer Gatte. Nimmst dir ein junges Flittchen ins Haus, während ich mich vor meinen Freunden bemühe, eine plausible Ausrede für dein brüskierendes Verschwinden zu konstruieren!“
Isabelle, in Marie- Louises Morgenmantel gehüllt, etwas strubbelig, doch bestens gelaunt, hatte Mühe das Tablett mit dem Frühstückskaffee nicht fallen zu lassen. Alain stand völlig hilflos da. Vergeblich versuchte er den aufgebrachten Wortschwall seiner Gattin zu unterbrechen. Ein aussichtloses Unterfangen. Madame stob wie eine Furie durch das Haus. Für sie war die Situation völlig eindeutig. Sie riss einige Koffer aus dem Garderobenschrank, kippte etwa fünf Dutzend Schuhe vor sich auf den Boden, fegte in die obere Etage, schmetterte eine Gemeinheit nach der anderen durch die weitläufigen Räume.
Isabelle hatte die Szene damals beinahe belustigend gefunden. Als Marie Louise mit einem riesigen Berg Klamotten die breite Treppe wieder heruntertorkelte, stellte sie sich ihr in den Weg.
„Madame, nur einen Augenblick. Bitte.“ Ein vernichtender Blick stampfte sie in den Boden, doch Isabelle sprach laut und deutlich weiter.
„Madame, ich bin Isabelle Steiner aus Wien. Vielleicht erinnern sie sich an diesen Namen. Ich bin ihre Tochter!“
Marie ließ den Wust Kleider fallen. Leichenblass stand sie einen Moment lang fassungslos, vor der jungen Frau. Alain war ebenfalls weiß im Gesicht geworden. Plötzlich lachte Marie- Louise hysterisch auf.
„Sind sie ja völlig verrückt. Was fällt ihnen ein, eine solche Behauptung aufzustellen. Verschwinden sie augenblicklich aus meinem Gesichtskreis, oder ich rufe die Polizei.“
Isabelles Lächeln blieb sphinxenhaft. „Sie glauben tatsächlich dies ist die Lösung ihres Problems. Ich habe es schwarz auf weiß!“ Isabelle hielt den Briefumschlag mit dem aufgebrochenen Siegel in die Luft. Marie- Louise stürzte sich wie von Sinnen auf das Mädchen, versuchte ihr den Brief aus den Händen zu reißen. Jetzt hatte sich auch Alain wieder gefangen. Vehement drängte er sich zwischen die beiden Frauen.
„Kann mir vielleicht jemand erklären, was das alles zu bedeuten hat?“
Marie-Louise ließ sich schluchzend auf den Teppich fallen. Sie spielte die Leidende, Missverstandene, Betrogene, mit perfekter Überzeugungskraft. Isabelle lief ins Gästezimmer. Wenig später stand sie, bepackt mit ihren wenigen Habseligkeiten, wieder im Raum.
„Ich habe mich sehr gefreut Alain, dich kennen gelernt zu haben und danke dir auch von ganzem Herzen für deine Liebenswürdigkeit.“ Marie Louise bedachte sie mit einem vernichtenden Blick. Besser keine Mutter als eine solche, überlegte sie resigniert, nahm ihren Regenmantel vom Kleiderständer und öffnete die Eingangstür.
„Warte Isabelle, ich bringe dich.“ Wenig später verließen beide in Alains Wagen das Haus. Er hatte eine ganze Weile gebraucht, die Sprache wieder zu finden. Schließlich hielt er vor einem Café, lud Isabelle zu einem ausgiebigen Déjeuner ein.
„Was machen wir jetzt mit dir?“, fragte er etwas zögerlich. „Du hattest doch die Absicht in Paris zu bleiben? Nach diesem Vorfall hast du vermutlich deine Pläne geändert?“
„Allerdings!“, meinte diese stockend. „Schade, ich hatte mir alles so schön ausgemalt.“ Richtig betrübt klang ihre Stimme. Aufsteigende Tränen füllten die wunderschönen Augen.
„Du solltest aber dennoch nichts übereilen. Nimm dir ein Zimmer, und bleibe wenigstens noch ein paar Tage in der Stadt. Wir könnten uns dann wieder sehen, alles weitere in Ruhe überlegen.“
Alain hatte seine Hand auf die ihre gelegt, drückte sie liebvoll, tröstend. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
„Du bist ein feiner Kerl, Alain. Ich bin wirklich froh, dich kennen gelernt zu haben. Aber du hast ja Marie-Louises Reaktion selbst miterlebt. Sie mag mich nicht. Ich passe absolut nicht in ihre Lebensplanung. Aufdrängen will ich mich bestimmt nicht.“
„Was hat dich denn gerade jetzt bewogen, deine leibliche Mutter zu suchen?“
Stundenlang hatte Isabelle von ihren liebenswerten Eltern erzählt, von deren tragischem Tod, von ihren Plänen, Ärztin zu werden. Alain hatte still dagesessen, ohne sie ein einziges Mal zu unterbrechen.
„Wenn du willst, tauschen wir Adressen und Telefonnummern aus. Wir könnten ja in Kontakt bleiben. Ich werde dir von meinen Erfolgen auf der Uni berichten, du erzählst mir den neusten Tratsch von Paris. So habe ich wenigsten einen guten Freund, dem ich mein Herz ausschütten kann wenn es Not tut.“ Jetzt lachte sie wieder. Gleich darauf zückte sie den Kuli.
Alain überreichte seine Visitenkarte und nahm ihr das Versprechen ab, wann immer sie etwas brauchte, sich unbedingt und ohne Scheu an ihn zu wenden.
„Ich bin zwar mit Sicherheit nicht dein Vater, meine liebe Isabelle. Ein solches Prachtstück hätte ich bestimmt nie fertig gebracht. Aber ich will dein bester Freund sein, wenn du es akzeptierst.“
Etwas verlegen fügte er noch hinzu. „Entschuldige, aber brauchst du vielleicht Geld? Kann ich dir wenigstens diesbezüglich behilflich sein?“
„Willst du mich etwa für meine Hostessendienste während der Ostertage bezahlen“, scherzte sie lachend. „Nein Alain. Ich habe ausreichen Geld zur Verfügung. Meine Eltern waren sehr wohlhabend. Papa hat eine immense Lebensversicherung abgeschlossen, die, da meine Mutter ebenfalls tot ist, mir zugute kommt. Für mein leibliches Wohl ist also bestens gesorgt. Nur mit dem seelischen werde ich noch eine Weile lang Probleme haben. Aber ich schaffe das, glaub mir. Ich stürze mich mit ganzer Kraft in mein Studium, dann habe ich bestimmt keine Zeit mehr nachzugrübeln. Das Leben geht weiter. Mein großes Ziel, du weißt ja.“ Sie hatte sich enthusiastisch erhoben. Plötzlich schien sie es eilig zu haben.
„Könntest du mich noch zum Flughafen bringen. Ich möchte eigentlich gerne so rasch wie möglich wieder nach Hause.“