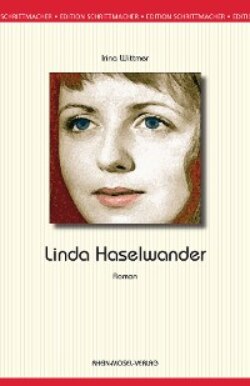Читать книгу Linda Haselwander - Irina Wittmer - Страница 3
ОглавлениеErster Teil
Linda, Malte, Hermina, Franz
Linda
Linda Haselwander wurde im Juni 1953 geboren. Ihre Mutter reichte gerade einen Laib Brot über die Theke, als die Wehen jäh und furchtbar einsetzten. Sie rief den Gesellen, der frühstückte, in den Laden und legte sich nebenan in der Küche auf das Kanapee.
Linda kam zur Welt während draußen unentwegt die Ladenglocke ging, während ihr Vater in der Backstube seinen Kirschstrudel, für den er bekannt war, aus dem Ofen zog und während ihre Großmutter im Waschhaus dampfende Laken aus dem Kessel zum Spülen in den Bottich hob.
Als keine Kundinnen mehr kamen, schaute der Geselle kurz in die Küche. Es war peinlich. Er hatte nichts gehört. Eilig schloß er die Ladentür ab und zog den Vorhang vor. Die alarmierte Hebamme mußte das Kind nur noch abnabeln und baden. Immer wieder sagte sie, das ist ja ein ganz Zartes das, und die Großmutter versuchte, das verdorbene Kanapee zu säubern und mit weißen Tüchern zu bedecken, damit ihre Schwiegertochter ordentlich daliegen würde. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Oben stand der für das Krankenhaus gerichtete Koffer. Über ein Monat wäre noch Zeit gewesen. Der Vater und der Geselle mit ihren hohen Bäckerhüten auf den Köpfen schafften den Stubenwagen vom Schlafzimmer herunter, und das Kind, das kaum geschrien hatte, wurde hineingelegt.
Die junge Mutter hieß Irmtraud. Ihr Vater arbeitete in einem Sägewerk, und sie hatte drei ältere Brüder und vier jüngere Schwestern. Aber sie war mit ihrem wunderbaren blonden Haar, das sie noch bis zur Hochzeit in vier Zöpfen geflochten trug, das schönste Mädchen ihres Jahrgangs gewesen, und an Festtagen hatte sie im Kirchenchor die Solostimme gesungen. Jetzt schwieg sie wie unter einem Schock und weinte sogar lautlos, als ihr die Hebamme half, die Schürze und das Kleid auszuziehen. Erst als sie gewaschen, in einem frisch gestärkten Nachthemd und gut zugedeckt auf dem Kanapee lag, spürte sie ein wenig Erleichterung.
Natürlich hätte sie lieber zuerst einen Jungen gehabt. Er hätte nach seinem Vater Herrmann heißen müssen. Für ein Mädchen wußte sie jedoch einen schöneren Namen. In einem Roman, der auf einer afrikanischen Missionsstation spielte, und den sie viele Male gelesen hatte, kam eine Linda vor. Sie wurde die Frau des Pfarrers dort. In der Hochzeitsnacht sagte er zu ihr, Linda, was ich jetzt tun muß, geschieht im Namen des Herrn. Er war ein sehr rücksichtsvoller Mann, und sie schenkte ihm viele Kinder.
*
Huwihl liegt im Hochschwarzwald, in einer langgestreckten Talmulde, durch die ein Bach fließt. Die Berge steigen sanft an, sie sind mit Wiesen und im oberen Drittel mit Wald bedeckt. Bei bestimmten Wetterlagen kann man vom Aussichtsturm auf dem Immliberg oben bis zu den Schweizer und den Französischen Schneealpen sehen. Sie glühen dann am Horizont, als wollten sie verbrennen.
Im Sommer kommen Feriengäste zum Wandern und zum Angeln, neben der Landwirtschaft ist das Vermieten von Zimmern eine wichtige Einnahmequelle. Entlang des Baches verläuft die Hauptstraße. Dort sind einige Geschäfte und Wirtshäuser, als Spezialität bieten sie vor allem Forellen an, die in vielen Variationen zubereitet werden. Seine Lage teilt den Ort in eine Sommerseite und in eine Winterseite. Von Oktober bis März scheint auf der Winterseite keine Sonne, so daß die Leute in ihren finsteren Zimmern schwermütig werden. Die meisten Häuser unten im Tal, wo, außer der katholischen, auch die kleine evangelische Kirche steht, sind aus Fachwerk gebaut. An den Hängen stehen vereinzelt Höfe mit ihren trutzigen Dächern und den blumengeschmückten Balkonen.
Für Herrmann Haselwander, der gerne sagt, die Flöhe und die Wanzen gehören auch zum Ganzen, ist es ein Nachteil, daß seine Bäckerei nicht wie die seiner beiden Kollegen unten an der Hauptstraße liegt. Wer die Backwaren von Herrmann Haselwander kaufen möchte, muß eine schmale Straße ungefähr zweihundert Meter weit hinaufgehen. Dort ist es gleich der erste Hof, ein typisches Schwarzwaldhaus, allerdings nicht mehr mit Stroh, sondern mit Schiefer gedeckt. Die Fassade besteht aus weiß gestrichenen Schindeln, auch das Balkongeländer, eine aufwendige Laubsägearbeit, ist hell gestrichen, so daß das Haus, trotz des mächtigen Daches, freundlich und wie für ein Spiel aufgebaut wirkt.
Noch vor der Währungsreform hat Herrmann Haselwander umgebaut und renoviert. Das Geld dazu gab ihm seine Mutter, die aus Bad Hohenbirch, der nahen Kreisstadt, stammte und die ein kleines Vermögen erbte, als ihre Tante starb. Wo früher der Stall war, ist das Haus jetzt nach hinten zur Bergseite verlängert, und es sind eine moderne Backstube und ein Laden mit einer weiß lackierten Theke und Vitrinen für die Kuchen und Pralinen eingerichtet worden. Über der Backstube und dem Laden entstanden zwei Fremdenzimmer mit fließend Kalt- und Warmwasser. Die Hausgäste bekommen ihr Frühstück in der Küche, wo sie besonders an kalten Tagen lange sitzen und die Aussicht über das ganze Tal genießen. Wenn sie baden wollen, steht ihnen, nach Anmeldung, das Familienbad zur Verfügung.
Die Ställe für die Kuh, die zwei Schweine, die Hasen und die Ziegen sind in der Scheune untergebracht. Die Waschküche, in der es außer dem Einweichbottich und dem Kessel für die Kochwäsche auch eine automatische Maschine und eine Schleuder gibt, befindet sich jetzt im ehemaligen Backhäuschen.
Linda wurde auf der Sommerseite, in Licht und Wärme und in den Duft nach frisch gebackenem Kirschstrudel hinein geboren. Ihr Vater und der Geselle trugen die hohen Bäckerhüte, die Großmutter hatte das Kopftuch fest im Nacken gebunden, und die Hebamme, die sagte, das ist ja ein ganz Zartes das, wurde von einem gefältelten Häubchen mit hellblauem Rand geschmückt. Es war an einem der ersten warmen Tage, die Wiesen blühten, und durch das geöffnete Küchenfenster kam das ewige Plätschern des Brunnens im Hof.
Solange Linda in den Stubenwagen paßte, trugen ihn die Großmutter und die Mutter morgens aus dem Schlafzimmer in die Küche hinunter und abends wieder hinauf. Als sie größer war, wurde der Laufstall in der Mitte der Küche aufgestellt und mit einer Decke und Kissen ausgepolstert. Im Laufstall konnte sie schlafen und auch spielen, ohne daß ihr etwas passierte, während die Mutter im Laden bediente. Oft streckten Kundinnen wegen Linda ihre Köpfe in die Küche und sagten, das ist ja praktisch mit dem Ställchen, wie schön sie sich darin verweilt. Und oben auf der Konsole stand das Radio, spielte Operettenmelodien und beobachtete Linda mit seinem leuchtenden grünen Auge.
Aber wenn ihr die Mutter zu lange im Laden blieb, weinte Linda still und gleich sehr verzweifelt. Oft boten sich Feriengäste an, das Kind auf ihren Spaziergängen mitzunehmen, doch das wollte die Mutter nicht. Immer fand sie Ausreden, warum es eben an diesem Tag nicht paßte. Was Linda betraf, war sie entschiedener als sonst.
Lindas Lebenskreis erweiterte sich langsam. Der Stubenwagen, der Laufstall, die Küche. Die Großmutter meldete Linda, nachdem sie zwei Jahre alt war, im Kindergarten an, aber die ließ Schreie vor Entsetzen, obwohl sie doch gerne mit den Kindern dort gespielt hätte. Meistens richtete es die Mutter so ein, daß Linda bei ihr zu Hause bleiben konnte. Heute hat sie zu lange geschlafen, heute hat sie Halsschmerzen, heute will ihre Tante Else kommen und sie sehen. Linda mußte sich mit der Langeweile einrichten und sich allein beschäftigen. Oft war sie müde. Während der dunklen Wintermonate, wenn in Huwihl meistens meterhoher Schnee lag, kam sie kaum hinaus.
Als Linda fünf Jahre alt war, brachte das Ehepaar Lübchen aus dem Rheinland, das jahrelang immer Anfang August zur Erholung kam, seinen neuen Photoapparat mit. Linda steht im Hof neben dem Brunnen und macht ein Gesicht wie Kinder, die sich genieren, ein Gesicht machen, wenn man ihnen sagt, jetzt siehst du gleich das Vögelchen herauskommen. Obwohl gar nicht Sonntag ist, trägt sie ihr Sonntagsdirndl, und die Haare sind zu dicken Ohrschnecken gesteckt und mit einem Reif verziert.
Zum gleichen Sommer gehört eine Szene, die sie nicht vergessen wird. Da hat sie die dunkelrote Scheibengardine am Fenster der Tür zwischen Küche und Laden ein klein wenig zur Seite geschoben, wie sie es gerne macht, um sich zu unterhalten, denn meistens darf sie nicht in den Laden gehen, wo sie am liebsten wäre. Oft träumt sie sich hinaus, sie öffnet die Vitrinen, nimmt die Pralinenschachteln mit den breiten Schleifen und die silbrigen Bonbonnieren heraus, wischt die Fächer sauber aus und arrangiert alles neu. Sie hätte das gekonnt. Wenn sie viel bittet und bettelt, darf sie der Mutter manchmal beim Verkaufen helfen. Dann steht sie voller Bedeutung auf einem Hocker neben der Kasse und reicht den Kundinnen die mit Brötchen oder Süßstücken gefüllten Tüten.
Gerade kauft niemand ein. Wo ist die Mutter? Vielleicht ist schon Ladenschluß. Linda hinter der roten Scheibengardine sieht den Vater und die dicke Hieberin, die sich hinter der Theke gebückt hat, wie sie sich immer beim Putzen bückt. Aber ihr fleckiger, geblümter Rock ist hochgeklappt, so daß Linda die Unterhose sehen kann und die rosa Strapse, an denen die Strümpfe spannen. Die dicke Hieberin bewegt sich unruhig hin und her, während der Vater ihr den Hintern tätschelt wie die Großmutter der Kuh nach dem Melken immer.
*
Früher glaubten die Menschen, Engel bewegen die Sterne. Seit sich gezeigt hat, daß sie das nicht tun, glauben nur noch wenige Leute an Engel. Linda wurde durch den lieben Gott erzogen, der alles weiß. Nie schlief er. Sie sah ihn Tag und Nacht über den Himmel hingestreckt. Sein alles durchdringender Blick war auf die Erde gerichtet, neben ihm lag das dicke, rote Buch, in das er die Sünden eintrug.
Linda aß ihren Teller nicht leer und schüttete das Fleisch, den Blumenkohl und die Kartoffeln schnell in den Schweineeimer, als die Mutter in den Laden mußte. Linda lief, anstatt in den Kindergarten zu gehen, an den Bach und schaute bis zum Elf-Uhr-Läuten dem närrischen Gottfried beim Angeln zu. Linda schenkte einem Jungen, der ihr gedroht hatte, sie am nächsten Tag zu verhauen, eine gelbe Zuckerstange aus dem Laden. Das waren ihre Sünden. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen.
Natürlich wurde sie jedes Mal erwischt, weil sie schon auf die Andeutung einer Frage hin schuldbewußt in Tränen ausbrach. Die Großmutter sparte nicht mit Schlägen, und die Mutter stieß sie von sich und sagte, wer lügt und betrügt, kommt in die Hölle, und da ist es furchtbar schwarz und heiß, das wirst du schon merken. Aber sonntags, wenn Linda zwischen Mutter und Großmutter in der Kirche saß und die Orgel zum Eingang mächtig spielte, spürte sie mit wohligem Schauder, daß Gott ihr vergab. Sie glaubte ihrer inneren Stimme mehr als den Stimmen ihrer Mütter.
Die Wohnverhältnisse in dem Haus waren beengend, und überall knarrten die Holzböden und die Stufen. Nachts knabberten sich Mäuse durch die Wände, und in den Balken knackte es. Linda lag oft wach in ihrem Bettchen und fürchtete sich. Gerne hätte sie eine ihrer Puppen, und wenn es nur die allerkleinste gewesen wäre, bei sich gehabt, aber das erlaubte der Vater nicht. Er wollte einen mutigen Pimpf.
Unter der Woche spielte sich das Leben hauptsächlich in der Küche ab. Da gab es immer zu tun. Mittagessen kochen, Marmelade einkochen, Obst eindünsten, Geschirr spülen, Geschirr abtrocknen. Außer dem Elektroherd wurde auch ein Kohleofen benutzt, auf dem immer ein Bottich mit Wasser brodelte, das man zum Geschirrspülen am Wasserstein in ein Zinkwännchen schöpfte. Die Paradestücke in der Küche waren ein Buffet im Stil des »Gelsenkirchener Barock« und das vom Sattler nach Lindas Geburt neu aufgepolsterte und mit einem roten Velours bezogene Kanapee, zu dem es zwei runde Kissen gab. Von der Küche aus gelangte man in eine kleine Stube, zu der die Tür meistens offen stand. In der sogenannten Schreibstube telephonierte man, und die Großmutter und samstags auch Herrmann Haselwander saßen dort am Schreibtisch über den Geschäftsbüchern. Im ersten Stock waren außer den beiden Fremdenzimmern ein großes Bad, das Schlafzimmer der Großmutter und das Schlafzimmer der Eltern, in dem Lindas Gitterbett stand. Das Wohnzimmer nahm den Platz über Küche und Schreibstube ein. Es hatte einen Holzbalkon, der über der ganzen Breitseite des Hauses verlief und weit von dem trutzigen Dach überragt wurde, so daß man an milden Tagen, auch wenn es regnete, gemütlich im Trockenen sitzen und zum Dorf hinunter und weit über das Tal schauen konnte.
Linda wartete immer auf die Sonntage. Wie lange dauert es noch? Wenn die Großmutter samstags im Wohnzimmer den Kachelofen anheizte, war es schon fast soweit. Linda saß gerne da im Ohrensessel und hörte der Großmutter zu, die Harmonium spielte und dazu sang. Über dem Harmonium hing in einem schwarzen Rahmen ein Photo des ernst blickenden Großvaters. Schon vor dem Krieg war er an einem Herzleiden gestorben. Seine Eltern hatten das Haus Ende des vorigen Jahrhunderts gebaut. Außer diesem Photo gab es an den Wohnzimmerwänden nur noch ein Geweih und eine Pendeluhr, die fleißig schlug.
Immer wird der Gedanke an das Wohnzimmer im Elternhaus mit etwas Festlichem verbunden bleiben. An Weihnachten und an Ostern trugen sie sogar das Essen aus der Küche nach oben und aßen dort von dem weißen Porzellan und mit dem Silberbesteck, das zur Aussteuer der Großmutter, die Regula hieß, gehörte.
Vom Gang im ersten Stock aus führte eine schmale Stiege unter das Dach, wo früher der Heuboden gewesen war. Der Platz wurde jetzt als Speicher für allerlei altmodisches Gerät genutzt. Da standen Schränke, eine Getreidewaage, eine Zinkbadewanne und Petroleumleuchter. In einer mit Schnitzereien verzierten Truhe saß noch Leinenwäsche von der Urgroßmutter. Mit Monogrammen bestickte Tischdecken, Bettzeug, Schürzen, Unterröcke und lange Nachthemden. Linda spielte gerne heimlich hier und probierte vor dem halbblinden Spiegel die Sachen an. Und mit diesen Spielen verbunden war der würzige Duft nach den geräucherten Schinken, den Schwartenmägen und Würsten, die die Großmutter nach den Schlachttagen dort immer an einer Stange aufhängte. Von einem Teil des Speichers war das Zimmer abgetrennt, in dem der Geselle wohnte. Linda war es bei Androhung von Schlägen verboten, den Gesellen zu besuchen. Wenn sie jedoch da spielte und der Geselle kam oder ging, versuchte sie, wenigstens in das Zimmer hineinzublicken. Es war hell darin, denn es hatte ein großes Gaubenfenster. Linda sah das zerwühlte Bett, einen Ofen und einen schiefen Schrank, auf dem Schachteln gestapelt waren. So gerne wollte sie alles in Ruhe betrachten. Nie schloß der Geselle ab, wenn er in die Backstube hinunter ging, aber Linda wagte es nicht, die Tür zu öffnen.
*
Linda trägt das Dirndl mit der Herzchenschürze. Ihre Haare sind zu dicken Ohrschnecken gesteckt. Die Rheinländer, zu denen sie Tante und Onkel sagt, obwohl sie weiß, daß sie überhaupt keine richtigen Verwandten sind, wollen Photos machen. Sie haben ihr einen Haarreif mitgebracht, auf dem kleben Blüten ganz fest. Linda hat daran geknabbert, denn sie sehen genau aus wie die bunten Marzipanblüten, mit denen der Vater manche Torten verziert. Dieses Lehrerehepaar aus Bonn kommt jeden August. Sie haben selbst keine Kinder und kennen Linda, seit sie ein paar Wochen alt war. Eigentlich würden sie gerne einmal nach Bayern in Urlaub fahren, aber wegen Linda entscheiden sie sich immer wieder für Huwihl. Die Frau, die eine starke Brille trägt, sagt oft zu ihrem Mann, wenn wir sie nur mitnehmen könnten, bei uns hätte sie es so gut, wir könnten ihr wenigstens etwas bieten.
Linda wird nicht gerne photographiert. Sie wäscht die Hände unter dem Brunnenwasser und spritzt herum. Ihre Hände sind nie anders als rauh und zerkratzt. Sie macht sich wichtig. Sie will der Tante und dem Onkel Lübchen jetzt die Häschen zeigen. Das Tor zur Scheune, in der auch die Ställe sind, steht offen. Es ist ein heißer Tag. Yolande, die Kuh, hat sich gelegt und käut träge, was ihr Magen heraufschickt. Weil Linda die Sonntagsschuhe anhat, geht sie auf Zehenspitzen zu ihr hin, um sie am Ohr zu streicheln. Zum Dank schleckt ihr Yolande über die Hände und die Arme. Da seht ihr, ruft Linda begeistert und als hätte sie das eben erst entdeckt, was die für eine lange Zunge hat. Sie reibt sich mit einem Bündel Heu sauber, so wie die Großmutter das macht. Nebenan meckern die Geißen empört. Ihre Jungen, die mit allen Vieren zugleich in die Luft springen konnten, hat der Vater geschlachtet. Die Schweine schlafen. Die stinken immer, sagt Linda fachmännisch und hüpft zum Hasenstall weiter. Den darf sie aber nicht öffnen. Sie steckt eine Möhre durch den Draht, damit die Häsin von den Jungen geht. Alle grau, wie die Russin selbst. Ihr Mann, das ist der Russe, der ist auch grau. Reinrassig, sagt Linda, mit Stammbaum. Der Lehrer und seine Frau flüstern. Zum Photographieren ist es hier zu dunkel. Linda will auf die Wiese und auch noch die Schafe zeigen, die beiden Lämmchen sind schon ganz groß. Hinter der Scheune, leicht ansteigend, befinden sich der Hühnerstall und der von einer niedrigen Mauer eingefaßte Gemüsegarten. Linda zeigt und erklärt alles. Hier muß endlich gegossen werden. Sie pflückt eine dicke Dahlie ab und hält sie der Lehrersfrau unter die Nase. Am hinteren Ende des Gartens steht ein knorziger Kirschbaum. Den hat meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter gepflanzt, sagt Linda, damit die Rheinländer lachen. Er trägt noch, aber man muß die Kirschen immer erst auseinanderklauben, denn in manchen sitzen fette Würmer. Zufrieden macht der Lehrer seine Aufnahmen.
*
Die Idylle, hinter der das Rasiermesser lauert. Wie das niedliche, blonde Mädchen den Leuten aus der Stadt seinen Bauernhof zeigt. Die Küken wollen unter die Glucke flüchten, die sich im warmen Sand eine Kuhle gebuddelt hat. Linda fängt eines und setzt es in die Hände von Tante Lübchen, die ganz weich sind. Onkel Lübchen photographiert, es ist der erste Urlaubstag. Das Kind am Brunnen, das Kind, das über den Gartenzaun geklettert ist, und das nun inmitten der blökenden Schäfchen steht.
Die Großmutter hat es nicht gerne, wenn ihr die Fremden im Stall und im Garten herumlaufen. Sie stören. Ihrer Ansicht nach sollen sie spazieren gehen oder auf der Wiese hinten in den Liegestühlen sitzen, und ansonsten können sie auf ihren Zimmern bleiben. Obwohl die Großmutter in Bad Hohenbirch aufgewachsen ist, wo ihre Eltern ein Juwelier- und Uhrengeschäft betrieben haben, lebt sie ganz für die Landwirtschaft. Sie ist eine kräftige, beherzte Frau. Auch an Werktagen, wenn sie die Ställe mistet, trägt sie eine helle Bluse und ihre zweireihige Perlenkette. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich mit dem Bauern vom Nachbarhof geeinigt. Sie stellt ihm ein großes Waldstück pachtfrei zur Verfügung. Er kann da abholzen, soviel er will. Dafür mäht er ihr die Wiesen und fährt das Heu ein. Auch sonst hilft er, wenn es notwendig ist. Deshalb braucht sie kein Fuhrwerk und keinen Traktor. Auf deren Platz in der Scheune steht der schwarze, immer auf Hochglanz polierte Mercedes ihres Sohnes, der davon träumt, die Landwirtschaft aufzugeben und dafür ein Café zu eröffnen. Aber die Großmutter sagt, solange ich lebe, wird der Stall nicht leer gemacht. Sie versorgt ihre Tiere, den Garten und die Wäsche. Ihre Schwiegertochter, die schwächlich ist, hat den Laden und nebenher die Küche. Damit sie überhaupt fertig wird, muß die dicke Hieberin jeden Tag ein paar Stunden lang helfen. Die Hieberin putzt auch die Fremdenzimmer.
Das Ehepaar Lübchen nimmt die Photos am selben Nachmittag auf, an dem sich Lindas Mutter töten will. Erst als Erwachsene wird sich Linda alles zusammenreimen können. Die Großmutter schreit, Herrmann, Herrmann, aus dem Bad oben, und auf der Treppe geht ein Poltern los. Die Rheinländer nehmen Linda, die sich heftig sträubt, zwischen sich und zerren sie hinaus, Richtung Wald, weil sie sehen wollen, ob schon die Rehe herauskommen. Wenn man ihnen etwas Salz auf die Schwänze streut, werden sie ganz zahm, heißt es. Wer bringt Linda abends ins Bett? Weil die Mutter fehlt, weint Linda bitterlich. Am nächsten Morgen will es mit dem Kämmen nicht klappen. Da nimmt die Großmutter die angerostete Küchenschere und schneidet Linda die Haare ab. Sogar der Vater ließ einen Entsetzensschrei, als er Linda danach sah.
Als die Mutter aus ihrer Erholung zurückkam, schien sie Linda viel kleiner als vorher, und immerzu sagte sie, du bist doch alles, was ich habe, ich lebe nur wegen dir. Linda durfte nichts passieren, nur sie konnte die Mutter, die oft in der Küche saß und weinte, trösten.
*
Durch eine Kriegsverletzung hinkte Herrmann Haselwander, sein rechtes Knie war steif, so daß er das Bein nachziehen mußte. Außerdem war er heftig und versprühte beim Sprechen schlecht riechende Spucketröpfchen. Er liebte fertige Sätze. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wie man sich bettet, so liegt man. Wenn ihn, was selten vorkam, seine Frau um etwas bat, sagte er unter einer leichten Verneigung: Dein Wunsch ist mir Befehl. Dazu lächelte er süffisant. In seiner Nähe konnte Linda immer nur wenig Luft einatmen, und oft tat ihr der Bauch weh. Dabei war sie stolz auf den Vater, er backte die schönsten und besten Torten, sogar zwei- und dreistöckige. Aus der ganzen Umgebung, auch aus Bad Hohenbirch, riefen Leute an und gaben Bestellungen auf. Linda gefiel es, wenn der Vater sie mitnahm und sie nebeneinander in den Polstern des schwarzen Wagens saßen und langsam ins Dorf rollten. Sie winkte gerne hinaus, außer ihnen fuhr nur noch der Metzger, der in seiner Freizeit Jäger war, einen Mercedes, aber dieser war grün und hatte eine Anhängerkupplung.
*
Es ist Samstag. Das Geschäft ist schon geschlossen. Als Mittagessen hat es Linsensuppe gegeben. Die Hieberin schrubbt die Ladenstaffel. Oben im Bad hat die Großmutter den Ofen angeheizt. Sie badet als erste. Dann, nach seinem Mittagsschlaf, der Vater und zum Schluß die Mutter. Wenn sie fertig ist, ruft sie Linda herein. In dem Bad ist eine trockene Hitze, und es riecht nach Fichtennadel-Badesalz. Linda bekommt Gänsehaut, als sie sich in das heiße Wasser setzt. Sie fährt ihr Plastikschiff hin und her, es ist ein Ozeandampfer. Die Mutter steht am Waschbecken. Sie hat ihren hellblauen Spitzenunterrock an und kämmt sich. Ihr Haar ist noch feucht, es fällt bis zu den Hüften hinunter. Vor anderen Leuten trägt sie es nie anders, als zu einem Knoten geschlungen. Aber samstags, nach dem Waschen, bleibt es offen, und für Linda ist die Mutter dann eine Märchenkönigin mit einem kostbaren Schleier.
Auf der Holzkiste liegen frische Wäsche und das Sonntagskleid für Linda. Sie haben es bei Leinwebers in Bad Hohenbirch gekauft, sein Koller ist mit einer Spitze verziert. Dazu wird Linda weiße Strümpfe und weiße Stiefel tragen. Immer darf sie samstags nach dem Baden schon das Sonntagskleid anziehen. Die Mutter wäscht Linda und ist ganz sanft.
Morgen ist erster Advent. Vom Wohnzimmer her tönen das Harmoniumspiel und der Gesang der Großmutter. Sie singt, Auf, auf, ihr Reichsgenossen, eur König kommt heran! Empfanget unverdrossen den großen Wundermann. An den Samstagabenden arbeitet sich die Großmutter durch das Kirchenjahr. Nachdem Linda angezogen ist, geht sie in das Wohnzimmer, sie soll am Kachelofen sitzen und die Haare trocknen. Wenigstens für einen Pferdeschwanz sind sie schon wieder lang genug.
Am nächsten Morgen liegt ein wenig Schnee und die Sonne scheint. Die Glocken werden schon geläutet. Es ist ein spiegelblanker Tag. Linda geht zwischen der Mutter und der Großmutter zur Kirche hinunter. Der Vater will mit dem Auto nachkommen. Linda liebt es, im Takt der Glocken zu gehen und ist immer enttäuscht, weil die Glocken für den Weg nach Hause nicht geläutet werden. Es ist, als würde ihren Beinen etwas fehlen, sie gehen dann so ins Leere.
Vor der Kirche treffen sie zwei Schwestern ihrer Mutter. Die Else, zu der Linda nicht Tante sagt, obwohl sie ihre Tante ist, hat mal wieder verschlafen. Sie bewundern Lindas neuen Mantel und sagen, mach auf, damit wir auch das Kleid sehen können. Aber die Großmutter drängt, sie will nicht wieder in der letzten Bank sitzen. Die Kirchenhälfte, die beim Hineingehen links ist, gehört den Männern, die rechte den Frauen. Wenn Gott vom Altar her ins Kirchenschiff schaut, sitzen die Männer zu seiner Rechten. Sonntags riecht die Großmutter immer nach Lavendel. Sie schiebt sich auf der Bank dicht an Linda heran und schwebt jauchzend mit ihrem Gesang über der Gemeinde.
Sonntag nachmittags, wenn die Küche sauber ist, geht Linda mit der Mutter und der Großmutter zum Pfarrsaal. Er wirkt festlich, denn er hat gelbe Fensterscheiben, durch die auch an trüben Tagen ein Licht hereinkommt, als scheine draußen die Sonne. Und es sind immer viele Kinder da. Linda hat eine Menge Cousinen und Cousins, mit denen sie im Pfarrhof Fangen und Verstecken spielt. Auch Lindas andere, ihre kleine Großmutter, die von allen die Großl genannt wird, und der Großvater kommen zu der sonntäglichen Kaffeestunde. Dem Großvater fehlen an der rechten Hand der halbe Daumen und der halbe Zeigefinger, und zum Spaß droht er mit seinen Stummeln bis die Kinder sich gruseln und kreischend davonrennen. Aber sie schleichen immer wieder heran, denn sie haben ihn alle gern.
*
Linda kennt Jesus persönlich, er ist Gast an ihrem Tisch. Oft wenn sie allein da sitzt und essen soll, unterhält sie sich mit ihm. Sie sagt, Jesus, bitte hilf mir doch, daß der Teller endlich leer wird. Und manchmal hilft er wirklich. Linda sieht den lieben Gott, über den Himmel hingestreckt, er ist allgegenwärtig mit seinem Sündenbuch. Linda hört das Meer in der großen Muschel rauschen, die auf dem Radio in der Küche liegt. Linda spürt, wie der Nachtkrapp nach ihr greift, wenn sie in der Dämmerung noch draußen ist. Linda lebt gewiß mit ihren Träumen, und sie wartet auf den Auftrag, der ihr für das Leben zugeteilt wird. Aber für manches, was um sie herum passiert, hat sie keine Worte.
Wenn sie den Vater die Speichertreppe herunterkommen sieht, ist irgend etwas anders an ihm, und er verschwindet dann im Bad und patscht die Tür heftig hinter sich zu. Linda kann der Mutter nicht sagen, daß sie die Unterhose und die Strapse von der Hieberin gesehen hat. Oft wacht sie nachts durch heftige Geräusche auf, und dann wartet sie auf das Winseln da von den Betten der Eltern her, immer folgt den Geräuschen das Winseln, doch sie getraut sich nicht, die Mutter zu rufen, die wohl ganz fest schläft. Linda hütet sich vor der drängenden, feuchten Nähe ihres Vaters, sie will nicht auf den Mund geküßt werden.
Als die Mutter einmal wieder wochenlang in Erholung bleiben muß, kommt zur Aushilfe Else, ihre jüngste Schwester, ins Haus. Else ist flink und sauber, aber sie hat ein lockeres Mundwerk, sagt die Großmutter. Mit Else hat Linda viel Spaß, ihr darf sie beim Verkaufen helfen so oft sie will, und die Kundinnen stehen lange im Laden und erzählen. Als Linda die Großmutter dann mit der Neuigkeit überrascht, der Geselle sei ein Hundertfünfundsiebziger, schlägt diese sofort zu. Während Linda geschlagen wird und unter Tränen ruft, ich schäme mich, Großmutter, ich schäme mich wirklich, sieht sie das Bild, wie der Vater sein Auto poliert und stolz sagt, es hat zweiundfünfzig PS und fährt gut hundertdreißig. Aber die Großmutter ist außer sich vor Zorn und steckt Linda ins Bett, obwohl noch gar nicht Abend ist.
Am nächsten Tag beim Mittagessen sagt der Vater, wenn ich ausgeschlafen habe, zeige ich dir was. Er schläft ja immer, nachdem er in der Backstube fertig ist, weil er schon um vier Uhr früh aufstehen muß. Er sagt, es ist aber ein Geheimnis, nicht daß du der Else etwas erzählst oder der Großmutter, die hätte bestimmt viel dagegen. Du und ich, wir zwei, fahren zusammen fort. Linda treibt sich im Hof herum. Sie ist neugierig, sie denkt an ein Geschenk oder noch lieber daran, daß sie vielleicht die Mutter in ihrer Erholung besuchen. Galant läßt er Linda einsteigen. Er spricht nichts. Sie fahren nach Sulzmatten und halten vor dem Haus des Tierarztes, den die Großmutter ruft, wenn die Kuh Fieber hat. Der Doktor ist nicht da, aber seine Frau weiß Bescheid. Ihre Bernhardiner-Hündin hat Junge. Es sind sieben, und Linda ist die erste, die sich eines aussuchen darf.
*
Als seine Tochter zur Welt kam, war Herrmann Haselwander dreiunddreißig Jahre alt. Er hatte Bäcker und Konditor gelernt und an der Ostfront gedient. Er verstand es, seine Nachteile in Vorteile zu verkehren. Obwohl das Geschäft abseits lag und im Winter sogar erst nach dem Schneeräumen erreichbar war, lief es doch besser als das der beiden Kollegen in der Hauptstraße. Zu Herrmann Haselwander ging man nicht wegen einem Laib Brot, sondern weil man Kirschstrudel oder Torte essen wollte. Bei ihm gab es ein klein wenig von dem Luxus, nach dem sich in den harten Zeiten alle sehnten. Auch die Fremden kamen gerne, sie kauften die Pralinen und Bonbonnieren, an denen Kärtchen steckten mit Motiven und der Aufschrift Herzliche Grüße aus Huwihl im Hochschwarzwald.
Eigentlich war Herrmann Haselwander kein richtiger Nazi gewesen, aber er vermißte doch die Ideale und die Ordnung, die sie dem Leben gegeben hatten. Die Kirche gehörte ins Weibliche, zum Schmuck, zum Beiwerk, er machte das Brimborium mit, weil es nicht anders ging, schon der Kundschaft und seiner Mutter wegen. Du sollst nicht töten? – Rüste dich, töte! Auch der Pfarrer hatte seinen Segen gegeben, darüber konnte Herrmann Haselwander nachträglich nur ausspucken. Niemand hatte einen Krieg gewollt, aber schließlich mußte gekämpft werden.
Manchmal, wenn seine Kameraden jetzt zum Skatdreschen heraufkamen, übte Herrmann Haselwander grinsend den Hitlergruß. Das sah zackig aus und verursachte bei allen automatisch ein herzhaftes Lachen. Mensch, Herrmann! Weil sie den Krieg verloren hatten, galt das für verboten, aber diese Tatsache verweigerte sich dem Kopf. Nicht das Glück, das Schicksal sollte sie bestimmen. Irgendwie war es Herrmann Haselwander, als könne morgen schon wieder alles ganz anders sein. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagte er gerne. Die Abenteuerlust und eine hündische Gehorsamslust verließen ihn nicht. Dein Wunsch ist mir Befehl. Auf viele Frauen hatte er eine enorme Wirkung. Seit er hinkte, mußte er sich etwas mehr Mühe geben als zuvor, aber er wurde selten enttäuscht.
Vor dem Krieg war er ein ehrgeiziger Schifahrer, ein knochenharter Sportler gewesen, gnadenlos mit sich selbst. Seine Urkunden und Medaillen schmückten die Schreibstube. Es war doch gerade ein paar Jahre her, als er sich noch im Turnverein an Reck und Barren beweisen konnte. Jetzt bezog er Invalidenrente, und alle drei Jahre hätten sie ihm eine Kur bezahlt, wenn er für eine Kur Zeit gehabt hätte. Wenn der Schmerz, der ihn immer quälte, unerträglich wurde, trank er Schnaps. Manchmal phantasierte er, er müsse ein ganzes Volk begatten, reihenweise, er allein. Was er tatsächlich leistete, war nur ein Bruchteil von dem, was er hätte leisten können.
*
(1. Part)
Natürlich ist die Großmutter entsetzt, als Linda und ihr Vater mit dem Welpen nach Hause kommen. Sie schreit, den fahrt ihr sofort zurück. Ausgerechnet jetzt, wo die Schwiegertochter schon wieder ausfällt, ausgerechnet jetzt bringen sie zu allem Vergnügen noch einen Hund daher. Es ist Hochsommer. Der Stall, der Laden, die Fremdenzimmer, der Garten, die Wäsche. Zu ihrem Sohn sagt sie, ich glaube, jetzt bist du auch noch so verrückt geworden wie die. Das Viech kommt mir aus dem Haus. Lindas Augen gehen fort, aus der Küche hinaus, über die Landstraße bis ganz weit zum Meer, wo ihre Mutter in Erholung ist.
Plötzlich ist das Gesicht der Mutter dicht bei ihrem, sie kann den Atem spüren, ihre Mutter würde sie doch nie verlassen. Die Großmutter gibt ihr einen Stoß. Damit du wieder zu dir kommst, ich kenne dich ja nicht mehr, gerade hast du wie deine Mutter ausgesehen. Linda weint gleich. Das ist Betty, ich taufe sie Betty, Betty ist meine Schwester, sie ist mir das Liebste auf der Welt. Als sie Betty noch ein bißchen fester an sich drückt, pinkelt Betty los, daß es aus Lindas Rock auf den Küchenboden tropft. Der Vater grinst und verschwindet.
Die Großmutter läßt sich auf das Kanapee fallen. Fast ist es Linda, als weine die Großmutter auch, jedenfalls schnaubt sie heftig in ihr Taschentuch und sagt, ach Gott, ach Gott. Gleich hat Linda ein schlechtes Gewissen. Die Mutter schickt Ansichtskarten, vergiß deine Gebete nicht. Engeli chum, moch mi frumm. Sei schön brav, Linda. Obwohl Linda brav sein soll, plagt sie, bitte, bitte-bitte, Großmutter. Sie setzt das Hündchen auf den Boden und umarmt die Großmutter heftig, sie gibt ihr sogar einen Kuß. Schließlich richten sie zusammen für Betty im Stall ein Kinderzimmer ein. Linda schenkt Betty ihre Puppe mit den echten Haaren. Nachts schleicht sie sich aus dem Haus, was wegen der knarrenden Stufen ein Kunststück ist, und legt sich zu Betty ins Stroh. Von diesem Sommer an orientiert sich Linda mehr nach draußen. Zusammen mit Betty geht sie furchtlos durch den Wald bis zur Jägerhütte hinauf.
*
Ab Ostern 1960 ging Linda zur Schule. Fräulein Jadow, ihre Lehrerin, war früher BDM-Führerin gewesen. Sie hatte rote Haare und das ganze Gesicht voller Sommersprossen. Obwohl sie von drüben kam, wußte man im Dorf recht gut Bescheid über ihre Vergangenheit. Fräulein Jadow galt als streng, aber gerecht, bei ihr, hieß es, lernen die Kinder fürs Leben. Gerne bediente sie sich eines besonderen Rohrstockes. Mit den schlimm entarteten Fällen ging sie vor die Tür des Klassensaals, wo sie dann, ohne den Anstand zu verletzen, mit Ausdauer auf die nackten Hintern schlagen konnte. Vor allem bei bestimmten Jungens war das notwendig, sie lernten schlecht und liefen das ganze Jahr mit grünen Rotznasen herum. Es war ja ungeheuerlich, was für Zustände bei den Bauern teilweise noch herrschten. Da hatte nicht einmal jeder sein eigenes Bett, und die Hühner gackerten in der Küche herum.
Fräulein Jadow studierte nicht allein ihre Schüler, sondern auch deren Familienverhältnisse genau. Bei ihren Hausbesuchen entging ihr nichts. Herrmann Haselwander überreichte ihr zum Abschied persönlich und mit einem verschwörerischen Blick ein Kuchenpaket. Natürlich, Fräulein Jadow war ja nicht blind. Lindas Mutter, diese farblose Frau, konnte doch kaum dreißig sein und ging schon zögerlich und gebeugt. Sie hing übermäßig an ihrer Tochter, ein ganz typischer Fall, wo die Mutter in der Tochter kein selbständiges Wesen sieht, sondern nichts als die hoffnungsvolle Fortsetzung ihres eigenen, hoffnungslosen Lebens. Aber die Art der Kleinen gefiel Fräulein Jadow, Linda schlug wohl eher nach dem Vater und ließ sich glücklicherweise nicht zu stark von der verweichlichenden, überängstlichen Mutter beeinflussen.
Fräulein Jadow klatschte Beifall, als ihr Linda vorführte, wie sie die muntere Bernhardinerin allein mit dem Blick dirigieren konnte. Ein rascher Augenaufschlag, eine kurze Kopfbewegung, und die Hündin reagierte sofort. Linda ließ sie wie ein Pferd über Hindernisse springen und wie einen Tiger durch den Hula-Hoop. Seit sie im Fernsehen Zirkus Krone gesehen hatte, träumte sie davon, mit Betty dort aufzutreten. Weil Betty, wenn Linda nicht in ihrer Nähe war, unentwegt heulte, ließ man sie aus dem Stall und mit zur Schule laufen. Bei jedem Wetter wartete sie vor dem Tor des Pausenhofs, bis Linda herauskam. Im Winter war sie oft völlig zugeschneit.
Natürlich war Linda die Lieblingsschülerin von Fräulein Jadow. Wenn es mit dem Stricken nicht so klappte, wurde sie zu ihr in die Wohnung im alten Schulhaus bestellt. Fräulein Jadow hatte eine Menge Bücher und einen Plattenspieler, auch Betty ging gerne hin, denn sie bekam dort ein saftiges Stück Wurst.
Wenn sich Linda auf den Weg zu Fräulein Jadow machte, hieß es immer, ach, gehst du schon wieder zu der. Einmischungen von außen konnten sie keine vertragen, da waren sich die Mutter und die Großmutter einmal einig. Manchmal verlegten sie beim Aufräumen Fräulein Jadows Bücher, so daß Linda sie weder zu Ende lesen noch zurückbringen konnte. Linda litt unter der Eifersucht der Mutter, nie durfte sie eine Freundin haben. Aber die Besuche bei Fräulein Jadow erkämpfte sie sich unter Tränen. Der Sog von draußen wurde immer stärker. Oft träumte Linda davon, zusammen mit Betty oben in der Jägerhütte zu wohnen oder ganz fortzuwandern und nie wiederzukehren, sie hätte kein Heimweh bekommen.
*
Linda geht an einem hellen, kalten Februartag auf das alte Schulhaus zu. Es liegt noch viel Schnee, aber die Straßen und Wege sind geräumt. Von einem leichten Wind werden Flocken dahingetrieben, sie fallen und steigen, sie trudeln in der Sonne dahin wie Pappelsamen. In einem Stall stößt ein Bulle entsetzliche, hohe Schreie aus. Es riecht nach frischem Mist. Neben Linda trabt Betty, stolz, sie trägt in der Schnauze das Handarbeitskörbchen zu Fräulein Jadow, die sie gewiß belohnen wird. Es ist keine Schule, weil Fastnachtsdienstag ist, aber mit Fastnacht hat Lindas Familie nichts zu tun, außer daß der Vater dann Krapfen backt und mit Marmelade füllt. Er hat für Fräulein Jadow eine pralle Tüte davon mitgegeben. Linda muß aus rosa und hellblauer Baumwolle einen Waschlappen stricken, aber ihr Strickzeug ist klebrig, bretthart und voller verdrehter Maschen.
Das alte Schulhaus liegt über dem Bach auf der Winterseite, von weitem sieht es wie eine vernachlässigte Villa aus. Es wird in Lindas Leben einen wichtigen Platz einnehmen. Seit Jahren findet der Schulunterricht nicht mehr dort, sondern in einem neuen, größeren Gebäude am Ortsende statt. Die ehemaligen vier Klassenräume werden jetzt von Vereinen zu Versammlungen benutzt, auch der Kirchenchor probt gelegentlich darin, und im Saal gleich links unten ist provisorisch die von Fräulein Jadow betreute Bibliothek untergebracht.
Unter dem Dach befinden sich zwei Wohnungen für Lehrer, in der einen wohnt Fräulein Jadow, die andere steht leer, weil die Gemeinde ungewisse Pläne mit dem Haus hat, das gründlich renoviert werden müßte. Zu dem Gebäude gehört ein mit einer hohen, gelben Mauer umgebener Garten, der verwildert ist, dieselbe Mauer begrenzt auch den Schulhof, in dem noch das Nebengebäude mit den Plumpsklos für die Schüler steht.
Fräulein Jadow hat für Linda Kakao gekocht. Trotz des sonnigen Tages ist es in dem Wohnzimmer dämmrig. Fräulein Jadow sitzt mit dem Strickzeug dicht beim Fenster. Beim besten Willen ist da nichts mehr zu machen, sie zieht es vollständig auf und schlägt neue Maschen an.
Wie schön still es hier ist. Keine Ladenglocke, kein Telephon. Bei Fräulein Jadow kann Linda gemütlich und vornehm im Sessel sitzen, und niemand verlangt etwas von ihr. Nachdem sie den Kakao ausgetrunken hat, darf sie eine Schallplatte auflegen. Sie sucht die Musik nach der Hülle aus, die ihr am besten gefällt. Lange zögert sie zwischen einem bunten Operettenchor und einem weißhaarigen Mann, der an einen Flügel lehnt. Arthur Rubinstein. Schließlich ertönt das erste Klavierkonzert von Beethoven. Das ist Musik. Fräulein Jadow schließt die Augen. Leuchtend wie der Tag heute, sagt sie und freut sich, weil das Kind die Schuhe auszieht und anfängt, sich zu bewegen. Ein Kätzchen, das nicht weiß, was es tut.
Fräulein Jadow selbst spielt Geige, wären die Zeiten damals besser gewesen, hätte sie wahrscheinlich Musik studiert, anstatt auf das Lehrerseminar zu gehen. Schon lange wollte sie mit Lindas Vater reden, der vernünftig schien, sie würde ihm anbieten, Linda kostenlos Unterricht zu geben.
Musik wird Linda immer veranlassen, ihr Leben stärker zu lieben, heftiger zu wünschen, freudiger zu geben und sich zu verschwenden. Wenn ich groß bin, werde ich Tänzerin, sagt Linda mit Gewißheit zu Fräulein Jadow, die für den Waschlappen zuerst die hellblaue Wolle verarbeitet. Und immer wird Linda jemanden finden, der für sie zuständig ist und ihr hilft, und sie läßt sich helfen.
*
Der lieb Gott het zuem Früehlig gsait:
»Gang, deck im Würmli au sy Tisch!«
Druf het der Chriesbaum Blätter trait,
viil tausig Blätter, grüen un frisch.
Fräulein Jadow hatte keine Probleme, als sie die Kinder in ihrer vierten Klasse »Das Liedlein vom Kirschbaum« von Johann Peter Hebel lesen ließ. Sie benötigten die Fußnoten im Lesebuch nicht. Schier unmöglich war es jedoch für Fräulein Jadow, ihnen das beizubringen, was sie selbst für hochdeutsch hielt.
Der lieb Gott het zuem Winter gsait:
»Deck waidli zue, was übrig isch!«
Druf het der Winter Flocke gstreut,
viil tausig Flocke, wyß un frisch.
Bei Linda zu Hause wurde auch mit den oftmals ratlosen Feriengästen unbefangen Dialekt gesprochen. Erst durch das Radio und dann erst recht durch das Fernsehen fing die Familie an, sich vor Fremden ein wenig tölpelhaft zu fühlen mit ihren Wörtern. Manchmal, wenn sie sicher war, daß es niemand hörte, sprach Linda mit Betty wie die Fernsehansagerin, für die sie schwärmte. Und heute Abend zeigen wir Ihnen die klügste Hündin der Welt im Zirkus Krone bei ihren einmaligen Kunststücken. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Auch durch den Einfluß des Lehrerehepaares aus dem Rheinland und durch Fräulein Jadow, die ihre Kindheit jedoch in Dresden verbracht hatte, wurde Linda schon früh so etwas wie zweisprachig. Sie verfügte zumindest über eine zweite, eine abgemilderte Version ihres Dialektes. Aber sie mußte Eisenschuhe tragen und hätte doch gerne getanzt. Wer anders sprach als sie, beeindruckte sie unwillkürlich und erschien ihr klüger, besser, gewandter, so daß sie manchmal mitten in einem Satz hilflos verstummte.
*
Keiner kann aus sich selbst heraus. Vielleicht ist es wirklich so: Wie einem ein bestimmter Körper mit all seinen Eigenschaften gehört, besitzt man auch einen bestimmten Charakter. Er ist der Panzer, der nach außen schützt und der zugleich unbeweglich macht. Man ist eingeklemmt zwischen Körper und Charakter. Linda konnte bezaubern, ein Machtgefühl beglückte sie, wenn sie spürte, daß sie andere für sich einnahm. Früh zeigte sich bei ihr eine Neigung, nicht eigentlich zur Theatralik, aber doch zu einer theatralischen Gestimmtheit. Sie hatte Distanz und war neugierig darauf, wie es weitergehen würde für sie.
Mit der Frage nach dem Sinn aller Dinge wurde Linda selbst ihre Erwartungshaltung zunehmend bewußter. Wer eine Sechs würfelt, darf alle anderen überholen. Sie dachte, ihr würde ein Lebensauftrag zugeteilt oder wenigstens ein Zeichen gegeben, dem sie dann zu folgen hätte. Oft konnte sie nicht einschlafen, und sie sinnierte darüber, mit welchem Menschen sie bald ihr Leben teilen würde. Nur durch eine Heirat könnte sie das Elternhaus verlassen. Früh sah sie ihre Kindheit als etwas an, das abgeschlossen war, sie wollte nicht mehr Kind sein, immer sehnte sie sich fort. Wo lebt er jetzt, wie sieht er aus. Was tut er eben in diesem Augenblick, wo ich das denke? Sie glaubte an ein Paradies auf Erden und wollte sich auf die Suche danach machen.
Nach den Osterferien, bevor Linda elf Jahre alt wurde, wechselte sie von der Volksschule zum Mädchengymnasium nach Bad Hohenbirch. Fräulein Jadow hatte sich dafür eingesetzt, und der Vater wurde nicht müde, nun von seiner »höheren Tochter« zu sprechen. Tagelang siezte er sie vor Begeisterung und fuhr sie morgens mit dem Auto zur Schule, denn wenn sie den Bus nahm, mußte sie schon um sechs Uhr aufstehen. Sie fing mit Latein an, und es war nicht so, daß ihr die Umstellung leicht fiel. Sie blieb während der ganzen Schulzeit eine mittelmäßige Schülerin, nur in Deutsch war sie immer die beste.
Im gleichen Sommer kündigte der Geselle unerwartet, und für Linda, die ihr Bett noch immer im Schlafzimmer bei den Eltern stehen hatte, wurde das Mansardenzimmer renoviert. Bald waren die Wände mit Holz verschalt und weiß gestrichen, eine elektrische Heizung eingebaut und ein blauer Teppichboden gelegt. Als Überraschung hatte die Großmutter weiße Chippendale-Möbel bestellt. Außer dem Bett und dem Schrank auch eine Spiegelkommode. Unter das Gaubenfenster wurde ein zierlicher Schreibtisch gestellt. Zur Einweihung brachte Fräulein Jadow einen Plattenspieler. Den stellte Linda auf die mit Schnitzereien verzierte Truhe, die vorher bei den alten Schränken auf dem Speicher gestanden hatte. Linda freute sich sehr. Am liebsten hätte sie das stille, warme Zimmer nicht mehr verlassen.
Malte
Malte Olson wurde 1952 in Bremen geboren. Seine Mutter war Organistin und Klavierlehrerin, sein Vater begann, nachdem er schon einige Zeit als technischer Zeichner gearbeitet hatte, ein Ingenieur-Studium. Malte hatte drei Geschwister. Carsten, den um zwei Jahre älteren Bruder, Caren, die um ein Jahr jüngere Schwester, und Marie, die 1963 geboren wurde. Bis zu ihrem Umzug in den Schwarzwald, wo der Vater dann Leiter einer Kunststoffabrik wurde, lebte die Familie ziemlich beengt in einer Mietwohnung.
Malte war ein bewegliches, lebensfrohes Kind. Für ihn gab es nur vollkommene Wachheit oder tiefen Schlaf. Er sang viel und laut und hüpfte und klatschte dazu im Rhythmus. Mit den Hausbesitzern in der darunter liegenden Wohnung gab es deshalb oft Ärger. Wenn er müde war, legte er sich irgendwohin und schlief sofort fest ein. Schon als Dreijähriger ging er nicht mit der ganzen Hand patschend auf das Klavier los, sondern drückte vorsichtig einzelne Tasten. Er lauschte, wie sich ein Ton ausdehnt und wie er nach und nach leiser wird, bis er ganz verklingt. Die Mutter freute sich darüber und spielte und sang oft mit ihm am Klavier. Carsten machte nicht mit, er wollte viel lieber ins Schwimmbad gehen, und Caren zog ihre Puppen vor.
Als Malte fünf Jahre alt war, gab ihm die Mutter regelmäßig Klavierunterricht. Sonntags durfte er beim Gottesdienst, den sie begleitete, neben ihr an der Orgel sitzen. Nie dauerte ihm das lang genug. Außer der Musikalität fielen an dem Jungen besonders seine leuchtenden blauen Augen auf. Sie blickten wach und interessiert und in gewisser Weise zärtlich. Jeder behandelte Malte mit Respekt und eher wie einen Erwachsenen. Undenkbar, daß man ihn in einen Kindergarten geschickt hätte. Im Halbschlaf hörte er oft wunderbare Klänge. Er spielte. Er allein, aber sein Instrument war nicht nur ein Klavier, sondern außerdem ein ganzes Orchester, und er sehnte sich danach, was er gehört hatte, aufzuschreiben. Neben der Musik war ihm alles andere nebensächlich. Bald sagte er, daß er Pianist werden wolle. Er las schon gerne in Biographien berühmter Musiker, und er hatte seine Vorbilder. Manchmal war es schwierig zu unterscheiden, was von ihm selbst kam und was er imitierte.
Mit acht Jahren beteiligte er sich zum ersten Mal an einem Wettbewerb am Konservatorium. Gleich bekam er den ersten Preis. Man wurde auf ihn aufmerksam, und er sollte im Theater mitmachen, als für ein modernes Stück ein Kind gesucht wurde, das auf der Bühne sicher Klavier spielen und Kraft und Konzentration eines frühreifen Genies darstellen konnte. Obwohl seine Mutter immer wieder betonte, sie halte nichts von Wunderkindallüren, ließ sie ihn mitmachen. Der Vater schüttelte nur den Kopf. Ihm wäre es lieber gewesen, daß Malte trotz seiner Begabung und seiner Neigung zum Extrem wie Caren und Carsten aufwuchs. Wurde in dem Jungen nicht ein Narr gezüchtet? Aber letzten Endes verstand der Vater ja nichts von Musik, und so schwieg er.
Auf dem Programmheft des Theaters war dann dieses Photo: Ein Junge mit einer Mozartperücke sitzt in einen engen Frack gezwängt vor einem Konzertflügel. Seine Füße stehen auf einem Schemel, denn sie würden noch nicht bis auf den Boden reichen. Wie zu einem wilden Akkord hat der Junge beide Hände erhoben. Alles auf dem Bild wirkt übertrieben. Aber tatsächlich war das Stück an jedem Abend ausverkauft. Maltes Spiel rührte die Menschen.
Nachdem Malte zehn Jahre alt war, verbrachte er die Sommerferien oft in Lübeck bei einer jüngeren Freundin seiner Mutter. Lioba Vengerowa wohnte außerhalb der Stadt in einem abgelegenen Haus, denn sie war Konzertpianistin und brauchte, wenn sie nicht auf Reisen war, einen Ort, an dem sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Aus ihrer Meisterklasse waren oft Schülerinnen und Schüler bei ihr. Sie sah wie eine Balletteuse aus und hatte eine große Liebe zu allem Indischen. Meistens trug sie weite, bunte Gewänder, sie mochte nichts, das einengte. Bei ihr mußte endlich auf niemand Rücksicht genommen werden, bei Lioba Vengerowa durfte Malte auch nachmittags zwischen eins und drei und sogar mitten in der Nacht Klavier spielen. Sie ließ ihm viel Freiheit, sie vertraute seiner Begabung und seiner Disziplin. Er mußte keine Anweisungen und keine Fingersätze in seine Notenbücher schreiben. Nichts von: Tu dies, tu jenes. Über ihren heimlichen Grundsatz, nur wer das Unmögliche verlangt, kann das Bestmögliche erreichen, sprach Lioba Vengerowa selten, vor allem mit ihren besten Schülern hatte sie Geduld. Sie konnte warten.
Und Malte war mit sich selbst streng genug. Sein Ziel war das klare, ebenmäßige Spiel. Er war erst zufrieden, wenn jeder Ton scharf abgegrenzt vom anderen erklang. Manchmal war er penibler als seine Lehrerin. Im Haus von Lioba Vengerowa war es Maltes Gewohnheit, vormittags zwei Stunden lang aus dem wohltemperierten Klavier zu spielen. Danach konnte der Tag erst recht beginnen. Zwang er sich, ein Stück zu erarbeiten, das er nicht mochte, wurde ihm davon körperlich übel. Auf langen Spaziergängen analysierten sie alle Arten von Musik. Malte folgte seiner Lehrerin, die sich auch schon als Komponistin einen Namen gemacht hatte, in vielem. Sie beglückten einander mit ihrer Lust am Experimentieren. Skizzen, Improvisationen, glückliche Reminiszensen an das ganz Einfache, das doch so schwer zu machen ist. Wenn Lioba Vengerowa Chopin spielte, saß Malte stundenlang in sich versunken dabei. Ihr Spiel versetzte ihn in eine Abwesenheit, aus der er oft nur mühsam wieder zurückfand. Für ihn selbst blieb Chopin lange Zeit unspielbar, es war die Musik, die allein seiner verehrten und geliebten Lehrerin gehörte.
So wuchs Malte Olson auf.
Hermina
Hermina wurde 1921 als Hermina Kavkowá in Wien geboren. Ihre Mutter kam aus einer großbürgerlichen Wiener Familie. Ihr Vater stammte aus Prag, wo seine Eltern ein Galanteriewarengeschäft betrieben. Nähseide, Bänder, Knöpfe, Unterwäsche, Kinderkleider. Sie hatten gespart, um dem Sohn sein Mathematikstudium zu ermöglichen. Kurz vor Herminas Geburt war er zum Professor an der Universität berufen worden. Als Hermina drei Jahre alt war, bekam sie eine Schwester und ein Jahr darauf noch eine. Beide waren blond wie die Mutter. Nur Hermina hatte den dunklen Teint und die schwarzen Haare ihres Vaters geerbt. In der Familie hieß sie deshalb »’s Mohrlerl«.
Von klein auf neigte sie zu Phantastereien. Wenn sie in einer ihrer Erzählungen nicht weiter wußte, legte sie die linke Hand an den Hinterkopf und stemmte die rechte in die Hüfte. No geh scho, Mohrlerl. So stand sie dann eine Weile mit fest zugepreßten Augen da, als könne sie auf diese Weise ihre fortströmende Phantasie in den Kopf zurückrufen. Bei dem kleinen Mädchen wirkte das drollig, wie es dastand und sich besann, aber Hermina verlor diese Gewohnheit auch als Erwachsene nicht ganz.
Die Familie zählte zu den assimilierten Juden in Wien. Man hielt zwar noch an verschiedenen Gebräuchen fest, sie gingen an den Hohen Feiertagen zur Synagoge und fasteten an Jom Kippur, aber mit der Sabatruhe nahmen sie es nicht so genau, und sie hatten eine Köchin, die nicht koscher kochen konnte. Dennoch gab es einen gewissen Stolz darauf, Juden zu sein. Hermina hatte eine unbeschwerte Kindheit. Ihre Eltern waren unbekümmert und tolerant. Mit Problemen gaben sie sich nicht gerne ab. Ihr Haus stand jedem offen. Aber dann kam die furchtbare Zeit des Nationalsozialismus, die aller Sorglosigkeit ein Ende bereitete.
Trotzdem verlobte sich Hermina mit ihrer heimlichen Liebe, einem nichtjüdischen Deutschen. 1941 fiel er in Rußland. Hermina litt unsäglich. Als das Leben für die Juden in Wien immer schwieriger wurde, kam der Vater von einer Reise nach Frankreich nicht mehr zurück. Die Mutter meinte, für eine Frau mit drei Töchtern sei es doch gar nicht gefährlich. Aber Wien entledigte sich elegant seiner unnütz gewordenen Juden.
Nach der Flucht des Vaters wurde das Haus beschlagnahmt, und die vier Frauen mußten in ein enges Hinterzimmer ziehen. Die Vermieterin, eine energische Witwe, hatte ihren Mann im ersten Weltkrieg verloren. Sie hielt mit ihrer Meinung über das Nazipack, das nur Elend über alle brachte, nicht zurück. Hermina gab ihr eine Mappe mit Papieren, Briefen und Photos und legte schweren Herzens den Ring aus rötlichem Gold, den sie seit ihrer Verlobung getragen hatte, dazwischen. Durch ihre Phantasie war sie manchmal weitblickend. Tag und Nacht lebten die vier Frauen in der Angst davor, daß sie abgeholt würden. Längst getrauten sie sich nicht mehr auf die Straße. Obwohl Sommer war, litt die Mutter unter einem Husten, der sie dauernd nach Luft ringen ließ, sie konnte das Bett kaum noch verlassen. Als die Nazis schließlich vorfuhren, konnte auch die gewaltbereite Kriegerwitwe, die einen Schrank vor die Tür des Hinterzimmers gerückt hatte, um die vier Frauen zu verstecken, nichts ausrichten. Die tobende Horde schlug ihr in wenigen Minuten die Möbel zusammen und warf sie aus dem Fenster. Mit einem der letzten Judentransporte wurde Hermina zusammen mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern nach Theresienstadt verfrachtet. Das war im September 1942.
Die durch ihren Husten schon geschwächte Mutter starb kurz nach der Ankunft in Theresienstadt. Herminas Schwestern wurden aussortiert und nach Auschwitz weitergeschickt. Hermina bekam offenbar eine Frist. Viele Wochen verbrachte sie in Theresienstadt. Kapierte sie dort endlich, was es heißt, Jüdin zu sein? Im Winter dann wurde auch sie in einen der Viehwaggons gepfercht und nach Birkenau verfrachtet. Sie hoffte, dort doch ihre Schwestern oder ihren Vater wiederzusehen. Immer hielt sie Ausschau nach ihnen. Später erfuhr sie, daß zu der Zeit schon längst alle drei vergast worden waren. Im Juni 1944 wurde Hermina selektiert und wieder in einem Viehwaggon, der allerdings weniger beladen war als der erste, fortgeschafft. Diesmal ging die Fahrt durch eine idyllische Sommerlandschaft nach Niederschlesien in ein Außenlager von Groß-Rosen, wo sie, zum Skelett abgemagert, im Wald Baumstümpfe ausgraben sollte. Da die Häftlinge hier mit der Bevölkerung in Kontakt kamen, wurden ihnen die Haare nicht mehr geschoren.
Als bei Kriegsende die Russen näherrückten, wurden die wenigen Häftlinge, die noch lebten, von uniformierten Männern evakuiert. Diesmal ging es zu Fuß vorwärts. Das war im Februar 1945. In der Dämmerung des dritten Abends konnte sich Hermina zusammen mit zwei anderen Frauen davonschleichen. Die Aufseher waren selbst zu erschöpft, um lange zu suchen. Überall herrschte hektische Aufbruchsstimmung, Trecks wurden zusammengestellt, manche Höfe waren schon verlassen. Die drei Frauen versteckten sich in Scheunen und Ställen, zu essen fanden sie genug. Von einem Dorfpastor bekam Hermina gefälschte Papiere. Sie war nun keine Jüdin mehr, sondern Hilde Fidler, eine junge, deutsche Flüchtlingsfrau aus dem Osten. Im Durcheinander der letzten Kriegswochen gelangte Hermina nach München, zu Tante Vera, der Schwester ihrer Mutter, die dort mit einem polternden Gamsbart-Katholiken verheiratet war. Ja, Mohrlerl, wo kommst du denn her?
Hermina schämte sich zu erzählen, wie sie die letzten Jahre verbracht hatte. Appellstehen, Durst, vor allem Durst und Angst, Willkür, Stockschläge, Lastwagen voller Leichen, der Gestank des Rauches über dem Lager. Der SS-Mann, der munter vor sich hinpfeifend die nackten Frauen bei der Selektion Kniebeugen machen ließ. No geh scho, Mohrlerl.
Tante Vera frühstückte jeden Morgen von ihrem Meissner-Porzellan, sie hätte das alles ohnehin nicht geglaubt, deshalb erzählte Hermina gleich eine andere Geschichte. Und die Eltern und die Schwestern, die würde sie sicher in Wien wiedertreffen. Gewiß. Onkel Sepp hatte sich mit den Nazis arrangiert. Mit Blick auf seine Frau flüsterte er Hermina ins Ohr, daß er nur auf diese Weise auch Juden hätte retten können. Seine Geschäfte liefen äußerst zufriedenstellend.
Die Nächte verbrachte Hermina nun mit ihrer vor Angst schreienden Tante Vera im Keller. Nachdem Hermina drei Konzentrationslager überlebt hatte, wäre sie fast im Bombenhagel der Befreier umgekommen. Dann waren die Amerikaner da. Gutmütige, kaugummikauende junge Kerle. Hello! Sie wußten nicht, für wen und gegen wen sie da eigentlich gekämpft hatten. Ein jüdischer Kommandant der Militärregierung verschaffte Hermina eine Stelle bei der Organisation für »displaced persons«. Sie half, Kontakte zwischen auseinandergerissenen Familien herzustellen. Hermina wirkte bald kräftig und selbstbewußt. Sie wollte nichts Schlimmes erlebt haben, und sie wollte sich vor allem Schlimmen die Ohren verstopfen.
Bei ihrer Arbeit lernte sie Maxim Wisniewski kennen. Er war fünfzig Jahre alt, trug einen Kaftan und sah aus wie die Figur aus einem russischen Märchen. Nie sprach er etwas anderes als jiddisch. Jiddisch, sagte er bedeutungsvoll, ist älter als deutsch, es ist die Sprache der Juden. Er war stolz darauf, Jude zu sein, und Hermina sehnte sich nach einem Menschen aus einer Bilderbuchwelt. Maxim hatte die schlimme Zeit in Amerika verbracht. Er war Vorkriegsemigrant und suchte nun in dem verwüsteten Europa nach seinen Verwandten. Mit Malech, seinem Schutzengel, führte er lange Gespräche. Durch seine unbeirrte Frömmigkeit besann sich auch Hermina auf ihr Judentum. Plötzlich bekam sie ein Heimatgefühl. Sie wollte dazugehören, vertrauen, gläubig werden und die Gebräuche halten. Vielleicht würde ihr daher eine Erklärung für alles kommen. Sie erzählte Maxim nicht, daß sie ihr Jiddisch im Konzentrationslager gelernt hatte.
Maxim war ein russischer Bär aus dem Schtetl, ein chassidischer Bohémien, ein Künstler, ein Narr, der durch Kneipen zog, auf seinem »Harmoschke« spielte und dazu sang. Schon 1933 war er nach New York ausgewandert, um dort ein Kabarett zu gründen, nur das geeignete Auditorium von Jidden, das er sich gewünscht hatte, fehlte ihm noch, so daß er sich als Sänger bei Hochzeiten und Bar-Mízwa-Feiern durchschlagen mußte.
Niemand vorher hatte Hermina so zum Lachen gebracht wie Maxim, wenn er rief, Herminale, gib a Guck, was da tut sich. Seine Väterlichkeit und sein Humor machten sie in manchen Augenblicken wirklich sorglos. Herminale, du sitzt in mein Herz, du sitzt auf einen weichen Scheslan in mein Herz, sang Maxim und spielte dazu auf seinem Harmoschke. Er hob sie liebevoll verehrend auf einen Thron, und alle sollten den Schatz bewundern, den er besaß.
Wer wollte die Juden vor dem Krieg aufnehmen?
Wer wollte die Juden während des Krieges aufnehmen?
Wer wollte die Juden nach dem Krieg aufnehmen?
Hermina träumte davon, nach Palästina auszuwandern. Vielleicht hätte sie von Italien aus mit einem illegalen Schiff einreisen können. Vielleicht wäre sie aber von den Engländern erwischt und auf Zypern interniert worden. Vor Lagern hatte Hermina einen Horror. Maxim schwärmte von New York. In New York sei er so gut wie zu Hause. Endlich würde er sein längst geplantes Kabarett gründen, Hermina sollte die geschäftliche Leiterin werden. In New York liege das Geld nur so auf der Straße herum. Alle Juden und alle Nicht-Juden in New York würden allabendlich Maxim Wisniewskis Kabarett füllen. Sie gab seinem sanften Drängen nach. 1948 heirateten sie und nahmen ein Schiff nach New York.
Zuerst wohnten sie in einem von einer jüdischen Hilfsorganisation zur Verfügung gestellten Obdachlosenhaus. Bald fanden sie eine billige Einzimmerwohnung mit einer geräumigen Küche, die jedoch kein Fenster hatte. In einem mit Stoff verhängten Regal war alles, was sie besaßen. Ein paar Kleidungsstücke, drei, vier Bücher, eine Pfanne und das Eßgeschirr. Nie wurden sie den Geruch nach feuchtem Keller und Schimmel los.
Maxim verbrachte viel Zeit damit, mit anderen Künstlern zu-sammen die Gründung des Kabaratts vorzubereiten. Sie planten und probten, aber bald war es doch wieder noch nicht ganz das Richtige. Abends zog er mit seinem Harmoschke von Kneipe zu Kneipe. Sie kamen nicht weiter. Herminale, mein Neschome, so wie an schlechta Traum kommt mir das vor.
New York forderte Anpassung, es zeigte den Einwanderern seine Krallen, das Geld war eine ständige Sorge. Hermina nahm eine Stelle als Gesellschafterin bei einer behinderten Dame an. Wenn sie unter die Leute ging, konnte sie wenigstens ihr Englisch verbessern. Da die Zugehfrau der Dame krank war, putzte Hermina, wusch die Wäsche und kochte dem Königspudel seine Diätmahlzeit. Alle drei Stunden mußte er um den Häuserblock geführt werden. Von der Vermieterin aus Wien ließ sich Hermina die schmale Mappe schicken, die sie ihr gegeben hatte, bevor die Nazis kamen. Darin waren ein paar Briefe und Photos, Urkunden und Zeugnisse. Ihr Verlobungsring steckte noch dazwischen.
An einer Nursing School bewarb sich Hermina um eine Ausbildung. Aber in einem Schreiben erklärte man ihr, mit achtundzwanzig sei sie zu alt und außerdem sei eine, die im Konzentrationslager war, ungeeignet dafür, als Krankenschwester zu arbeiten. Schließlich fand sie Arbeit in der medizinischen Bäderabteilung eines Krankenhauses, wo sie den Leuten Massagen und Wickel verabreichen mußte. Sie verdiente nun besser, ließ sich Dauerwellen legen und kaufte ein Kleid mit einem schwingenden Petticoat darunter. Ein Arbeitskollege lud sie abends ins Kino ein.
Als sie nach Hause kam, brüllte Maxim wie ein Irrer. Er schlug auf sie ein und zerriß das Kleid in Fetzen. Tagelang mußte sie im Zimmer bleiben, weil sie sich schämte. Ihr Gesicht war blau geschlagen, die Lippen aufgeplatzt. Maxim heulte vor Reue wie ein Kind. Herminale, mein Neschome, das Liebste in mein ganzen Leben!
1950 bekam Hermina einen Sohn. Sie nannte ihn Franz nach ihrem Vater, der in Auschwitz vergast worden war. Durch das Kind hing sie nun völlig von Maxim ab. Tante Vera, die immer gegen die Heirat mit diesem Ghetto-Juden gewesen war, schickte gute Ratschläge und vor allem Geld. Ohne Tante Veras Hilfe hätten sie nicht einmal die Geburt im Krankenhaus bezahlen können. Drei Jahre später befreite sich Hermina von der einlullenden Liebe und von den Eifersuchtsszenen Maxims. Sie hinterließ nicht einmal eine Nachricht. Mit dem Jungen und einem kleinen Koffer kam sie bei Tante Vera in München an. Da war schon ein Kinderzimmer eingerichtet worden. Ein Schaukelpferd und ein rotes Tretauto für Franz.
Aus New York kamen verzweifelte Briefe. Herminale, aus großer Liebe zu Dir versagen meine Nerven, und ich mache Sachen, die Dir und mir wehtun. Du mein Liebstes, Du meine Heilige, Du sitzt auf einen Scheslan in mein Herz. Bis in den Tod Dein Maxim.
Hermina durfte den Führerschein machen und in dem Cabriolet der Tante zum Chiemsee hinaus fahren. Es war Sommer, sie war braungebrannt und sportlich, man hielt sie für eine Italienerin oder für eine Spanierin, sie hatte Verehrer. Aber Hermina, die den Ring des im Krieg gefallenen Verlobten nun zu ihrem Ehering dazugesteckt trug, wollte nichts mehr von Männern wissen. Über ein Jahr spielte sie im Haus von Tante Vera, die so gerne sagte, no geh scho Mohrlerl, die Rolle der Tochter. Dann ermutigte sie sich und nahm einen Zug nach Wien. Schon nach drei Tagen wußte sie genug. Sie wollte weder in der Straßenbahn fahren noch auf den frisch gestrichenen Parkbänken am Heldenplatz sitzen. Immerhin waren die Schilder Für Juden verboten abmontiert worden. Hermina sah sie in den Kellerräumen der Hofburg lagern, bis sie wieder gebraucht würden. Auch am Prater hatte sie kein Vergnügen mehr. Nicht einmal zum Riesenradfahren hatte sie Lust. Die hinterfotzige Freundlichkeit der Leute widerte sie an. In der Wohnung der Kriegerwitwe wohnte jetzt eine junge Familie. Hermina fragte nicht weiter. Aber Tante Vera berichtete sie von rührenden Wiedersehensszenen und was diese sonst noch gerne hörte. Kein Wort über die Toten.
Bei Tante Vera und Onkel Sepp trug Franz, der ein kräftiger, aber für sein Alter ungewöhnlich besonnener Junge war, Lederhosen und ein Filzhütchen. Für Hermina hatte die Tante ein Dirndl aus Seidenstoff gekauft und eine passende Brosche dazu. Es hatte kurze Ärmel und ließ die in Auschwitz eintätowierte Nummer sehen. Aber nach ihrer Wienreise ertrug Hermina den biedermeierlichen Haushalt ihrer Tante, wo das Dienstmädchen mit einer kleinen, weißen Spitzenschürze herumging, nicht mehr. Sie wollte nicht verwöhnt werden wie eine einzige Tochter, und auch das Angebot von Onkel Sepp, als Sekretärin im Geschäft mitzuarbeiten, lehnte sie ab. Wie hätte sie es erklären können? Sie hatte Anspruch auf Wiedergutmachungsgeld. Es half für den Anfang. Hermina ließ sich zur Krankengymnastin ausbilden. Sie zog mit Franz in eine Wohnung im Lehel, die zwei große, hohe Zimmer mit abgeblätterten Stuckdecken und eine Küche hatte, ein Bad gab es nicht. Die Toilette war für mehrere Wohnungen zusammen im Treppenhaus.
Jahre später, als Hermina das beharrliche Gefühl des Neben-sich-selbst-Stehens nicht mehr aushalten konnte, vertraute sie sich einer Psychologin an, mit der sie sich angefreundet hatte. Bei ihr lernte sie mühsam, über das, was sie durchgemacht hatte, zu sprechen und über die Toten zu weinen.
Franz
Franz ist ein besonderer Junge. Aber das weiß nur er selbst, er läßt sich das nicht anmerken. Er hat schon über zwanzig Geheimnisse, die er alle ganz für sich behalten kann und die er in seinem Geheimbuch auflistet. Er hat sie in drei Gruppen unterteilt: Geheim, höchst geheim, geheim bis in den Tod. Geheim ist beispielsweise, daß er schneller als der Klassenlehrer rechnen kann, unter geheim bis in den Tod fällt der ungeöffnete Brief mit dem Absender Maxim Wisniewski, New York, USA, den er in seiner Schätzekiste aufbewahrt. Wenn Hermina die Post aus dem Briefkasten unten holt und ein Luftpostbrief dabei ist, seufzt sie schwer. Der Vater hat in Amerika eine lebenswichtige Aufgabe zu erledigen. Deshalb kann er nicht einmal zu Weihnachten kommen, so daß Franz und Hermina, damit sie nicht allein sind, bei Tante Vera und Onkel Sepp feiern, wo der Christbaum mit seiner silbernen Spitze bis zur Decke hoch reicht und wo es nach der Bescherung Gänsebraten gibt.
Franz besitzt einen Cowboyhut, einen Gürtel, in dem zwei Colts stecken, und einen Sheriffstern. Wenn er die Sachen trägt, sieht er wie sein Vater aus. Der hat außerdem ein Lasso und zwei Pferde, auf denen er abwechselnd durch die Prärie reitet. Vom sonntäglichen Fernsehen bei Tante Vera weiß Franz genau, wie es auf der Ranch am Fuß der blauen Berge aussieht. Sein Vater ist der Freund eines großen Indianerhäuptlings. Wenn sich die beiden in der Prärie begegnen, zünden sie ein Lagerfeuer an, setzen sich nieder und rauchen die Friedenspfeife. Auch Franz besitzt eine Friedenspfeife, er hat sie von Onkel Sepp ausgeborgt, dem so viele Pfeifen gehören, daß der es gar nicht merkt, wenn einmal eine fehlt. Den Cowboyhut, die Colts, den Sheriffstern und die Friedenspfeife holt Franz jedoch nur dann aus seinem Schätzekoffer, wenn er allein zu Hause ist.
Franz ist oft allein, weil Hermina im Krankenhaus arbeitet. Sie verdient dort Geld und hilft, kranke Leute gesund zu machen. Meistens kommt sie erst um sechs Uhr abends nach Hause. Er hat dann längst bei Frau Mumbauer unten gegessen und seine Schulaufgaben gemacht. Die sind immer ganz einfach, Franz bekommt die besten Noten, deshalb darf er schon jetzt nach Ostern, ein Jahr früher als üblich, ins Gymnasium wechseln. Wenn er fertig gerechnet und geschrieben hat, wartet er, bis Frau Mumbauer von ihrem Mittagsschlaf aufwacht. Um sich die Zeit zu verkürzen, liest er in den Büchern von Frau Mumbauers Mann, der Buchhändler war und letzten Sommer gestorben ist. Franz geht fast nie zum Spielen hinaus, er will weder anderen Kindern noch Bällen noch sonst etwas nachlaufen. Er wartet mit einem Buch am Küchentisch, bis Frau Mumbauer aus ihrem Schlafzimmer herauskommt und sich einen Kaffee aufbrüht. Dann fragt er, ob sie ihm den Schlüssel gibt und ihm erlaubt, nach oben zu gehen. Meistens unterhalten sie sich noch ein wenig, dann bedankt sich Franz für das Mittagessen, macht eine kleine Verbeugung, denn er weiß, wie man sich benimmt, und zieht die Tür sehr vorsichtig hinter sich zu, weil Frau Mumbauer oft ihre Migräne hat. Oben zieht Franz gleich die Schätzekiste unter seinem Bett hervor und holt den Cowboyhut, den Gürtel mit den Colts und die Friedenspfeife heraus. Damit verwandelt er sich in den Sohn des großen Maxim. Mit gewichtigen Schritten stolziert er zum Spiegel in das Zimmer von Hermina hinüber um nachzuprüfen, ob alles richtig sitzt.
Er ist ein großer, kräftiger Junge, der so schwarze Augen und so schwarzes Haar hat wie keiner sonst in der Klasse. Auch seine Haut ist dunkler, selbst im Winter sieht sie wie eben gebräunt aus. Franz weiß, woher das kommt. Seine Mutter ist nämlich gar nicht seine richtige Mutter. Das hat er schon vor zwei Jahren unter geheim bis in den Tod notiert. Deshalb hat er vor einiger Zeit angefangen, sie Hermina statt wie vorher Mutti zu nennen. Zuerst hat sie gemeint, das sei doch keine gute Idee, aber jetzt hat sie sich daran gewöhnt, und es scheint ihr recht. Hermina ist eigentlich die Schwester seines Vaters. Um Franz vor den für ihre Grausamkeiten bekannten Komantschen zu schützen, hat Maxim seine Schwester, die sich niemals fürchtet, beauftragt, mit dem Kind nach Deutschland zu fliehen. Seine wirkliche Mutter ist eine Häuptlingstochter, die die Komantschen entführt haben. Maxim hat ewige Rache geschworen.
Franz schürt den Küchenherd, er stochert mit dem Schürhaken in der Glut, daß Funken aufsteigen. Er legt ein Brikett nach. Dann setzt er sich nach Indianerart auf den an den Herd gerückten Küchentisch und schaut in das Feuer und zieht an der kalten Pfeife, die einen widerlichen Geschmack im ganzen Mund macht. Er zwingt sich, solange wie möglich mit durchgestrecktem Rücken dazusitzen und seine Gedanken zu ordnen. Als Sohn der Häuptlingstochter ist er natürlich nicht katholisch wie die anderen in der Klasse, deshalb wird er auch kein Kommunionsfest feiern, obwohl das ein herber Verzicht für ihn ist, er hätte gerne ein Fest und Geschenke gehabt. Doch nur der Form halber besucht er überhaupt den Religionsunterricht, das hat Hermina so mit dem Lehrer besprochen. Tatsächlich haben sie jedoch eine ganz andere, eine viel bedeutendere Beziehung zu Gott. Das kann man leicht daran erkennen, daß Hermina eine Nummer an ihrem Arm stehen hat. Diese Nummer geht nicht weg, soviel Hermina auch badet und sich wäscht. Bevor Franz viel fragt, macht er sich lieber seine eigenen Gedanken, außerdem hat er die Bücher vom verstorbenen Herrn Mumbauer, in denen er manches nachlesen kann.
Einmal, schon länger her, als sie im Bad waren und nach dem Schwimmen in der Sonne lagen, rieb Franz mit dem Zeigefinger über die Nummer, er nahm auch Spucke, irgendwie, dachte er, dieser Stempel müsse unter dem Reiben doch verschwinden. Hermina hielt da in der Sonne die Augen geschlossen und machte ein ganz normales Gesicht. Aber schließlich sagte sie leise zu Franz, gib dir keine Mühe, das geht nicht weg, das ist die Telephonnummer zum lieben Gott.
Franz, da auf dem Küchentisch, tut bald der Rücken weh und die Knie, mit dem Schmerz kommt ihm die Haltung immer irgendwie lächerlich vor, überhaupt ist alles blöd. Er räumt die Sachen in die Schätzekiste zurück und macht ein paar Notizen in das Geheimbuch. Unter die Rubrik Briefe 1959 setzt er ein Kreuz, denn gestern hat Hermina, als sie von der Arbeit kam, einen Luftpostbrief mit hochgebracht. Nur sie besitzt einen Schlüssel zum Briefkasten. Noch im Mantel steckte sie sich eine Zigarette an, seufzte tief, setzte sich an den Küchentisch und las. Das dauerte nur eine halbe Minute, Franz schaute auf die Wanduhr, dann warf sie den Brief in den Herd.
Franz fragt nicht mehr. Wenn Hermina die Augen zusammenpreßt und die Hand so an den Hinterkopf legt, weiß er inzwischen, daß keine vernünftige Antwort kommt. Als er noch kleiner war, konnte sie ihm die tollsten Geschichten erzählen. Er ahnt jedoch, daß das Verbrennen des Briefes eine notwendige Vorsichtsmaßnahme sein wird, um den Sohn der schönen Häuptlingstochter vor den Komantschen zu schützen.
Nachdem Franz nichts mehr einfällt, das er in das Geheimbuch zu notieren hätte, nimmt er sich den ungeöffneten Brief mit dem Absender Maxim Wisniewskis wieder vor. Er kennt jeden Schnörkel der großen umständlichen und irgendwie schlecht zu lesenden Schrift. Obwohl sich Hermina vor nichts fürchtet, ist es doch Franz, der die Verantwortung trägt, das weiß er ganz genau, und eigentlich ist er auch kein Lügner. Es war nur so, daß er vorletzten Freitag, als die Schule erst um zehn Uhr anfing, vor dem Haus dem Briefträger begegnete. Der war eilig und überreichte im Vorbeigehen Franz den Brief, Post heute nur für euch, Bub, rief er, und Franz wurde es zuerst heiß, dann kalt und schwindlig, es war das erste Mal, daß er etwas, das direkt von seinem Vater kam, in den Händen hielt. Endlich wieder bei Besinnung steckte er den Brief in die Schulmappe, wo er ihn zwischen den Heften und Büchern ja leicht hätte vergessen können.
Nachmittags notierte er die New Yorker Adresse sorgfältig in sein Geheimbuch, denn natürlich hatte er schon oft über eine heimliche Reise nachgedacht. Ihm kam die Idee, Maxims Schrift nachzumachen. In den großen, umständlichen Buchstaben schrieb er Maxim Wisniewski, bis sich das, was im Geheimbuch stand, nicht mehr von dem auf dem Umschlag unterscheiden ließ. Als Hermina abends nach Hause kam, fragte sie nicht etwa, ist der Briefträger heute morgen eilig gewesen und hat im Vorübergehen gesagt, Post heute nur für euch, Bub. Sie war an diesem Tag sehr zufrieden, erzählte beim Essen lustige Geschichten, wie sie im Krankenhaus passieren, und bevor sie schlafen gingen, spielten sie noch zwei Runden Halma, bei denen er Hermina absichtlich gewinnen ließ. Nach ein paar Tagen dachte Franz, dem es natürlich mulmig war, es sei ja nun ganz undenkbar, Hermina den Brief noch zu geben oder ihn selbst in den Briefkasten unten zu stecken, weil sie gewiß merken würde, daß es ein alter Brief war, und nachforschen würde. Diese Schande könnte Franz nicht aushalten. Die einzige Möglichkeit, die er noch hatte, war, den Brief im Herd zu verbrennen.
Im Zimmer ist es schon düster geworden, Franz zittert ein wenig vor Kälte, der Küchenherd allein schafft es nicht, auch noch die beiden Zimmer zu heizen, die keine Öfen haben. Er schiebt die Schätzekiste unter sein Bett und geht in die Küche hinüber, den Brief nimmt er mit. Das Feuer brennt nicht gut, er zerknüllt Zeitung und stopft sie hinein. Wenn er den Brief verbrennt, so macht es ja keinen Unterschied, ob er ihn vorher geöffnet hat oder nicht. Von dem Brief wird nichts wirklich übrig bleiben, sondern nur das, was Franz im Kopf behält. Und es kann sein, daß eine lebenswichtige Botschaft darin steht, ohne die er und Hermina verloren sind. Als er die Stufen im Treppenhaus knarren hört, rennt er in sein Zimmer zurück und versteckt den Brief schnell unter der Matratze. Schließlich, halb unter das Bett gekrochen, ermutigt er sich. Es ist fast, wie er vermutet hat, trotzdem ist er enttäuscht. Der ganze Brief besteht aus Geheimschrift, jeder Buchstabe, pure Geheimschrift, so daß Franz nichts, gar nichts entziffern kann. Er steckt den Brief in die Schätzekiste zurück, tief unter die anderen Sachen.
Franz kennt Herminas unmögliche Chefin im Krankenhaus, und er weiß über den unverschämten Hausbesitzer Bescheid, der nichts renovieren läßt, aber dauernd mehr Miete will. Wenn Tante Vera wieder geseufzt hat, bei uns könntet ihr es so gut haben, heult Hermina oft schon auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn und dann noch den ganzen Abend lang, und Franz bringt ihr Kamillentee ans Bett und setzt sich daneben, bis sie aufhört zu zittern und einschläft. Immer sorgen sie füreinander. Sie hätte gerne, daß Franz häufiger hinausgeht, daß er Fußball spielt und Kameraden hat, statt dauernd über Büchern zu hocken. Der Schularzt hat gesagt, Franz sei zu dick, er brauche mehr Bewegung. Franz selbst hat nur ein einziges Problem, aber soviel er es im Kopf auch probiert, die Wörter kommen nicht heraus. Seit er nicht mehr klein ist, erzählt ihm Hermina keine wunderbaren Geschichten mehr über den Vater, daß es ihn überhaupt gibt, beweisen nur die Briefe. Er fragt Hermina auch dann nichts, als er in der neuen Klasse auf dem Gymnasium hört, wie ein Mitschüler einem anderen laut und so bedeutungsvoll zuflüstert: Juden sind immer die Klassenbesten.
Franz weiß vom Religionsunterricht, daß es in der Bibel um Juden geht. Aber sicherheitshalber schlägt er im Lexikon des verstorbenen Herrn Mumbauer nach, es riecht noch neu, ganz unbenutzt. Unter einem Bild, auf dem drei bärtige Männer mit Hüten gehen, steht: Orthodoxe Juden aus Munkatsch (Karpato-Ukraine) mit der übernommenen Tatarenkleidung (Talar und Fellmütze). Wie soll Franz das mit sich und seinen guten Noten in Verbindung bringen? Juden sind ein Rassengemisch vorderasiatischer und orientalischer Semiten. Und weiter unten: Die sagenhafte Vorgeschichte des Volkes Israel beginnt nach der Bibel mit Abraham, der um 2140 v. Chr. von Mesopotamien nach Kanaan (Palästina) auswanderte, den Monotheismus und die Beschneidung einführte und dessen Enkelsfamilie (Jakob) Israel sich in der ägyptischen Prov. Gosen ansiedelte. Es ist viel zu viel, um sich alles zu behalten und um es dann oben ins Geheimbuch zu schreiben. Frau Mumbauer wird noch eine Weile in ihrem Schlafzimmer bleiben, und Franz macht etwas, was er sonst noch nie getan hat. Er faltet eine scharfe Kante und trennt die Seite vorsichtig aus dem noch völlig unbenutzten Lexikon heraus. Von nun an hat Franz viel Gelegenheit, seine Sammlung über das Judentum zu erweitern, im Heraustrennen wird er immer ungenierter. Sein Geheimbuch ist bald vollgeschrieben und beklebt, heimlich kauft er sich ein neues, in dem er nun systematisch alles, was er in Erfahrung bringt, nach Jahreszahlen ordnet. Ein paar Mal geht er sogar mit Onkel Sepp auf die Jagd, um ihn zum Erzählen zu bringen, und er spitzt die Ohren, wenn sich Hermina und Tante Vera in der Küche unterhalten. Eins paßt zum andern, endlich durchschaut er die Anläufe, die Hermina nimmt, um mit ihm offen zu sprechen, aber er tut naiv und macht ihr damit absichtlich das Leben schwer. In das Geheimbuch schreibt er mit roter Tinte schlimme Schwüre.
Als er vierzehn ist, sagt er ihr, daß er alles weiß, auch woher sie die Nummer hat. Zum Beweis legt er ihr das Bild einer nackten und zum Skelett abgemagerten Frau, die einen irren Blick hat, vor. Darunter steht, Bergen-Belsen am 15. April 1945, das Photo wurde unmittelbar nach der Befreiung des Lagers von einer britischen »Film and Photographic Unit« aufgenommen.
Ist es so mit dir auch gewesen? Wochenlang genieren sie sich derart voreinander, daß sie nur noch das Nötigste sprechen. Zum ersten Mal stellt Franz eine Forderung. Er will seinen Vater sehen.
In der Klasse spricht er mit keinem mehr, er liebt plötzlich das Gefühl, eine Art Märtyrer zu sein. Seine Mutter ist doch nicht vom Himmel gefallen. Sie hat ihm den Namen ihres Vaters gegeben, der in Auschwitz vergast worden ist. Franz trägt den Namen eines vergasten Juden. Zu den Lehrern ist er arrogant, mit diesen verbohrten alten Nazis will er nichts zu tun haben. Geschichte fällt jetzt öfter aus, bevor Hitler an die Macht kommt, läßt sich der Lehrer an der Galle operieren. Franz braucht keinen Unterricht. Diese Obersturmbannführer sollen dem Juden seine Einsen und sein Abiturzeugnis geben und ihn nicht anmachen.
Hermina sagt ihm, daß Maxim jetzt siebzig Jahre alt ist, in einer fast fensterlosen Kellerwohnung haust und als Straßenmusikant herumzieht. In all den Jahren hat sie ihm Geld geschickt, obwohl sie kaum wußte, wie haushalten mit ihrem Gehalt. Sie will Franz die Briefe, die noch immer regelmäßig eintreffen, vorlesen. Er tut, als höre er nicht hin. Herminale, mein Neschome, mein Liebstes auf der Welt, ich will du sollst glicklich sein, aber ich bleibe dein Mann bis in den Tod. Maxim verweigert den Scheidungsbrief. Was hätte er auch noch ändern können?
Franz will keinen Christbaum und keinen Gänsebraten mehr, das nette Spiel ist vorbei. Als die ungeheure Beklemmung nicht aufhört, mischt sich Tante Vera doch ein. Man hätte von vorneherein alles anders machen sollen. Ihr war schon immer klar gewesen, daß es eines Tages zur Katastrophe kommen mußte. Großmütig spendiert sie Franz ein Flugticket nach New York und das nötige Taschengeld dazu. Franz will ganz entschieden nicht, daß Hermina mit ihm kommt.
Am Flugplatz steht ein alter, Mann, der aussieht wie einer der drei Juden in Herrn Mumbauers Lexikon. Er weint hemmungslos. Franz, der schon größer ist als sein Vater, läßt sich in den Arm nehmen und immer wieder abküssen, obwohl es ihm unangenehm ist. Er hat sich vorgenommen, Englisch zu sprechen. Aber Maxim sagt, sei asej gut und redt mit mir in a Sproch, was ich kann verstehn. Franz lacht das erste Mal seit langer Zeit, er will sich auf alles einlassen, vielleicht wird er für immer in New York bleiben.
In der finsteren Wohnung steht noch das Kinderbett von Franz. Seit Hermina vor zwölf Jahren fortgegangen ist, hat sich hier nichts geändert. Franz soll neben Maxim in ihrem Bett schlafen. Es ist ihm seltsam, da in New York neben einem fremden, alten Mann im Ehebett zu schlafen. Maxim steht früh auf, legt die Gebetsriemen an und geht zur Synagoge, das Harmoschke nimmt er in einer großen schwarzen Tasche mit. Franz tut, als schlafe er noch, er spürt, daß der Sohn, der keine Toraschule besucht hat, ein Unglück für diesen Vater ist. Nur am Sabat geht er in die Synagoge mit, freilich ohne ein Wort zu verstehen.
Die Morgen verbringt Franz damit, nach und nach Küche und Bad zu schrubben. Er wäscht sogar den karierten Vorhang, der vor dem Regal hängt, und die Regalbretter, er lüftet, so gut es geht. Franz ist in Haushaltsdingen nicht ungeübt, jeden Samstag erledigt er zu Hause mit Hermina alles, was zu tun ist. Maxim sagt nichts zu den Verbesserungen, wahrscheinlich bemerkt er sie gar nicht. Mittags kommt er und schüttet eine Menge Münzen in den Kochtopf, der ihm als Sparkasse dient. Dann gehen sie zum Essen in einen Saal, wo die jüdische Gemeinde billig Eintopf ausgibt. Alles koscher, und Franz trägt während des Essens die Kippa, die man ihm bringt. Es kann doch nicht sein, daß Maxim das ernst nimmt. Alle seine Freunde hier tragen lange Bärte und schwarze Hüte, manche haben Schläfenlocken.
Sie laufen viel durch die Straßen nebeneinander her. Franz lädt Maxim zu einer Sightseeing-Tour im Bus ein. Einmal machen sie eine Schiffahrt zur Freiheitsstatue und um Ellis Island. Maxim schildert mit viel Rührung, wie Hermina und er 1948 hier ankamen. Sie hatten kurz zuvor geheiratet, es war die glücklichste Zeit in seinem ganzen Leben. Am Ende werden die vier Wochen lang. Franz will nach Hause, und Maxim hält ihn nicht auf.
1965
Herrmann Haselwander kauft das neue Mercedes Modell, einen Traum in Weiß, und schenkt seiner Frau zum Geburtstag eine silbergraue Persianerjacke. Sein Knie plagt ihn viel. Jede Art von Ablenkung ist ihm recht.
Auch Fräulein Jadow kauft sich einen Wagen. Sie ist aus dem alten Schulhaus in eine Neubauwohnung im Nachbarort gezogen. Oft fährt sie hupend vor die Bäckerei, um Linda zur Geigenstunde abzuholen.
Die Großmutter legt ihr Geld, bevor es wieder bei einer Inflation verreckt, wie sie sagt, lieber in Gold und feingeknüpften Perserbrücken an. Die Pracht der Muster und Farben sind ihr eine Wohltat. Die Kuh und die Schweine hat sie abgeschafft, überhaupt macht sie es sich jetzt leichter, sie wüßte gar nicht, wozu sie sich immerfort abplagen soll.
Die Olsons ziehen von Bremen nach Huwihl und mieten das alte Schulhaus, das von der Gemeinde provisorisch hergerichtet wurde. Hier können sie endlich soviel Musik und Lärm machen wie sie wollen.
Malte spielt täglich mehrere Stunden Klavier. Marie ist jetzt zwei Jahre alt und übt, sich gegen die drei älteren Geschwister durchzusetzen.
In dem linken unteren Klassensaal ist weiterhin die von Fräulein Jadow betreute Bibliothek untergebracht. Aber das macht der Familie nichts aus. Frau Olson übernimmt die Leitung des Kirchenchors und gibt Musikunterricht. Im Haus ist ohnehin ein ständiges Kommen und Gehen. Ihre Schlafzimmer haben sie unter dem Dach in den Lehrerwohnungen. Der andere Klassensaal unten ist zugleich Küche und Wohnzimmer. Die beiden oberen Klassensäle sind Musik- und Gästezimmer. Oft wohnen bei den Olsons Musiker und Maler und Schriftsteller. Eine Menge solcher mit langen Haaren und Bärten. Auch Lioba Vengerowa kommt gelegentlich, um sich für ein paar Tage im Schwarzwald zu erholen und um mit Malte zu musizieren.
Künstler, sagen die Leute. Aber sie sagen es wohlwollend und sogar mit einem Stolz auf das, was ihr Ort zu bieten hat. Vor allem Frau Olson ist beliebt.
Tante Vera und Onkel Sepp machen eine Kreuzfahrt in die Karibik, um endlich einmal etwas anderes als München zu sehen.
In die Wohnung von Hermina und Franz wird ein Bad eingebaut, indem man durch die Küche eine Wand zieht. Auch eine Zentralheizung wird installiert. Seit Franz in Amerika gewesen ist, kommt von Maxim kaum noch Post.
Frau Mumbauer will das hintere Zimmer an eine Studentin vermieten. Um mehr Platz zu haben, schenkt sie Franz die Bücher ihres Mannes. So kommt es, daß im Zimmer von Franz an einer Wand fast bis zur Decke Kartons mit Büchern gestapelt sind. Es sieht aus, als sei Franz gerade am Umziehen. Ihm gefällt es so. Hermina will bald ein Regal kaufen.