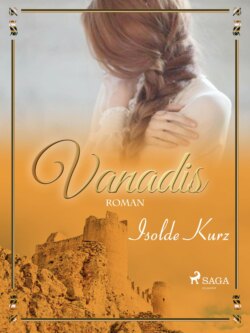Читать книгу Vanadis - Isolde Kurz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes kapitel Vanadis das Kind
ОглавлениеEs war in der Zeit, wo die Frauen noch lange Haare und kurzen Verstand hatten und demgemäß in der Versammlung schweigen mußten, dafür aber von Küche und Alkoven aus desto herzhafter die Welt regierten. In jenen dunklen Tagen, die noch gar nicht so fern sind, wie es heute scheinen mag, wuchs auf einem Herrensitz in nächster Nähe einer süddeutschen Kreisstadt ein kleines Mädchen auf, das den Namen Vanadis trug. Ihr Vater, der Mythenforscher Heinrich Folkwang, hatte ihr gegen den Widerspruch der ganzen Verwandtschaft diesen Namen gegeben, der bei unsern Altvordern soviel wie Göttin oder „Dîs“ der Wanen bedeutete und ein Zuname der Freya war. Nur ein so eigenbrötlerischer und sonderbarer Herr wie dieser Professor Folkwang, sagten die Leute, konnte sich darauf versteifen, ein Kind mit so fremdartigem Namen ins Leben hinauszuschicken. Er war in der Tat ein steifnackiger Gelehrter, von der Waterkant gebürtig, der sich durch Schriften und Vorlesungen mit den Häuptern seiner Zunft verfehdet hatte, worüber ihm eine aussichtsreiche akademische Laufbahn in die Brüche ging. Seit dem frühen Tod seiner entzückenden jungen Frau litt er an zeitweiligen Gemütsstörungen, die sich als Menschenscheu und Schwermut äußerten. Darum war er, dem Drang nach Einsamkeit folgend, zu seinen Schwiegereltern, den van der Mühlens, in das alte Herrenhaus übergesiedelt, den letzten Rest eines ehemals umfang- und ertragreichen Ritterguts, das der jetzige Besitzer, dem es durch Heirat zugefallen war, wegen Schulden stückweise verkauft und der aus ihren alten Toren herausdrängenden Stadt als Baugrund überlassen hatte. Das Haus besaß schöne Verhältnisse und einen stattlichen Aufgang, war aber äußerlich ein wenig herabgekommen, weil die Mittel zur Instandhaltung fehlten. Dagegen bewahrte der Park, den ein alter Gärtner versah, noch die Erinnerung einstigen Glanzes. Da standen herrliche Baumgruppen und steinerne Götterfiguren, die freilich ihre Glieder nicht mehr alle beisammen hatten, und deren schönste, eine Hebe, neben ihrem Sockel im Grase lag, von Moosen überklettert. Was aber diesen Garten von allen anderen Gärten unterschied, war ein Bächlein mit flachen Borden, das fast in gleicher Höhe mit dem Rasen hinlief, das Anwesen in zwei Hälften schnitt, und das den wilden Knaben des Hauses Folkwang, solange sie klein waren, eine gern benützte Gelegenheit zum Hineinfallen gab. Ein Brücklein überspannte es und führte in den Waldgrund hinüber, das Überbleibsel eines bedeutenden Forstes, den Herr van der Mühlen bei Geldknappheit nach und nach hatte schlagen lassen. Dieser einst sehr lebenslustige Herr kam in der Zeit, wo unsere Geschichte beginnt – das war in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts –, nur noch selten aus seinem Zimmer im oberen Stockwerk herunter und glitt alsdann wie sein eigenes Gespenst durchs Haus. Er war schwachsinnig geworden und vergaß immer wieder, daß die lärmende Jugend unten im Garten seines Blutes war, wie oft seine noch sehr lebensvolle Gemahlin, die geliebte Schutzgöttin der Kinderschar, ihn an diese Tatsache erinnerte. Nur die kleine Vanadis kannte er als seine Enkelin. Sie brachte ihm zuweilen einen Strauß Blumen aufs Zimmer, worüber er eine närrische Freude bezeigte. Sie war ein eigenes Geschöpf, die kleine Vanadis oder Vana, wie sie sich selber nannte. Um sich vor der Wildheit der Knaben, die sie auf Schritt und Tritt bedrängten, zu retten, schuf sie sich eine eigene abseitige Welt. Wenn der Vater seinen Spaziergang machte, schmuggelte sie sich in sein Zimmer, um, was ihr von seinen Büchern dem Titel oder den Abbildungen nach verlockend war, vom Bord zu stehlen, denn sie hatte viel früher als andere Kinder lesen gelernt. Mit ihrem Raub flüchtete sie unter die niederhängenden Zweige einer gewaltigen Zeder, die ihr fernab vom Tohuwabohu der Brüder ein häusliches Obdach bot, und verschlang wahllos, was sie ergattert hatte. Sie nannte diese Zuflucht „Schloß Tronje“ und den umgebenden Moosgrund mit Leberblümchen und Steinnelken den „Garten Immerschön“. Das Gelesene erzählte sie der großen Lumpenpuppe, die sie überall mit sich trug. Sie besaß zwar Puppen in Menge, aber sie spielte mit keiner andern. Nur für diese eine aus Werg und Zeuglappen war sie auf den ersten Blick erglüht. Und doch konnte man nichts Häßlicheres sehen als diese Puppe: Mund, Kinn und Nase waren aus Stoff gezupft und genäht, die Augen bestanden aus flachen schwarzen Perlen und funkelten mitunter ganz schreckhaft, daß das kleine Ding ein dämonisches Ansehen bekam. Eine rote Mütze machte sie noch häßlicher. Überdies war sie von den wilden Griffen der Brüder in der Mitte eingeknickt, so daß sie, wollte man sie frei halten, vornüber sank. Vanadis liebte sie ob dieses Leibschadens nur noch mehr, wie eine Mutter ihr krankes Kind vor allen andern bevorzugt.
Was kommt der Wirkung gleich, die ein den elterlichen Garten durchströmendes Wasser auf die kindliche Phantasie auszuüben vermag! Es war ein bewegliches Eigentum inmitten eines unbeweglichen, es kam und ging ohne Unterlaß, war nicht zu halten und war doch immer da. Innerhalb und außerhalb des van der Mühlenschen Gutes hieß dieses Wässerlein von jeher nur „der Bach“. Die kleine Vanadis gab ihm einen Namen; nach seiner leisen, singenden Stimme nannte sie ihn das „Bächlein Lirili“. Er gab ihr mit seinem eilenden Gang, der aus dem Unbekannten kam und ins Unbekannte ging, die sehnsüchtige Ahnung der Ferne. Wenn sie eine Blume hineinwarf, so lief sie jubelnd mit, sah sie diese dann in dem schmalen Durchbruch der Mauer, durch die das Bächlein hinausströmte, verschwinden, so stand sie bestürzt und traurig. Das Empfinden des Unaufhaltsamen und Vergänglichen war dann unbewußt über ihr. Das Bächlein Lirili senkte ihr den ersten Keim zu jenem Fernweh in die Seele, das immer die Heimat im Unerreichbaren suchen muß. Das tiefste und geheimste Wunschziel des Kindes war die „Selige Insel“. Sie lag ihr im Sinn, seit sie einmal ihren Vater hatte gegen den älteren Bruder äußern hören, die Alten hätten tief im Westen, wo die Sonne vom Tageslauf rastet, die Inseln der Seligen gesucht. Wort und Vorstellung ließen sie nicht mehr los, und die dort badende Sonne mußte sie sich als etwas Leibhaftes, wenn auch Unfaßbares, vorstellen. Dorthin ging ihr Sinnen; mit der Lieblingspuppe dort zu wohnen, wo weder die Unarten der schrecklichen Jungen noch Tante Fannys kreischende Stimme sie erreichen konnte, das war der Traum ihres jungen Lebens. Das Kind hatte nicht wie andere kleine Mädchen den Trieb, die Puppe immer neu zu kleiden, das wäre auch bei deren eigentümlicher Beschaffenheit, der es an einer fest abgegrenzten Leiblichkeit gebrach, schwierig gewesen. Dagegen ersann sie ihr immerzu neue Namen, geistige Gewänder, mit denen sie wechselte. Denn das Namengeben war ihre besondere Stärke, und diese mußten entweder hochromantisch sein wie Filomene oder Blanchefleur oder ganz und gar seltsam und selbstgebildet: die tiefe Zärtlichkeit, womit das Kind diese Unnamen sprach, gab ihnen den seelischen Wohlklang. Mit ihrem ursprünglichen Namen aber hieß diese Puppe Vana, wie die Herrin selbst, deren zweites Ich sie war. Der große Vorzug, den sie nicht nur vor den anderen Puppen, sondern auch vor den lebenden Spielkameraden genoß, erregte die Eifersucht und den grimmigen Haß der Brüder. Diese hatten sie „Lumbell“ benamst und sangen Spottlieder auf sie, und die beständige Jagd, die sie auf die Lumbell machten, war der hauptsächlichste Anlaß für die Kleine, sich mit der Puppe auf das feste Schloß Tronje zu retten, wohin die wilde Rotte sich nicht leicht verlief.
Es war ein sonnig-kühler Tag zu Anfang März, um Schloß Tronje her wuchsen die ersten Veilchen. Da saß die Kleine mit ihrer Geliebten in der Schloßkemenate, das heißt in den höheren Zweigen der Zeder, und tröstete sie über ein im Vorübergehen zugeflogenes Spottwort:
„Sie sind wieder sehr ungezogen gegen dich gewesen. Die Jungen, siehst du, sind solch ein häßliches Volk, Gott sollte gar keine erschaffen. Gunther meine ich nicht, der ist gut. Aber den andern muß man aus dem Weg bleiben. Sie meinen: ein Mädchen muß sich alles gefallen lassen, dafür ist es ein Mädchen. Nein, das wird uns jetzt zuviel. Morgen gehen wir ganz leise fort, dann sollen sie uns suchen. Wir reisen nach der Seligen Insel. Das ist die grünste, grünste Wiese mit wundervollen Bäumen mitten im Wasser wie ein großer grüner Smaragd, der von den schönsten Diamanten umgeben ist. So wie Großmutters allerschönster Ring. Niemand darf dort wohnen als wir beide. Damit keine bösen Jungen da hinkommen können, brausen die Wellen so hoch um die Insel – o so hoch! –, kein Schiff kann landen. Uns trägt ein Albatros auf seinen Flügeln hinüber. Weißt du, was das ist, ein Albatros? Das ist ein großer, großer Vogel mit rosenrotem Schnabel – halte dich fest, damit du nicht ins Meer fällst –, er fliegt schneller als irgendein Vogel.“–
Vor dem Strömen ihrer Einbildung hatte sie nicht bemerkt, daß es hinter ihr knackte und daß die Mauern von Schloß Tronje erschlichen waren. Plötzlich griff eine Hand über ihre Schulter und riß ihr die Puppe weg, und eine polternde Knabenstimme schrie in rauhem Triumph: „Wir haben die Lumbell!“
„Roderich, du Bengel!“ rief das Kind auffahrend.
Aber jetzt erscholl es von allen Seiten um ihr Obdach her: „Wir haben sie! Wir haben sie! Wir haben die Lumbell!“ Es lief wie ein ungewollter Kanon rund um den Baum.
„Wir gerben ihr das Fell!“ sang eine hellere Knabenstimme dazwischen. Das war ihr älterer Bruder Gunther, der seine dichterische Begabung gern in Knittelreimen leuchten ließ.
„Wir haben sie! Wir haben sie! Wir gerben ihr das Fell!“ sang es im Kanon mit.
Das Kind war vom Baum herabgesprungen, ohne zu beachten, daß ihr ein Büschel Haare in den Zweigen hängenblieb. Aber Roderich hatte den Vorsprung und rannte mit seinem Raub über den Steg nach dem Hause zu, die Brüder jubelnd, Vanadis schreiend hinterher. Auf dem Vorplatz machte er halt und schwang die Puppe höhnisch gegen seine Verfolgerin. Diese stürzte sich leidenschaftlich auf den Räuber ihres Kleinods. Aber sie stieß gegen eine Mauer, denn die ganze Rotte stand gegen sie zusammen.
„Laßt ihr die Puppe, sie gehört ihr!“ wehrte das Kindermädchen, das gerade mit der zweijährigen Esther im Hof spielte.
„Nein, sie gehört uns allen!“ rief es ihr entgegen.
„Die Lumbell ist eine Hexe, sie muß brennen!“ polterte die rauhe Stimme von vorhin wieder.
„Sie ist eine Hexe!“ stimmten die andern ein. „Sie ist uns auf dem Besenstiel ins Haus geritten!“
Letzteres hatte seine Richtigkeit. Die Lumbell war eine Schöpfung der erfinderischen Großmutter, Frau van der Mühlen, die im obersten Stock wohnte und die diese Geburt ihrer witzigen Laune in der verflossenen Walpurgisnacht, als draußen der Frühlingssturm tobte, spät noch am Abend auf dem Besenstiel ins Kinderzimmer geschoben hatte, wo sie mit rasendem Freudenausbruch begrüßt worden war. Vanadis aber hatte mit dem Vorrecht ihres Geschlechts die Puppe für sich allein in Beschlag genommen und damit die Brüder, wie diese meinten, um ihre rechtmäßigen Ansprüche verkürzt.
Jetzt stürzte sie zu dem Bruder, der ihr der liebste war: „Gunther, hilf du mir!“ Aber der half nicht, der Haß der Brüder auf die Lumbell war zu groß geworden. Roderich war auf den moosigen Stein gesprungen, der seitlich im Hofe lag, und die Lumbell im Arm schwingend, schrie er: „Erst wird ihr der Prozeß gemacht! Sie muß bekennen, daß sie eine Hexe ist! He, Lumbell, willst du gestehen, daß du bei Nacht zum Schornstein hinausfährst?“
Die Lumbell gestand nichts.
„Wir müssen sie mit Zangen zwicken, dann wird sie schon gestehen!“ brüllte der dicke Bruno und kam in wildem Eifer mit einer Gartenschere angerannt. Vanadis sprang dazwischen und entwand ihm die Schere, wobei sie selber an der Hand verletzt wurde. Aber auf die zweite Frage, ob sie eine Hexe sei, war die Lumbell in der Mitte eingeknickt, was als ein Ja gedeutet wurde.
„Sie hat gestanden, sie wird verbrannt! Die Hexe wird verbrannt!“ – „Nein, vorher die Wasserprobe!“ schrie Roderich, der sich im Quälen der Lumbell und ihrer Herrin nicht genugtun konnte. „Keine Wasserprobe mehr, wenn sie gestanden hat!“ entschied Gunther, der als kleiner Gelehrter, der er war, in den mittelalterlichen Rechtsbräuchen besser Bescheid wußte. – „Auf den Scheiterhaufen!“
Der kleine schlanke Enzio, den sie das Häschen nannten, lief in die Küche nach einem Feuerbrand. Unterdessen hatte Vanadis den Augenblick ersehen, um dem schlimmsten ihrer Widersacher mit katzenartiger Geschwindigkeit an den Hals zu springen und ihn ins Gesicht zu beißen, daß er unwillkürlich die Beute fahrenließ. Diese war in jammerwürdigem Zustand, das Flachshaar war ihr ausgerissen, der ganze Leib ging in Stücke. Nichtsdestoweniger hielt das kleine Mädchen sie mit verzweifelter Inbrunst ans Herz gepreßt.
Auf dem Stein flammte ein Reisigfeuer, in das die Brüder dürres Holz und Fichtennadeln warfen, der Rauch stieg in die Höhe. Vanadis blickte auf ihre Dränger mit Augen, als ob sie morden könnte. Da gewahrte sie ihr kleines Schwesterlein, wie es, aufgeregt vom Lärm der Brüder, auch sein Stecklein herzutrug in so heiligem Eifer wie jenes alte Weiblein sein gespartes Holzscheit zum Scheiterhaufen des Huß. Jetzt ging in dem Busen der Bedrängten etwas Merkwürdiges vor – sei es, daß sie ihr Geliebtestes nicht von fremden Händen sterben lassen wollte, da sie keine Rettung sah, oder war es plötzlich erwachte kindliche Grausamkeit –, sie hob die Arme, und mit einem einzigen wilden Schrei warf sie selber die Lumbell ins Feuer. Beifallstoben begrüßte die Tat, die Kinder faßten sich bei den Händen und führten einen wilden Tanz um ihr Opfer auf, das alsbald von den Flammen ergriffen war und mächtig rauchte. Dabei wiederholten sie aus heiser werdenden Kehlen immer den gleichen Singsang: „Wir haben die Lumbell!“ – worein Gunther wieder etwas Abwechslung brachte: „Die Hexe fährt zur Höll’!“
„Seht nur, was sie für greuliche Augen macht!“ schrie Roderich dazwischen.
Die Perlenaugen der Hexe funkelten noch aus der Asche heraus, in die sie gesunken waren.
Wer am wildesten sprang und am lautesten sang, aber in wortlosen Tonfolgen, war Vanadis. Sie raste wie eine kleine Mänade. Auf einmal riß sie sich aus dem Ringelreihen los, die andern wollten sie halten.
„Laßt mich! Ich hole den Don Alonso!“
„Ja, den Alonso! Her mit dem Don Alonso!“ brüllte die mordgierige Meute.
Don Alonso war das einzige männliche Mitglied ihres Puppenstaats und gleichfalls von den geschickten Händen der Großmutter gefertigt, aber mit einem richtigen Puppenkopf und -körper. Er war Kavalier vom Wirbel bis zum Zeh, in Strümpfen und Schnallenschuhen, den Hut unter dem Arm und den Degen an der Seite, ganz im Gegensatz zu der Lumbell ein allerliebstes Männchen. Aber Vanadis machte sich nichts aus ihm, er gehörte zu einem Geschlecht, von dem ihr schon allzuviel Unlust und Herzeleid widerfahren war. Sie warf ihn gleichfalls in die Glut, nachdem sie ihm zuvor noch mit grausamer Lust den Kopf an dem Stein zerschlagen hatte. Das Kind kannte sich selbst nicht mehr, sie hätte jetzt im Zerstörungsrausch alle ihre kleinen Habseligkeiten der Lumbell nachgeworfen, wenn die Brüder, die schneller zur Besinnung kamen, ihr nicht am Ende gewehrt hätten.
Als das Feuer ausgebrannt und die wilde Schar abgezogen war, stand das kleine Mädchen noch immer bei dem Opferstein und sah in den Aschenhaufen. Plötzlich erwachte sie aus dem Taumel:
„Meine Vana! Wo ist Vana?“
„Närrin, die bist du ja selber“, hohnlachte Roderich, der allein zurückkam.
„Die andre mein’ ich, die Lumbell! Meine arme Lumbell! Wo habt ihr sie?“
Das ging dem bösen Roderich über den Spott, er wurde betreten.
„Hast sie doch selbst verbrannt, du dummes Ding! Hier sind ja noch ihre Augen in der Asche.“
Da weinte das Kind auf, wie es noch nie geweint hatte, weinte stromweise unter schüttelndem Schluchzen und riß sich ganze Strähnen des blonden Haares aus. In der Verzweiflung wollte sie gar ihren Kopf in dem rauchenden Aschenrest begraben, daß die entsetzte Kinderfrau sie gegen sich selbst beschützen mußte und ihr Urfeind erschrocken davonschlich.
Wortlos in einen Winkel gekauert, verbrachte sie den Rest des Unglückstages, nachdem ihr die verwundete Hand von der Großmutter verbunden worden war. Von da an wollte sie mit keiner Puppe mehr spielen; das grausame Ende der Lumbell und ihre eigene Beteiligung daran war ein großes und schweres Erlebnis, das als tragisches Rätsel auf dem untersten Grunde des Kindergemütes zurückblieb.
Der Stern des Hauses war die alte Frau van der Mühlen. Mit einem Manne vermählt, der ihr innerlich immer fremd geblieben, hatte sie bis in die vorgerückten Jahre herauf Neigungen erweckt, deren Erinnerung sie beglückte und jung erhielt. Und noch immer suchten die Männer gerne ihre Gesellschaft, sie fühlten unter dem Schleier, den das nahende Alter ihr übergeworfen hatte, das Jugendfeuer und den Jugendreiz hindurch, jetzt von dem Schmelz einer ganz leisen Wehmut verklärt. Sie hielt sich nicht an das Herkommen, das damals die älteren Frauen zwang, auf ihre oft noch schönen Haare plumpe Stoffwülste oder unförmige Hauben zu setzen und ihre Gestalt in einer trübseligen, quäkerhaften Alterstracht verschwinden zu lassen. Ebensowenig suchte sie durch zu jugendlichen Anzug zu täuschen, sondern kleidete sich immer in eine helles, mit Schwarz verziertes Grau, das ihr gut zu Gesichte stand, und nach einem frei erfundenen Schnitt, der sie der Zeit entrückte. Unter den weiten offenen Ärmeln trug sie Sommer und Winter duftigweiße gestickte Unterärmel, die im Verein mit einem ebensolchen Kragen sich äußerst schmuck ausnahmen, und auf dem leicht angegrauten Haar eine Art Stuartschneppe, die ihren Wuchs erhöhte und ihr etwas Königliches gab. Ihre Bewegungen waren noch immer leicht und rasch, dabei kannte sie keine Eile, sondern tat alles zur rechten Zeit und war immer fertig, sie pflegte von sich zu rühmen, daß sie niemals auch nur eine Viertelstunde habe auf sich warten lassen. Sie besaß viel Mutterwitz und strömte, wenn sie angeregt wurde, von guten Einfällen nur so über. Dabei verfügte sie über ausgebreitete, wenn auch lückenhafte Kenntnisse. Da die Frauen ihrer Zeit geistige Güter nur durch das Leben selbst, vor allem durch den Umgang mit geistvollen Männern erlangen konnten und hierzu Weitherzigkeit in der Liebe ein sehr gangbarer Weg war, hatte sie wie viele ihrer begabten Zeitgenossinnen in jüngeren Jahren stets einen Kreis von Verehrern um sich zu halten verstanden, die ihr Gesichtsfeld erweiterten: Männer der Literatur, der Politik oder der Wissenschaft, unter denen jeweils einer der Begünstigte war, aber ein jeder hoffen konnte, auch einmal an die Reihe zu kommen. Die Freunde ihrer Frühzeit pflegten lächelnd zu sagen: „Ihr ist viel vergeben, denn sie hat viel geliebt.“ – Doch hatte sie im ganzen von böser Nachrede nie viel zu leiden gehabt. Die Zeit, in der sie aufwuchs, und die Klasse, der sie angehörte, hatten sich großer Nachsicht in Sachen der Liebe beflissen, und ihr aufrichtiges, von jeder Mißgunst freies Wohlwollen wie ihre hilfreichen Hände machten, daß ihr niemand böse sein konnte. Die Neigungen, die sie erweckte und erwiderte, hatten ihr Leben angenehm erwärmt, aber nicht versengt, noch mit Stürmen auf den Grund durchrüttelt.
War die Liebe ausgeliebt, so machte sie die gewesenen Günstlinge zu Freunden, und leidenschaftslos, wie sie war, konnten auch gelegentliche Enttäuschungen ihr keine Bitterkeit bereiten. Nur einmal war ihr ein Mann begegnet, für den sie fähig gewesen wäre, sich selbst zu verlieren. Aber seine Liebe glitt ab auf ein jüngeres, neben ihr erblühtes Haupt. Sie dankte dem Schicksal, als die Versuchung vorüber war. So klang ihr Leben in einem friedeseligen Abendlied aus. Und doch hatten die letzten Jahre ihr zwei tiefe Wunden gebracht: ihr einziger Sohn war das Opfer eines Unfalls geworden, und ihrer jüngsten Tochter, der vermählten Folkwang, hatte die Geburt Esthers das Leben gekostet; von der älteren trennte sie seit langem der Ozean. Aber sie hatte sich dem Kummer nicht hingegeben, sie lebte für das nachwachsende Geschlecht. Dabei pflegte sie den schwachsinnig gewordenen Gatten mit heldenhafter Selbstverständlichkeit und ließ sich niemals eine Ungeduld über sein kindisches Gehabe und seine lästigen Gewohnheiten anmerken. Ihre Wohnung mit der kostbaren alten Einrichtung glänzte wie ein Reliquienschrein, obgleich sie einen großen Teil der häuslichen Arbeit selbst verrichten mußte. Trotzdem blieben ihre schönen Hände ganz weiß und jugendlich und stets mit funkelnden Ringen geschmückt und fanden noch die Zeit zu kunstreichen Handarbeiten für die künftige Ausstattung der Enkelinnen und zu allerlei lustigen Erfindungen für die Kinderstube.
In diesen Händen lag die Leitung der kleinen Vanadis, denn Vater Folkwang, der die Tage in seinem Studierzimmer verbrachte und seine altnordischen Forschungen niederschrieb, kam für Kindererziehung nicht in Betracht. Tante Fanny aber, seine verwitwete Schwester, die über die Jugend gesetzt war, hatte kein Verständnis für das kleine Mädchen und somit auch keine Macht über sie. Sie mochte ihr rufen, solange sie wollte, Vanadis regte sich nicht, während sie Flügel bekam, sobald die Großmutter einen Wunsch äußerte.
Für diese Tante Fanny, Heinrich Folkwangs ältere Schwester, war es ein Unglück, fünf bis sechs Jahrzehnte zu früh geboren zu sein. Sie wäre ein glücklicher Mensch geworden, hätten ihr die Vorurteile ihrer Zeit erlaubt, zu studieren und einen ihrem Selbständigkeitstrieb und ihrer Anlage entsprechenden männlichen Beruf zu ergreifen. Allein für einen solchen Lebensgang einer Frau war die Welt noch nicht reif, der bloße Hang danach machte sie schon in ihren Kreisen anstößig. Daher übertrug Fanny ihr geistiges Sehnen und ihren geistigen Ehrgeiz auf den begabten Bruder Heinrich, den sie schon in Kinderschuhen bemuttert hatte. Als sich beim Tode ihres Vaters, des Hamburger Großkaufmanns Heinrich Folkwang sen., herausstellte, daß das Vermögen zum größten Teil einem Halbbruder aus zweiter Ehe gehörte, verzichtete sie auf ihr Erbe, um ihrem Pflegling den Weg zu erleichtern. Dann waren mehrfache Versuche, sich in fremden Häusern eine Stellung zu schaffen, an ihrer Wesensart gescheitert, bis sie sich zuletzt entschloß, einen ehemaligen Angestellten der Firma, der ihre verblühten Reize noch immer mit den Augen seiner Jugend sah, zu heiraten. Der Bund fiel zum Unsegen für beide aus, denn Fanny war nicht für die Ehe geschaffen und konnte in diesem Stand nicht glücklich sein noch glücklich machen. Der Mann, den sie geistig unter sich sah, war ihr zur Last, sie grämte sich, daß sie in keiner höheren Welt mit ihm leben konnte und daß ihr selbst die Mittel gefehlt hatten, sich eine über den weiblichen Durchschnitt hinausgehende Bildung zu verschaffen. Als ihr vergötterter Bruder seine Frau verlor, war sie schon seit Jahren Witwe und kinderlos; daher schien es das richtigste, daß sie nun seinen Kindern wie vordem ihm selber die Mutter ersetzte. Es kann nicht geleugnet werden, daß der Professor, der alles Zarte und Leise liebte, ein wenig erschrak, als die Schwester mit dem knochigen Gliederbau und der harten Stimme vor der Tür stand und erklärte, daß sie zum Bleiben gekommen sei. Aber in seiner Hilflosigkeit konnte er nicht nein sagen und mußte ihr noch dankbar sein, daß sie in die Lücke trat, sonst hätte er nur die Wahl gehabt, eine zweite Frau zu nehmen, wovor ihm graute, oder die Kinder und sich selbst bezahlten Händen anzuvertrauen. Es ging auch besser, als er zu hoffen gewagt hatte, besonders nach der Übersiedlung. Fanny unterzog sich ihrem neuen Amt mit Begeisterung, sie fühlte es als Glück, in der Luft dieses Hauses zu leben, und unter den vielen Knaben war sie in ihrem Element. Sie sorgte für deren leibliches Wohl, überwachte, als sie heranwuchsen, ihre Schulaufgaben und hielt sie in Zucht, daß sie aufs Wort gehorchten. Ihr Liebling war Gunther, in dem sie ihres Bruders Geistigkeit und leicht verletzliches Gemütsleben wiedererkannte und der ihm auch äußerlich am meisten glich. Auf diesen Knaben übertrug sie nun die Erwartungen, die der Vater, durch unglückliche Gemütsanlagen verhindert, doch nicht völlig verwirklicht hatte. Der Neffe, der allen seinen Altersgenossen fast lächerlich weit voraus war, sollte einmal dem Namen Folkwang den Glanz geben, den sie für ihren Bruder umsonst geträumt hatte. Sie nahm sogar diesen Glanz vorweg, indem sie Gunthers Ruhm in der engeren und weiteren Familie verbreitete, und einen Teil davon schrieb sie sich selber zu, weil sie ihm bei den Rechenaufgaben half und seine Vokabeln und Geschichtstabellen mit ihm auswendig lernte. Daß vom Tische dieses Reichen manches nahrhafte Bröcklein für sie abfiel, beglückte sie und war ihr wie ein Ersatz für die nicht in Erfüllung gegangene Hoffnung auf einen innigen geistigen Verkehr mit seinem schweigsamen Vater.
Allein, Gott hatte die arme Fanny in seinem Zorn zur Hausfrau gemacht, indem er ihr zugleich allen Sinn für Schönheit und Reiz einer fraulichen Häuslichkeit versagte. Bei ihrer Hochschätzung der geistigen Güter schien ihr jede über der Hauswirtschaft verbrachte Stunde ein Raub an diesen. Vor lauter Eile fand sie zu nichts die richtige Zeit, deshalb war alles, was sie tat, nur halb getan. Immer im flatternden Hauskleid, das vorn auseinanderflog und mit einer Haarnadel an Stelle des fehlenden Knopfes zusammengehalten war, peitschte sie den Haushalt vor sich her, der durch ihren Eifer immer weniger gemütlich wurde. Denn sie lähmte durch ihre Übergeschäftigkeit auch die Selbständigkeit der Mägde, denen sie jeden Augenblick die Arbeit aus der Hand nahm, um sie selbst schneller und schlechter zu verrichten. Auf diese Weise hatte sie das Hauswesen auf einen Punkt labilen Gleichgewichts gebracht, wo es ohne sie überhaupt nicht weiterging, so daß ihr Tun, so unzweckmäßig es an sich war, nunmehr doch als ganz unentbehrlich erschien; denn wenn sie fehlte, stand gleich das ganze Getriebe still. Fuhr sie dann wieder darein, so schrillte und rasselte die Maschine, daß Professor Folkwang sich auf sein Zimmer flüchtete und sein Töchterchen auf seinen Baum. Bis die gute Fee vom oberen Stockwerk herunterkam, mit ihren schön gepflegten, ringgeschmückten Händen, und mit ein paar geschickten Griffen die Ordnung wiederherstellte.
Noch ein anderes Auge wachte über der Kindheit des kleinen Mädchens: das war ein Jugendfreund des Vaters, Baron Solmar, der Vanadis aus der Taufe gehoben hatte und bei groß und klein im Haus der Pate hieß oder auch schlechtweg mit seinem Vornamen Egon genannt wurde, weil das sonst in diesem Fall gebräuchliche Wort Onkel seinem empfindlichen Ohr ein Greuel war. Die Kinder duzten ihn, aber es bestand keine Gefahr, daß bei dieser Vertraulichkeit jemals einer der wilden Jungen die Ehrerbietung verletzt hätte. Baron Solmar verbreitete eine Luft um sich, in der man sich ganz von selbst taktvoll und zurückhaltend betrug, man konnte gar nicht anders. Der ehemalige Diplomat war zwar ein stiller Gelehrter geworden wie Heinrich Folkwang, doch sah er sehr vornehm aus und wurde mit seinem schmalen bartlosen Gesicht und dem sehr gepflegten Äußern, über das sein Kammerdiener Carlo wachte, von den Kindern für bedeutend jünger gehalten als ihr Vater. Er ging aufrecht und federnd, eine Folge gewissenhafter täglicher Körperübungen, während Professor Folkwang, der seit dem Tode der blühenden Gattin alle äußeren Ansprüche aufgegeben hatte, seinen mit frühem Grau gesprenkelten Bart wachsen ließ und mit seiner langen schwanken Gestalt im Gehen vornüber hing. Baron Solmar verbrachte alljährlich ein paar Wochen im Folkwangschen Hause. Das war Heinrich Folkwangs beste Zeit, in der er aus seiner langen, tiefen Schweigsamkeit heraustrat; denn mit dem weit gewanderten Freunde, der an seinen Studien teilnahm und die nähere Kenntnis der Örtlichkeiten hinzubrachte, konnte er alles, was ihn innerlich beschäftigte, durchsprechen.
In diesen Wochen lebte auch die kleine Vanadis ein erhöhtes Leben. Die Jungen waren alsdann zahm und belästigten sie nicht, Fanny dämpfte ihre Stimme, durch das ganze Haus ging eine Welle von Freudigkeit und Erhebung. Das Kind wußte es immer so einzurichten, daß sie sich ins Zimmer schmuggelte, wo Egon mit den Hausgenossen und den von auswärts Geladenen beisammen saß. Dann streckten sich gleich alle Arme aus, um das ziervolle Ding mit den großen Augen und den schmiegsamen Gliedern zu sich heranzuziehen, und es bedurfte aller Geschmeidigkeit und Klugheit des Kindes, um sich an den andern vorbeizuwinden, ohne sie zu kränken, bis sie den Stuhl erreicht hatte, wo Egon saß, und die Ärmchen um seinen Hals legen konnte. Er hob sie alsdann auf seinen Schoß, von wo sie befriedigt um sich sah, als habe sie einen Thron erstiegen. Der verherrlichte Freund hatte nur eine anfechtbare Seite: daß er der Vater des schrecklichen Roderich war und diesen ins Haus gebracht hatte, damit er mit ihren Brüdern gemeinsam die Schule besuchte. Roderich war der einzige, der Baron Solmars Erscheinen ohne Freude begrüßte; er brachte seinem Erzeuger eine scheue Zurückhaltung entgegen, hinter der verborgene Widersetzlichkeit schlummerte. Vanadis fand ihn einmal, wie er mit Kohle auf die innere Wand eines Schuppens ein verfratztes Geckenbild zeichnete, das unter der Verzerrung die vornehme Gestalt und weltmännische Haltung des Baron Solmar leicht erkennen ließ. Dieser Knabe hatte von der Natur einen unförmigen Kopf mit groben und häßlichen Zügen empfangen und führte mit seiner dämonischen Kohle, die ein frühes ungewöhnliches Talent verriet, einen Verfolgungskrieg gegen alles Schöne und Anmutige. Die kleine Vanadis hatte an jenem Tage mit Zornestränen das Zerrbild weggewischt und gedroht, den Urheber zu verklagen, aber dieser hatte nur gelacht, er wußte wohl, daß sie dazu nicht fähig war.
Egon war stolz auf den Vorzug, den er bei der Kleinen seit ihren frühesten Tagen genoß, und liebte sie mit Anbetung. Da sie kein Naschwerk wollte, zerbrach er sich unablässig den Kopf, womit er sie beschenken konnte. Einen ganzen Schrank voll Märchen- und Bilderbüchern hatte er ihr schon zusammengekauft. Als er von dem tragischen Untergang der Lumbell vernahm, meinte er seine Sache gutzumachen, indem er dem Kinde eine Auswahl der herrlichsten Puppen von der Reise mitbrachte. Aber er hatte fehlgegriffen. Beim Anblick dieser fremdländischen Kunstgebilde, an die sie kein Zug des Herzens band, schluchzte das Kind und lief mit stürzenden Tränen ins Freie, um unter der großen Zeder im Garten Immerschön, den sie seit dem Unglückstag nicht mehr betreten hatte, ihren neuerwachten Schmerz um die Verlorene auszuweinen.
Egon stand am Fenster des großen Gastzimmers und sah dem kleinen Mädchen zu, wie es auf der blühenden Wiese saß, als wäre sie eine da herausgewachsene Blume, und mit spitzigen Fingerchen aus einer Perlenschachtel in ihrem Schoß kleine Ringe und lange Ketten anfertigte. Mit den Ringen schmückte sie die Zehen ihrer nackten kleinen Füße, und die Ketten wand sie um ihre Knöchel. Durch das Geschenk der Perlenschachtel und eine Kinderausgabe von Tausendundeiner Nacht hatte Egon seinen Mißgriff gutgemacht. Das Kind hatte die Lumbell vergessen und befand sich mitten in den Arabischen Nächten. Mit den beweglichen Füßchen führte sie sich selbst ein ganzes Schauspiel auf. Den rechten hatte sie reicher bedacht, er war der Sultan, den linken nannte sie Scheherazade. Und Scheherazade kniete bei dem Sultan und reichte ihm Sorbett in silberner Schale und redete, redete immerzu von Edelsteingärten, Zauberpferden und Wunderlampen, denn solange sie redete, konnte er sie nicht töten. Der Mann aber am Fenster folgte den Bewegungen des kleinen Mädchens und dachte: Es ist etwas einziges um dieses Kind. Wo sie erscheint, wird ihr die Umgebung zum Rahmen, aus dem man sie nicht wegdenken kann. Wie sie da in der Bodenfalte sitzt, zwischen den hohen Gräsern, gehört sie so natürlich dazu wie die blühende Spiräa über ihrem Kopf. Und wie sie das Hälschen biegt und mit dem innigen Ernst der Kindheit diese drolligen, kleinen Spielkameraden schmückt, das ist einfach zum Vergöttern. Ich muß wegsehen, daß ich nicht hinunterstürze und sie mit Küssen überschütte. Das Kind macht mich zum Narren. Ich liebe sie nicht nur, ich bin verliebt in sie, mehr als jemals in eine Frau, ihre herrliche Mutter nicht ausgenommen, es ist ein Anmutsreiz, wie ihn keine Erwachsene mehr besitzen kann.
Während er sich vom Fenster zurückzog, aus Furcht, das Kind könnte ihn erblicken und sich in seinen Heimlichkeiten belauscht fühlen, wurde das Schauspiel, das die zwei kleinen Füßchen miteinander aufführten, von einer anderen Seite unterbrochen. Auf der Nachbarmauer tauchte ein dunkler Knabenkopf auf, und eine gut gezielte Nelke fiel mitten in die Arabischen Nächte hinein.
„Vanadis, viens jouer avec nous – Du werden sein Kutschèr, wir sein ’ferd.“
Ein zweiter hellerer Kopf erschien auf der Mauer und wiederholte die Einladung.
Zwei kleine Franzosen aus Nancy weilten seit einigen Wochen mit Mutter und Bonne in dem Nachbarhaus, dem erstere entstammte. Vanadis hatte von der Großmutter die Erlaubnis, mit ihnen zu spielen, und es war eingetreten, was diese voraussah, daß die äußerst sprachbegabte Kleine im Zeitraum weniger Wochen ganz von selbst den fremden Gästen so viel von ihrer Sprache ablernte, daß sie sich natürlich darin bewegte. Dieses schien der Großmutter, die selber nach dem damaligen Brauch adliger Familien noch eine ganz französische Erziehung genossen hatte, das A und O aller feineren Bildung zu sein. Da die Mittel ihres Schwiegersohnes nicht zu einer französischen Erzieherin ausreichten, wie sie selber und wie ihre Tochter eine besessen hatten, kam ihr diese Gelegenheit erwünscht, dem französischen Unterricht, den sie der Enkelin erteilte, durch die fremden Kinder spielend nachgeholfen zu sehen.
Und Vanadis spielte gerne mit den kleinen Franzosen, die besser angezogen waren und daher hübscher aussahen als ihre Brüder, auch immer schön gekämmt und mit rein gewaschenen Händen gingen, was man von diesen nicht sagen konnte. André, der Ältere, ein feines kränkliches Kind, war ihr stiller Verehrer; er brachte ihr zuweilen Süßigkeiten von seinem Nachtisch herüber oder eine Blume aus dem wohlgepflegten Garten seiner deutschen Verwandten. Aber der Jüngere, Gaston, erregte die Bewunderung des kleinen Mädchens durch seine katzenhafte Geschicklichkeit im Klettern und den Übermut, womit er auf den schon hochgeführten Balken eines Neubaus hin und zurück lief. Sie war einmal zugegen gewesen, wie das deutsche Fräulein, das die Knaben behütete, den Älteren in die Arme nahm und sagte: „André, du bist mein Liebling!“ – und wie sich da Gaston mit der Schulter dazwischenbohrte: „Und ich – ich bin dein Bösling, Fräulein!“ – worauf diese ihn wegschiebend sagte: „Jawohl, das bist du.“ Dem schnell fassenden Kinde war es aufgegangen, daß das Fräulein zu dieser Zurücksetzung wohl einen Grund haben mußte. Aber gleichwohl gefiel ihr der flinke, muntere Knabe, dessen Unarten mehr Geschick hatten als die ihrer Brüder, von Roderich ganz zu schweigen. Sie folgte also der an sie ergangenen Einladung.
Hinter dem Haus zwischen Fluß und Parkmauer lief ein Wiesenstreif, den ein schmaler Fußweg längs des Ufers einfaßte. Es war ein Lieblingsspielplatz der Nachbarskinder und ihre Rennbahn, worauf sie gern Wettläufe oder Wagenrennen veranstalteten. Dort warteten André und Gaston mit einem vierrädrigen Handwägelchen, sie nötigten das kleine Mädchen einzusteigen und wollten ohne weiteres mit ihr davonrennen, aber diese gebot Halt, weil sie nicht ohne Zaumzeug lenken könne. Gaston lief weg und brachte einen Strick, den Vanadis ihren beiden Rossen in den Mund legte, worauf sie selbst die Enden ergriff und „Hü!“ rief. Eine Peitsche brauchte sie nicht, es ging schneller, als ihr lieb war. Die beiden faßten die Deichsel und rannten los. Das Bächlein Lirili, das hier außen unter einer flachen Bohlenbrücke in den Fluß ging, war sonst die natürliche Grenze ihrer Rennbahn, in diesem regenlosen Sommer aber war es ausgetrocknet, so rasten die zwei Pferde mitten durch den Graben. Das Wägelchen kippte um, das kleine Mädchen fiel heraus, und die zweie liefen weiter, den gestürzten Wagen nachschleppend, ohne zu bemerken, daß die Insassin fehlte. Diese erhob sich heftig erzürnt und hatte nicht übel Lust zu weinen, doch der Stolz verhinderte es. Endlich merkten die beiden, was geschehen war, und kamen mit dem wiederaufgerichteten Wagen zurückgerannt. André blieb bedauernd bei dem Kinde stehen, aber Gaston schoß lachend davon, und Vanadis wandte dem Tröster unmutig den Rücken, als ob er an der Ungezogenheit des Bruders mitschuldig sei.
Das hinderte sie jedoch nicht, als Gaston ein paar Stunden später zwischen dem Fachwerk des Neubaus herumturnte und sich von ihr bewundern lassen wollte, in den Nachbarhof hinüberzuschlüpfen und auf seine Frage, ob sie sich zu ihm heraufgetraue, durch die Tat zu antworten. Da lief die Kleine furchtlos mit dem sicheren Gleichgewicht der Kindheit auf dem obersten Balken des schon ziemlich hoch gediehenen Baues, bis sie von Roderich gesehen wurde. Der Schlimme ging alsbald zu Tante Fanny, um Vanadis zu verklatschen. Diese gute, aber immer aufgeregte Frau kreischte laut, als sie das Kind in solcher Höhe sah, und schrie durchdringend über die Gartenmauer hinüber: „Vanadis, du fällst!“ Erschrocken blieb das Kind stehen, die eben noch sicheren Füßchen stockten, sie konnte nicht weiter. Doch faßte sie sich noch zum Glück, erreichte den Eckpfosten, an dem sie sich festhielt und von einem Querbalken zum andern gleiten ließ, bis sie den Boden wieder unter den Füßen hatte. Tante Fanny, die den ganzen Vorgang mit Geschrei begleitete, schloß jetzt beruhigt das Fenster. Gaston kam lachend auf dem Längsbalken herabgeritten:
„Bist du schwindelhaft?“
„Nein“, antwortete sie trotzig, „aber es heißt schwindlig.“ (Die Kinder waren angehalten, einander gegenseitig ihre Sprachfehler zu berichtigen.)
„Ich bin niemals schwindlig“, bemerkte der Knabe. „Warum sagt das Fräulein, daß ich ein Schwindler sei?“
Die Kleine blickte ihn verwundert an: „Das weiß ich nicht.“
Plötzlich begannen die Augen des Knaben zu funkeln, sein gallisches Blut war mit einer verfrühten Regung erwacht, daß er auf seine ahnungslose Gespielin zuschoß, sie blitzschnell in eine Ecke trieb und mit hart zustoßenden Fingern nach den kleinen Brüstchen greifen wollte, die noch gar keine waren. Zu Tode erschrocken stieß das Kind gellende Schreie aus und wehrte sich mit Fußtritten gegen den Angreifer, bis das Fräulein herzugestürzt kam und der Knabe Reißaus nahm. Die Kleine hielt ihr zerrissenes Kleidchen über der Brust zusammen und schämte sich fast zu Tode: es war ihr gefühlsmäßig aufgegangen, wenn ihr auch die Begriffe dafür fehlten, daß etwas Fremdes, Unreines sie berührt hatte, das von den Unarten ihrer Brüder und Roderichs grundverschieden war. Sie wollte auch dem Fräulein keine Rede stehen, sondern hatte nur den Trieb, die Schmach von sich zu waschen, vor sich selber wieder rein zu sein. Eilig lief sie über die herumliegenden Balken nach dem Flusse hinab, zog Kleidchen und Hemdchen bis zum Gürtel herunter und bog sich über die Böschung, um sich mit beiden Händen abzuspülen. Aber sie verlor das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Der Fluß war nicht tief; ein Bauer, der in der Nähe arbeitete, zog sie heraus und trug sie triefend nach Hause. Sie hatte etwas Wasser geschluckt, war aber schon wieder bei Besinnung. Auf die erschrockenen Fragen der Umgebung antwortete sie nur, sie habe sich waschen wollen. Sie wurde zu Bett gebracht und mit warmen Tüchern gerieben und war nun wieder selig im Kinderland, denn das Häßliche war abgespült und den Strom hinuntergeschwommen. Die Großmutter saß bei ihr, erzählte Geschichten und hielt ihre Hand, bis sie einschlief. Und nie erfuhr ein Mensch, warum das Kind sich an jenem Tage im Flusse hatte waschen wollen.
Ein paar Tage später war die französische Familie abgereist. Das Dienstmädchen aus dem Nachbarhaus brachte ein Briefchen an Vanadis herüber. Es war mit großen ungleichen Buchstaben äußerst fehlerhaft in zwei Sprachen geschrieben und schloß:
„Chérie, ne m’oublie pas, je ne t’oublierai jamais.
Dein lieber unvergeßlicher André.“
Es war der erste Liebesbrief, den Vanadis empfing, und sie hütete ihn eifersüchtig, doch ohne viel nach dem Absender zu fragen. Von dem vormals bewunderten Gaston hörte sie das Mädchen erzählen, daß er alles im Hause beschmutzt und zerbrochen, die Tiere gequält und seinen gutherzigen älteren Bruder, der schwächer war, mißhandelt habe, kurz, ein wahrer kleiner Teufel gewesen sei.
Aus den kleinen Kindern wurden allmählich größere, Gunther und Roderich besuchten schon das Gymnasium, Vanadis blieb mit ihrer Ausbildung nach wie vor auf Mutter Natur, den väterlichen Bücherschrank und den Unterricht der Großmutter angewiesen, denn mit Mädchenerziehung befaßte sich die Gesetzgebung noch nicht: je weniger sie wußten, für desto wertvoller galten sie. Und da Frau van der Mühlen selber ausschließlich von französischen Bonnen und Gouvernanten unterrichtet worden war, wie es damals der deutsche Adel für notwendig erachtete, so konnte sie auch der hörbegierigen Enkelin nicht mehr geben, als was sie selber empfangen hatte. Das war kunterbunt genug und mischte sich nun mit dem Kunterbunt in dem Köpfchen des Kindes. So wußte die alte Dame zwar aufs genaueste Bescheid über die Etikette, die beim Lever der Marie Antoinette geherrscht hatte, konnte auch viele prickelnde Anekdoten von dem Hof des Ersten Napoleon erzählen, die sie zu Louis Philipps Zeit als junge Gesandtin eines kleinen deutschen Staates in Paris gehört hatte, wußte aber um so weniger von ihrem eigenen Vaterland; dieses war zur Zeit ihres Lernens für ihre Standesgenossinnen noch nicht entdeckt gewesen. Über die Geographie von Deutschland besaß sie ein französisches Handbuch, von einem gewissen Abbé Gauthier verfaßt, aus dem sie selber ehedem ihre Kenntnisse geschöpft hatte. Da hieß es zum Beispiel bei Erwähnung der Lüneburger Heide von den Heidschnucken: „Les Heydschnukes (gesprochen „Edsnük“), petite population noire de la Vestfalie.“ Infolgedessen hatte Frau van der Mühlen unverbrüchlich geglaubt, daß die Heidschnukken Menschen wären, so etwas Ähnliches wie die Heiducken oder die Seldschuken. Erst durch ihre zur Schule gehenden Enkel wurde der Irrtum aufgeklärt, und die Großmutter lachte lustig mit, sooft sie mit den Heidschnucken geneckt wurde, denn sie wollte nicht in Altersweisheit über der Jugend thronen. Vanadis jedoch, die sich ganz fest in die Vorstellung von einer merkwürdigen schwarzen Zwergenrasse in der Lüneburger Heide eingebissen hatte, widersprach mit zornigen Tränen und wollte das wimmelnde Zwergenvolk, das sie sich mit Pfeil und Bogen, schwarz behaart von Kopf zu Fuß dachte, nicht fahrenlassen. Unendliches hatte das Kind mit seinen frühen Jahren nach und nach im unersättlichen Lesehunger verschlungen. Es war ganz gleich, was in ihre Hände fiel, ob ein Schmöker oder ein Klassiker, sie konnte alles gebrauchen: die Bücher fügten sich mit einem höchst wunderbaren Anpassungsvermögen ihrer Innenwelt ein, die immer so viel davon aufnahm, als ihr eine natürliche Nahrung gab. Am schönsten war es, wenn sie aus den brüderlichen Bücherschätzen Coopers Indianergeschichten entwenden konnte. Mit diesen erstieg sie gerne die höchsten Zinnen von Tronje und las und las. Dann dehnten sich die Prärien um sie, die Flüsse der Neuen Welt rauschten, flinke Kanus, von Rothäuten gesteuert, schossen darüber hin, wilde Reiter auf schnellen Rossen warfen sich in die Fluten, um weiße Mädchen zu retten; es war ein herrliches Leben. War sie mit den Indianern fertig, so begab sie sich in das äußerste Thule, um mit Asen und Thursen zu leben; das war fast ebenso schön. Es war ihr unverständlich, daß es Leute gab, die ein Buch an einer bestimmten Stelle niederlegten, um wieder in ihrer leiblichen Umwelt zu sein und des andern Tags an derselben Stelle weiterzulesen. Sie grämte sich, wenn ihr die Nacht dazwischenkam. Neben sich hielt sie stets einen Vorrat von Tannzapfen aufgespeichert zum Schutz gegen etwaige Angriffe, aber es bedurfte dessen nicht mehr, nach dem Schicksalstage der Lumbell wurde Tronje kein zweites Mal gestürmt. Selbst Roderichs Tätlichkeiten hatten aufgehört; wenn sie jetzt noch angegriffen wurde, so war es von seiten ihres Gunthers, der sie gern mit Knittelverschen neckte, worin er ihre Helden durchhechelte. Sie blieb ihm jedoch nichts schuldig, beide hatten eine Begabung für Sprache und Reim, die durch das viele Lesen gestärkt war, und wenn der Mutwille über sie kam, setzten sie sich zusammen auf ein Mäuerchen und bewarfen sich mit Trutzverschen.
Und nun rückte ihr zehnter Geburtstag heran, der im Hause festlich begangen werden sollte. Die Kleine sah ihm mit einer tiefen, feierlichen Bewegung entgegen. Nicht nur, weil jetzt der Zahl ihrer Lebensjahre die bedeutungsvolle Null angehängt werden sollte, sondern weil sie einem ganz großen Erlebnis entgegenging: sie wollte an diesem Tage heiraten. – Heiraten? Jawohl, und wen anders als ihren Längstgeliebten, Einzigen, den Herrn Egon von Solmar. Seit zwei Jahren war das fest bestimmt. Er hatte eines Tages in Gegenwart der Großen zu ihr gesagt: „An deinem zehnten Geburtstag heirate ich dich!“ – und wie erklärend hatte er gegen die Anwesenden hinzugefügt: „In Indien heiraten die Mädchen in noch früherem Alter.“ Seitdem hatte sie mit Ungeduld den Tag ersehnt, an dem sich ein so großer Wandel vollziehen sollte. Schon am Vorabend sah sie stille Vorbereitungen treffen wie für das Doppelfest einer Geburtstags- und Hochzeitsfeier. Blumen wurden geschnitten und Kränze gewunden. Annemarie, die Köchin, buk einen Kuchen von besonderer Feinheit und trug ihn in der Frühe mit zehn brennenden Lichtern vor ihr Bett. Die Großmutter brachte ein blühendes Myrtenstöckchen, wie man sie Bräuten schenkt, und über dem Arm hing ihr das duftige weiße Kleidchen, an dem man sie seit Wochen hatte sticken sehen. Dann klingelte die Post und brachte Brieflein und kleine Geburtstagsverse von den Freunden des Hauses, von den Freundinnen umfangreiche Schachteln mit vielen schönen und erwünschten Sachen drin. Frau Fanny wunderte sich, daß Egon, der sonst immer mit der Geburtstagssendung der erste war, diesmal nichts von sich hören ließ.
„Ich denke, er wird uns überraschen wollen und zu Mittag selber dastehen“, meinte die Großmutter.
Dies fuhr Fanny in die Glieder, daß sie rasch in die Küche eilte, daselbst noch ein wenig Unordnung zu stiften. Vanadis aber lächelte still in sich hinein: Er wird wohl in Person erscheinen, wenn er heute Hochzeit macht – und sie wunderte sich, daß die andern nicht soweit dachten.
Gunther hatte einen gutgefaßten Geburtstagsspruch ausgedacht, den die kleine, jetzt sechsjährige Esther, gleichfalls weiß gekleidet, mit einem Strauß in der Hand aufsagen mußte, und er selber überreichte dazu ein niedliches, von seiner eigenen Bastlerhand gebundenes Büchlein, in das sie künftig ihre Trutzverschen aufzeichnen wollten. Bruno und Enzio bliesen gewaltig auf ihren Trompeten, um auch zur Feier des Tages beizutragen, und Roderich zeigte seine Achtung vor der Herrin des Festes dadurch, daß er sich abseits hielt und sie den ganzen Tag weder ärgerte noch quälte.
Am Mittag hielt ein Wagen vor der Tür, und wie erwartet stieg Baron Solmar heraus. Er hielt in der einen Hand einen hohen, mit Seidenpapier verhüllten Blumenstrauß, in der andern ein kleines Saffianköfferchen, was er beides vorsichtig ins Haus trug, während Carlo, sein florentinischer Kammerdiener, mit den ziemlich umfangreichen Koffern und Schachteln nachkam. Das Kind flog dem Ankömmling diesmal nicht auf der Treppe entgegen, ein Gefühl bräutlicher Befangenheit hielt sie bei ihrem Geburtstagstisch fest. So empfing sie strahlend, aber still die Geschenke ihres Freundes. Aus dem Seidenpapier kamen herrliche hochstengelige Rosen, die dunkelroten, duftgesättigten, die sie vor allen liebte, zum Vorschein, für diese Jahreszeit eine Seltenheit. Das Köfferchen enthielt in Silber gefaßte Kämme und Bürsten, kristallene Fläschchen mit Wohlgerüchen, nebst allem Bedarf für die Handpflege, und es fehlte nichts, was ein zartgewöhntes Dämchen auf die Reise mitzunehmen pflegt.
„Das ist zuviel, Egon, du verwöhnst uns das Kind“, sagte Herr Folkwang.
„Zuviel?“ antwortete jener. „Jetzt kommt erst die Hauptsache.“
Er zog noch ein längliches lilasamtenes Futteral heraus und öffnete es, daß die darin liegende Kette aus geschliffenen goldgelben Perlen in der Sonne funkelte.
„Sieh her, Kind, das ist der Schmuck, den die Zwerge deiner Namensschwester, der Göttin Freya, schmiedeten. Wie hieß er bei Asen und Alben?“
„Breysing!“ jubelte das Kind, und schon lag die Kette um ihren Hals und ein Kuß auf ihren Lippen.
„Es ist wirklich zuviel, Egon“, sagte jetzt auch die Großmutter.
„Was kann für ein solches Geschöpf zuviel sein?“
Man ging zu Tische. Ein Zufallsbesucher, den man zu bleiben bat, vermehrte die Gesellschaft. Vanadis saß gefeiert zwischen ihrem Freund und dem Vater an der blumengeschmückten Tafel, horchte auf die Reden der Erwachsenen und nippte von dem ihr ungewohnten Weine. Es wurde ein Trinkspruch auf sie ausgebracht, der Fremde stattete seinen Glückwunsch ab, dann aber verwickelten sich die Herren in eine gelehrte Unterhaltung, der sie nicht folgen konnte. Nach der Mahlzeit wurden die Kinder weggeschickt, Vanadis mit ihnen. Als sie knicksend um den Tisch ging, sich von allen zu verabschieden, küßte Egon sie auf die Stirn. Das war alles. Daß sie Braut und Bräutigam waren, mußte er wie die andern vergessen haben. Dann sah sie vom Fenster aus, wie ihr Vater und Egon den fremden Herrn zur Stadt zurückbegleiteten.
Der Tag ging zu Ende wie jeder andere, sie begriff das nicht.
Als nun die Familienhäupter mit Baron Solmar zu Abend speisten – die Kinder pflegten zum Abendbrot nicht mehr zu erscheinen –, ging plötzlich die Türe auf, und herein bewegte sich ein seltsamer Aufzug: Voraus schritt Vanadis, den kostbaren Brautschleier der Großmutter auf dem Kopf, den sie sich heimlich aus der Lade geholt hatte, ein Prachtstück alter Nadelarbeit, darüber ein Kränzlein aus Myrtenknospen, das ihr der Myrtenstock hatte lassen müssen, Egons Bernsteinkette um den Hals und in jeder Hand eine brennende Kerze auf silbernem Leuchter. Ihr folgte Estherchen, gleichfalls weiß gekleidet, die die lange feingestickte Schleppe des Brautschleiers mit kindlicher Anmut hielt. So umschritten sie langsam die Tafel, bis Vanadis vor Egon stehenblieb und ihn aufmunternd ansah. Dieser staunte über die elfenhafte Zartheit des Kindes, dessen feines Gesichtchen mit den strahlenden Augen ihm aus dem duftigen, zu beiden Seiten niederrieselnden Gewebe mit heiligem Ernst entgegensah, und wunderte sich zugleich, was der seltsame Einfall bedeute.
„Was willst du von mir, mein Liebling?“ fragte er.
„Ich will, daß du mich jetzt heimführst auf deine Selige Insel, weil wir heute Braut und Bräutigam sind.“
Das Wort „heimführen“, das ihr aus den vielen gelesenen Geschichten geläufig war, hatte einen besonderen Reiz für sie, vielleicht weil ihrem eigenen mutterlosen Leben doch das richtige Heimgefühl fehlte.
„Ach so“, erinnerte sich der vergeßliche Bräutigam. Er hielt sie an beiden Händchen fest, nachdem er ihr zuvor die Leuchter abgenommen hatte, und sah sie mit tiefem Entzücken an.
„Freilich“, sagte er, „ist heute unser Hochzeitstag, du süßer Schatz. Aber siehst du, das mit dem Heimführen läßt sich so schnell nicht machen. Mein Haus ist noch nicht gebaut, und bis es fertig wird, müßtest du auf Streu schlafen statt in deinem schönen weißen Bettchen. Auch auf der Seligen Insel braucht man ein Haus, um drin zu wohnen, sonst fressen einen die wilden Tiere. Wachse du unterdessen fort und bleibe mir schön und gut wie jetzt und lerne fleißig, daß ich eine verständige kleine Frau bekomme. Wenn es an der Zeit ist, will ich dich schon holen.“
Dabei küßte er sie zärtlich auf beide Wangen. Jetzt hielten auch die andern nicht mehr an sich, das Kind wurde von einem Arm in den andern gezogen und mit Liebkosungen erdrückt.
„Wenn dich doch deine Mutter sehen könnte“, sagte Herr Folkwang, indem er das Töchterchen auf sein Knie zog, was sich Egon neuerdings nicht mehr gestattete. Aber sie strebte gleich herunter und warf sich erschüttert in die Arme der Großmutter.
Diese hatte zuerst etwas betreten geblickt zu dem Mißbrauch, der mit ihrem sorglich gehüteten Prunkstück getrieben wurde. Aber sie konnte diesem Kind nicht böse sein, sie umschlang sie mit zärtlichem Stolz und sagte:
„Daß ich das erleben darf, unsere kleine Vanadis als Braut zu sehen.“
Jedoch das kleine Idyll sollte einen traurigen und schrecklichen Ausgang nehmen.
Als das Stubenmädchen dem alten Herrn van der Mühlen, der niemals an einer gemeinsamen Mahlzeit teilnahm, sondern auf seinem Zimmer bedient wurde, das Essen brachte, sagte sie scherzend:
„Herr Baron, Sie sollten doch Ihre Enkelin sehen, die heute Braut ist, wie schön ihr der Hochzeitsschleier steht.“
Der alte Herr, dem die Zeit- und Altersbegriffe mehr und mehr zu schwinden begannen, nahm den Scherz für Ernst und mochte sich vorstellen, daß Vanadis, die er am Morgen als Kind gesehen hatte, unterdessen erwachsen sei. Nun wollte er sie zu ihrem Brauttag beglückwünschen und tat, was er nie getan hatte. Sobald das Mädchen gegangen war, setzte er sein Mützchen auf und nahm einen Leuchter zur Hand, um sich in das untere Stockwerk hinabzubegeben. Wie es zuging, konnte man hernach nur vermuten. Aller Wahrscheinlichkeit nach blies ihm ein Luftzug von unten die Kerze aus, und er trat fehl. Mitten in die frohen Stimmen der Tischgesellschaft hinein erdröhnte plötzlich ein langandauerndes Gepolter auf der Treppe, dem ein Schrei und ein hartes Aufschlagen folgte, das klang, als ob ein Haufe Knochen ausgeschüttet würde. Der alte Herr war die Stufen herabgekollert und lag bewußtlos am Fuß der Treppe. In jämmerlichem Zustand, ganz zerstoßen und zerbeult, wurde er in sein Bett gebracht, von dem er sich nicht mehr erhob. Der Arzt stellte eine innere Verletzung fest. Mit großer Lebenszähigkeit wehrte sich der arme, schwache Körper, den sein Geistiges schon lange zuvor verlassen hatte, noch mehr als vierzehn Tage, während die Großmutter nicht von seinem Lager wich. Dann trugen sie einen Toten hinaus.
Der Gast war gleich nach dem Unfall abgereist. Vanadis ging stille, wie schuldig, um die Großmutter her, die sich in der Pflege des nie geliebten Mannes fast aufgezehrt hatte und jetzt untröstlich war, als ob sie den besten Inhalt ihres Lebens hingeben sollte, während die Geschwister unter der Tür standen und dem schwarzen Zuge nachsahen, bei dem sie sich schlechterdings nichts denken konnten.
Aber ein seltsamer Spuk ließ das Haus Folkwang nicht zur Ruhe kommen. Am Abend nach dem Begräbnis, als alle aus Ermüdung ganz früh zu Bette lagen, mit Ausnahme Vater Folkwangs, den ein Geschäft nach auswärts gerufen hatte, wurden sie plötzlich durch ein starkes Gepolter auf der Treppe aufgeschreckt. Man hörte das Herunterkollern eines Körpers von Stufe zu Stufe und ein hartes Aufschlagen auf dem Grund. Alles lief halbbekleidet zusammen, überzeugt, daß ein neues Unglück geschehen sei. Da war jedoch nichts zu sehen, kein Tier, kein gefallener Gegenstand, und keines von den Hausgenossen fehlte: sie standen alle staunend und ratend umher, die Kinder drückten sich zusammen und bebten. Am nächsten Abend dasselbe Poltern, derselbe Aufschlag und wieder niemand gefallen, kein Anlaß des Lärms zu entdecken. Schon begannen die Dienstboten zu raunen, daß sich der alte Herr „anzeige“, er habe noch immer die Absicht nicht aufgegeben, seine Enkelin zu sehen, und müsse, solange ihn die Sehnsucht treibe, jede Nacht den Todessturz wiederholen. Diese litt unaussprechliche Ängste, sie getraute sich nicht mehr in die Wohnung der Großmutter hinauf, von wo das Geräusch seinen Ausgang nahm, sie meinte, der Großvater sitze dort oben mit seinem Mützchen auf dem Kopf und erwarte sie. Glücklicherweise kam der Vater schon am dritten Tag zurück und ließ alsbald eine starke windgeschützte Lampe an der steilen Treppe anbringen, die bis dahin jedes mit der eigenen Kerze erstiegen hatte. Die Beleuchtung vertrieb den Spuk: das Fallgespenst ließ sich nicht weiter vernehmen.
An einem strahlenden Sommermorgen kam Heinrich Folkwang gegen seine Gewohnheit ins Kinderzimmer herab, wo die Jugend des Sonntags wegen noch vollzählig beisammen am Frühstück saß, und sagte:
„Wißt ihr, Kinder, was heute für ein Gedenktag ist?“
Keines antwortete.
„Nun besinnt euch. Denkt daran, daß wir den längsten Tag des Jahres haben, den Tag, wo die Sonne sich in ihrem Laufe wendet, der schon morgen wieder abwärts führt.“
Gunther erhob den Kopf aus dem Buche – er hatte immer eines neben sich liegen – und sagte:
„Heute ist Balders Todestag.“
„Du hast es getroffen. Er war der lichte, der milde Gott, der beste und schönste der Asen, der von allen geliebte. In ihm war vorgebildet, was der germanische Stamm als Wunschziel im Herzen trägt: die Lauterkeit, die Güte, die Wahrheit. Und er war die frühe nordische Spiegelung dessen, der zu Bethlehem in der Krippe lag und der der Menschheit die Mahnung zurückließ: ‚Seid vollkommen!‘ Auch Balder war vollkommen, er konnte kein Böses tun. Wißt ihr, wie es zuging, daß er sterben mußte? Wer es weiß, soll es erzählen.“
Alle redeten durcheinander, aber keiner im Zusammenhang, nur Vanadis schwieg.
„Gunther soll allein sprechen, er weiß es am besten.“
Gunther erzählte vom bösen Traume der Frigga, und wie sie allem Lebenden und selbst den Pflanzen und den toten Steinen den Schwur abnahm, Balder nicht zu schaden, einzig der schwachen kleinen Mistel nicht. Und wie die Götter ein Freudenfest anstellten, wobei sie alle im Wettkampf nach Balder warfen und schossen, jubelnd ob seiner Unverletzlichkeit, bis der blinde Hödur, durch den bösen Loke geführt, den unvereidigten Mistelzweig warf, der des Gottes Verhängnis ward. Und wie sie den Herrlichen auf das Schiff Ringhorn legten und zu ihm, ehe sie es hinausschoben, seine Nanna, die Blumengöttin, der beim Anblick des toten Gemahls das Herz zersprang. Und wie die Sonne dunkel ward und nichts mehr zu sehen als der Widerschein des brennenden Schiffes auf dem Weltmeer. Dann von Wotans Gebot an den Hermodr, daß er den toten Balder von der Hel zurückhole.
„Und Hermodr sprengte auf dem Rosse Sleipnir über die Brücke der Unterwelt, daß sie erbebte“, fuhr Gunther mit blitzenden Augen fort, „und er trat vor die Hel, seinen Bruder zurückzufordern. Der saß mit Nanna auf der Ehrenbank, aber sein Antlitz war blaß und er war traurig.“
Hier unterbrach Roderich in seiner derben Weise den Erzähler, weil ihm plötzlich auch etwas einfiel:
„Sie war scheußlich zu sehen, am ganzen Leibe schwarz und weiß gestreift, und fraß Leichen. Da schlug Hermodr mit der Faust auf den Tisch, daß die Hölle dröhnte.“
„Nein, Roderich“, verwies der Vater lächelnd, „so darf kein Abgesandter auftreten, wenn er eine Gunst erbitten will. Erzähle du weiter, Vanadis.“
Diese erzählte weiter. Aber sie gab ihrer Stimme möglichst wenig Ausdruck, um sich nicht zu verraten. Denn sie liebte den strahlenden Balder, und sein Tod war der frühe und große Schmerz ihres Lebens, von dem niemand wußte, weil es ein heiliger Schmerz war. Als sie die Worte des bösen Riesenweibes sprechen mußte: „Thök wird weinen mit trockenen Augen, Hela behalte, was sie bekam“, ging ihr die Stimme aus, und sie blieb unbeweglich sitzen, daß sie selber wie die Thök aussah, die um Balder nicht weinen wollte, denn im ganzen Kinderkreis waren nur ihre Augen trocken. Gunther blinzelte und blickte zu Boden, um seine Tränen nicht sehen zu lassen, Bruno und Enzio weinten laut, und Roderich drehte sich mit einem widerwillig grunzenden Tone weg. Fanny blickte mißbilligend auf die Nichte und sagte halblaut zu ihrem Bruder: „Dieses Mädchen hat am wenigsten Herz von allen deinen Kindern.“
Am Abend entwickelte sich, was der Vater mit seiner Anrede vom Morgen eingeleitet hatte. Auf dem Wiesenhang gegen den Fluß hinab war ein Holzstoß aufgeschichtet, den hatten die Kinder mit unermüdlichem Eifer zusammengeschleppt. Dürre Äste und Reisig aus dem Forst, Bretter und Balken, alles kunstvoll aufgeschichtet. Im Augenblick, wo die Sonne glühend hinter dem Hügel versank, schlug der Vater mit einem Feuerstein den heiligen Funken, der Balders Scheiterhaufen entzünden sollte; der Eindruck blieb unvergeßlich in den Kinderseelen haften. Das war ein anderer Leichenbrand als das Feuerchen, das die Lumbell verzehrt hatte, er spiegelte sich glührot im Fluß und stieg als breiter schwarzer Rauch zum Himmel. Daneben stand der Vater und sprach noch einmal von Balder, der das Licht und die Liebe gewesen und der nun bei der Hel wohnen müsse, weil der Neid eines einzigen ihm die Rückkehr gewehrt habe. Und wie arm die Welt ohne ihn geworden sei – daß er aber einstmals wiederkehren werde und versöhnt und friedlich neben seinem Mörder wohnen und daß er die goldenen Tafeln wieder im Grase finden werde, worauf die Ursatzungen der Gerechtigkeit geschrieben seien. Er sprach noch mehr von diesen Täfelchen, die einst in der Frühzeit den Asen nur zum heiteren Spiele gedient hätten, deren Inhalt aber von nun an die Welt regieren sollte. Wenn die Kinder ihn auch nicht alle verstanden, so fühlten sie sich doch insgesamt von etwas Erhabenem angerührt und hörten in großer Bewegung zu. Das war die besondere Erziehungsweise Heinrich Folkwangs: er kümmerte sich nicht um die Unarten seiner Kinder und ließ sie machen, was sie wollten. Aber von Zeit zu Zeit trat er unter sie und hielt in einer Form, die ihre Mitwirkung verlangte, eine neue und ungewohnte Feier ab, die zugleich Freudenfest für die Kinder war und eine unausrottbare Lehre in ihre Seelen brannte.
„Balder ist tot“, sagte er am Ende, „der Frühling ist dahin. Seine Gefährtin hat ihm alle ihre Blumen als Opfer in den Leichenbrand gelegt, ihren ganzen Frühlingsschmuck und zuletzt sich selber. Wißt ihr, Kinder, was das Wort ‚Opfer‘ bedeutet? Etwas Geliebtes hingeben, um etwas noch Geliebteres, etwas Heiliges zu ehren. Wollen wir heute nicht auch dem toten Balder ein Opfer bringen? An dem, was ein Mensch opfern kann, erkennt man seinen Wert. Ein jedes lege, was ihm von seinen Sachen besonders lieb ist, in Balders Flammengrab. Wir wollen sehen, wer am schönsten für Balder opfert. Ich selber will den Anfang machen. – Aber zuvor noch ein Wort, verstehen wir uns recht. Es kann keine Rede davon sein, daß euch jemals von den Großen das ersetzt wird, was ihr heute hergebt. Ein Opfer muß endgültig sein, sonst ist es keines. Wer sein Eigentum nicht verschmerzen kann, soll es nicht hergeben. Und jetzt beginnen wir.“
Auf seinen Wink wurde die schöne weiße Eidergans heruntergebracht, die mit ausgebreiteten Schwingen über seinem Schreibtisch schwebte. Er hatte sie selbst am Nordkap geschossen, und niemand konnte zweifeln, daß sie ihm wert war. Auf dem Stabe, der sie trug, setzte er sie mitten hinein in das Feuer.
„Balder, weißer Gott, laß dir dieses Opfer gefallen, das schön und weiß ist wie du.“
Jetzt kam Gunther an die Reihe. Seine großen blauen Augen leuchteten. Er hatte ein in roten Saffian gebundenes Büchlein in der Hand, sein vorjähriges Geburtstagsgeschenk, es war ganz vollgeschrieben mit seinen Versen. Keinem fremden Auge hatte er sie je gezeigt, aber er schätzte sie für das Schönste auf Erden und ihr Gewand des Inhalts würdig. Schlicht und ernst trat er heran und legte sie in die Glut.
„Für Balder“, sagte er. „Möge er bald zu uns zurückkehren.“
Was wird Vanadis dem Gotte geben, den sie liebt? Sie hat der Kinkerlitzchen viele, aber keines dünkt ihr würdig zum Totenopfer für Balder, denn sie hängt an keinem, alle kann sie ohne Schmerz lassen und folglich auch ohne Lust opfern. Und die Bernsteinkette kann es nicht sein, die ist in der Verwahrung der Großmutter. Aber einen Gegenstand besitzt sie doch, den hinzugeben wohl und wehe tut. Auch ein Geschenk von Egon, oben in der Kommode liegt es, die ganz davon duftet. Es ist ein Fläschchen echtes Rosenöl mit schönen türkischen Goldbuchstaben im Kristall, die niemand lesen kann, und mit einem Wohlgeruch, der mitten in die Wundergärten von Tausendundeiner Nacht versetzt. Dieses Fläschchen holt sie herbei und legt es im geöffneten blauseidenen Kästchen in die Flamme. Das Glas zerbirst und ergießt seinen Inhalt in die Glut, die von dem Öl höher aufleckt und den Abend mit unbeschreiblichen Düften tränkt. Vanadis atmet Wonne, und alles berauscht sich an dem Wohlgeruch.
Unter den jüngeren Knaben, deren Schatzkammer nicht so reich gefüllt ist, entsteht ein Streit, was der eine und der andere spenden soll.
„Halt! Niemand darf gezwungen werden“, sagt der Vater, „nur ein freiwilliges Opfer kann Balders Herz erfreuen.“
Nun einigen sich die beiden, und jeder bringt das Seine dar. Roderich allein will nichts geben, die gerührte Anwandlung vom Morgen wurmt ihn noch in der Seele, wenn auch niemand sie unter dem Grunzlaut bemerkt hat.
„Ich habe nichts“, murrt er unter dem Drängen der Kinder. „Was soll ich denn geben? Von meinen Sachen ist kein Stück mehr ganz.“
„Weil du alles zerschlägst, was in deine Hände kommt“, sagte Vanadis.
„Meinen Schulranzen hab’ ich noch“, höhnte er. „Den kann Balder haben, wenn er ihn mag.“
„Das könnte dir passen, du fauler Bursch!“ rief Tante Fanny und schwang drohend ein Reisigbüschel gegen ihn.
„Loke, Loke!“ fauchte ihn das Mädchen an. „Du bist er selbst, der Böse, der den Tod des Balder verschuldet hat!“
„Ruhe, Kinder, keinen Streit!“ gebot der Vater. „Jetzt ist die Glut gesunken, jetzt darf jedes von euch hindurchspringen. Laßt sehen, wer es am schönsten macht. Gunther voran! Dann Roderich! Einer nach dem andern! Es geht dem Alter nach. Vorwärts!“
Das war ein Jubeln und Springen und Röckeflattern, denn unmittelbar hinter den größeren Knaben sprang die Schwester und tat es diesen gleich. Nur Esther und die Großmutter fehlten. Letztere war nach dem Tode ihres Gatten so leidend gewesen, daß man eine Zeitlang geradezu fürchtete, sie möchte ihm nachsterben, wie es zuweilen bei langen Ehen geht, auch wenn sie sich nicht durch großen Einklang ausgezeichnet haben, daß ein Teil den andern nachzieht. Aber eine Erkrankung Esthers rief ihre Liebes- und Opferkraft wieder auf und gab sie dem Leben zurück. Jetzt saß sie am Bette des Kindes, das früh zur Ruhe gehen und laute Freuden meiden mußte.
Beim Abendessen wurde nichts mehr gesprochen, aber die Kinder saßen mit glänzenden Augen da und dachten Balders Totenfeier nach. Nur Vanadis war nicht mit sich zufrieden. Sie schlüpfte vor dem Schlafengehen noch einmal aus dem Haus und stand lange vor der Glut, die noch nicht erlöschen wollte. Ihr Herz war so voll von Balder, daß es sich weiter und weiter ausdehnte, wie um die ganze Welt in sich aufzunehmen und daran zu zerspringen. Sie weinte vor Freude und vor Schmerz, daß er so schön war und so früh sterben mußte. Und das Opfer, das sie ihm dargebracht hatte, dünkte ihr viel zu klein. Gunther, ja, der hatte gewußt, wie man Balder ehren mußte, er hatte sein Bestes gespendet, seine Gedichte. Sie war zu arm, sie hatte nichts Gleiches zu geben. Aber etwas mußte sie doch noch darbringen, etwas, das besser war als eine Flasche Rosenöl, und nun wußte sie plötzlich, was. Jedes der Kinder besaß ein eigenes Stückchen Gartenland zur Bebauung und Wartung, worauf es pflanzen konnte, was es wollte. Vanadis hatte Lilien gezogen, ein ganzes Beet Feenkinder, und sie liebte es, im Mondschein schnell noch in den Garten zu schlüpfen, um mit ihren Lilien allein zu sein. Niemand hatte sich noch erlaubt, eine zu brechen, nicht einmal der böse Roderich. Sie kannte und liebte jede einzelne besonders, hatte sie alle mit feenhaften Namen geschmückt und behauptete, jede auch mit geschlossenen Augen an ihrem besonderen Dufte zu erkennen. Die Lilien wollte sie opfern, wie Nanna ihren Frühlingsschmuck opferte. So wie heute hatten die weißen Feenleiber noch nie im Mondlicht geleuchtet. Sie standen hochgestreckt mit weitoffenen, dem Monde zugekehrten Kelchen und strömten ihm verzückte Düfte entgegen, deren stumme Liebeslaute das Kind verstand. Sie sprach noch mit einer jeden und tröstete sie über ihr Los:
„Alle müssen wir einmal sterben, auch ich. Und den Menschen tut es weher. Wenn doch auch ich einmal für Balder sterben dürfte.“
Das war aber nur der Anfang. Als die abgeschnittenen Lilien beisammenlagen, wandte sie die Schere gegen ihr eigenes Haupt. Die dicke schwere Flechte, die ihr gelöst schon bis über das Knie herabwallt, ist der Stolz der Großmutter. Morgen wird die alte Frau, die ja nicht beim Balderfest zugegen war und auch seine Begeisterungen nicht verstanden hätte, weinen über den verstümmelten Hauptschmuck ihrer Enkelin. Aber daran kann diese jetzt nicht denken, und sie weiß auch nicht, daß sie mit dem kurzen Haar noch reizender sein wird als zuvor. Sie umwickelt den Arm voll Lilien mit dem Haar und weiht alles zusammen in der warmen stillen Nacht der Sommersonnenwende dem glühenden Kohlenrest von Balders Scheiterhaufen. Das Haar flammt auf, und die Lilien bräunen sich, des Kindes ganzes Ich aber floß aus in ein stummes Gebet, rein und edel zu sein wie die Flamme, die für Balder emporstieg, keinen Winkel in ihrem Herzen zu haben, wohin sein Sonnenauge nicht blicken dürfte.
„Ich habe ihn anerkannt und werde immer danach handeln, aber ich gestehe dir, daß ich meine Zweifel habe – und wenn ich ihn ansehe ...“
Diese Worte hörte die kleine Vanadis Baron Solmar eines Tages mit gedämpfter Stimme zu ihrem Vater sagen. Mit frühreifer Spürkraft ahnte sie dahinter etwas Besonderes und schämte sich wie ein Dieb, daß sie Zeugin eines Gesprächs geworden, das augenscheinlich nicht für ihre Ohren bestimmt war. Denn als sie aus der Ecke hervortrat, in die sie sich gestellt hatte, um ihren Freund vorübergehen zu sehen, war dieser plötzlich verstummt, und die beiden Herren hatten einen raschen Blick getauscht. Sie gab ihrem Reifen einen Schwung, als ob sie ihn eben aus der Ecke geholt hätte, und flog damit vorüber. Aber als sie außer Hörweite war, blieb sie nachdenklich stehen. Worüber hatte er seine Zweifel, und was erschütterte ihn so? Brennend gerne hätte sie das gewußt, und es schien ihr so halb und halb, als komme ihr auch ein Anteil an seinen Sorgen zu; aber nicht um die Welt hätte sie ohne sein Wissen länger zuhören mögen.
Egon fuhr inzwischen gegen den Freund fort:
„Ich weiß nicht, ob es eine Stimme des Blutes gibt. Jedenfalls habe ich sie nie gespürt, und er spürt sie noch minder. Wer sich im Hause am wenigsten über meine Ankunft freut, das ist jedesmal mein Sohn. Der ganze Groll seiner Mutter gegen mich scheint zusamt ihrer Unbezähmbarkeit in ihm Fleisch geworden zu sein. Da ist keine feinere Ader. Nur eben, als ich vorbeiging, hing er mit einem Arm an dem hohen Buchenast und schwenkte sich in der Luft, gelenk wie ein Affe und ebenso häßlich. Er läßt mich nicht vergessen, daß er Seiltänzer unter seinen Vorfahren hat. Es ist mir immer ein Stachel, daß ich dein Haus mit dieser Aufgabe belaste, aber in einer Erziehungsanstalt würde er mir mit Sicherheit zum Taugenichts gemacht.“
„Die Sache ist viel einfacher, als du dir denkst“, antwortete Folkwang. „Kinder erziehen sich gegenseitig, indem sie sich aneinander schleifen, und wo schon zuvor ein Häuflein wilder Jungen rauft, kann auch der deinige mitraufen. Roderich ist kein verderbtes Kind, nur rauh und störrisch. Es ist keine Gefahr, daß die Meinigen an ihm Schaden nehmen könnten. Gunthers hochgeschwungene Geistigkeit, die nicht ohne Gefahr ist, kann sogar den derberen Gefährten recht gut gebrauchen, der ihn am Erdboden festhält. Solche Dienste können sich nur Altersgenossen untereinander leisten, denn Erziehung ist eine sehr fragwürdige Sache. Das einzig Bedauerliche ist, daß er die arme kleine Vanadis neckt und ärgert, wo er kann, aber sie ist ihm gewachsen, und wenn er erst älter wird, so hört das von selber auf. Es ist also gewiß nicht pro domo gesprochen – denn wir alle, vielleicht nicht einmal Vanadis ausgenommen, würden sein Fortgehen bedauern –, wenn ich sein Anliegen vor dich bringe, du möchtest ihn aus dem Gymnasium wegnehmen, wo er doch nichts lernt, und ihm den Eintritt in eine gute Zeichenschule, die es hier nicht gibt, ermöglichen.“
„Davon kann für jetzt keine Rede sein“, war die Antwort. „Wenn er das Zeug zum Künstler hat, so werde ich ihn gewiß nicht hindern, aber zuvor soll er mir ein gebildeter Mensch werden. Ich hasse das Banausentum gewisser Künstler, die meinen, ihre Kunst könne darunter leiden, wenn sie unsere klassischen Dichter kennen und ein richtiges Deutsch schreiben. Bevor er mit der letzten Klasse des Gymnasiums fertig ist, soll er mir an keine Kunstschule denken; bis dahin hat sich dann gezeigt, was von seinem Talent zu hoffen steht.“
„Wenn nun aber das Gymnasium doch an ihm verloren ist, wäre es da nicht besser, er käme so früh wie möglich in sein natürliches Fahrwasser? Daneben könnte er noch immer eine Privatschule besuchen. Du siehst ja, er hat Jahr für Jahr die schlechtesten Zeugnisse und ist der Schrecken der Lehrer, die ihm bei der Prüfung durchhelfen, daß er ihnen nur ja nicht ein Jahr länger in der Klasse bleibt. Dagegen werden die Kohlezeichnungen, womit er alle Wände bedeckt, täglich besser und merkwürdiger. Seine Tiergestalten haben etwas so unmittelbar Erschautes, daß man staunen muß, wie ein Kind dergleichen ohne alle Anleitung fertigbringt, denn der Zeichenunterricht in der Schule ist wahrlich eine jämmerliche Sache. Und dann seine Fratzen und Ungeheuer – eine ganze dämonische Welt –, hast du dir sie recht betrachtet? Man begreift nicht, wo er sie herbringt; man denkt, solange man sie ansieht, er müsse ihnen irgendwo leibhaft begegnet sein, so ganz voll sind sie von Leidenschaft und Leben.“
„Ja, und hier steckt gerade der Knoten“, antwortete Baron Solmar. „Sein Dichten und Trachten geht auf das Abstoßende, das Widerwärtige. Wenn ich sagen wollte, er habe keinen Schönheitssinn, so wäre es falsch ausgedrückt, er hat einen tatsächlichen Sinn für das Häßliche. Seine Tierbilder sind talentvoll, zugegeben. Aber hat es ihn je gereizt, ein edles Roß, das Schönste der Schöpfung, nachzubilden? Und schöne Pferde kann er doch täglich sehen! Nein, einen Ackergaul stellt er dir hin mit Hufen wie vier Klötze oder einen jammervollen Klepper, dem alle Rippen durchscheinen. Und was fängt er mit dem Schönen an, wenn er ihm nicht ausweicht? Er macht eine Fratze daraus. Wahrhaftig, vor einem solchen Talent, wenn er wirklich eines hätte, müßte man ja die Kunst bewahren. Wir brauchen keinen neuen Höllenbreughel. Er soll jetzt hübsch bei seinem Latein und seiner Mathematik bleiben. Nach der Matura wollen wir weiter sehen, vielleicht hat er bis dahin gelernt, die Welt mit anderen Augen zu betrachten.“
Dabei blieb’s. Wenn Baron Solmars reizbares Schönheitsgefühl verletzt wurde, so war das schlimmer als eine persönliche Beleidigung. Er hatte so lange in den Ländern der Sonne gelebt, wo Zweckmäßigkeit und Schönheit zusammenfallen, daß jede unschöne Form, plumpes Betragen, steife oder schwerfällige Bewegungen ihm einen beinahe körperlichen Schmerz verursachten. Nun hatte ihm das Schicksal wie zum Hohne einen Sohn gegeben, der – obwohl von zwei schönen Eltern und aus einer entflammten Stunde stammend – unebenmäßig und häßlich war und noch obendrein – je älter er wurde, um so mehr – mit allem Schönen Krieg führen zu wollen schien. Zwischen diesen beiden Naturen war eine Verständigung nicht vorstellbar, und der Vater hielt sich von vornherein, zwar ohne Härte, aber kühl bis ans Herz, von dem Knaben zurück, zu dessen Seelenleben er keinen Zugang sah noch suchte. So hatte auch das Gespräch über Roderichs Zukunft keinen andern Erfolg, als daß Baron Solmar häuslichen Nachhilfeunterricht in denjenigen Fächern, worin der Knabe besonders schwach sei – das waren so gut wie alle –, anordnete.
Das Opfer, dem dieses saure Amt zufiel, war auch schon gefunden. Es war Herr Wittich, ein stiller, unscheinbarer, aber um so gründlicherer Gelehrter, wie es deren zu jener Zeit viele gab, wahre Aschenbrödel der Wissenschaft, von deren Bedeutung in Gelehrtenkreisen die nächste Umwelt zumeist nichts ahnte. Aus Bescheidenheit und wegen beschränkter äußerer Umstände hatte er es nicht weiter gebracht als zum Titularprofessor am Städtischen Gymnasium, so daß er gerne die Gelegenheit wahrnahm, einer zu kleinen Besoldung bei zu großem Familiensegen durch ein Nebenamt aufzuhelfen. Gewissenhaft, wie er war, legte er sich gleich einen Lehrplan zurecht, durch den, wie er hoffte, der jungfräuliche Boden von Roderichs geistigen Fähigkeiten urbar gemacht werden sollte. Allein, er wußte nicht, was ihn erwartete. Als Roderich erfuhr, daß er nicht nur nicht aus dem verhaßten Joch der Schule erlöst werden, sondern jetzt sogar noch seine Freistunden an Dinge wenden sollte, deren Nützlichkeit ihm unerfindlich war, zerbiß er sich die Fäuste und brüllte seinen Zorn durch den abgelegenen Forst. Zwar wagte er, solange Baron Solmar um den Weg war, nicht gegen den Stachel zu löcken, aber auch er legte sich seinen Plan zurecht, der darin bestand, den Feind – als solchen betrachtete er Herrn Wittich – durch passiven Widerstand hinzuhalten, zu zermürben und endlich aufzureiben. Als er zuerst dem neuen Lehrer entgegentrat, geschah es mit so undurchdringlich verstockter Miene, daß jener sogleich wußte, woran er war. Er suchte ihm zunächst durch Güte und Vernunft beizukommen, indem er ihm den Wert einer guten Schulbildung fürs Leben und die Notwendigkeit, mit Zahlen umzugehen, auseinandersetzte, doch ohne daß sich die düstere Miene des Schülers erhellte. Dann begann die beiderseitige Qual, die sich nun Tag für Tag wiederholen sollte.
Herr Folkwang hatte die Wahrheit gesagt, als er dem Freund versicherte, daß sein Sohn trotz seiner Untugenden niemand im Hause zur Last sei, ausgenommen Vanadis, die aber so an ihn gewöhnt war, daß sie ihn als notwendiges Übel betrachtete. Denn er hatte dazugehört, fast solange sie zurückdenken konnte. Carlo, der florentinische Kammerdiener, hatte ihn als kleinen Knirps ins Haus gebracht mit einem geringen Vorrat italienischer Wörter, deren er sich längst nicht mehr erinnerte. Damals war er ein urdrolliger Kobold. Sein Kopf war viel zu groß für den kleinen Körper und sein Schädel so hart, daß er ihn als Sturmbock gegen alles gebrauchte, was sich ihm hindernd in den Weg stellte. Es war ihm gleich, wenn er sich noch so viele Beulen schlug. Schon damals hatte er es auf die kleine Vana abgesehen, der er gerne einen krabbeligen Maikäfer oder eine schaurig kalte Eidechse in den Nacken schob. Doch wurde seine Gegenwart in dem gerade verwaisten Hause, über dem die Dämpfung der Trauer lag, als eine Erfrischung empfunden, weil er immer Anlaß zum Lachen gab. Als er beim ersten Osterfeste erfuhr, daß die Hasen Eier legen, schöne rote, grüne und blaue, die im Gras zusammengesucht werden mußten, ging er eine Zeitlang täglich im Forst auf die Hasenjagd, um einen Eierlieferanten heimzubringen. Weil er keinen Hasen fing, stahl er im Nachbarhause ein Kaninchen aus dem Stall und wollte es zum Eierlegen nötigen, und er war sehr niedergeschlagen, als er gezwungen wurde, in Gesellschaft der Magd die Beute zurückzutragen und um Verzeihung für den Diebstahl zu bitten. Eine Zeitlang – er trug schon den Ranzen zur Schule, was freilich in jenen Tagen früher begann als jetzt – beschäftigte ihn der Zweifel, ob Frauen Beine haben. Es lag ja nahe, das anzunehmen, weil sie sich fortbewegten, aber die Mode der langen Röcke hinderte ihn, sich Gewißheit zu verschaffen, und fragen mochte er nicht. Zwar hatten ihm die Großmutter und Tante Fanny beim Treppensteigen gelegentlich Anlaß zu der Erkenntnis gegeben, daß es sich in der Tat so verhalte, aber aus Familienbeinen ließen sich nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Allgemeinheit ziehen, denn im Hause Folkwang war alles anders als anderwärts. Das sagten wenigstens seine Schulkameraden, die es von ihren Eltern wußten, er selber hatte ja keinen Maßstab. Eines Tages beschloß er, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein rundliches Fräulein aus der Nachbarschaft, das den spaßhaften Namen Hußwadel hatte, war von den Damen zum Kaffee gebeten. Der Name mochte den Knaben reizen, gerade bei ihr die Probe zu machen. Er wußte aus Erfahrung, daß der Gast den Ehrenplatz auf dem Kanapee neben der Großmutter einzunehmen pflegte, während die Tante gegenüber saß. Also verkroch er sich unter dem Kanapee, ehe man sich setzte. Als sich der angenehme Mokkaduft verbreitete, der ihm die Gewißheit gab, daß jetzt die Aufmerksamkeit abgelenkt war, machte er sich nach vorn und hob vorsichtig den seidenen Rocksaum des Gastes auf, darunter einen zweiten, gestreiften und endlich gar noch einen dritten, leichteren. Da erblickte er zu seinem Schrecken in weißen straffgespannten Strümpfen ein Paar mächtig gerundete Waden.
Roderich hatte trotz seiner Ungezogenheit eine unbewußte Hochachtung vor dem anderen Geschlecht, das er sich gern dem seinigen so unähnlich wie möglich dachte. Diese Hochachtung, die er vor sich selbst nicht wahrhaben wollte, war es ja, was ihn vorzüglich zu seinem widerhaarigen Betragen gegen die Weiblichkeit veranlaßte. Die Entdeckung, die er da machte, empörte ihn: Da wollen sie was Besseres sein und sind doch gerade wie unsereiner. Er fletschte gegen die ahnungslosen Beine, und plötzlich überkam ihn die Wut, daß er hineinbiß! Mit einem Schrei fuhr die Inhaberin empor: „Ein Tier! Ein Tier hat mich gebissen! Es war ein Hund!“ – Man machte ihr begreiflich, daß es keinen im Hause gab. – „Dann war’s eine Ratte!“ – Während die Großmutter mit schönen weißen Händen die gebissene Stelle untersuchte, rannte Fanny nach einem Stock, um die Ratte aufzustöbern. Bis sie zurückkam, fand Roderich in der Verwirrung Zeit, zwischen den Sofabeinen heraus und hinter den großen Ofen zu schlüpfen. Dort stand er an die Wand geklebt, während der Stock unter dem Kanapee herumfuhr, bis er die Gelegenheit ersah, durch die offene Tür zu entwischen. Es wurde niemals aufgeklärt, welches Tier es war, das die Spur seiner Zähne in Fräulein Hußwadels üppigem Fleisch gelassen hatte.
Aber wie man wohl eine Zeitlang ein Bärenjunges im Hause hegen und sich an seinen lustigen Streichen ergötzen kann, bis beim Größerwerden das wilde Tier erwacht und für die Umgebung bedrohlich wird, so war es mit dem Knaben gegangen. Wie er heranwuchs, trat etwas Fremdes an ihm hervor, etwas seltsam Wildes und Unzivilisiertes, das sich in plötzlichen Ausbrüchen äußerte, wobei er nicht mehr wußte, was er tat. Endlose Klagen liefen in der Schule gegen ihn ein, und sogar die Polizei hatte sich mit ihm zu beschäftigen. Zielsicherheit im Wurf, diese schätzbare Ausbildung von Hand und Auge, übte Roderich mit Steinen an den Nachbarfenstern. War irgendwo in der Stadt eine Laterne zerbrochen, so wurde die Tat ohne weiteres mit Recht oder Unrecht Folkwangs Roderich – so hieß der Knabe bei den Leuten – zugeschrieben. Gab es Streit, so rannte er blindlings auch die Stärksten um und fragte nicht nach den Löchern im Kopf, die er davontrug. Noch immer verfolgte er Vanadis mit seiner Bosheit. Wenn er sie aber eine Zeitlang mürrisch in Ruhe ließ, so war ihr dieser Zustand so fremdartig, daß sie ihrerseits den Stummen reizen mußte, indem sie ihn mit Büchschen voll Spielmarken wie mit Kastagnetten klappernd umtanzte: „Was kostet das Wort, Roderich? Ich kann’s bezahlen.“ – Bis er sie wild anschnaubte und sie mit Lachen davonstob. Bei all seinen Untugenden war er unter den Kameraden nicht unbeliebt, und die Folkwangschen Knaben traten für ihn ein, wie wenn er ihres Blutes wäre.
Auch sein Talent hatte etwas Besessenes, die Fratzenköpfe, die er überall hinschmierte, waren wie Einschläge innerer Entladungen. Sobald er wieder anfing Tiere zu zeichnen oder pflügende Bauern, wußte man, daß die Krisis vorüber war. Alle Wände des Hauses trugen die Spuren dieser Übungen, seine Hefte waren mit Gesichtern und Figuren vollgekritzelt, und sooft sie ihm in der Schule um die Ohren geschlagen wurden, er ließ sich von seinem Tun nicht abbringen. Jedes größere Stück Papier oder Pappe war ihm verfallen. Allerdings zog ihn seine Lust wie sein Widerspruchsgeist zum Derbnatürlichen, das unter seiner ungeübten Hand ins Häßliche ausartete. Aber Egon übertrieb, wenn er meinte, er suche mit Absicht, was das Auge abstößt. Anschauung von Kunstwerken und richtige Anleitung hätten Auge und Hand verfeinert, aber das Zeichnen in der Schule nach langweiligen Gipsköpfen trieb ihn immer mehr in den Gegensatz. Es gab wohl in der Stadt ein kleines Museum mit einigen guten Bildern älterer Schule, die Roderich nicht müde wurde sich einzuprägen, allein für eine junge Kraft, die nach Wachstum drängt, war damit nicht gesorgt. Baron Solmar, der Sammler und Mäzen, der mehr als einem jungen Talent den Weg zur Ausbildung erleichtert hatte, verkannte das seines eigenen Sohnes.
Ein Vorfall solcher Art, der sich eben jetzt ereignete, trieb den Groll des Knaben aufs höchste. Seit einigen Jahren zeigte sich regelmäßig zu Ende des Sommers ein junger italienischer Gipsfigurenhändler in dem Städtchen, wo er leidlichen Absatz fand. Die besseren Bürgersleute, zum guten Teil Katholiken, kauften ihm zu niederen Preisen kniende Engel oder kleine Madonnen ab, womit man Gräber schmückte oder um die Weihnachtszeit auswärtige Freunde, die keine solche Gelegenheit hatten, beschenken konnte. Es war ein hübscher Junge, ein paar Jahre älter als Roderich, braun und geschmeidig, mit dunklem Krauskopf und beweglichen Augen und Gliedern. Auch im Hause Folkwang pflegte er sich einzustellen, wo man ihn gut leiden mochte und jedesmal zum Vesperbrot der Kinder einlud. Sein gesittetes Betragen und gebrochenes, aber angenehm klingendes Deutsch erwarben ihm die Zuneigung der ganzen Familie. Dort brachte er mit der frühen Menschenkenntnis, die sich solche wandernden Knaben erwerben, statt der kitschigen Engel kleine Nachbildungen nach Antiken zum Vorschein. Im Vorjahr hatte sich Vanadis in eine von diesen, eine im Flattergewand hineilende Diana mit Hund, verliebt und sie gegen ihre ganze verschlossene Sparbüchse von ihm erhandelt. Sie wußte selber nicht, wieviel die Büchse enthielt, der Betrag war aber so hoch, daß der Junge sich bewogen fühlte, ihr bei seiner heurigen Wiederkehr noch ein weiteres Figürchen zum Geschenk zu bringen, das er sie selber aussuchen ließ, weil er so anständig war, sich der Überzahlung zu schämen. Sie wählte einen kleinen gipsernen Napoleon, denn durch Béranger, den ihr die Großmutter vorlas, war sie durch die Napoleonlegende verzaubert worden, und öfters hörte man sie zu Gunthers Verdruß vor sich hin sagen:
„Il portait petit chapeau
Avec redingote grise ...“
Auch jetzt wurde der Bruder über ihre Wahl ungehalten: „Weißt du nicht, daß er ein Feind Deutschlands war? Hast du nie von der Schlacht bei Leipzig gehört?“
„Nun, so freue dich, daß er uns Gelegenheit gab, auch etwas zu tun.“
O Mädchenkopf! Sie bringt es fertig, den großen Friedrich und Napoleon gleichzeitig zu lieben!
Aber da war nichts zu machen, wo sie liebte, liebte sie. Und endlich fand sie das für ein Kind fast zu wahre Wort: Helden sind alle von einer Nation.
Das hinderte aber nicht, daß schon an einem der nächsten Tage der kleine Napoleon von ihrer Lade verschwunden war, und Gunther allein hätte sagen können, wo er geendet hatte.
Egon kam dazu, wie der Lucchese seinen Korb zusammenpackte, und redete ihn in der Sprache seiner Heimat an. Der Knabe strahlte und erzählte mit dem natürlichen Anstand seiner Rasse, daß er einen Bildhauer zum Vater gehabt und nach dessen Tode sich schon als kleiner Junge auf den Handel mit Gipsfiguren geworfen habe, um die Mutter zu entlasten. Diese, an der er sehr zu hängen schien, sei in die Stadt gezogen und diene tagsüber in einem Gasthof. Egon fand Gefallen an dem Jungen und fragte weiter. Er erfuhr, daß seine Mutter Deutsche sei und mit ihm von klein auf ihre Sprache gesprochen habe und daß auch der Rat, mit seinen Sächlein in Deutschland zu handeln, von ihr stamme, weil dort die Menschen weitherziger seien. Vom Vater aber, der Florentiner war, hatte er sein wundervolles Toskanisch, das für jede Tönung gleich das rechte Wort findet und womit er Egons Ohren entzückte. Nun begann dieser ihn nach Lucca auszufragen, mit welcher Stadt ihn eine unvergeßliche Erinnerung verknüpfte. Dort hatte er einst die hinreißende Eugenie van der Mühlen mit ihren Eltern kennengelernt, bevor sie die Gattin seines Freundes Folkwang wurde. Durch Wochen hatten sie denselben Gasthof bewohnt, er war ihr Führer durch Stadt und Umgebung gewesen und hatte sein Herz hoffnungslos an die junge Schönheit verloren. Sein Gefühl fand volle Erwiderung, und die Eltern warteten täglich darauf, daß er sich erkläre. Egon litt Höllenqualen zwischen dem Vorwärts und dem Zurück, denn er war heimlich an eine andere gebunden, von der er nicht loskam, dieselbe, die später Roderichs Mutter wurde. Er schied, nachdem er sich mit Eugenie auseinandergesetzt hatte, und ließ dem Freunde die Braut. Aber die Tage von Lucca glänzten mit unbeschreiblicher Leuchtkraft in seiner Seele nach.
„Ich habe viele Städte auf der Welt gesehen“, sagte er leutselig zu dem Knaben, „aber keine hat mir jemals besser gefallen als deine Vaterstadt.“
„Ja, Herr“, sagte der Knabe mit bescheidenem Eifer, „das kommt davon, daß alles dort geblieben ist, wie es in den Tagen der großen Kunst entstand, man hat gar nichts verändert und verdorben.“
Egon wunderte sich über die Richtigkeit dieses Gedankengangs. „Ist der schöne Wall mit seinen Ulmen und Platanen rund um die Stadt noch erhalten? Blüht dort noch immer der Krokus so früh im Jahr?“
Der Knabe bejahte mit leuchtenden Augen.
„Es gab zu meiner Zeit einen Gasthof dort, wie hieß er nur? – Er lag nicht weit von San Michele mit dem Blick auf ein kleines Palmengärtchen. Besteht er noch? Man war dort gut untergebracht.“
„Jawohl, Herr, das ist derselbe, wo meine Mutter dient. Auch der Besitzer hat nicht gewechselt, er würde gewiß den Herrn gleich wiedererkennen, denn er vergißt keinen seiner Gäste.“
„Hast du dich auch fleißig unter den Kunstschätzen umgesehen? Kennst du das schöne Grabmal von Jacopo della Guercia im Dom?“
Das Gesicht des Jungen blühte auf.
„Das Grabmal des Jacopo della Guercia? Ob ich es kenne? O Herr, jede freie Stunde gehe ich hin es ansehen, es ist gewiß das schönste in der Welt, die liegende Frau mit dem Hündchen zu ihren Füßen und dem herrlichen fließenden Gewand. Wie schön der Kopf in dem Kissen liegt, das darüber von beiden Seiten aufschwillt, so natürlich und doch so – so –“, er suchte das Wort, „so ganz besonders.“
„Und von dem Gesichte der Frau sagst du nichts?“
„Oh, sie ist schön – und edel – eine wahre Gentildonna.“
„Ja, das ist sie“, antwortete Egon, „die Mutter dieses jungen Fräuleins hat ihr geglichen.“
„Und auch das Fräulein gleicht ihr und ist ebenso schön.“
Die unbefangene Anmut des Knaben nahm den Frager ganz gefangen, und seine Begeisterung für das Grabmal des Jacopo della Guercia rückte ihn menschlich näher heran. Der wundervolle Sarkophag hing in einer großen Zeichnung zu Hause über seinem Schreibtisch; noch mehr als die hohe Kunst fesselte ihn daran die Ähnlichkeit der Liegenden mit Eugenie van der Mühlen. Da war das etwas kurze, aber unendlich reizvolle Näschen mit seinem so ganz persönlichen Abstand zur Oberlippe, worin die Ähnlichkeit lag. Sie war keine nachträglich eingebildete, sie war ihm schon damals aufgefallen, als er die beiden Gesichter zur Vergleichung nebeneinander hatte.
„Was hast du denn hier in dem zweiten Korb unter dem Tuche?“
„Das sind lauter Marmorsachen, Herr, Kunstwerke, die mein verstorbener Vater in seinen Mußestunden angefertigt hat. Er war kein gewöhnlicher Steinmetz, Herr, er war ein Künstler, nur daß die Mittel ihm nicht erlaubten, etwas Großes zu machen.“
„Laß sehen.“ – Egon nahm eins ums andere der Figürchen auf und legte sie in den Korb zurück. Es waren plastische Spielereien, wie sie zu Hunderten in all den kleinen Bildhauerwerkstätten um Carrara her gefertigt werden.
„Und dieses hier? Hat das auch dein Vater gemacht?“ Egon fragte es lächelnd, indem er ein Pferd von ganz unmöglichen Verhältnissen unter den anderen Stücken hervorzog.
„Nein, das hat mein Vater nicht gemacht, ich weiß auch nicht, wie es hier hereinkam. Es ist ein Versuch von mir, und ich weiß wohl, daß er mißlungen ist.“
„Das ist er freilich. Hast du dich noch mehr versucht? Was ist denn das hier?“
Er zeigte auf ein anderes Stück, einen kleinen Jungen, der auf der Muschel blies. Der jugendliche Künstler reichte ihm das Ding in großen Ängsten:
„Ich kann noch gar nichts, ich weiß es wohl, aber ich möchte gern etwas können.“
„Treibst du diese Versuche schon lange?“
„Herr, solange ich zurückdenken kann, knetete ich in Vaters Werkstatt Figürchen aus Ton und Wachs. Seit er tot ist, habe ich nichts mehr zu kneten, aber ein paar hübsche Stücke Marmor fanden sich noch vor und sein Handwerkszeug, das Mutter nicht verkaufen wollte.“
„Und da schlugst du diese Sachen gleich aus dem Stein?“
Der Junge nickte. Egon nahm die Stücke nebst ein paar anderen von der Hand des Jungen noch einmal auf und legte sie fein säuberlich wieder in den Korb.
„Du hast recht, du kannst jetzt noch nichts, aber es kommt vielleicht eine Zeit, wo du etwas können wirst, wenn du zu einem guten Meister kommst, der dich anleitet.“
Die Augen des Jungen glänzten. „Wenn ich die Mittel hätte, wäre ich längst in eine Bildhauerschule gegangen. Aber ich muß mit meinem Verkauf der Mutter aufhelfen, die nicht mehr so streng arbeiten kann.“
Egon ließ sich seine Verhältnisse ganz genau auseinandersetzen und auch die Wohnung seiner Mutter nennen.
„Geh jetzt und sieh, daß du deinen Gipskram verkaufst. Die Marmorsachen kannst du ja solange stehenlassen, die nimmt dir in hiesiger Gegend doch niemand ab. Dann komm noch einmal hierher, daß wir weiterreden.“
„Pate, darf ich nicht den Knaben mit der Muschel behalten? Er gefällt mir“, sagte Vanadis.
„Mir auch“, lächelte Egon. „Behalt ihn nur, ich werde den kleinen Künstler entschädigen.“
Indessen legte er Wert darauf, auch die Meinung Folkwangs zu vernehmen. Sie betrachteten den Muschelbläser von allen Seiten und fanden von allen Seiten zu loben.
„Es ist nichts Nachgemachtes dabei“, sagte Egon, „es ist alles selbst gesehen, auch das Pferd, so mißlungen es ist, hat eine Bewegung, die frisch aus der Natur geholt ist, nicht von einem Vorbild. Der Junge hat Augen im Kopf, aus dem kann etwas werden; man darf ihn nicht verkommen lassen. Und einen guten Charakter scheint er auch zu haben. Konnte nicht Gott mir einen solchen Sohn geben!“
Als der Junge wiederkam, zitternd vor Verlangen nach seinem Schicksalsspruch, gab ihm Egon zunächst eine kleine Summe Geld, mit der solle er nach München fahren und sich dort mit einigen Zeilen von ihm bei einem angesehenen Künstler vorstellen, der eine Bildhauerschule leitete. Wenn dieser finde, daß sein Talent die Ausbildung verlohne, so solle er für ein paar Jahre eine kleine Unterstützung erhalten, die ihn bei sparsamem Leben über die Lehrzeit wegbringen werde, besonders wenn er sich noch gelegentlich durch Modellstehen etwas zu verdienen suche, da er ja gut gewachsen sei. Danach ermahnte er ihn streng zu Fleiß und Sparsamkeit, und daß ihm auch das Geld keineswegs geschenkt sei, daß er es vielmehr zurückerstatten müsse, sobald er etwas sei und habe, weil auch andere der Hilfe bedürftig seien.
Die Freude des Jungen äußerte sich in leidenschaftlichen Dankesworten und wiederholten Handküssen, die nichts Sklavisches an sich hatten, weil sie unverkünstelt aus der glücklichen Art eines Volkes flossen, das jedes Gefühl äußern kann, ohne sich etwas zu vergeben. Man sah ihm an, daß Paradiese vor seinen Augen aufgingen.
„Ich will mich fest zusammenhalten“, sagte er, „daß ich Ihrer Güte keine Schande mache. Denn ich will ein wirklicher und großer Künstler werden, größer als mein guter Vater war, und sehr, sehr reich.“
Egon belustigte sich an diesem echt südländischen Gedankengang. „Was tust du denn, wenn du ein großer Künstler wirst und sehr reich?“
„Dann will ich das Fräulein hier fragen, ob sie mich heiraten will“, sagte er sehr einfach und sehr kindlich. So begann die Laufbahn Giulio Goffredis.
Herr Folkwang hatte weislich angeordnet, daß der Vorgang mit dem Lucchesen vor Roderich geheimzuhalten sei, aber Fannys Temperament übersprang das Schweigegebot. Daß ein Vater den Herzenswunsch des eigenen Sohnes abschlug, um ihn gleich darauf einem Wildfremden, nur eben des Weges Gekommenen, zu erfüllen, wollte ihr nicht hinunter, und was ihr nicht hinunter wollte, mußte alsobald heraus. Vermutlich hätte sich Egon, der gar nicht zu den Schnellentzündlichen gehörte, den Entschluß noch überlegt, wäre ihm nicht bei der Erinnerung an den Wall von Lucca und das Grabmal des Jacopo della Guercia das Herz mit einem Male durchgegangen und die Fremdheit zwischen ihm und dem Sohne des wilden Weibes, das damals seinem Glück im Wege gestanden, ihm noch schwerer auf die Seele gefallen. Denn diese würde im Fall seiner Verheiratung in der Öffentlichkeit ein lärmendes Ärgernis erregt haben, dem er nicht gewachsen war und das wohl auch die Eltern van der Mühlen zurückgeschreckt hätte. Daß er der niedrigen Weibsnatur dennoch aufs neue verfallen war und ihr Anlaß gegeben hatte, ihn für den Vater Roderichs zu erklären, war eine Schwäche, die er sich nie vergab. Er büßte sie mit freiwilliger Entsagung und asketischer Lebensführung, die allmählich das Wohlgefallen am andern Geschlecht in ihm abtötete, die es aber auch begreiflich machte, daß er dem aus solcher Verwirrung hervorgegangenen Sohn keine väterlichen Gefühle entgegenbrachte.
Dieser rächte nun die vom Vater erfahrene Zurücksetzung an dem unglücklichen Lehrer, und war er zuvor unachtsam und abgeneigt gewesen, so setzte er jetzt dessen treuen Bemühungen einen stummen Hohn entgegen. Herr Wittich war schon nahe daran, sich von dem undankbaren Amte zurückzuziehen, als Fanny auf einen Ausweg verfiel, der sich als segensreich erwies. Es wurde beschlossen, daß Vanadis mit ihrer schnellen Fassungsgabe und ihrem glücklichen Gedächtnis als Mithörerin dazugesetzt werden sollte, teils um durch ihre Anwesenheit den trägen Schüler zum Wettlauf anzuspornen, teils um ihren eigenen Geist an dieser gastlichen Tafel zu nähren. Am liebsten hätte ja Fanny selbst dabeigesessen, denn Lernen, Sichbilden war noch immer der Traum ihrer Seele, allein die mannigfachen Obliegenheiten, die sie zwar auf absonderliche Weise, aber doch mit Treue und Hingebung erfüllte, ließen ihr keine Zeit dazu.
Es war in jenen Tagen der Gedanke, ein Mädchen am Knabenunterricht teilnehmen zu lassen, etwas so Außergewöhnliches und Verwegenes, wie es nur der Familie Folkwang einfallen konnte. Der Lehrer selbst, ein kleiner verwachsener Mann von linkischem, behindertem Auftreten und ein wenig stotternd, wußte sich nicht gleich in die Neuheit der Aufgabe zu finden, allein die Unbefangenheit des Kindes gab ihm bald die eigene zurück. Freilich hatte die neue Mitschülerin noch weniger festen Grund unter den Füßen als Roderich nach seinem mehrjährigen, wenn auch schlecht benützten Schulbesuch. Aber ihre Fähigkeit, schnelle Verbindungsbrücken zu schlagen und das Fehlende durch die Vorstellung zu ergänzen, half ihr zum Erfassen des Lehrstoffs nach, wo die Vorkenntnisse mangelten, auch hatte das Überhören der Knaben, worin sie mit Tante Fanny abwechselte, ihr immerhin die Gegenstände, die jenen oblagen, nahegebracht. Herr Wittich war zuerst erstaunt, dann bewegt und schließlich mehr und mehr entzückt von einer Schülerin, die seine Auseinandersetzungen verstand, bevor er zu Ende gesprochen hatte, und da er nicht wußte, daß der weibliche Geist sich naturgemäß schneller entwickelt als der männliche, betrachtete er sie geradezu als eine Wundererscheinung. Roderich gähnte unterdessen und fing Fliegen, die er zwischen den Fingern zwirbelte und dann sachlich eine neben die andere auf den Tisch legte. Das gewährte ihm die doppelte Befriedigung, daß sich Vanadis vor den toten Fliegen graulte und daß er dem Lehrer seine Mißachtung zu verstehen gab. Daß dieser mehr und mehr seine Reden und Fragen über ihn weg an das wißbegierige Mädchen richtete, focht ihn nicht im geringsten an, und nichts lag ihm ferner, als sich durch die Erfolge seiner Mitschülerin zum Ehrgeiz aufstacheln zu lassen. Vielmehr beschäftigte er sich damit, unter dem Tisch, der eine zweite Platte besaß, auf einem Stück Papier abscheuliche Zerrbilder seines Lehrers zu zeichnen mit jener Sicherheit des Strichs, die einer besseren Verwendung wert gewesen wäre. Das von der Natur selbst schon arg verzeichnete Gesicht des Herrn Wittich nahm unter dem Tisch die wunderlichsten und lächerlichsten Tierähnlichkeiten an. Mehr als einmal riß ihm Vanadis das beleidigende Blatt mit schnellem Griff unter dem Tische weg und zerknüllte es in der Stille. Durch diese Bewegung wurde Herr Wittich erst auf den Vorgang aufmerksam gemacht, und er war weise genug, zu tun, als hätte er nichts gesehen. Aber ihr entschlossenes Einschreiten gegen die Verunglimpfung seiner Person vermehrte noch in ihm die fast anbetende Liebe zu der jungen Schülerin.
Zuweilen kam auch sein Sohn Oskar ins Haus, der ein Schulfreund Gunthers war und nur wenig älter als dieser, ein begabter Junge von angenehmer Erscheinung und ruhigem, sicherem Auftreten, in keinem Zuge an die Häßlichkeit und Unbeholfenheit des Vaters erinnernd; er schlug der Mutter nach, einer stillen, anziehenden Frau, die vorzüglichen Klavierunterricht erteilte. Die Eltern hatten ihn zum Theologen bestimmt, weil ihm ein Familienstipendium zustand, das ihn zum theologischen Studium ohne Inanspruchnahme der solcher Belastung nicht gewachsenen elterlichen Kasse berechtigte. Allein Oskar hatte den leidenschaftlichen Wunsch, Medizin zu studieren, wozu jedoch die Mittel nicht aufzubringen waren, und empfand einen heftigen Widerwillen gegen die geistliche Laufbahn. Es wurde deshalb erwogen, ihn zu einem Kaufmann in die Lehre zu schicken, ein Plan, der ihm ebenso abstoßend war wie der erste. Der innere Kampf gab seinem anziehenden Gesicht einen Ausdruck von frühreifem Ernst, der Vanadis zu Herzen ging, daher sie ihn vor den anderen Kameraden ihrer Brüder bevorzugte. Er pflegte ihr Rosen außerhalb der Jahreszeit zu bringen, wenn es im van der Mühlenschen Park deren keine gab, denn sein Großvater, der Totengräber und Friedhofaufseher Wittich, betrieb zugleich einen Blumenhandel und zog das ganze Jahr hindurch in seinem kleinen, an die Friedhofmauer angelehnten Wärmehaus den schönsten und seltensten Rosenflor. Die meisten Blumen, die in der Stadt zu Hochzeiten oder anderen Festen gespendet wurden, waren zwischen Gräbern gewachsen. Auch die andern Knaben begannen bereits der Schwester Gunthers kleine Aufmerksamkeiten zu erweisen, denn der Trotz gegen das weibliche Geschlecht schmolz mehr und mehr, seit man sich dem Alter näherte, wo die Liebe ihr Spiel zu treiben beginnt.
Mit dreizehn Jahren hatte sie nichts von dem Ungeschick des Backfischalters an sich, dem plötzlich Arme und Beine zu lang werden, daß es nicht mehr weiß, was mit diesen Gliedmaßen beginnen, sondern die sprichwörtliche Anmut ihres mütterlichen Geschlechtes blieb ihr auch in den ungefälligen Jahren treu. Nur das Gesicht nahm vorübergehend jene Herbheit an, die einzutreten pflegt, wenn die Kindlichkeit verschwindet und die volle Blüte der Jungfräulichkeit noch nicht aufgebrochen ist.
Zur Entschädigung für die vielen Ärgernisse, die ihr sein Sprößling bereitete, hatte Egon sie durch das Geschenk eines kleinen munteren Ponys beseligt, auf dem sie die Wiese und den Forst auf und ab galoppierte und lachte, wenn sie ins Gras flog. Das Pony war ein äußerst gutmütiges Tier, das sich von der jungen Herrin eigenhändig aufzäumen ließ und, weil es den Tag über frei auf der Wiese grasen durfte, des Morgens durch die offene Verandatür an den Frühstückstisch kam, sich ein Stück Zucker zu erbetteln. Es wurde der liebste Spielkamerad der Jugend, die sich abwechselnd auf ihm im Reiten übte, ließ sich auch geduldig einem kleinen Wägelchen vorspannen und trabte auf der Landstraße dahin, fast mehr durch Zuruf der Kinder als durch die Zügel gelenkt. Denn es verstand augenscheinlich die Laute der Menschensprache, wenigstens soweit sie es betrafen, und vor allem seiner Herrin gehorchte es aufs Wort. Es schien sie über alles zu lieben und auch zu fühlen, daß sie das meiste Recht an ihm besaß, denn es lief ihr durch den Garten nach und wieherte zum Gruß, wenn sie zu ihm in den Stall trat. Sie gab ihm den Namen Falada nach dem treuen Roß aus ihrem Lieblingsmärchen. Oft neckte es sich mit ihr ganz auf Menschenweise, indem es sich locken ließ, auf wenige Schritt herankam und, wenn sie es fassen wollte, entwich, um sie spielend in weiterem oder engerem Bogen zu umkreisen. Wenn es sich einmal gar nicht greifen lassen wollte, stellte sie sich unmutig, schalt und drehte ihm den Rücken, um wegzugehen, dann kam es fröhlich wiehernd nachgesprungen.
Die Freunde des Hauses schüttelten den Kopf zu diesem Treiben und fanden, das Mädchen müßte nachgerade gleichaltrigen weiblichen Umgang haben, sonst würde sie noch ganz und gar zum Jungen. Einen solchen aber wollte sie nicht, zwischen ihr und ihren Altersgenossinnen, die in der Stadt nach der alten Schablone heranwuchsen, fehlte jede Brücke. Dagegen erblühte ihr jetzt unmittelbar an ihrer Seite die Freundin, deren sie bedurfte. Das war ihr Schwesterchen Esther. Auch diese war begabt und früh entwickelt und staunte an der noch begabteren älteren Schwester hinauf, nach der sie sich zu arten suchte. Sie war jedoch völlig anderen Schlages, das richtige kleine Mädchen mit dem Sinn für das Nahe und Nützliche. Sie betreute mit Wonne die Puppen, die von der älteren Schwester verschmäht und auf sie übergegangen waren, kleidete sie an, kochte für sie und legte sie allabendlich zu Bett mit größter Sorgfalt und Pflichttreue, und das in einem Alter, das sonst der Puppen schon überdrüssig ist. Wo es im Hause zu helfen gab, sprang sie zu, und manchmal machten schon ihre kleinen Hände ein von Fanny im Übereifer begangenes Ungeschick wieder gut. Die große Verschiedenheit ihrer Naturen war aber den Schwestern nicht bewußt und führte zu keinen Reibungen, sie lehnten sich gegeneinander, wenn das männliche Übergewicht zu drückend wurde. Vanadis liebte das Schwesterchen glühend, was von ihr noch glühender erwidert wurde, denn Esther lebte kein Doppelleben, sie träumte von keiner Insel, wo es schöner war, und von keinem Schiff, das dahin führte. Sie gab ihre ganze Liebe der sichtbaren Umwelt, und ihr tiefster Trieb war zu dienen. Als Jüngstes vom Hause ward sie von allen, auch von den Brüdern, gehätschelt und von niemand angefochten, nicht einmal von Roderich. Sie hatte nur zu lieben und sich lieben zu lassen. So war sie eigentlich die Glücklichste von allen.