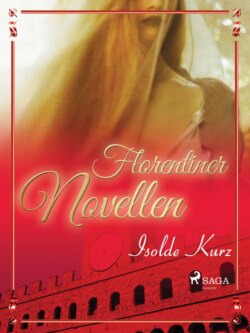Читать книгу Florentiner Novellen - Isolde Kurz - Страница 3
Die Humanisten
ОглавлениеGanz Florenz war in Bewegung, als an einem lachenden Apriltag des Jahres 1482 Graf Eberhard von Württemberg, genannt der Bärtige, mit einer stattlichen Zahl von Räten, Edlen und Knechten seinen Einzug hielt.
Zwar war es den Florentinern nicht ungewohnt, fremde Gäste in ihren Mauern zu beherbergen, wurde ja der glänzende Hofhalt des Mediceers fast nie von Besuchern leer, und dieser Reiterzug erregte die Aufmerksamkeit des schaulustigen Völkchens nur deshalb so stark, weil man wußte, daß er weit von jenseits der Alpen aus einem kalten, finstern Barbarenland komme, dessen Lage und Beschaffenheit sich tief im Nebel der geographischen Begriffe verlor. Die Menge stand viele Reihen tief in den geschmückten Straßen, durch welche die Reiter kommen mußten, denn es war denselben ein mächtiger Ruf vorangegangen, daß sie Zyklopen von ungeheuerlichem Ansehen seien, mit langen, feuerroten Haaren und lodernden Augen, deren Blick man nicht ertragen könne. Von dem Führer aber ging die Rede, er habe einen Bart, der zu beiden Seiten über den Bug des Pferdes niederwalle und das Tier wie mit einem Mantel verhülle.
Jetzt erschien der Zug in einer engen, von hohen Palästen gebildeten Gasse, die sich in halber Länge zu einer dreieckigen Piazzetta erweiterte.
Vorüber zogen die wallenden städtischen Gonfalonen, die Bläser mit ihren langen silbernen Trompeten, woran unter weißem Federbüschel das Wappen der Republik schwankte, und die lustigen Pfeifer mit der roten Lilie auf der Brust – doch als nun an der Spitze der Reiter die kleine, hagere Gestalt des Grafen Eberhard in Sicht kam, dessen Bartwuchs zwar von stattlicher, doch nicht von unerhörter Länge war, da malte sich Enttäuschung auf den meisten Gesichtern.
»Das ist der Anführer der Barbaren – er ist ja kleiner als der Magnifico! – Und wie einfach er sich trägt!« hieß es im Volke, denn der erlauchte Lorenzo war mit den Herren vom Magistrat und vielen Edlen, alle reich in damaszierten Samt gekleidet und mit den Insignien ihrer Würde geschmückt, dem fürstlichen Gaste vor das Stadttor entgegengeritten und führte ihn jetzt auf einem großen Umweg nach seiner Wohnung.
Nun drängten sich die weiter hinten Stehenden auch vor. – »Und nach Rom ziehen sie? Zum Heiligen Vater? Sind sie denn Christen?« murmelte es durcheinander. – »Nein, die hätte ich mir viel merkwürdiger vorgestellt.«
Das gleiche mochte das schöne Mädchen auf der rosenumrankten, mit Teppichen behängten Loggia denken, das zwischen zwei älteren Herren stand und den Zug aufmerksam musterte. Sie hatte dazu den allergünstigsten Standpunkt, da die langgestreckte Säulenhalle mit der schmalen Seite nach der Straße ging und mit der Längsseite die Piazzetta, auf welcher sich der Zug zu stauen begann, einfaßte.
»Nun siehst du, Kind«, sagte der betagtere von den beiden Herren, ein bartloser Mann mit regelmäßigen Zügen und dichten, noch schwarzen Augenbrauen, dem die Kapuze, welche zu seinem roten Lucco gehörte, vom Kopf geglitten war, daß das wallende Silberhaar frei floß – »siehst du, daß es Menschen sind wie wir, ohne Hörner und Klauen.«
»Puh, was sie für Bärte haben«, sagte das schöne Kind naserümpfend.
»Unseren Schönheitsbegriffen entspricht das allerdings nicht«, antwortete der Vater mit gelassener Würde. Er sprach langsam und bewegte sich so schön, daß sein Lucco bei jeder Wendung des Körpers malerische Falten warf. – »Aber es sind sehr brave Leute. Betrachte dir den jungen Mann da vorn im schwarzen Habit – das scheint mein Freund, der gelehrte Kapnion zu sein, mit dem ich schon seit Jahren im Briefwechsel stehe, wenn ihn auch die Augen meines Leibes noch nie zuvor erblickt haben. Eine Leuchte der Wissenschaft und würde es wahrlich verdienen, die Sonne Virgils seine Amme zu nennen.«
»Er wird Euch wohl die Handschrift bringen, nach der Ihr so lange suchen ließt, Vater?«
»Wenn der kostbare Kodex noch vorhanden ist, so möchte er leichthin einen andern Liebhaber gefunden haben«, mischte sich der dritte, ein hagerer Mann mit schmalem, vergilbtem Gesichte, ein, der den enthaarten Schädel durch ein flachanliegendes schwarzseidenes Mützchen geschützt hielt.
»Ich dürfte ihn darum nicht einmal schelten, Marcantonio«, entgegnete der schöne Greis mit Sanftmut. »Ist es doch ein Wettkampf, in dem alle Waffen gelten.«
»Die armen Leute!« rief das Mädchen in jugendlichem Mitgefühl, »es mag ihnen wohltun, sich an unserer freundlichen Sonne zu wärmen. Darum zogen sie auch immer so gerne von ihren schneebedeckten Alpen zu uns herunter. Es muß kalt sein, sehr kalt in diesem Germanien.«
»Ja, es ist ein kaltes, unwirtliches Land«, antwortete der Alte. »Und wenn ich denke, wie viele unserer glorreichen Väter noch dort gefangen liegen und in ihren dunkeln Burgen und feuchten Klöstern der Befreiung entgegenschmachten!« setzte er mit einem Seufzer hinzu.
Zum Verständnis unserer Leser sei es gesagt, daß der alte Herr mit diesen Vätern die römischen Autoren meinte, welche die Nacht des Mittelalters hindurch in sauberen Abschriften von den deutschen Mönchen erhalten und gehütet worden waren und jetzt, seit dem Wiederaufblühen der klassischen Studien, scharenweise in ihr Geburtsland zurückwanderten.
Aber während der Vater sich nach der Straße hinabbeugte und mit sehnsüchtigen Augen dem gelehrten Kapnion, vulgo Johann Reuchlin, folgte, hing der Blick des Töchterleins an einem jugendlichen Reiter, der hinter dem Zuge zurückgeblieben war, um sein ungestümes Pferd zu bändigen, das sich stellte und auf dem Pflaster der Piazzetta Funken schlug. Er regierte das heftige Tier nur mit der Linken, während er mit der freien rechten Hand einen starken Lorbeerzweig, den er unterwegs gepflückt hatte, über das Gesicht hielt, um sich vor der ungewohnten Sonne zu schützen, die blitzend auf seinem blanken Stahlgehenke und den Metallplatten seines ledernen Kollers spielte.
Als sein Auge das an eine Säule gelehnte, mit Rosenranken spielende Mädchen traf, senkte er langsam wie zum Gruße den Lorbeerzweig und ließ ein gebräuntes, angenehmes Gesicht, von blondem Kraushaar umrahmt, sehen. Da überkam das Mädchen der Mutwille, daß sie ein Rosenzweiglein brach und dem hübschen Barbaren zuwarf. Dieser erhob sich in den Bügeln, ließ den Lorbeer fallen und haschte geschickt das Röslein, worauf er sich dankend verneigte. Noch ein rascher Blick aus den blauen, leuchtenden Augen, und gleich darauf war der Reiter fast unter der Mähne des Rappen verschwunden, der unter seinem Schenkeldruck hoch aufstieg und ihn dann mit wenigen Sätzen dem Zuge nachtrug.
»Gar nicht übel für einen Barbaren«, lächelte der alte Herr, der sich eben umgewandt hatte, wohlwollend, »was meinst du, Kind?«
Das Mädchen schwieg, sie hätte um alles in der Welt nicht gestehen mögen, wie sehr ihr der Reiter gefallen hatte, aber während sie alle drei von der Loggia zurücktraten, legte sie sich im stillen die Gewissensfrage vor, ob es wohl möglich sei, einen Barbaren zu lieben.
Das Volk hatte sich schon verlaufen, denn alles drängte jubelnd und lärmend dem Zug zum Palaste des Medici nach, in dessen kühlem Hofraum zwischen antiken Marmorstatuen, plätschernden Brunnen und lebendigem Grün der Imbiß für die fremden Gäste bereitet war.
Doch als nach einer Viertelstunde das Mädchen noch einmal flüchtig auf der Loggia erschien, wie um auf dem Pflaster, das schon wieder seine Alltagsmiene trug, nach den Spuren des jungen Reiters zu suchen, da sah sie an der Straßenecke den ungestümen Rappen des Weges zurückkommen, von einem Reitknecht am Zügel geführt, und gewahrte nicht ohne geheimes Wohlgefallen, daß ein Diener des Medici den fremden Knecht nach der Herberge zu den »Drei Mohren« wies, die auf der Piazzetta ihrer Loggia schräg gegenüber lag.
Der Wirt trat heraus, half das Tier zum Stalle bringen und führte dann den fremden Knecht in seine Schenke zu ebener Erde.
Dort schob der Schwabe die Mütze zurück, trocknete seine schweißbedeckte Stirne und öffnete das Wams ein wenig, dann ließ er einen Blick über die anwesenden Gäste gleiten und setzte sich schwer auf die alte Holzbank vor eines der kleinen Marmortischchen. Der Wirt machte sich gleich an ihn heran.
»Caldo, eh!« begann er zutraulich. »Was, kalt!« rief der Kriegsknecht entrüstet. »Esel, sieht Er nicht, wie ich schwitze? Bring mir Wein!«
Alsbald stand ein mächtiger, mit Stroh umbundener Fiasco vor ihm. Er schenkte sich das rote Naß von Chianti ein und stürzte ein Glas auf einen Zug hinunter. Dann bestellte er in seiner Muttersprache zu essen, und auch dieser Befehl fand augenblicklich Folge. Er freute sich, daß ihm die Sprache so wenig Schwierigkeit bereite. Als er aber mit dem Essen fertig war und sich, durch den Wein zur Geselligkeit angeregt, mit dem Wirt in ein längeres Gespräch einlassen wollte, da erkannte er zu seinem Verdruß, daß dieser der schwäbischen Laute nicht Meister war.
Doch winkte der gefällige Florentiner ihm verheißungsvoll zu und entfernte sich eilig, um in Bälde mit einem wunderlichen Menschengebilde zurückzukommen, lang und schwank wie ein Haselrohr, aber so gebrechlich, daß man fürchten mußte, es zerknicke bei der ersten Berührung in der Mitte, wo es am schwächsten schien. Dünnes rotes Haar, mit Weiß gemischt, hing schlaff um ein fahles, bartloses Gesicht, eines jener Gesichter, die nie zur Mannheit ausreifen, sondern in die späteren Jahre eine welke Jugendlichkeit hinübernehmen. Jede seiner Bewegungen war unnatürlich, von den schmachtenden Wendungen des mageren Halses zu dem gezierten Gang, der im Tanzschritt ansetzte und den Boden unter den Füßen zu verschmähen schien. Nur ein paar blaue Augen, die ehrlich und wohlwollend aus fast unbewimperten Lidern hervorsahen, versöhnten ein wenig mit der dürftig-anspruchsvollen Erscheinung.
Dieses seltsame Wesen kam unter Verbeugungen heran und fragte den Schwaben in schlechtem Deutsch, was des Herrn Landsmanns Begehr sei, und es war possierlich anzusehen, wie sich beim Sprechen seine Ellbogen zu einer flügelschlagenden Bewegung erhoben und das Gewand wedelte, als wollte die ganze luftige Gestalt zum Himmel entflattern.
Der Kriegsknecht sah den Roten verdutzt an, denn er wußte nicht, was er aus ihm machen sollte, und fuhr mit der Hand nach der Mütze, besann sich aber auf halbem Wege anders und kratzte sich nur am Kopf.
Er sei kein Herr, stotterte er verlegen, sondern nur der Peter von Lorch, im Dienst des Edlen Veit von Rechberg-Stauffeneck, eines der besten Ritter im Schwabenland. Die Erwähnung seines Herrn stärkte sein Selbstgefühl, denn er gewann nun die Kühnheit, auch den Roten nach Stamm und Namen zu fragen, wobei er jedoch geflissentlich die direkte Anrede vermied, um ihm weder zu viel noch zu wenig Ehre zu geben.
Er heiße Lucius Rufus, antwortete der andere mit seiner hohen und dünnen Stimme, die die ganze Erscheinung wunderbar vollendete, und sei Majordomus in dem schönen Palaste gegenüber. Auch er dürfe sich eines Gebieters rühmen, der hinter keinem Mann der Erde zurückstehe, denn ganz Florenz kenne den edlen Herrn Bernardo Rucellai als Urbild aller Bürgertugend und als den wahren Vater der Weisheit.
»So«, entgegnete Peter mit breitem Lachen. »Ich habe wohl zuweilen unseren Pfarrer sagen hören, Vorsicht sei die Mutter der Weisheit, aber daß der Herr Rutschel ihr Vater ist, war mir nicht bekannt.«
Der Rote belächelte herablassend diesen Witz und setzte sich neben dem Landsmann nieder, während der Wirt eilig auch ihm ein Glas vollschenkte. Bald kamen noch andere von den schwäbischen Kriegsknechten nach, die ihre Pferde gleichfalls im Stall der »Drei Mohren« unterstellten und vom Wirt dienstbeflissen zu dem Paar am Marmortisch geführt wurden. Doch sie wußten sich schlecht in die Unterhaltung zu finden und sprachen in ihrer Verlegenheit um so mehr dem Weine zu, denn der Rote, dem es ein Vergnügen machte, seine barbarischen Landsleute zu verblüffen, flößte ihnen durch geschraubte fremdländische Redensarten eine gewisse Scheu ein.
Soeben erzählte er, daß er aus Augsburg gebürtig sei – Augusta Vindelicorum – wie er erläuternd hinzusetzte, und wenn sein Stammbaum nicht verloren wäre, so ließe sich leichtlich nachweisen, daß er von einem gewissen Lucius Rufus abstamme, der Unterbefehlshaber im Heere des Kaisers Augustus gewesen und der die Stadt habe gründen helfen. Er selbst habe vormals den Beruf eines Haar- und Bartkünstlers in seiner Vaterstadt geübt und sei den Mitbürgern nur als der rote Lutz bekannt gewesen, denn die Nacht der Unwissenheit habe noch schwer auf ihm gelastet. Erst in Florenz habe er den Namen seines Ahnherrn wieder angenommen und sei »antik« geworden.
»Was ist das?« fragten alle wie aus einem Mund.
Der Rote leuchtete auf, denn er war jetzt ganz in seinem Fahrwasser, und er bemühte sich, seinen Zuhörern eine faßliche Erklärung des Wortes zu geben.
Das Antike, bedeutete er sie, sei die schöne Manier in Sprache und Gebärden, die von den Alten stamme und in Florenz zur Bildung und guten Sitte unentbehrlich sei. Dazu gehöre vor allem auch eine Hauseinrichtung im Stile der alten Römer, und nun beschrieb er den sprachlos dasitzenden Kriegsknechten die Gastmähler seines Herrn, wobei die Geladenen mit bekränztem Haupt sich nicht zu Tische setzten, sondern legten, während er nach dem Takt der Musik das Essen auftrage und das Fleisch zerschneide; denn so verlange es der römische Brauch. Ehe das Mahl beginne, sprenge sein Herr eine Schale vom besten Wein auf den Boden, als Weiheguß für die alten Götter, die in Marmor herumstünden, und spreche einen lateinischen Vers dazu, und das alles, wenn es mit der schönen Art gemacht sei, nenne man antik.
Die Knechte stießen sich heimlich mit den Ellbogen an, und Peter sagte, sich bekreuzend: »Straf mich Gott! Das ist ja heidnisch; seid ihr denn keine Christen?«
Lucius entgegnete mit nachsichtigem Lächeln: »Freilich; aber die heilige Jungfrau und den Bambino in Ehren, diese Gebete an die alten Götter gehören zum Ganzen, zum Stil und zur Einrichtung, mit einem Wort zum Antiken, und selbst der Heilige Vater hält es nicht anders.«
Nun fuhr er in seiner Lebensgeschichte fort und erzählte, wie in seine Barbierstube häufig ein fahrender Schüler gekommen sei, der unter dem Seifenschaum lateinische Verse zu deklamieren pflegte, und wie er auf diese Weise ein schön Stück Latein und viele Verse aus einem Gedicht kennengelernt habe, das von den Irrfahrten des Trojerhelden Äneas handle. Da sei die Wanderlust so mächtig in ihm geworden, daß er sein Handwerk an den Nagel hängte und in Diensten eines Kaufmanns nach der Levante zog. Dort geriet er aber durch den Tod seines Herrn in großes Elend, so daß er wieder zu seinem früheren Handwerk greifen und viele Türkenbärte scheren mußte, bis ihm eines Tages ein welscher Bart unter die Hände kam, der einem edlen Florentiner angehörte. Dieser erkannte aus der blumenreichen, von Zitaten wimmelnden Sprache seines Barbiers, daß solch ein Mann zu etwas Höherem geboren sei, und nahm ihn von der Baderstube weg in seine Dienste. Der Florentiner war nach dem Fall von Konstantinopel in die Levante gekommen, um in kleinasiatischen und griechischen Klöstern auf alte Manuskripte zu fahnden, und da sich Lucius ebensowohl auf die türkische wie auf die fränkische Sprache verstand, mußte er bei diesen Unterhandlungen den Dolmetsch machen. Sein Herr richtete ihn mit der Zeit auf alte Klassiker ab, wie einen Falken auf den Reiherfang.
Als sie nun schon einige hundert Bände gesammelt hatten und mit der kostbaren Fracht die Rückreise nach dem Abendland antreten wollten, litten sie im Ägäischen Meere Schiffbruch und mußten es ansehen, daß all die kostbaren Bücher, die ein ganzes Vermögen verschlungen hatten, in den Wellen versanken.
Bettelarm kehrte der Florentiner in seine Heimat zurück und starb da an gebrochenem Herzen, hatte aber zuvor noch den getreuen Lucius bei Bernardo Rucellai, seinem besten Freunde, untergebracht.
Dies alles berichtete der Rothaarige seinen Zechgenossen mit manchen Ausschmückungen und großem Schwulst, zuweilen seine Rede mit einem lateinischen Spruch durchflechtend. Auch machte er viel Rühmens von dem Ansehen und Reichtum seines Herrn und vor allem von den unermeßlichen Bücherschätzen, um deretwillen aus der ganzen Welt viel vornehme und gelehrte Männer im Hause Rucellai zusammenströmten, und er suchte dem stumpfsinnig dreinblickenden Peter den Wert solcher Sammlungen begreiflich zu machen.
Dem aber war der ungewohnte welsche Wein zu Kopf gestiegen, und die Ruhmredigkeit des Roten begann ihn zu verdrießen. Er schlug auf den Tisch und rief herausfordernd: »Und mein Herr ist doch noch ein viel größerer Herr, das sag ich. Der schlägt mit der gepanzerten Faust einen Ochsen nieder, und den stärksten Ritter hebt er aus dem Sattel, als ob es ein Strohmann wäre. Acht Wölfe hat er einmal an einem Tag erlegt, und die Dienste, die er dem Hause Württemberg bei der Mühlhäuser Fehde geleistet, wird ihm der Graf gewiß zeitlebens nicht vergessen. Und was den Reichtum betrifft, so brauche ich nur die Burg Stauffeneck zu nennen, mit Dörfern, Wäldern und Äckern, und die Herrschaften im Oberland, gar nicht zu reden von den kleineren Höfen und Weilern zwischen Staufen und Rechberg, die ihm zinspflichtig sind. Es lebt kein besserer Ritter im ganzen römischen Reich, und wer’s nicht glaubt, der hat mit mir zu tun.«
Die anderen Kriegsknechte ließen ein beistimmendes Murmeln vernehmen.
»Ich glaube es ja gern, ihr Herren«, begütigte Lucius. »Aber seht: Andere Völker, andere Sitten! wie der Lateiner sagt. Bei uns gilt der Mann mehr nach dem Kopf als nach der Faust, und eine schöne Bücherei hat größeren Wert als Schlösser und Burgen. Da ist zum Beispiel Herr Marcantonio, das alter ego meines Gebieters; nun, wer ihn sieht, der muß bekennen, daß die Göttin der Liebe nicht an seiner Wiege gestanden hat, und dennoch darf er um das schönste Mädchen von Florenz, um unsere Lucrezia, werben, und meine alten Augen werden es noch erleben, daß Hymens Fackel ihnen den Brautgesang tönt. Das kommt daher, daß er vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben hat, ein lateinisches Buch« – Lucius dämpfte seine Stimme zum Flüstern, als ob er sich in der Nähe des Allerheiligsten befände – »seit den großen Alten sei nichts Schöneres geschrieben, sagt Seine Magnifizenz, der erlauchte Lorenzo, der nicht nur ein Kenner ist, sondern auch selber den Pelikan besteigt.«
Er sah sich im Kreise nach Beifall um, fand aber nur gleichgültige Gesichter.
»Bücher«, sagte Peter wegwerfend, »die wachsen bei uns wie Unkraut, aber wir fragen nichts danach, denn das ist für die Klerisei, nicht für Kriegsleute. Mein eigener Herr hat eine großmächtige Truhe voll von dem Zeug in seinem Keller stehen und hat sich in seinem Leben noch nicht nach ihr gebückt.«
Der Rothaarige stieß einen Laut der Überraschung oder des Zweifels aus.
»Ich weiß, was ich sage!« rief Peter, sich erhitzend, »ich habe sie selbst gesehen, denn ich bin einmal, es ist schon lange her, in unseren Burgkeller auf Schloß Stauffeneck heimlich eingestiegen. Ich hatte einen störrischen Hengst im Burghof getummelt, daß er und ich von Schweiß troffen, denn es war ein heißer Sommertag. Da bemerkte ich nicht weit von dem großen runden Turm ein Loch im Boden, durch das man in den Keller hinabsehen konnte, und der Quaderstein an dieser Stelle war losgebröckelt, denn es ist ein gar altes Gemäuer. Ich, nicht faul, hebe den Stein aus und drücke mich durch die Öffnung hinunter. Es war ein übler Weg, wie ihr euch denken könnt, und ich kam halb geschunden auf dem feuchten Boden an, aber ich hoffte einen tüchtigen Schluck zu tun, denn mir schien’s, als sei hier der Weg zum großen Faß. Aber ich befand mich in einem engen Bretterverschlag und konnte nur durch die Latten nach den schönen Wein- und Mostfässern hinüberschielen. Durch einen engen Gang aber kam ich in ein anderes ausgemauertes Gelaß und stieß dort auf eine große eiserne Truhe. Da fiel mir ein, was ich einmal gehört hatte, daß in diesem Gewölbe der Klosterschatz von Sankt Blasien vergraben sei, und ich sah mich um, ob nicht auch in einer Ecke der Hund mit den feurigen Augen sitze, der die Truhe hüten soll. Aber da war nichts Lebendiges außer mir. Also, ich gehe hin und hebe den Deckel auf, und was glaubt ihr, daß ich drinnen fand? Vergoldete Altarleuchter und silberne Becher? – Ja, wisch dir den Mund ab! Lauter verschimmeltes Schweinsleder mit Krackelfüßen darauf und mit farbigen Bildchen am Rand. Ich, wieder zugeklappt und nicht gemuckst von dem Fund, denn wer hätte auch etwas davon gehabt? Ja, wären es harte Taler gewesen! Dort muß die Bescherung noch liegen, und es hat kein Hahn danach gekräht bis auf den heutigen Tag. Was das Ungeziefer übrig läßt, das frißt der Schimmel. Unser Junker weiß gar nichts davon, der Unrat stammt noch aus des Herren selig Zeit, der hatte es mit den Mönchen.«
Hier aber ward Peter unterbrochen durch eine Stimme, scharf und schneidend wie ein Peitschenhieb, die seinen Namen rief. Er stolperte eilig die Treppe hinauf in das Zimmer seines jungen Herrn, der eben vom Gastmahl des Mediceers zurückkam, denn er wußte, daß es nicht rätlich war, den Gestrengen auch nur eine Minute warten zu lassen. Als er dessen Befehl entgegengenommen hatte und zu dem neuen Freund zurückkehren wollte, war dieser schon davongeeilt, um seinem Gebieter von dem merkwürdigen Bücherfund des neuen Gegenüber zu berichten.
Der junge Ritter stand am Fenster und blickte unruhig nach der säulengetragenen, ganz von kleinen schwefelgelben Schlingröschen umrankten Halle hinüber, wo ihm beim Eintritt jene flüchtige reizende Erscheinung aufgetaucht war. Er gedachte eines Auftrags, den ihm seine jugendliche Landesmutter auf die Reise mitgegeben hatte. Wenn ihr Herr Veit eine rechte Freude machen wolle, hatte sie gesagt, so möge er von Italien, wo es der schönen Mädchen viele gebe, die schönste, die er finde, nach Hause bringen als seine eheliche Wirtin, damit Frau Barbara auch in ihrem Residenzschloß zu Stuttgart die Laute der geliebten Muttersprache vernehme.
Veit, der in Gräfin Barbara das Muster der Frauen verehrte, hatte sei dem ersten Schritt auf italienischem Boden keinen anderen Gedanken mehr, als ein Weib zu finden, das der anmutigen Gebieterin gleiche. Aber je länger er suchte, desto schwieriger fand er die Wahl. Von einer stolzen Visconti, die ihm beim Einzug in Verona mit ihrem fürstlichen Brautgeleite wie die Königin von Saba begegnet war, bis herab zu der anmutigen Spinnerin in Holzschuhen, die es ihm auf den Apenninen angetan hatte, wollte sein Herz gar nicht mehr zur Ruhe kommen, und er bekannte seinen Reisegefährten, daß er Muselmann werden und einen ganzen Harem nach Hause bringen müßte, um den Auftrag seiner Herrin richtig zu vollziehen.
Doch in Florenz ereilte ihn sein Geschick, denn seit ihm Bernardo Rucellais Tochter jenes Röslein zugeworfen hatte, war ihm alles weitere Schauen leid und widrig geworden, er hätte am liebsten die Augen schließen mögen, um dieses Bild durch keine anderen Bilder mehr verwischen zu lassen. Er fand, daß sie der Gräfin gleiche, nur war ihr Wuchs höher und schlanker, und ein Liebreiz ging von ihr aus, der in des Junkers Augen alles übertraf, was er bis jetzt gesehen hatte. Er brauchte sich nicht zu fragen, ob Lucrezia Rucellai auch wirklich die Schönste sei, denn sie war gleich bei dem ersten Blick für ihn die Einzige geworden. Ihren Namen hatte er durch einen der Florentiner Herren, die den Zug geleiteten, erfahren, aber mehr wußte er nicht von ihr, und jetzt fühlte er sich zum ersten Male etwas verzagt, wenn er bedachte, daß die Besitzer dieses Kleinods doch wohl schwerlich auf einen wildfremden Landfahrer gewartet hatten, um es loszuschlagen.
Die kleine Entfernung von seinem Fenster zu ihrem Hause bedeutete also wohl eine unüberschreitbare Kluft, und dennoch lächelte der junge Mann leise vor sich hin, während seine Phantasie eine bunte Brücke in den Farben des Regenbogens hinüberbaute.
Da ging drüben am Hause, das mit der Loggia verbunden war, die Türe auf, und heraus trat zu Veits froher Überraschung Johann Reuchlin, Graf Eberhards jugendlicher Geheimschreiber, geleitet von jenem schönen würdevollen Greis im Silberhaar, den Junker Veit neben dem Mädchen erblickt hatte, und er sah, daß die beiden sich auf der Schwelle herzlich wie alte Freunde verabschiedeten.
Veit sprang mit klirrenden Sporen ungestüm die Treppe hinab, um den Geheimschreiber an der Straßenecke zu stellen und über die Bewohner jenes Hauses zu befragen. Da erfuhr er, daß der würdevolle alte Herr Bernardo Rucellai heiße, ein Stern des Humanismus sei, durch Familienbande dem Herrscherhaus verknüpft und zugleich naher Anverwandter jenes berühmten Marcantonio Rucellai, den die gelehrte Welt als den glänzendsten neulateinischen Autor verehre.
»Leider mußte ich dem alten Herrn eine schmerzliche Enttäuschung bereiten«, fuhr der Geheimschreiber fort. »Er hatte gehofft, ich würde ihm ein einzig vorhandenes Manuskript zur Stelle schaffen, einen uralten Cicero, auf den die Rucellai seit dreißig Jahren fahnden. Doch meine Bemühungen waren vergeblich, und nun schmerzt es mich, daß der alte Herr wohl im stillen denken mag, ich habe den kostbaren Kodex auf die Seite gebracht, denn leider, Junker, gibt es unter Gelehrten weder Treu noch Glauben, sobald ein alter Autor auf dem Spiele steht.«
Der Junker hörte diesen Erklärungen nur mit halbem Ohre zu, denn ganz anderes lag ihm am Herzen als der alte Herr mit seinen literarischen Nöten.
»Habt Ihr auch seine Familie kennengelernt, Herr Geheimschreiber?« fragte er zögernd.
»Herrn Marcantonios Bekanntschaft ist mir auf morgen versprochen«, entgegnete Reuchlin nicht ohne eine kleine Bosheit, fuhr aber, als er die unbefriedigte Miene seines Reisegenossen sah, gleich gutmütig fort: »Für euch hat wohl der Autor der ›Facetien‹ mindere Anziehungskraft als Herrn Bernardos schwarzäugiges Töchterlein. Nun, diese werdet Ihr morgen bei dem Lanzenrennen sehen, das Seine Magnifizenz zu Ehren unseres Herrn veranstaltet. Ich höre soeben, daß Fräulein Lucrezia den Sieger krönen soll. Wenn also Euer bewährter Ruhm Euch treu bleibt, so werdet Ihr meine Wenigkeit morgen nicht mehr zu beneiden brauchen. Und nun, verzeiht, ich muß noch zu unserem Herrn, der mich hier schlecht entbehren kann. Gute Nacht, Herr Ritter, und mögen Euch die Sterne günstig sein.«
Mit diesen Worten ging der Geheimschreiber eiligst von dannen.
– Das glänzende Kampfspiel war zu Ende, und Herr Bernardo hatte sein bewundertes Töchterlein zu Pferd durch die gaffende Menge nach Hause begleitet. Ihr reiches Festkleid lag schon wieder im Schrein, und Lucrezia war in die einfache Haustracht geschlüpft, die ihr nicht minder lieblich stand. Der Tag war nicht erschöpfend gewesen, denn die Sonne hatte sich wie aus Mitleid mit den eisenbeschwerten Reitern während des Turniers verborgen gehalten, dennoch brannten Lucrezias Wangen, und ihre Augen strahlten einen Glanz aus, vor dem sie im Spiegel selber erschrak. Eine Stimme lag ihr in den Ohren, die sie heute zum ersten Male gehört hatte, aber nie wieder vergessen zu können glaubte, deren Klang sie noch in der Einsamkeit wie mit körperlicher Gegenwart umschwebte.
»Möchte es nicht das letzte Mal sein, daß meine Augen Euch erblicken!« murmelte sie vor sich hin, und suchte den fremdartigen Ton der Stimme nachzuahmen, die diese Worte gesprochen hatte. Sie mußte sich dabei ein bräunliches, wohlgeformtes Gesicht vorstellen, das unter dem hohen Helm mit Rehgeweih zuversichtlich zu ihr aufblickte. Sie hörte wieder das Stampfen und Wiehern der Pferde, sah das funkelnde Waffengewühl und den Staub der Arena und folgte unverwandt jenem Helme mit Rehgeweih, der blitzartig da und dort auftauchte, alle anderen Helmzeichen weit überragend. Es waren schlankere, schönere Gestalten auf dem Kampfplatz als dieser Fremdling und Halbbarbar, dessen herkulischer Kraft auch von den eigenen Landsleuten keiner ganz gewachsen war, aber die Menge schien den blonden Deutschen vor allen anderen zu bevorzugen, denn sie grüßte sein Erscheinen immer mit hellem Jubel. Lucrezia wußte selber nicht, warum ihre Augen suchend umherliefen, sobald das Rehgeweih verschwand, und wie es kam, daß sie keinem Gang mit rechter Aufmerksamkeit folgen konnte, an dem der Träger dieses Zeichens nicht beteiligt war. Wenn er als Sieger vor ihr erschien und seine Augen fest auf die ihrigen heftend leise sagte: »Nicht zum letzten Male, Madonna!« so wünschte sie ihn beklemmt und unruhig weit hinweg, sobald er sich aber vom Kampfplatz entfernte, hatte das ganze Schauspiel seinen Reiz verloren. Für die Artigkeiten ihrer Landsleute, die wie immer mit übertriebenen Huldigungen nicht kargten, hatte sie heute nur eine Regung der Ungeduld, weil ihr dadurch der Magnet ihrer Augen entzogen ward.
Als nun endlich der letzte Gang, das große und nicht gefahrlose Lanzenrennen begann und sie auch den Rechberger wieder in die Schranken reiten sah, siegesgewiß den Hals seines starken Tieres klopfend, da wartete sie mit solcher Unruhe auf die Entscheidung, als wäre sie selbst als letzter und höchster Kampfpreis gesetzt. Sie hatte keinen Sinn für all den Aufwand von Waffenkunst, der vor ihren Augen entfaltet wurde, sie nahm keinen Teil an der brennenden Frage, ob die Barbaren ihren Landsleuten an Stärke überlegen seien, und ob die Florentiner wiederum jene an Gewandtheit überträfen, es beschäftigte sie nicht einmal, daß der fremde Graf mit der dunklen Kleidung und dem ernsten Gesicht sich diesmal selbst mit einem der Florentiner Herren maß; sie verfolgte immer das Rehgeweih und den Schild mit den züngelnden Rechbergischen Löwen. Sie meinte noch in der Erinnerung die Gewalt der Stöße, das Splittern der Schäfte, das grausame Aufeinanderprallen der Pferde zu vernehmen und das ängstliche Klopfen ihres eigenen Herzens, bis der Herold als Sieger den blonden Deutschen mit dem unaussprechlichen Namen verkündete und die Bühne von dem Jauchzen, Stampfen und Tücherschwenken der Menge wankte. Ihre Blicke hatten sich umflort und ihre Hände gezittert, als sie ein Kränzlein lebendiger Rosen mit goldenen Blättern an der Lanzenspitze des Junkers befestigte, und es war ihr, als habe sie mit diesem Kränzlein das eigene Ich hinweggegeben. Er aber lächelte siegesfroh, blickte ihr mit den guten blauen Augen fest ins Gesicht und sagte mit seinem fremden Akzent: »Madonna, ich hoffe, Euch wiederzusehen.«
Ein Florentiner hätte sich schwungvoller und zierlicher ausgedrückt, aber die stete Wiederholung der schlichten Worte, als ob der Sprecher nichts zu denken noch zu sagen vermöge als nur das eine, den Wunsch, sie wiederzusehen, hatte sie erschüttert und erschreckte sie zugleich mit der Ahnung, daß diese unwiderstehlich starken Arme nun auch sie ergreifen und nicht wieder freigeben würden. Doch während sie sich gegen diesen Zwang zu wehren suchte, freute sie sich selbst im stillen, daß heute abend der unaussprechliche Name des Fremdlings in aller Munde war, als ob sie selber an seinem Triumph einen Teil hätte.
Gleichzeitig ereignete sich der seltsame Fall, daß des Vaters Gedanken nicht minder lebhaft mit dem anziehenden Fremdling beschäftigt waren als die der Tochter; freilich aus sehr verschiedenem Grund. Seit er die Nachricht von jenen vergrabenen Bücherschätzen auf Schloß Stauffeneck erhalten hatte, war in Bernardos Seele die fast abenteuerlich kühne Hoffnung aufgekeimt, daß der verschwundene Kodex vielleicht mit in jener Truhe liege. Es war zuerst nur eine Eingebung des roten Lutz gewesen, die der Gebieter selbst belächelte; aber in langer Nacht hatte er die Ortsnamen, die fest in seinem Gedächtnis hafteten, mit den Angaben über den letzten Verbleib des Manuskriptes verglichen, und zu seiner eigenen Überraschung stimmten sie wunderbar. In seinen schlaflosen Grübeleien hatte er noch dem Zweifel Raum gegönnt, aber am Morgen, als die freudigen Lichtfluten durch das Fenster strömten, öffnete er sein Herz der frohen Überzeugung, daß es der Schatten des großen Römers selber sei, der aus dem Munde eines barbarischen Kriegsknechts um Erlösung flehe.
Herr Bernardo war vor allen Dingen Humanist, und die Leidenschaft für das klassische Altertum erstickte in ihm jede andere menschliche Empfindung. Darum konnte auch Lucrezia kein Herz zu ihrem Vater fassen, obwohl sie me ein ungütiges Wort von ihm zu hören bekam, aber er schien ihr glatt und kühl wie ein Aal, und wenn er einmal zärtlich wurde, so hatte sie den Eindruck, als sei es ihm nur um die wohltönenden Reden zu tun, die leicht und elegant von seinen Lippen strömten.
In seinem Studierzimmer saßen an den Winterabenden die Mitglieder der Platonischen Akademie unter einer Marmorbüste Ciceros beisammen, der Herr Bernardos stärkster Heiliger war und dem er ein ewiges Lämpchen unterhielt, wie sein Freund Marsilio Ficino dem Plato. Jahraus jahrein arbeiteten die besten Meister der Goldschmiedekunst an seinem berühmten, den antiken Mustern nachgebildeten Tafelgeschirr; er selbst trug im Hause statt des Florentiner Lucco eine römische Toga und bewegte sich mit dem Anstand, der diesem Gewande entsprach. Er redete niemals mit Heftigkeit, noch ließ er je eine Erregung des Gemütes blicken, so daß er zu jeder Stunde an jene römischen Senatoren gemahnte, die in ihren kurulischen Stühlen sitzend das Herannahen des Galliers erwarteten. Sein Sprechen war so gewählt, daß er nie einen Satz unvollendet ließ, und daß jede seiner abgerundeten Perioden für eine vollkommene Stilübung gelten konnte. Im Latein, das dazumal die höhere Umgangssprache war, legte er sich lieber den Zwang auf, seinen Gesprächsstoff zu beschränken, als ein Wort zu gebrauchen, welches nicht durch die Autorität Ciceros gedeckt war. Und diesem Manne, der so hoch und sicher im Leben stand, dessen Söhne die ersten Ehrenposten des Staates bekleideten, fehlte nur eines zur Zufriedenheit, dieses eine aber fehlte ihm so sehr, daß es ihm fast die anderen Güter entwertete, nämlich jener uralte, ciceronianische Kodex, dessen Trugbild ihm soeben aufs neue zwischen den Händen zerronnen war.
Dieser Kodex hatte im Haus der Rucellai schon eine schicksalsschwere Rolle gespielt. Zuerst war es Donato Rucellai, Bernardos älterer Bruder, gewesen, der vor mehr als dreißig Jahren bei einem Besuch auf der Insel Reichenau den kostbaren Fund getan. Der damalige Abt befand sich häufig in Geldverlegenheiten und wäre gerne bereit gewesen, das Buch zu verkaufen, aber er tat, als er das Entzücken des Entdeckers sah, eine so ungeheure Forderung, daß der Italiener mit leeren Händen abziehen mußte, denn eine Abschrift zu nehmen wurde ihm nicht gestattet.
Doch sein Verzicht ließ Herrn Donato keine Ruhe. Er verkaufte ein Landgut, legte die Summe bei einem deutschen Bankhaus nieder und begab sich wieder auf die Fahrt. Unterdessen hatte aber das Manuskript den Besitzer gewechselt, da es pfandweise in ein württembergisches Kloster übergegangen war. Landfremd, der Sprache nur zur Not kundig, und im ärmlichsten Aufzug, um keinem Wegelagerer zur Beute zu fallen, verfolgte der weichliche Humanist unter schweren Mühen und Entbehrungen die Spuren eines Schatzes, die ihn bis tief in den Schwarzwald führten.
Dort stand unter endlosen finstern Tannenwäldern, die dem lichtgewohnten Sohne des Südens wie die Pfade der Unterwelt erschienen, das ehrwürdige Kloster Hirsau – in italienischem Munde Irsava gesprochen. In dieser Abtei war Donato zum letzten Male gesehen worden, denn ein anderer italienischer Manuskriptensammler hatte ihn dort getroffen, als der Unermüdliche eben im Begriffe stand, nach einem Klösterlein des heiligen Blasius im Osten des Landes, nicht gar weit von der alten Staufenfeste, aufzubrechen, wohin ein Hirsauer Bruder den kostbaren Kodex verschleppt haben sollte.
Dies war die letzte Kunde, die von Donato Rucellai nach Florenz drang, und der edle Gelehrte war nie in seine Heimat zurückgekehrt. Nachfragen wurden angestellt, aber sie brachten nur zutage, daß jenes Klösterlein, welches Donatos letztes Reiseziel gewesen, durch eine Feuersbrunst vom Boden verschwunden sei. Es war damals viel Krieg und Fehde in schwäbischen Landen, wobei man es mit Menschenleben nicht sehr genau nahm, und von dem Tiefbetrauerten wurde niemals wieder eine Spur gefunden.
Jahrelang war nun auch der Kodex verschollen, und die Familie der Rucellai hatte vor Ciceros irrem Geist Ruhe. Da kam vor nunmehr sieben Jahren ein reisender Kaufmann nach Florenz und berichtete, im suevischen Lande habe man eine uralte Handschrift aus dem neunten oder zehnten Jahrhundert entdeckt, welche allem Anschein nach der von den Rucellai gesuchte Cicero sei. Ein Kleriker sei sein jetziger Besitzer; derselbe verlange einen so hohen Preis für das einzig vorhandene Manuskript, daß er es im Lande nicht losschlagen könne und daß er deshalb in Italien einen Käufer suche.
Wie der Keim einer Seuche, der jahrelang verschlossen gelegen, plötzlich wieder an die Luft treten und aufs neue eine Ansteckung bewirken kann, so ging es hier. Das Gift der Bibliomanie kroch in Herrn Bernardos Adern und entzündete jetzt in ihm jenes fieberhafte Verlangen nach Ciceros liber jocularis, dem sein unglücklicher Bruder zum Opfer gefallen war. Sein Anverwandter, Marcantonio Rucellai, der damals noch ein unberühmtes Dasein führte, erbot sich, das Buch durch einen tüchtigen Agenten, den er für den Ankauf und das Kopieren alter Manuskripte in den alemannischen Landen geworben hatte, zur Stelle zu schaffen. Doch nach Jahresfrist kehrte der Agent mit dürftiger Ausbeute nach Florenz zurück, denn die Zeit der großen Bücherfunde war vorüber, und die Nachricht jenes Reisenden hatte sich, wie Marcantonio seinem Blutsfreund berichten mußte, einfach als Fopperei erwiesen.
Aber der ciceronianische Kodex umspann den edlen Bernardo bereits mit einem dämonischen Zauber, und auch die ungesühnten Manen seines Bruders, dessen Gebeine vielleicht unbestattet auf fremder Erde lagen, drängten sich wieder klagend vor seinen Geist.
Auf Reuchlin stützten sich nunmehr seine Hoffnungen, aber ach, seit Donatos Verschwinden waren dreißig Jahre verflossen, und der weise Kapnion gehörte einer anderen Generation an als die deutschen Gelehrten, die einst dem edlen Florentiner auf seiner Reise mit Rat und Tat beigestanden hatten. Wie sollte man nach so langer Zeit noch von einem verschollenen fremden Wanderer und von einem längst niedergebrannten Klösterlein, dessen Lage ungewiß und dessen Name kein seltener war, Nachricht erlangen? Bernardo begriff es wohl, aber dennoch konnte seine Phantasie von dem liebgewordenen Gegenstand nicht mehr lassen, und erregt durch die wieder aufgerührten Erinnerungen knüpfte er an die Prahlereien des alemannischen Knechtes alsbald den neuen Hoffnungsfaden an.
Die folgenschwere Mitteilung war ihm gestern erst nach Weggang seines Besuches gemacht worden, und so lag es ihm sehr am Herzen, den neuen Freund so rasch wie möglich ins Vertrauen zu ziehen und für die Förderung seiner Absichten zu gewinnen. Doch Reuchlin war während des Kampfspiels durch seine Dolmetscherpflichten so sehr in Anspruch genommen, daß er für die sehnsüchtigen Blicke Bernardos kein Verständnis hatte, und erst als die Herrschaften sich zum Aufbruch rüsteten, war es dem alten Herrn noch rasch gelungen, sich mit seinem Anliegen an den Geheimschreiber heranzudrängen.
Zu Hause trat er gleich an sein Fenster und starrte mit den brünstigen Augen eines Liebhabers nach den geschlossenen Läden gegenüber. Die niedergehende Sonne setzte den ganzen Himmel in Flammen, und Bernardo Rucellai erblickte eine selige Vision, schön wie der Ruhm und die Unsterblichkeit; die farbendurchglühten Abendwolken zeigten ihm in purpurnen, dunkelvioletten und goldenen Lettern die Schrift: M. T. Ciceronis liber jocularis nunc primum repertus et in lucem editus.
Aus seiner Verzückung schreckte ihn Hufschlag auf dem Pflaster, und das Herz begann ihm zu klopfen wie einem Mägdelein beim Herannahen des Geliebten. Es war aber nicht Junker Veit von Rechberg, der sein Pferd um die Ecke lenkte, sondern der erlauchte Lorenzo selbst, und in der muntersten Laune, wie es schien, denn er winkte schon von weitem herauf mit einem feinen Lächeln, das ein schalkhaftes Geheimnis barg. Die ganze Dienerschaft steckte die Köpfe zusammen, als gleich darauf der alte Herr mit der Miene würdig verhaltener Neugier seinen erhabenen Besucher, der nicht aufhörte zu lächeln, die Treppe herauf nach seinem Studierzimmer führte. Auch Lucrezia sah den Herrscher eintreten, der ihr Pate war, denn sie stand gleichfalls am Fenster und blickte in den brennenden Abendhimmel, aber für sie hatte das magische Farbenspiel eine andere Bedeutung als für ihren Vater: in den Umrissen der segelnden Goldwölkchen meinte sie ein blondes germanisches Haupt zu erkennen. Ahnung sagte ihr, daß etwas Außergewöhnliches im Anzug war, und etwas, das sie selbst betraf. Sie wollte sich zur Ruhe zwingen und zur gewohnten Beschäftigung, aber keine Arbeit glückte, sie war unfähig selbst zu der geringsten Verrichtung und mußte sich, von Zimmer zu Zimmer irrend, dem qualvollen Zustand dieser rastlosen Muße ergeben.
Endlich brach Lorenzo auf, und der Vater geleitete ihn bis vor die Schwelle des Hauses. In sein Arbeitszimmer zurückgekehrt, schloß sich Bernardo ein und schritt lange gegen seine Gewohnheit aufgeregt hin und her. Nach geraumer Zeit kam er endlich heraus, ging in den Büchersaal, und Lucrezia sah von der halboffenen Türe aus, wie er in der Dämmerung ein in karmesinrotes Leder gebundenes Buch vom Schranke nahm. Er schlug auf gut Glück auf und trat dann an das Fenster, um bei dem schwindenden Tageslicht die Stelle zu entziffern, die sein Finger bezeichnete. Jetzt wußte Lucrezia, daß der Vater eine schwere Entscheidung seinem Virgil anheimgestellt hatte.
Bei Tisch jedoch zeigte Bernardo sein gewöhnliches undurchdringliches Gesicht und die olympische Ruhe, die ihm stets ein so großes Übergewicht über die Umgebung verlieh. Er scherzte mit Lucius, der die Bedienung der Tafel überwachte, und sprach so schön und gewählt wie immer, während seine Tochter keinen Bissen genoß. Endlich nach einer qualvoll langen Stunde wurde unter den üblichen Förmlichkeiten die Tafel aufgehoben, und nachdem der Vater noch langsam und wohlbedacht die zu der Gesundheitspflege nötigen tausend Schritte abgeschritten hatte, ließ er die Tochter in sein Studierzimmer rufen, das die schwebende Ampel jetzt freundlich erleuchtete, während die Fenster und Innenläden gegen Nachtluft und Zanzaren verschlossen waren.
Dort empfing sie die Mitteilung, daß der fremde Graf ihr die Ehre angetan habe, durch Seine Magnifizenz um ihre Hand für jenen jungen Ritter zu werben, der bei den Kampfspielen so große Ehren gewonnen habe.
Lucrezia saß auf einem kleinen Schemel zu Füßen des Vaters und rang nach Atem, während er ruhig fortfuhr, ihr die Vorteile dieser Heirat und die ehrenvolle Stellung, der sie am Hofe der Gräfin Barbara entgegenging, zu erklären.
»Ich will dir nicht verhehlen, daß mich die Werbung erschüttert hat«, sprach er, langsam die Worte wägend, »denn ich hatte anderes mit dir im Sinne. Aber es gibt höhere Pflichten als die des Blutes. Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist dieser junge Barbar der jetzige Besitzer der Handschrift, nach der wir seit dreißig Jahren suchen. Ich will nicht davon reden, was dieser Fund für mich bedeutet, noch daß dein Oheim sein Leben dafür gelassen hat. Aber denke an die Wissenschaft und die ganze Gesittung unserer Tage. Ein Cicero! Sein liber jocularis! Denke, was es heißen will, diesen Genius, den wir in der Ruhe, im Zorn, in der Begeisterung bewundert haben, jetzt auch im feinen attischen Scherz, in der munteren Weinlaune kennenzulernen! Nicht mehr als feurigen Redner oder als Philosophen, nein, als geselligen Tischnachbarn, mit Cajus und Titius über Alltagsgegenstände plaudernd, doch voll köstlichen Salzes, voll feiner Worte und Wörtchen!« Herr Bernardo schloß die Augen und machte ein Gesicht, als ob er Kaviar auf der Zunge zergehen lasse.
»Ich brauche nichts weiter zu sagen, du bist unterrichtet genug, um zu wissen, was auf dem Spiele steht. Der Schatz ist reif, wenn wir ihn nicht heben, so versinkt er vielleicht auf ewig in den Schoß der Erde. Ein Cicero!«
Längst war sein etwas gekünsteltes Sprechen in den Ton wahrer Empfindung übergegangen. Jetzt riß ihm der Faden entzwei, er schlug die Augen zum Himmel und wiederholte mit inniger Andacht: »Liber jocularis! Liber jocularis!« indes zwei Tränen langsam über das ehrwürdige Gesicht niederrannen.
Lucrezia schwieg noch immer. Die Entscheidung war so jählings über sie gekommen, daß sie völlig überwältigt war. Erst nach einer langen Pause sagte sie stockend: »Habt Ihr Eure Zusage gegeben?«
»Er wird sie sich morgen holen. Sie ist an eine Bedingung geknüpft, die du errätst. Er kläre das dunkle Ende deines Oheims auf und bringe mir den Kodex. Am Tage, wo Ciceros liber jocularis unversehrt vor meinen Augen liegt, wird er dein Gatte, es sei ihm geschworen.«
Jetzt erst bemerkte er, daß seine Tochter sich in die Fensternische geflüchtet hatte und heftig schluchzend ihren Kopf an den geschlossenen Laden drückte.
Er trat zu ihr, streichelte ihren schwarzen Scheitel und suchte sie zu trösten, indem er ihr wiederholt erzählte, welch warme Fürsprache der erlauchte Lorenzo für den Junker eingelegt habe, und daß der deutsche Graf ihr ein zweiter Vater sein wolle. Auch legte er kein geringes Gewicht auf die Herkunft des Jünglings, der, wie er der Tochter erzählte, eines Stammes sei mit jenem gewaltigen Schwabengeschlecht, das Italien seine großen Kaiser gegeben habe.
»Soll ich dir noch mehr vertrauen?« fuhr er flüsternd fort. »Du weißt, ich verachte den Aberglauben, aber es gibt ein Orakel, das mich nie getäuscht, das mich immer recht beraten hat. Und siehe, wunderbar! Derselbe Götterspruch, der in Latium an den König Latinus erging, hat heute auch mir geboten, den Fremdling zum Eidam zu nehmen.«
So endigte das Gespräch zwischen Bernardo und seiner Tochter. Diese stand noch lange am offenen Fenster ihres Schlafgemachs und blickte in die duftatmende Frühlingsnacht mit der unermeßlichen Sternenfülle, unter der die ersten Leuchtkäferchen schwirrten. Sie dachte ängstlich an jenes kalte, finstere Barbarenland, wo es weder eine rechte Sonne gab, noch rechte Sterne, geschweige denn die goldenen Leuchtkäferchen, die flatternden irdischen Sterne. Träne um Träne rann, ohne daß sie es beachtete, über ihre Samtwangen. Der junge Fremdling schien ihr jetzt bei weitem nicht mehr so hübsch wie zuvor, sie fand sogar, daß er mit seinem starkgliedrigen, schweren Wuchs und den barbarischen Stößen, denen niemand standhielt, neben den eleganten Florentinern einem Wilden geglichen habe. Auch deuchte es ihr grausam und unbarmherzig, daß der eigene Vater ihre blühende Jugend gegen ein altes Pergament verhandelte, und doch war der Entschluß, sich dem harten Gebot kindlich zu unterwerfen, nicht ohne stille innere Befriedigung. Sie trocknete ergeben ihre Tränen ab und suchte den Schlummer, um nicht am anderen Tag ein übernächtiges Gesicht zu zeigen, denn wieviel sie auch an dem barbarischen Werber mäkeln mochte, er sollte seinerseits an ihrer Erscheinung keinen Tadel finden.
Junker Veit gehörte zu den glücklichen Naturen, denen es der Herr im Schlafe gibt. Mit seinem munteren Sinn, seiner anerkannten Tapferkeit, seiner männlichen Gestalt war er überall eines günstigen Eindrucks gewiß. Nie hatte er sich noch über den Ausgang eines Unternehmens Sorge gemacht, und so fand er es nicht mehr als billig, daß ihm auch jetzt die reife Frucht nur so in den Schoß fiel.
Als Reuchlin ihm die Vermutungen und Wünsche klargemacht, die sich an seine Person knüpften, hatte er es frischweg gewagt, den Grafen, der selbst in einer italienischen Heirat sein Glück gefunden, um Vermittlung anzugehen, und der Graf hatte mit väterlicher Güte durch den erlauchten Lorenzo den überraschenden Antrag gestellt: die junge Lucrezia um den alten Tullius.
Veit zeigte vor dem Grafen so große Zuversicht, daß darüber die Stimme des Zweifels in seinem eigenen Inneren verstummte. Im stillen aber pflog er mit sich selber Rat und zwang sein Gedächtnis zu ungeheurer Anstrengung, um jeden Punkt hervorzusuchen, der zu Bernardos Begehren stimmte. Nur das unaufgeklärte Ende des älteren Rucellai schuf ihm Bedenken, des Manuskriptes glaubte er sicher zu sein. Doch wenn er erst an Ort und Stelle war, wollte er schon den unsichtbaren Faden finden, der sich von dem einen zum anderen spann. Denn daß es im Grunde doch vermessen war, dem Zufall so unerhörte Güte zuzutrauen, das zu denken fiel ihm gar nicht ein.
Über Sankt Blasien konnte er genaue Auskunft geben, denn es war einst ein Schirmkloster seines Vaters gewesen, und ein Zweig der Familie Rechberg hatte dort ehedem die Grablege gehabt. Nicht gar weit von Stauffeneck, dem Witwensitz seiner Mutter, war die Stelle, wo einst das Kloster stand; jetzt waren längst die Trümmer abgetragen, und der Pflug ging über den Ort. Zur Zeit des Städtekrieges nämlich, während sein Vater mit dem Grafen Ulrich von Württemberg vor Eßlingen zog, hatten die raublustigen Gmünder, die es mit den Städtern hielten, auf rechbergischem Grund und Boden viel Schabernack verübt und auch jenes wehrlose Klösterlein überfallen und niedergebrannt. Der Prior von Sankt Blasien, ein alter gebrechlicher Mann, hatte sich nach dem nahen Stauffeneck geflüchtet, wo er aber infolge des Schrecks und der erhaltenen Verletzungen starb. Die Truhe, welche Peter gesehen hatte, mochte also wohl die von dem Prior gerettete Klosterbibliothek enthalten, denn der Junker entsann sich gut, daß er einst als kleiner Junge von einer Magd gehört hatte, im Burgkeller sei der Schatz von Sankt Blasien vergraben, den ein schwarzer Hund mit feurigen Augen hüte.
Noch eine andere Erinnerung aber, weit unheimlicher und schauerlicher als diese, tauchte ihm zugleich aus seiner Kinderzeit auf. Im Örtchen Salach am Fuße von Stauffeneck war außerhalb der Kirchhofmauer ein kleiner Hügel, wohl durch Anhäufung von Scherben und allerlei Unrat entstanden, aber seit langer Zeit mit üppigstem Grün bekleidet, und unter dieser Erhöhung, so flüsterte man im Volke, sei der »schwarze Mann« begraben. Dorfkinder mieden den Ort, obwohl hier immer die ersten Primeln blühten und zur Veilchenzeit ein wunderbarer Duft von der Stelle ausging. Auch Veit hatte es in seinen Knabenjahren, wenn er nach Stauffeneck kam, als keine geringe Leistung betrachtet, in der Dunkelheit allein an dieser Kirchhofecke vorüberzugehen, und er tat es nur mit zugedrückten Augen und beschleunigtem Schritt.
Wer der schwarze Mann war, wußte er nicht, denn nach Kinderart war es ihm nie eingefallen, sich um Dinge zu kümmern, die so weit vor seiner Zeit lagen, nur ging im Dorf die halbverschollene Sage, derselbe sei ein schrecklicher Zauberer und Schatzgräber gewesen. Auch spielten zuweilen die älteren Leute auf irgendeinen schauerlichen Vorfall an, der mit dem »Schwarzen« zusammenhing.
Diesen Nekromanten hatte nun die Phantasie der Schloßkinder mit dem Schatz im Kellergewölbe in Verbindung gebracht, und sie pflegten sich zu erzählen, daß nächtlicherweile der schwarze Mann aus seinem Hügel steige und nach dem Burgverlies schleiche, um dort den Schatz zu heben, der ihm auch im Grab keine Ruhe lasse, daß er aber jedesmal von dem Hund mit den feurigen Augen zurückgetrieben werde. Oder war es doch nicht die eigene Einbildungskraft gewesen, welche jene beiden Gegenstände so eng in seiner Vorstellung verwob? Hatte er vielleicht einmal erzählen hören, dieser Schatzgräber habe nach dem Klostergut von Sankt Blasien gestrebt und sei darüber ums Leben gekommen? Hier wurden seine Erinnerungen so dunkel und ungewiß, daß dem angestrengten Gedächtnis mit aller Mühe nichts weiter abzuringen war.
Als der Junker sich festgesetztermaßen in Reuchlings Gesellschaft bei Herrn Bernardo einfand, traf er dort nebst den Söhnen und anderen Verwandten des Hauses auch den unvermeidlichen Marcantonio, der ihn mit dem kalten Blick stillen Hohnes maß. Junker Veit hatte zwar nach den deutschen Begriffen von dazumal eine für seinen Stand ausreichende Bildung genossen, konnte sich auch zur Not im Lateinischen ausdrücken, aber bei all der Gelehrsamkeit, welche die Florentiner Herren zu seinen Ehren verpufften, wurde ihm heiß und kalt, und er war herzlich froh, sich unter die Fittiche des Geheimschreibers ducken zu können, besonders gegen den berühmten Marcantonio, der sich ein Vergnügen daraus machte, ihn in gefährliche Satzbildungen zu verstricken und vor dem künftigen Schwäher zu Fall zu bringen. Doch Reuchlin war dem Italiener völlig gewachsen, und der Gelehrte fing mit dem funkelnden Schwert seines Geistes manchen Hieb auf, der dem Kriegsmann gegolten hatte, wofür ihm dieser erst viele Jahre später, da Reuchlin von den Dunkelmännern seiner Heimat umlagert war, den schuldigen Dank und Gegendienst entrichten konnte.
Allgemach kamen die Verhandlungen nach langem Hin- und Widerreden, das den Florentinern einen aufrichtigen Genuß gewährte, zu gedeihlichem Abschluß, und der Heiratskontrakt wurde Punkt für Punkt zu Papier gebracht. Jetzt erschien auch das Fräulein morgenfrisch und züchtig erglühend ohne eine Spur der nächtlichen Tränen, und Herr Bernardo trat in die Mitte der Anwesenden, die Tochter an der einen, den Junker an der anderen Hand, und hielt, nachdem die Ringe getauscht waren, eine schöne lateinische Verlobungsrede über das Wesen der Treue, die mit dem Tode des Regulus begann und mit der Zerstörung von Karthago endigte. Glückwünsche wurden nach antikem Muster getauscht, und auch Marcantonio stattete den seinigen ab, ohne durch eine Miene zu verraten, daß ihm der lästige Zwischenfall einen altgehegten Wunsch durchkreuzte.
Indes die breiten Wogen der Dialektik, jetzt völlig zum Selbstzweck entfesselt, das Gemach durchrauschten, stand Junker Veit neben seiner Verlobten in einer Fensternische, von dem mächtigen Teppichvorhang halb verdeckt, und suchte sich mit ihr durch Blicke und leisen Druck der Hand zu verständigen, bei welcher Sprache er der Hilfe des gelehrten Kapnion wohl entraten mochte. Wie Lucrezia diese Zeichensprache aufnahm, konnte man nicht sehen, denn sie hielt ihr Köpfchen von der Gesellschaft abgewandt, aber wenn die Miene des jungen Mannes ein Spiegel der ihrigen war, so konnte es kein unfreundliches Gesicht sein, was sie ihm zeigte.
Da trat Herr Bernardo dazwischen und legte mit anmutiger Hoheit seine Hand auf des Junkers Schulter.
»Es ist Zeit zu scheiden«, sagte er. »Fahre wohl, mein Sohn, die Götter schenken dir günstigen Vogelflug, und dich geleite der Gott der Wanderer an seinem sicheren Stabe.« »In die Unterwelt; Amen!« setzte Marcantonio leise hinzu. Beim nächsten Morgengrauen, während Graf Eberhard mit Rossen und Mannen der Ewigen Stadt entgegenzog, lenkte Junker Veit sein Pferd durch die Porta San Gallo der nordischen Heimat zu.
Längst waren die Leuchtkäfer verglommen und die Nachtigallen verstummt, der Hochsommer war eingezogen mit seiner weißglühenden Sonne und seinem endlosen Zikadengeschmetter, aber noch war keine Kunde von Junker Veit gekommen. Im Hause der Rucellai hatte man geglaubt, daß der rasche Werber in spätestens zwei Monaten zurück sein würde, und Lucrezia hatte im Vorgefühl des nahen Abschieds die Plätze ihrer Kindheit durchstreift und tränenden Auges allen Freundinnen Lebewohl gesagt. Sonst war alles sich gleich geblieben, nach wie vor brannte das Lämpchen bei Ciceros Büste, nach wie vor sprach Herr Bernardo im Stil der römischen Redner, und Lucius Rufus mühte sich treulich, es ihm nachzutun. Wie sonst verbrachte der berühmte Marcantonio seine Abende im Palaste Rucellai oder in der Loggia, die jetzt von übermächtigem Orangen- und Zitronenduft erfüllt war. Bernardo hatte sich eine Karte von Germanien zu verschaffen gewußt, an der sie zu dreien studierten, um die Lage des Landes Suevien festzustellen; da sie aber nicht wußten, ob sie dasselbe in Nord, Süd, Ost oder West zu suchen hatten, standen sie bald wieder von ihren geographischen Forschungen ab. Diesen Umstand benützte Marcantonio, um dem Kinde von den germanischen Landen, die auch der Vater nur aus der Beschreibung des Tacitus kannte, ein höchst abschreckendes Bild zu entwerfen, und von den Bewohnern sagte er, sie seien ein wildes, dem Trunke ergebenes Volk, wozu aber Bernardo die Bemerkung fügte, daß die Frauen dort in hohen Ehren gehalten würden.
Im übrigen führten sie zusammen ein einförmiges Leben, denn der alte Herr öffnete den Mund nur, um sich selber reden zu hören, und Marcantonio, so witzig mit der Feder, war ein dürftiger und trockener Gesellschafter.
Als sich nun die Frist, die dem Mädchen anfangs so erwünscht war, wider Erwarten mehr und mehr in die Länge zog, ertappte sie sich zuweilen auf dem Gedanken: »Er bleibt aber lange aus« – was auch Marcantonio dem Vater gegenüber auf seine Weise aussprach mit den Worten: »Er zeigt wenig Eile, dein junger Barbar.«
Bernardo war nicht aus seiner Gemessenheit zu bringen. »Ich habe ihm längere Frist zugestanden, als er zum knappen Hin- und Herreiten braucht. Auch kann ihm ja ein Unfall zugestoßen sein.«
Bei diesen Worten erbleichte Lucrezia und empfand etwas wie einen Stich am Herzen. Sie beugte sich über die Loggia hinaus und wandte die Augen ängstlich nach der Richtung, in der sie das Land Germanien vermutete. Von nun an blickte sie oft nach Norden und eilte zum Fenster, sooft die Piazzetta von Hufschlag dröhnte. Selbst wenn einmal ein Windzug von den Alpen her die glühende Hitze kühlte, so dachte sie stets daran, daß diese Lüftchen denselben Weg gewandert seien, auf welchem auch der blonde Reitersmann kommen mußte.
Doch erfuhr niemand, was in ihr vorging, als der rote Lutz, der sie von Kindesbeinen kannte und von dem sie sich jetzt insgeheim die Anfangsgründe der deutschen Sprache beibringen ließ. Er war zwar wegen seiner Schwülstigkeit nicht der berufenste Lehrer, hatte auch in zwanzigjähriger Abwesenheit vom Vaterland das Deutsche zum Teil vergessen, aber mit Beharrlichkeit brachte sie es so weit, die Namen der Dinge aus einem Wust von Torheit herauszuschälen und sich ins Gedächtnis zu prägen. Es war nur ein schwacher Anfang, aber er sollte dem Verlobten ihren guten Willen zeigen, und sie freute sich königlich darauf, ihn in den Lauten seiner Muttersprache zu begrüßen.
Unterdessen war in der ganzen Stadt die seltsame Verlobung Lucrezias bekannt geworden, und auch am mediceischen Hofe wurde viel darüber gescherzt, daß die junge Florentinerin den alten Römer aus der Gefangenschaft loskaufen müsse. Doch, obwohl man allgemein bedauerte, ein so schönes Mädchen aus Florenz zu verlieren, war niemand, der Herrn Bernardo getadelt hätte, denn so hoch stand das Ansehen des römischen Autors, daß man wohl begriff, wie der Vater sein eigen Fleisch und Blut nicht zu kostbar hielt für diesen Tausch.
Nur Marcantonio sah den alten Freund mit immer vorwurfsvolleren Augen an. Als sich gar der Hochsommer zu Ende neigte, suchte er allmählich durch leises Wühlen den Glauben Bernardos an die Rückkehr des barbarischen Bräutigams zu erschüttern, indem er ihm vorrechnete, daß eine Frist wie die verstrichene genügt hätte, das goldene Vlies herbeizuschaffen, geschweige einen alten Kodex aus dem eigenen Keller.
Doch Bernardo runzelte nur die olympischen Brauen ein wenig.
»Der Verfasser der ›Facetiae‹ darf sich etwas bei mir erlauben. Aber treibe keinen Mißbrauch mit dem Recht an meine Liebe, das ein unvergleichliches literarisches Verdienst dir erworben hat. Kann der Fremdling die Bedingung nicht erfüllen, so sendet er mir den Ring zurück, und alsdann magst du deine Werbung erneuern.«
Auch gemeinsame Freunde, die sich auf Marcantonios Bitten bei Bernardo bemühten, erhielten keine andere Antwort als: »Ein Rucellai hält, was er verspricht. Was hülfe uns das Studium der Alten, wenn wir uns nicht ihre Tugenden zu eigen machten!«
Der alte Herr war mittlerweile mit seinem Töchterlein auf ein kleines Landgut im Val d’Ema gezogen, das eigentlich Marcantonio gehörte, aber wegen seiner reizenden schattigen Lage und der Nähe der Stadt schon seit Jahren der Familie zum Sommersitz diente. Dort las er zum vierzehnten Male das berühmte Buch seines Verwandten und ergötzte sich an der geistigen Fülle, die aus den toten Lettern sprudelte und von der dem Verfasser im Umgang so wenig anzumerken war. Unter diesem Einfluß verwandelte sich ganz allmählich der Wunsch, seine Tochter durch die Hand eines solchen Mannes glücklich zu machen, in ihm zur Überzeugung, daß der deutsche Junker doch nicht zurückkehren werde, und endlich ließ er sich von Marcantonio das Versprechen entreißen, daß, wenn binnen eines Monats noch immer keine Nachricht von dem Fremdling gekommen sei, er der Heirat seines bewunderten Freundes mit Lucrezia kein Hindernis mehr in den Weg stellen werde.
Noch ein Monat! Dem Gelehrten schien es, als habe dieser Zeitraum die zehnfache Zahl der Tage, die sonst zu einem Monat gehörten. Nicht daß er gefürchtet hätte, der deutsche Junker werde unterdessen mit dem alten Manuskript zurückkehren und den Preis einfordern, er wußte ja und er allein, daß dies unmöglich war. Aber das Ziel seiner Wünsche rückte abermals in die Ferne, und doch war ihm die Hand der schönen Lucrezia schon versprochen am Tag, wo seine berühmten Facetien das Licht erblickt hatten, und wenn auch die schwarzen Augen des Mädchens kein jugendliches Feuer mehr in seinen Adern entzündeten, so fand er es doch süß, die Hand der schönsten Erbin einzig seinem Ruhme zu danken.
Damals, nach Erscheinen seines Buches, war der gemessene Bernardo wie außer sich zu ihm gestürzt, hatte sich an seine Brust geworfen, ihn den Stolz der Familie und seinen künftigen Eidam genannt.
Ach, diese Facetien! Wäre nur nicht mit dem Ruhm eine so widerliche Erinnerung verknüpft gewesen! Jahrelang hatte Marcantonio sie in den fernsten Winkel seines Gedächtnisses zurückgedrängt und sie am Ende fast vergessen. Seit dem Besuch der Deutschen in Florenz und dem erneuten Forschen nach dem ciceronianischen Kodex war sie plötzlich aus ihrem Winkel hervorgekrochen und blickte ihm jetzt ängstlich ins Gesicht, mit heimlicher Schamröte auf den Wangen.
Er hatte lange gehofft, das unsichtbare Schandmal, das an seinem literarischen Triumph hing, durch nachfolgende Triumphe zu verlöschen. Der Ruhm, dachte er, werde seinem Geiste Nahrung geben und ihn zu einer Reihe großer Schöpfungen befähigen. Diese Hoffnung blieb unerfüllt. Wie die Aloe nur einmal blüht, so hatte Marcantonio in den »Facetiae« seine literarische Kraft erschöpft, so wenigstens sagten seine Freunde.
Es war indes kein Wunder, wenn man diese Fülle glänzender Einfälle und ihre unnachahmliche klassische Form bedachte. Ein Reichtum an Geist, den bisher niemand bei dem ledernen Gelehrten gesucht hatte. Cicero selbst hätte sich dieses Buches nicht zu schämen gebraucht.
Es war eine schwere Wahl gewesen, vor die sich Marcantonio gestellt sah, als vor nunmehr sechs Jahren sein Agent aus Deutschland zurückkehrte und ihm mit den anderen Bücherschätzen auch jenen langgesuchten ciceronianischen Kodex überbrachte, nach welchem Bernardos Sinnen stand.
Sollte er sich mit dem Ruhm des Finders begnügen und noch dazu das Buch seinem Freunde ausliefern? Es war seine redliche Absicht gewesen, aber da begann er zu lesen und blieb gefangen. Er stieß auf so überraschende Sprachwendungen, zugleich einfach, treffend und wohllautend, daß er nicht umhin konnte, die eine und die andere seiner eben begonnen literarischen Arbeit einzuverleiben. Bald riß es ihn weiter, Ciceros Gedanken, Ciceros Worte drängten sich ihm in die Feder, und so entstand jene Perle der neulateinischen Literatur, welche die gelehrte Welt unter dem Titel »M. Antonii Oricellaris Facetiae« bewunderte. Sein Leben lang verzehrt von ohnmächtigem Ehrgeiz, war er endlich unter die Fittiche des Adlers gekrochen und hatte sich von ihm nach dem ersehnten Ziele, einem Stuhl in der platonischen Akademie, tragen lassen.
Bei der Erinnerung an den Ursprung seines Ruhmes warf Marcantonio einen scheuen Blick nach dem Kamin, wo dazumal Ciceros liber jocularis in Rauch und Flammen aufgegangen war. Es ängstigte ihn, als sei ein Brandmal davon zurückgeblieben.
Sonnenlose Schwüle hatte den ganzen Tag über der Landschaft gelastet, daß selbst das Laub der Bäume schlaffer hing und die ganze Natur unter dem Bann des Scirocco siechte. Kaum daß da und dort ein Vogel schüchtern die Stimme erhob und gleich wieder verstummte, wie erschreckt von dem unheimlich brütenden Schweigen.
Bernardo, der trotz seiner Jahre dem Glutstrom mannhaft standhielt, war den ganzen Tag tätig gewesen, um ein paar jungen Landleuten für das morgige Fest einen Schäferchor einzuüben, zu dem er selbst die Verse verfaßt hatte. Als jedoch der Abend dämmerte, ohne der Welt Erlösung zu bringen, da gab auch er sich überwunden und wankte mit schweißtriefender Stirne in sein schwüles Schlafgemach. Seine Tochter hatte sich schon lange zurückgezogen, die Diener schnarchten, im Hause war alles still, nur der Bräutigam machte mit Lucius einen letzten Gang durch die Räume, wo morgen die Hochzeitsgäste bewirtet werden sollten. Nachdem alles besorgt war, schlich Lucius leise vor sich hinmurmelnd in den dämmernden Garten hinunter, der sich in Terrassen gegen die Talsohle zu senkte. Er hatte auf das Beispiel seines Gebieters hin den kühnen Plan gefaßt, für das morgige Fest einen »Triumph der Liebe« zu dichten, den er selbst in der Maske des Götterboten vorzutragen gedachte. Schon seit mehreren Tagen mühte er sich im Schweiße seines Angesichts, aber die Muse setzte ihm einen so hartnäckigen Widerstand entgegen, daß er der Verzweiflung nahe war.
Jetzt verwünschte er den Scirocco, der ihm das Hirn zerrütte, haderte mit dem traubenschweren Rebenspalier, das ihm schwül über dem Kopfe hing, und scharrte mit den Füßen im Sand, als könnte er hier die fehlenden Reime ausgraben, wie eine Henne ihr Futter. Endlich flüchtete er sich auf einen freien Rasenplatz in der Nähe des Parktores, wo in anmutigem, von Wasserrosen überwuchertem Becken ein Springquell plätscherte. Eine dunkle Wolkenbank hatte sich am Rande des Horizonts gesammelt und ließ, langsam heranschiebend, die abendliche Dämmerung noch düsterer erscheinen. Lucius schwang sich kühn auf den Schoß einer steinernen Najade und ließ seine Stirn von dem fallenden Wasserstaub benetzen, indes er fingernd auf dem Rand des Wasserbeckens den Takt schlug. Dabei kam ihm der Hufschlag eines trabenden Pferdes vom Tal herauf wunderbar zur Hilfe, und er brachte nun wirklich eine geistige Geburt zustande, die einige Ähnlichkeit mit dem Anfang eines freien Hymnus besaß.
In seinem Feuer beachtete er nicht, daß der Hufschlag immer näher kam, bis er durch die Gitterstäbe eine Reitergestalt auf dem breiten Lorbeergang erblickte, der außerhalb des Gartentores die Besitzung Marcantonios mit der Landstraße verband.
Sah er ein rächendes Gespenst oder war es wirklich der Junker Veit von Rechberg, der sich jetzt vom Pferde schwang und an das Gartenor pochte?
In heiligem Schreck, als hätte er sich durch seine dichterischen Mühen an dem Bruch der Verlobung mitschuldig gemacht, rannte Lucius in das Haus zurück, laut nach Herrn Bernardo rufend. Dort taumelte er gegen Marcantonio, dem bei der Schreckenskunde einen Augenblick gleichfalls die Knie versagten. Aber schnell besonnen legte der Florentiner dem Rothaarigen die Hand auf den Mund und zog ihn aus dem Bereich der Schlafgemächer.
»Den Mund gehalten, Deutscher!« herrschte er ihn an. »Und kein Geräusch im Hause! Das Fräulein und Herr Bernardo dürfen heute nacht nicht mehr gestört werden. Du kommst mit mir und führst das Pferd ganz stille in den Stall. Und ich will nicht hoffen, daß ein Deutscher an seinem Herrn zum Verräter wird.«
Lucius war so verblüfft von diesem Ton, daß er gar nicht wußte, wie ihm geschah. Nein wahrlich, er haßte ja den Verrat mehr als den Schlund der Hölle und hatte auch nicht die geringste Lust, in dem Kampf, der jetzt notwendig entbrennen mußte, Partei zu nehmen. Er war dem Junker zugetan, aber nur um des Fräuleins willen, nicht weil er ein Deutscher war, denn Lucius fühlte sich ganz als Florentiner. An Marcantonio dagegen war er gewohnt, mit Ehrfurcht emporzublicken, und vor allen Dingen durfte er es mit dem Manne nicht verderben, der im Haus Rucellai Regen und Sonnenschein machte. Er gönnte das Fräulein dem einen und hätte sie doch dem andern nicht gern entrissen gesehen. Aber mochte Herrn Bernardos Weisheit morgen die verschlungenen Fäden entwirren, er hatte kein Amt, als zu schweigen und zu gehorchen. Gedemütigt folgte er Marcantonio, der an das Tor eilte, um den Ankömmling zu begrüßen. Lucius empfing schweigend die Zügel und führte das dampfende Pferd nach dem Stall.
»Ihr kommt spät, Herr Ritter«, begann der Florentiner, »aber Ihr seid nicht minder willkommen.«
»Doch nicht zu spät?« stammelte Veit erschrocken.
»Für heute wohl«, entgegnete Marcantonio ausweichend, »denn Herr Bernardo und seine Tochter sind schon zur Ruhe.«
»Denkt Ihr, daß ich Eile hatte, edler Herr?« rief der Junker. »Ihr dürft es glauben. In Mailand ließ ich meine Knechte zurück, weil sie nicht schnell genug vorwärts kamen, in Bologna überholte ich den vorausgesandten Boten, aber Ihr müßt wissen, daß die Erlangung des Kodex –«
»Ihr habt also den Kodex wirklich?« unterbrach der Florentiner mit heimlichem Spott.
»Hier«, sagte Veit lächelnd und legte die Hand auf seine Brust, wo sich ein Gegenstand wie eine Pergamentrolle abzeichnete.
Marcantonio empfand ein gewisses Unbehagen, obwohl er sich nichts anderes vorstellen konnte, als der Ritter habe durch irgendwelchen deutschen Gelehrten eine mehr oder minder geschickte Fälschung anfertigen lassen.
Doch ganz anders erschrak er, als ihm nun der Jüngling, gerührt durch seine lebhaften Glückwünsche, bekannte, daß er gar nicht die Urschrift bringe, die vor Jahren nach Italien verkauft worden sei, sondern nur eine sauber geschriebene Kopie.
Marcantonio wurde bleich wie der Tod, und um seine Bestürzung zu verbergen, ließ er sich von dem Ankömmling die ganze Jagd auf den Kodex ausführlich erzählen.
»Ihr müßt wissen«, begann der Junker seinen Bericht, »daß ich bei meiner unerwarteten Rückkehr auf Schloß Stauffeneck zu meinem Schrecken die Truhe leer fand, denn der Schatz war schon vor mehreren Jahren durch einen Zufall zutage getreten. Meine Mutter hatte ihm wenig Beachtung geschenkt und die Bücher dem Gemeindepfarrer überlassen, mit Ausnahme eines einzigen, das ein auf dem Schloß herbergender Mönch sich zum Geschenk erbat. Natürlich war es mein erstes, den Gemeindegeistlichen aufzusuchen, und von ihm erfuhr ich – Heil und Unheil in einem Atem – daß die weggeschenkte Handschrift wirklich der ciceronianische Kodex war.
Der Pfarrherr entsann sich dieses Umstandes genau, denn an den Titel des Buches knüpfte sich eine schauerliche Erinnerung, die er damals auf Schloß Stauffeneck zum besten gegeben und die er jetzt auch mir mit aller Breite wiederholte.
Vor ungefähr dreißig Jahren nämlich, da er eben erst als ganz junger Mann zu der Gemeinde versetzt worden, sei im Dorfe das Gerücht ausgekommen, ein fremder Zauberer und Schatzgräber habe sich in den Ort geschlichen und treibe in den nahen Ruinen des etliche Wochen vorher niedergebrannten Blasiusklösterleins sein Wesen. Der Schwarzwälder Führer, welcher den Unhold begleitete, habe selber die Anzeige gemacht, daß der fremde schwarze Mann, der ihm schon unterwegs unheimliche Dinge von einem Zauberbuch gesprochen, die Brandstätte durchwühlte und wie außer sich in unverständlicher Sprache wilde Beschwörungen murmle. Die Bauern seien mit Knütteln und Heugabeln an den Ort gerannt, der Pfarrer hinterher, um den übelangekommenen Fremdling, in welchem er nach den Aussagen des Führers einen wandernden Büchermaulwurf vermutete, mit seinem eigenen Leibe zu decken. Doch sei der Fremde, ein hagerer Mann mit schwarzem Bart und Haar, von den Stichen und Hieben der wütenden Bauern, die seine Gebärden und Sprache für Zauberformeln hielten, schon so unmenschlich zugerichtet gewesen, daß die Hilfe zu spät kam. Es sei ihm zwar gelungen, den Schwerverwundeten lebend den Händen seiner Peiniger zu entreißen, aber noch desselben Tages habe der Unbekannte in dem Asyl der Pfarrei den Geist aufgegeben, ohne mehr seinen Namen und Herkunft nennen zu können. Aber noch im Todeskampf habe der Unglückliche von einem Manuskript gesprochen, das er im Kloster holen gesollt, ja, das letzte vernehmbare Wort, das er zu sprechen vermocht, sei der Name jenes Buches gewesen, der sich ihm, dem armen ungelehrten Dorfpfarrer, auf ewig in die Seele geprägt habe.«
Der Junker hielt ein wenig inne, um Atem zu schöpfen, und betrachtete teilnehmend seinen Wirt, dessen verstörtes Aussehen er der Erschütterung über das schreckliche Ende seines Verwandten zuschrieb.
»Der Pfarrer wollte das Opfer christlich bestatten«, fuhr er fort, »doch die erregte, abergläubische Gemeinde ließ es nicht zu, und die Leiche mußte an der Kirchhofecke bei Vagabunden und Selbstmördern eingescharrt werden. Ich will hoffen, daß die Nähe seines Schatzes dem unglücklichen Märtyrer nie den Schlummer gestört hat, wie wir es uns einst in kindischer Einbildung vorstellten. Denn solltet Ihr nach dem allem zweifeln, daß der so grausam Erschlagene wirklich Euer edler Verwandter war, so habe ich aus den Händen des Pfarrers den einzigen Wertgegenstand des Toten, seinen Siegelring, erhalten, der die eckigen Querbalken Eures Wappens trägt und der, wie ich gewiß bin, alle Zweifel beseitigen wird.
Nun werdet Ihr fragen, wie es kommt, daß ein so schweres Verbrechen keinen Richter fand in schwäbischen Landen. Aber, Herr, es herrschte damals wegen des Städtekriegs, der besonders in den östlichen Gauen raste, ein trauriger, rechtloser Zustand, bei dem auch das Leben der Landeskinder keinen Heller galt; wer hätte da um einen erschlagenen, namenlosen Fremdling viel Aufhebens gemacht. Mein Vater kehrte aus der städtischen Fehde nur als Leiche zurück, die Vormünder kümmerten sich nicht um die Gerichtsbarkeit, und jetzt ist die Übeltat verjährt; wie sollte man nach so langer Zeit noch die Schuldigen ausfindig machen?
Aber ich brauche Euch nicht zu sagen, wie mir das Geschick des unglücklichen Mannes zu Herzen geht und wie es mich drängt, die schwere Missetat, die auf meinem Grund und Boden begangen worden ist, zu sühnen. Der Pfarrer ist unterdessen angewiesen, täglich eine Messe für die Seele des Ermordeten zu lesen, und wenn ich zurück sein werde, soll es meine erste Aufgabe sein, dem edlen Märtyrer, den ich alsdann meinen Oheim nennen darf, eine würdige Ruhestätte zu bereiten. Eine Kapelle soll sich an dem Ort erheben, wo die gräßliche Tat geschah, und ich will mit meinem jungen Weibe täglich an der Gruft des Ermordeten beten.«
Hier machte der Junker abermals eine Pause, denn von dem langen Ritt und dem vielen Sprechen klebte ihm die Zunge am Gaumen.
Marcantonio hatte den Bericht bald mit entsetzten, bald mit bedauernden Gesten begleitet, innerlich aber zollte er dem Los seines Anverwandten wenig Teilnahme, denn ihm selber stand das Wasser jetzt am Halse. Doch trotz seiner Angst und Wut vergaß er die Pflichten des Wirtes und die sprichwörtliche florentinische Artigkeit nicht.
Er ließ sich mit dem späten Gast unter einem bunten Sommerdach nieder und schickte den in der Ferne wartenden Lucius nach Erfrischungen aus, mit dem nachdrücklichen Gebot, die Schläfer nicht zu stören, denn er möge es dem alten Herrn wohl gönnen, daß er für heute wenigstens von dieser gräßlichen Geschichte nichts mehr erfahre.
Der Junker begann mit gedämpfter Stimme aufs neue: »Nun war ein Teil meiner Sendung erfüllt, aber der zweite, schwierigere lag noch vor mir: die Wiedererlangung des Kodex. Solltet Ihr es glauben, Herr, daß niemand, nicht einmal der Pfarrer, mir den Namen jenes Mönches angeben konnte, der damals auf Schloß Stauffeneck geherbergt hatte und wahrscheinlich durch die Erzählung des Pfarrers veranlaßt worden war, sich das Manuskript von meiner Mutter auszubitten. Auf Stauffeneck kannte man ihn nur unter dem Namen Bruder Einhand, denn der Mönch war früher kaiserlicher Dienstmann gewesen und hatte bei einem Treffen seine linke Hand eingebüßt. Wie ich dennoch seinen wahren Namen und jetzigen Aufenthalt erkundete, das, Herr Marcantonio, ist eine viel zu lange Geschichte, als daß ich Euch noch heute nacht damit ermüden dürfte. Es genüge, zu sagen, daß ich vor acht Tagen der Schwarzen Muttergottes von Einsiedeln meine Aufwartung machte, bei der ich gewiß sein durfte, meinen Mann zu finden. Ich täuschte mich nicht, aber der Einhändige hatte die Frechheit, den Empfang des Kodex zu leugnen, und erst da ich ihn hart in die Enge trieb, bekannte er, die Handschrift schon vor etlichen Jahren an einen italienischen Bücheragenten verkauft zu haben.
Zu meiner Schande muß ich bekennen, daß mich bei diesem abermaligen Zusammensturz meiner Hoffnungen die christliche Geduld völlig verließ, und es wäre fast zu einem Bruch des Klosterfriedens gekommen, denn ich schüttelte den Kuttenmann derb und ließ erst ab von ihm, als er mir den wehrlosen Stummel seiner Linken entgegenstreckte. Doch meine Fäuste hatten das Pfäfflein mürbe gemacht, es fragte jetzt kleinlaut, ob ich, da die Urschrift doch nicht mehr zu haben sei, mich mit einer sauberen, wortgetreuen Kopie zufrieden geben wolle, für die eine Entschädigung an das Kloster zu entrichten wäre. Ihr könnt Euch denken, wie begierig ich ja sagte, ich ließ mir das Manuskript einhändigen, das der Schelm vor Verkauf der Urschrift angefertigt hatte, also den welschen Agenten hintergehend, der den Kodex als einzig vorhandenes Exemplar erstand. Meine Zweifel an der Echtheit des Textes widerlegte der gelehrte Prior und schwur bei seinem wundertätigen Gnadenbild, daß er die Handschrift zurücknehmen und den Kaufschilling dreifach erstatten wolle, wenn die Florentiner gelehrten Herren den Inhalt nicht für echt erkennten. So ward der Kodex mein, ich warf mich zu Pferde, und hier bin ich in so kurzer Zeit, als je ein Reisender den Gotthardpaß überschritten hat. Meine große Eile gestattete mir nicht mehr, das Gutachten deutscher Gelehrter einzuholen, aber ich zähle auf die Einsicht und Billigkeit der florentinischen Akademie, vor allem auf meinen gnädigen, hocherleuchteten Gönner, den Herrn Lorenzo Medici.«
Marcantonio wischte sich den kalten Schweiß von der Stirne. Er erkannte mit furchtbarer Klarheit, daß sein Ruf, seine Ehre, sein Dasein, alles, alles zusammenbrach, wenn er nicht ebenso rasch und kühn wie verschlagen handelte. Er betrachtete den jungen Mann mit verstohlenen Blicken, die einem Todesurteil gleichkamen, und überlegte im Weiterschreiten, wie er sich am besten seines ahnungslosen Todfeindes entledige. Die Akademie! Lorenzo! Mehr brauchte er nicht zu denken, um jede Gewissensregung im Keim zu ersticken.
Schnell erwog sein findiger Geist die Möglichkeiten mit ihrem Für und Wider. Daß der Jüngling allein gekommen, war schon ein günstiger Umstand, Herrn Bernardos früher Schlummer bot eine andere sichere Handhabe zu Marcantonios Rettung.
Es galt vor allem, den Junkherrn aus der Nähe des Wohnhauses zu entfernen, und dann – Zeit gewonnen, alles gewonnen, dachte Marcantonio, indem er den ermüdeten Gast unter einem Rebendach nach dem Olivenwäldchen führte, das sich einen sanften Hügel hinanzog und in den Bezirk des Gutes mit eingeschlossen war. Sie hatten einen hohen Brückenbogen zu überschreiten, der über einen tief eingebetteten, jetzt fast vertrockneten Wildbach weg die beiden Hälften des Gutes verband, deren eine Seite mit dem Wohnhaus und dem Garten zu Terrassen geebnet war, während die andere als Olivenhain mit angrenzenden Ackerfeldern und Wiesengrund die ursprüngliche hügelige Gestalt beibehalten hatte. Dort stand auf einem Vorsprung in gleicher Höhe mit der Villa, aber durch den Wildbach auf die Entfernung eines Steinwurfes von derselben getrennt, ein ehemaliges Bauernhäuschen, das einmal bei Gelegenheit eines ländlichen Festes von Marcantonio mit einem hölzernen Anbau versehen worden war und jetzt zuweilen bei Überfüllung des Wohnhauses einem überzähligen Gast als Nachtherberge diente. Deshalb war in dem einzigen Zimmer des oberen Stockes immer ein Lager bereit, eine Strohmatte deckte den Boden, eine andere bildete den Fenstervorhang gegen die Sonnenglut. Die unteren Räume waren früher Ställe gewesen und wurden jetzt nebst dem hölzernen Schuppen als offene Heuböden benutzt, soviel sich in der anbrechenden Dunkelheit erkennen ließ.
In dieses Häuschen, dessen Außenseite ganz von wilden Rosen umwuchert war, führte Marcantonio seinen späten Gast unter vielen Entschuldigungen, daß er ihm für heute kein besseres Quartier anbieten könne.
Er entzündete ein zierliches Kettenlämpchen auf dem Tisch und öffnete die Türe, die nach der hölzernen Veranda führte, um frischere Luft einzulassen, aber draußen schien es ihm nicht minder schwül als innen. Er wollte dem Fremdling noch ein Mahl aufnötigen, aber dieser lehnte alles ab und bat nur um ein Glas Wasser für seinen immer brennenderen Durst.
Da ließ es sich Marcantonio nicht nehmen, selbst nach dem Trunk zu gehen. Veit untersuchte währenddessen nach seiner Gewohnheit den neuen Raum, er warf das Schwert zu Boden und trat auf die hölzerne Veranda hinaus, die unter seinem Tritt erbebte und einen Regen zerflatternder Rosenblätter auf ihn niedersandte. Unter seinen Füßen fiel der Abhang felsig und steil wohl zwanzig Schuh tief nach dem Wildbach hinunter, der Marcantonios Anwesen in zwei Teile zerriß. Drüben dunkelte das Wohnhaus in unklaren Umrissen, nur einen kleinen steinernen Balkon, dem seinigen fast gegenüber, konnte er noch mit Deutlichkeit erkennen. Ob wohl hinter dieser Türe die Geliebte schlief? Es freute ihn, diesen Gedanken sich auszumalen und wie sie morgen früh an der steinernen Balustrade lehnen werde. Er warf eine Kußhand hinüber, dann schob er die Strohmatte von dem einzigen Fenster zurück und öffnete auch dieses, um sich zeitig durch die Sonne wecken zu lassen. Hier stand auf einem bemoosten Felsenhang über des Junkers Haupte eine hohe finstere Zypresse wie ein schwarzer Riesenfinger, der ihn warnend fortzuwinken schien.
Jetzt kam Marcantonio mit einer Kanne Wein und zwei silbernen Bechern zurück. Er schwenkte die Becher mit Malvasier aus, den er auf die Veranda sprengte, und trank dem Junker auf das Glück seiner Ehe zu, aber er selbst nippte nur, während Veit den Wein auf einen Zug hinunterstürzte und, durch den raschen Trunk nur durstiger geworden, noch einen zweiten Becher leeren mußte. Beim Schein der Lampe fiel ihm auf, wie bleich sein Wirt war: er schien jählings gealtert, und seine Brust keuchte. Kein Wunder, denn die Schwüle in dem Gemach war fast erstickend. Veit eilte wieder auf die Veranda hinaus und drückte seinen blonden Krauskopf trunken und liebesselig gegen das kühle Laubgeschlinge.
Marcantonio folgte ihm und sagte mit einer Anwandlung von Mitleid: »Wie wäre es, Herr Ritter, wenn Ihr mir noch heute den Kodex zeigtet, damit ich Euch gleich morgen mit meinem schwachen Urteil zur Seite stehen kann?«
»Verzeiht«, war des Junkers unumwundene Antwort, »ich habe geschworen, ihn durch niemand berühren zu lassen, ehe ich ihn in Herrn Bernardos eigene Hände gebe. Des Tages ruht er sicher auf meiner Brust, bei Nacht lege ich ihn unter mein Kopfkissen«, fügte er lachend hinzu.
Marcantonio Rucellai war ein reinlicher Mann und liebte es nicht, seine Hände mit Blut zu beflecken. Er würde auch gerne des Jünglings Leben geschont haben, hätte er nur eine andere Möglichkeit gesehen, ihn unschädlich zu machen. Er bebte innerlich vor der Tat zurück, ja, er wäre bereit gewesen, das Manuskript mit dem Opfer seines Vermögens zu erkaufen, aber er sah wohl, daß an einen gütlichen Ausweg nicht zu denken war.
Er schüttelte seinem Gast die Hand.
»Einen langen, festen Schlaf und süße Träume unter meinem Dach«, wünschte er und entfernte sich, indem er die Türe nach der Treppe angelehnt ließ.
Veit wurde es plötzlich zu Mut, als ob tausend kleine Flämmchen über seinen Körper huschten. Er riß das Wams auf, zog die Papierrolle heraus, die ihn jetzt belästigte, und warf sie achtlos auf den Tisch. Seine Gedanken verwirrten sich, das Zimmer ging mit ihm im Kreise, und er mußte sich mit wankenden Knien an den Pfosten der Verandatüre klammern. Sonderbar, daß zwei armselige Becher Wein eine so berauschende Wirkung auf ihn übten! Junker Veit war sich doch bewußt, auch beim Glase seinen Mann zu stellen.
»Aber freilich, dieser Griechenwein, der unter Florentinischer Sonne reift, ist auch ein anderer Held als unser zahmes Neckargewächs«, dachte er. »Ein Glück, daß sie mich nicht so sehen kann.«
Und erschrocken zog er sich in das Innere des Zimmers zurück, als wäre zu fürchten, daß die Augen der Geliebten ihn noch durch die Dunkelheit in so unwürdigem Zustand erblicken könnten.
Er tastete sich nach dem Lager, auf das er, angekleidet wie er war, niedersank. Doch nach einiger Zeit hob er mühsam den Kopf, denn es kam ihm vor, als ob die Tür geknarrt habe und die Strohmatte knistere.
Da erblickte er eine Gestalt, die ihn trotz seiner Müdigkeit zum Lächeln reizte. Lucius Rufus war auf den Zehenspitzen hereingeschlichen, seinen schmächtigen Leib mit dem langen dünnen Hals im Gehen einziehend und wieder ausreckend, wie jene Raupe, die man Spanner nennt. Jetzt stand er vor dem Lager.
»Was willst du, Lutz?« fragte der Jüngling in schläfrigem Tone.
»Ah, Herr Ritter, Ihr seid noch nicht in Orpheus’ Armen?« flüsterte der Rote. »Ich kam, um zu sehen, ob Ihr nichts bedürfet.«
Dabei horchte er mit vorgeneigtem Ohr nach dem Wäldchen hinaus.
»Nichts, ich danke dir«, sagte Veit mühsam. Die Anstrengung des Sprechens riß ihn ein wenig aus der Betäubung. Er richtete sich auf.
»Was macht dein Fräulein, Lutz? Hat sie zuweilen meiner gedacht, während ich ferne war?«
»O Herr, sie seufzte nach Euch wie die getreue Helena!«
Veit rüttelte aufs neue an den Fesseln des Schlummers, die ihn schon wieder umstricken wollten.
»Die getreue Helena?« sagte er befremdet.
»Ja, Herr, wie die getreue Helena, da sie dem abwesenden Gatten Ulysses das Strumpfgewand wob. Von ihr habt Ihr nichts zu besorgen.«
Veit war zu müde, um zu lächeln, er sank nur beruhigt mit dem Kopf aufs Kissen zurück.
»Hört Ihr mich, Herr Ritter?« begann Lucius ängstlich aufs neue. »Das Fräulein will Euch wohl, aber die Luft hier ist Euch nicht ganz gesund, denn schon mancher Fremdling fiel in des Verderbens Schlingen, statt in den Schoß der Liebe.«
Lucius hätte gerne den Jüngling durch einen versteckten Wink gewarnt, ohne sich selber bloßzustellen, denn Marcantonios übergroße Beflissenheit gegen den ahnungslosen Nebenbuhler schien ihm unnatürlich und gefährlich. Aber Veits Schlaftrunkenheit und seine eigene schwülstige Redeweise, die er bei Gefahr seines Lebens nicht zu ändern vermocht hätte, hinderten ihn, sich verständlich zu machen.
»Was willst du sagen?« gähnte Veit.
»Daß Ihr umlauert seid von der tausendköpfigen Mitra des Verrats«, flüsterte der Rote keuchend. »Herr, man hat Euch liebevoll und gastfrei aufgenommen, aber mir fällt dabei ein, was der lateinische Poet sagt – wie sagt doch der lateinische Poet? Hm, es fällt mir jetzt nicht ein – aber es würde sehr gut hierher passen.«
»Laß den lateinischen Poeten, guter Lutz«, murmelte Veit. »Wenn du mir etwas zu sagen hast, so tu es, aber ohne Zitate und Schnörkel werk, denn ich bin müde.«
»Herr, möchtet Ihr Euch wach halten – ach, da nickt er schon wieder. Herr Ritter, trennt Euch nicht von Eurem Schwert! – Er hört mich nicht!«
Lucius bückte sich und suchte in heftiger Beängstigung nach des Jünglings Schwert, das er an seine Seite legte, ohne ihn durch seinen flüsternden Zuruf mehr erwecken zu können. Er sah sich ratlos um. Vom Haine her meinte er Geräusch zu hören. Er lauschte.
»Nein, es ist alles still. Aber mir ist so bange. Was bin ich doch für ein Hasenfuß! Und der schöne Anfang meines Gedichtes ist auch weggeblasen. Was mische ich mich denn in fremde Angelegenheiten!«
Er wollte sich zurückziehen, da fiel sein Blick auf den Tisch. Hier lag die Schriftrolle, das goldene Vlies, das dem Hause Rucellai unerhörte Opfer gekostet hatte. Er konnte es nicht lassen, liebkosend mit den Fingern darüberzufahren, der klassische Kitzel siegte über seine Furchtsamkeit, er hielt die Rolle gegen das Licht und betrachtete ehrfurchtsvoll die Schnüre, womit sie umwunden war.
Plötzlich fuhr er zusammen, er hörte ein leises Wehen und Schleichen auf der Treppe und dann einen deutlichen Schritt. Darauf wurde es ganz still, als ob der späte Schleicher an seinem eigenen Geräusch erschrocken sei und den Atem verhalte. Dem Roten sträubten sich die Haare auf dem Kopf. Jetzt schlich es wieder und noch leiser als zuvor, aber es war schon viel höher oben auf der Treppe. Da stürzte Lucius, ohne noch einmal nach dem preisgegebenen Schläfer zu blicken, in sinnloser Angst auf das offene Fenster zu, schwang sich hinaus und kletterte behend und leise wie ein Eichhorn auf das Dach des Schuppens und von da auf den Waldboden hinab. Es war völlig dunkel; Lucius kam erst ein wenig zur Besinnung, als er auf seiner raschen Flucht mit Heftigkeit gegen einen knorrigen Olivenstamm rannte. Sein Herz klopfte so laut, daß er fast taub war gegen äußeres Geräusch. »Es ist ja nichts«, dachte er, »nur meine eigene Einbildung. Wäre doch die Nacht schon vorbei!«
Jetzt bemerkte er auch, daß er noch immer die Schriftrolle in der Hand hielt; er nahm sie zitternd und leise Gebete sprechend mit sich auf seine Kammer.
Der Junker erwachte nicht, als sich die Gestalt seines Wirtes leise und vorsichtig zu der offenen Türe hereinschob. Marcantonio trug ein blankes, langes Messer in der Hand und ließ einen raschen Blick durch das ganze Gemach gleiten. Seine Züge zeigten in dem blassen Licht des Lämpchens den Ausdruck erbarmungsloser Entschlossenheit.
Er näherte sich leise dem Kopfende des Lagers, das dem Eingang abgekehrt war, und schob vorsichtig die linke Hand unter das Kissen, indem er zugleich mit der Rechten das Messer über dem Schläfer gezückt hielt, um bei der leisesten Bewegung zuzustoßen. Doch Junker Veit lag wie ein Toter, nur die Flut und Ebbe seines halbentblößten Busens verkündete Leben in der ausgestreckten Gestalt.
»Das Pulver tut seine Schuldigkeit«, sagte sich Marcantonio, »aber wo hat er den Kodex?«
Er wagte es sogar, ihm die Hand unter das Wams zu schieben, nachdem er leise das Schwert entfernt hatte, aber er zog sie leer hervor.
Der Zorn über die vergebliche Mühe verscheuchte das aufkeimende Mitleid mit dem ahnungslos Schlummernden.
»Junger Tor«, sagte er grimmig,» Gott weiß, ich verlangte nicht nach deinem Leben, auch nicht um Lucrezias willen, hättest du nur das Buch gutwillig hergegeben! Aber du hast es selbst gewollt.«
Er zog einen Strohwisch aus dem Busen, entzündete ihn an der Lampe, nachdem er leise die Matte am Fenster wieder herabgelassen hatte, und schob ihn unter die Lagerstatt.
»So bin ich rein von Blut«, murmelte er zufrieden. »Fahre nun in Flammen gen Himmel, samt deinem Cicero!«
Leises Knistern in dem von der Sommerhitze spröden Strohteppich sagte ihm, daß das Feuer schon sein Werk begann. Er zog sich rasch zurück, verschloß die Türe von außen und warf noch im Vorübereilen einen glimmenden Strohhalm auf gut Glück in den Heuschuppen.
»Zur Sühne für den armen Donato«, murmelte er, »den das Barbarenvolk wie einen Hund erschlagen hat.«
Als er am Fuß des Hügels stand, sah er von oben schon den Qualm zum Himmel steigen, und der Brandgeruch drang ihm in die Nase.
»Der Olivenhain wird verloren sein«, sagte er sich und empfand es fast als eine Beruhigung seines Gewissens, daß er sein eigenes Gut zugleich dem Verderben preisgab.
»Es ist am besten so«, dachte er noch, indem er nach Hause schlich. »Morgen wird es heißen, daß er in der Trunkenheit die Lampe umgestoßen habe.«
Zu derselben Stunde stöhnte Lucrezia unter dem Bann eines schweren Alpdrückens auf ihrem Lager. Sie war stets ein gehorsames Kind gewesen und hatte ihre Ehre dareingesetzt, des Vaters Befehl willig nachzukommen, als er sie mit dem deutschen Junker verlobte. Daß ihr das leicht geworden, hatte sie sich zum besonderen Verdienst angerechnet und nicht geahnt, wie schwer ein väterliches Gebot fallen kann, wenn es dem eigenen Herzen widerspricht. Als sie nun vor wenigen Tagen die Wendung ihrer Zukunft erfuhr, da hatte sie wohl schüchterne Berufung auf ein früheres Versprechen gewagt, war aber von dem Vater nachdrücklichst bedeutet worden, daß sie dem Geschick und ihm für diesen Tausch zu ganz besonderem Danke verpflichtet sei.
Bernardo hatte seine Kinder stets in strenger Zucht gehalten, und Lucrezia fürchtete seinen lächelnden Ernst und die glatte Unbeugsamkeit mehr, als wenn er ein Wüterich gewesen wäre. Also hatte sie auch diesmal ihr Köpfchen geneigt, aber nicht in willigem Gehorsam, sondern erschrocken und wehrlos wie ein Lamm, das zum Schlachthaus geführt wird. Sie fühlte wohl in ihrem Grausen vor dem gelehrten Bräutigam, der mit dem pergamentenen Schädel selber einem alten Kodex glich, etwas wie ein heiliges Naturrecht durch, aber wie sich auflehnen, sie allein, ohne Hilfe, gegen den Druck einer eisernen Welt? Ja, wenn der blonde Fremde zurückkehrte und sie wieder in seine starken Arme faßte, dann würde sie keine Furcht mehr kennen. Sie mußte sich ihn denken, wie er etwas breitspurig herankam mit dem schweren Reitertritt und dem ehrlich leuchtenden Blick seiner blauen Augen. Ach, damals hatte sie nicht gewußt, wie glücklich er sie machte. Jetzt würde sie sich selig preisen, wenn sie nur mit ihm ziehen dürfte in jene finsteren, sonnenlosen Wälder, wo die Gebeine ihres Oheims moderten, und dort in einer Höhle mit ihm leben. Doch Tag für Tag sah sie das Geschick näher heranrücken und klammerte sich der fliehenden Zeit ans Gewand, die sie erbarmungslos dem Entsetzlichen entgegentrug.
Überwältigt von Kummer und Scirocco hatte sie sich in dem schwülen Zimmer zur Ruhe gelegt, das auch durch die weitgeöffnete Balkontüre keine Luft empfing. Aus den Stallungen stiegen schwere Dünste auf, mischten sich mit dem Geruch welkender Blumen im Garten und vermehrten ihre Betäubung. Das häusliche Getriebe war verstummt, der dunkle Himmel, der durch die Balkontüre zu ihr niedersah, hatte keinen Stern, und es deuchte ihr, als sehe sie einen finsteren Magier mit großen dunklen Fittichen, die sich im Fluge nicht bewegten, geräuschlos über dem Himmel hinziehen; es war der menschgewordene Scirocco, der wie durch bösen Blick die Natur lähmte und sie willenlos erschlafft in seine feuchten widerlichen Arme zwang. Nun streckte er diese Arme auch gegen sie aus, und jetzt erkannte sie, daß er Marcantonios Züge trug. Sie stöhnte unter seinem Druck, aber ihre kraftlosen Glieder konnten ihn nicht zurückstoßen. Da klang Veits Stimme in ihre umschläferten Ohren, so hatte sie ihn schon oft zu vernehmen geglaubt, aber heute vernahm sie ihn wirklich, nur vermochten die ersehnten Laute sie nicht aus dem Zauberschlaf des Glutwindes zu erwecken, sondern mischten sich in das Spiel, das ihre Träume trieben. Die Stimme, die einen Augenblick näher gekommen war, verlor sich wieder in der Ferne, der Retter fand nicht den Weg zu ihr, er ließ sich zur Seite locken, sie sah ihn ferner und ferner hinschwinden, aber sie konnte weder rufen noch die Arme nach ihm ausbreiten.
Mit Anstrengung öffnete sie die schweren Lider und sah im Waldhäuschen drüben ein rötliches Licht. Aber gleich begann die Phantasie ihr Spiel von neuem und verwob auch dieses Licht in ihren Traum. Da fuhr mit einem Male eine zischende Feuerschlange nieder, die sie auch mit geschlossenen Lidern wahrnahm, und fast gleichzeitig ein übergewaltiger Donnerschlag, der das ganze Haus in seinen Grundmauern rüttelte. Das Mädchen sprang mit beiden Füßen aus dem Bette, der Donner war das große Erlösungswort gewesen, das den Bann des Scirocco sprengte. Denn jetzt kam auch Leben in die Natur, die Lüfte rangen sich los, die Welt atmete befreit auf, während neue Blitze folgten. Im Hause schlugen Türen und Fenster, mehrere Stimmen wurden zugleich laut, die Pferde wieherten in den Ställen. Die Jungfrau griff nach einem Gewand, das sie hastig umwarf, und trat ohne Furcht auf den Balkon, um dem prächtigen Gewitter zuzusehen, das in wilden Blitzen niederging, sich aber schon ein wenig entfernt hatte. Seltsam, drüben im Waldhäuschen brannte noch immer das rote Licht, aber es schien größer geworden, ja, es wuchs von Sekunde zu Sekunde. Jetzt tauchten andere Lichter daneben auf, feurige Zungen leckten empor und ließen auf Augenblicke die Umrisse des Häuschens aus der Dunkelheit hervortreten. Das Mädchen starrte lautlos auf das überraschende Schauspiel, denn nun erhellte sich das Häuschen auch von innen, und in dem roten Glutmeer, das langsam aufstieg, sah sie eine dunkle Gestalt. Wie ein Blitz trat es vor ihren Geist, daß sie soeben geträumt hatte, der Geliebte werde von dem Zauberer im Waldhäuschen gefangengehalten.
»Guido!« schrie sie mit durchdringender Stimme, die weit in die schlafende Landschaft hinaushallte, und streckte die Arme aus, als könnte sie ihn durch den leeren Raum herziehen. Die Gestalt war plötzlich näher gerückt, sie stand wie in freier Luft, aber ganz von roten Flammen umzüngelt. Aufs neue schrie sie: »Guido! Guido!« aber jetzt wurde ein polterndes Krachen vernehmbar, das ganze Flammengerüst versank auf einmal in schwarze Nacht, und dichter Qualm verhüllte die Stätte.
Länger ertrug es Lucrezia nicht; ohne ihrer bloßen Füße zu achten, flog sie die Treppe hinab und durch das geöffnete Haustor ins Freie. Auf sandigem Weg eilte sie den Abhang hinunter nach dem Wildbach, dessen tiefeingerissenes Ufer von einem dichten Rohrwald bedeckt war. Sie brach durch das Gezweige, obgleich ihr der Wind den Rauch entgegentrug. Aber oben leckten noch wilde Gluten, die sich jetzt mehr nach abwärts wandten, und bei dem Feuerschein erkannte Lucrezia eine dunkle Gestalt am anderen Rande des Flußbetts. Sie arbeitete sich hinüber, mehrmals strauchelnd, weil das trockene Steingeröll ihre zarten Füße verletzte und ihnen keinen festen Halt bot. Sie erkannte jetzt den Junker, der am Boden lag, ja, sie hätte ihn auch mit geschlossenen Augen erkannt, denn sie fühlte seine Gegenwart, und ihre Schüchternheit überwindend schlang sie beide Arme um ihn und suchte ihn emporzurichten. Doch er seufzte nur und schien nicht bei Besinnung zu sein. Da tauchte sie den Zipfel ihres Gewandes in den schwachen Wasserfaden, der noch inmitten des vertrockneten Bettes hinschlich, und netzte ihm die rauchgeschwärzte Stirn.
Er erholte sich und nannte ihren Namen.
»Ich sah dich stehen und winken«, stammelte er, »da sprang ich herab und verdanke dir mein Leben.« Er versuchte aufzustehen, aber ein heftiger Schmerz bewies ihm, daß eine Kniescheibe verletzt und an kein Gehen zu denken war. Mittlerweile wurde der Qualm immer dichter und drohte beide zu ersticken. Mit röchelnder Stimme beschwor er sie, ihn zu verlassen und sich zu retten, aber sie schüttelte den Kopf, und nachdem sie mehrmals mit äußerster Anstrengung versucht hatte, den schweren Mann in ihren Armen aufzuheben, setzte sie sich ergeben nieder, zog seinen Kopf auf ihren Schoß und sagte zärtlich: »So sterben wir zusammen.«
Aber der Himmel hatte Erbarmen mit dem jungen Paar, denn der Wind drehte sich und jagte die Flammen mit dem größten Teil des Rauches hügelabwärts und seitlich gegen das Olivendickicht hinüber.
Endlich wurde es im Garten lebendig. Windlichter tauchten auf, man hörte die Stimmen der Diener, und nun gelang es Lucrezia mit allem Aufwand ihrer vom Rauch belästigten Lungen Hilfe herbeizurufen. Zwei erstaunte, noch halb verschlafene Knechte schleppten den fremden Jüngling, den ihre junge Herrin liebevoll mit den Armen stützte, die Uferböschung hinauf in den Garten. Dort aber, außer dem Bereich des Qualmes, mußten sie ihn niederlegen und sich nach einer Tragbahre entfernen, da der Verletzte bei der Fortbewegung zu große Qualen litt. Der Lärm wuchs, die Bauern eilten mit Äxten und Hacken nach dem Olivenhain, um den begonnenen Waldbrand einzuschränken, aber der Wind wehte stark, und die Bäume standen so dicht, daß die Waldung preisgegeben werden mußte. Die Leute stellten alle Rettungsversuche ein und trösteten sich mit der Hoffnung, daß das Feuer, wenn es das Ackerland und die Wiesengräben erreichte, ohne Nahrung in sich zusammensinken werde.
Inzwischen prasselten die Flammen lustig weiter, ein Knistern, Knattern und Knallen ging durch den Hain wie über ein Schlachtfeld. Das Feuer wart seinen Schein weit über den Garten und beleuchtete die Gestalt des jungen Mädchens, die sich aufs neue neben dem halb ohnmächtigen Fremdling niedergeworfen hatte und sein Haupt mit ihren Händen stützte. Sie betrachtete ihn liebevoll. Sein sonst so schönes blondes Kraushaar war ganz versengt und sein Gesicht von Rauch geschwärzt, sonst schien er außer der gebrochenen Kniescheibe keinen Schaden davongetragen zu haben, aber er litt heftige Schmerzen, und der Kopf, der auf Lucrezias Knien lag, war so schwer wie Blei.
Endlich erschien auch Herr Bernardo in all dem Tumult ohne Übereilung in weißem Überwurf mit schönem würdigem Schritt. Er betrachtete überrascht die Gruppe am Boden, hatte aber Schönheitsgefühl genug, im stillen einen Maler herbeizuwünschen, damit er das wild-anmutige, von rotem Schein umzuckte Bild festhalte: die Jungfrau im weißen Gewande wie eine Pietà mit ihren entblößten Armen den Verwundeten stützend und umschlingend, mit dem kleinen elfenbeinweißen Fuß, der sich fest gegen den Sandboden stemmte, um der schweren Last eine Stütze zu geben, und dem langen schwarzen Haar, das wie ein dunkler Strom am Boden floß.
Doch aus diesem Kunstgenuß riß ihn eine schreckliche Ahnung.
»Und der Kodex!« rief er plötzlich.
»Hier auf meiner Brust«, murmelte Veit, den der Angstschrei Bernardos aus der Halbohnmacht weckte, und er betastete mit den Händen sein Wams.
»Nein, er ist nicht hier – o mein Gott – ich habe ihn oben gelassen.« –
Was jetzt geschah, blieb allen Anwesenden als etwas Unerhörtes auf ewig ins Gedächtnis geprägt: Herr Bernardo vergaß plötzlich Haltung und Römerwürde, er fuhr sich mit den Händen in die Haare, zerbiß seine Fäuste und umschlang den Stamm eines jungen Bäumchens, das er verzweifelt rüttelte, indem er in einem fort schrie: »Verbrannt! – Verbrannt! – Verbrannt!« bis sein wildes Geheul in einem tonlosen Krächzen endigte.
Als er sich des Jammers gesättigt hatte, kehrte ihm noch einmal die Hoffnung zurück, denn für so tückisch wollte er die Götter nicht halten.
»Das Haus steht noch, nur die Veranda ist zertrümmert. Das Buch muß noch zu retten sein. Kommt alle her, Simone, Gasparino, Giacomo und du, braver Pasquale! Wer mich liebt, der hole das Buch aus den Flammen, ich mache ihn zum reichen Mann. Aber eilt, rettet!«
Niemand rührte sich; als einzige Antwort streckte eine Flamme ihre breite rote Zunge zu dem seitlichen Fenster heraus, vermutlich, weil die als Vorhang dienende Strohmatte sich jetzt auch entzündet hatte.
Der Junker war zusammengezuckt und reckte sich aus, als wollte er sich erheben, aber er sank mit jammervollem Stöhnen wieder zurück, und Lucrezia hielt ihn ängstlich fest, ihn mit mütterlichen Liebesworten wie ein krankes Kind beschwichtigend. Die Umstehenden, obwohl sie nur Bauersleute waren, blickten mit inniger Rührung auf das schöne junge Paar, nur Bernardo hatte keine Regung des Mitleids übrig. Er erkannte jetzt die unerbittlich-unversöhnlichen Mächte, die dem Sterblichen den Kelch von der lechzenden Lippe reißen, aber er hatte seine Fassung wiedergefunden. Mit dem Saum seiner Toga verhüllte er den Kopf, denn die Knechte sollten seine Tränen nicht sehen. Nun erschien eine schlotternde, gebrochene Gestalt auf dem Brandplatz: der gute Lucius, dem die Augen weit aus den Höhlen standen und trotz der leckenden Hitze die Zähne klapperten.
»Ist es wahr, daß er verbrannt ist?« fragte er mit heiserem Ton, der sich kaum hervorgetraute.
»Verbrannt!« bestätigte Bernardo mit dumpfer Trauer und streckte, ohne sich zu enthüllen, die Rechte nach seinem Diener aus, um eine mitfühlende Hand zu drücken. Aber nichts Lebendiges kam ihm entgegen. Lucius hatte jetzt die Gruppe am Boden erspäht und staunte einen Augenblick mit aufgerissenen Augen. Doch im nächsten Moment lag er auf den Knien und küßte dem Junker die Hände und die sporenbeschwerten Reiterstiefel.
»Er ist gerettet!« jauchzte er. »O Herr, blickt doch her, hier liegt er ja, er ist in Sicherheit.«
Bernardo enthüllte einen Augenblick sein Gesicht und sagte dann mit einem Ton, der für den deutschen Junker nichts Schmeichelhaftes hatte: »Der da?« – Und in Gedanken setzte er hinzu: »Möchten doch zehn solcher Barbaren brennen, wenn nur der Kodex gerettet wäre!«
Aber Lucius verstand seinen Herrn auch ohne Worte. Er schnellte in die Höhe und sagte: »O Herr, ich habe, was Euch trösten wird.« Damit rannte er eilig fort und stand schon nach zwei Minuten wieder da.
»Hier ist der Kodex«, stammelte er schluchzend, »ich, ich habe ihn für Euch gerettet.«
Bernardo war überwältigt und stumm. Wie ein Kindlein wiegte er die Schriftrolle am Busen. Jetzt im Glück erwachte auch die Menschlichkeit, er trat zu dem Junker, drückte ihm die Hand und beglückwünschte ihn herzlich zu seiner Rückkehr und Rettung aus der Gefahr.
»Wir müssen nun vor allen Dingen an Eure Verletzung denken. Und was ich versprochen habe, das halte ich.«
Er ließ ein heiteres Auge über die Stätte der Zerstörung schweifen, sandte noch einen Dankesblick zum Himmel und entfernte sich, den geretteten Kodex ans Herz drückend. Die Diener hoben unter Lucrezias Anleitung den verletzten Fremdling auf die Bahre und trugen ihn vorsichtig ins Haus. Unterwegs teilten sie sich murmelnd ihre Verwunderung darüber mit, daß Herr Marcantonio von dem fürchterlichen Donnerschlag und dem darauffolgenden Feuerlärm nicht erwacht sei; das mußte ein gesunder Schlaf sein.
»Man hört es doch immer am Schlag, wenn der Blitz gezündet hat«, sagte ein alter Bauer. »Es war grausig, und wenn der Wind sich dreht und die Funken ins Röhricht wirft, so ist auch das Wohnhaus in Gefahr. Ein Glück, daß es endlich zu regnen beginnt.«
Noch hatten sie das Wohnhaus nicht erreicht, so goß der Regen schon in Strömen nieder mit so jäher, unwiderstehlicher Gewalt, als ob aus den geöffneten Himmelsfenstern eine Riesenbadewanne ausgeschüttet würde.
Die herbstliche Mittagssonne blickte auf ein völlig verwandeltes Bild. Das zierliche Rosenhäuschen stand schwarz und nackt in seinen Grundmauern da, und der schattige Hain war in einen häßlichen, dunklen Schutthaufen voll nasser Asche verwandelt, aus dem nur einzelne verkohlte Olivenstämme in grotesken Stellungen herausragten. Weithin lag alles Land versengt, das Wiesengrün war völlig ausgedörrt in dem Gluthauch, und die hohen Rohre niedergebrochen von der Gewalt des Regens. In dem steinigen Bette des Wildbachs schoß ein trüber reißender Strom herunter, der entwurzelte Bäumchen und zertrümmertes Lattenwerk mitführte und sich tief unten im Tale mit den geschwollenen Wassern der Ema vereinigte. Die Bauern und Tagelöhner des Herrn Marcantonio standen teils müßig auf der Brandstätte, teils wühlten sie in dem Trümmerhaufen des Waldhäuschens, aus dem sie den Leuchter und die geschmolzenen Becher und Kannen zum Vorschein brachten.
Kopfschüttelnd betrachteten sie die mächtige alte Zypresse, die gar nicht so nah bei dem Häuschen stand, wie es dem Junker gestern geschienen hatte, und die von oben bis unten zerspalten war. Also hatte der Blitz doch nicht in das Waldhaus geschlagen, und wie der Funke dorthin überspringen konnte, das war und blieb den guten Landleuten ein Rätsel.
Um diese Stunde trat Herr Bernardo bleich und übernächtig, aber ernst wie ein Totenrichter in das Gemach, wo Marcantonio noch zu Bette lag, von Frost geschüttelt, mit einem nassen Tuch um die Stirn und mit klappernden Zähnen, denn von der wilden Energie der vergangenen Stunden war nichts übriggeblieben als eine jämmerliche Angst. Der Schuldige hatte, als er den Lärm vernahm, nicht mehr gewagt, an die Stätte seiner Tat zurückzukehren, und wußte, obwohl er schlaflos auf jedes Geräusch hörte, wenig von den Vorgängen der Nacht. Er hatte nicht einmal den Mut, seine Leute auszufragen, und entschuldigte sich der Umgebung gegenüber mit einem Fieberanfall infolge der Aufregung.
Dies nahm die Dienerschaft nicht wunder, denn man war gewohnt, den Herrn bei allen außerordentlichen Anlässen sehr schonungsbedürftig zu sehen. Aber Bernardo blickte tiefer, er hatte bereits den Kodex gelesen.
»Ich will nicht fragen, Marcantonio, wie heute nacht der Brand auskam«, begann er, und nur an einem leisen Zittern der Stimme war seine tiefe Erregung zu erkennen. »Es ist ein Glück, daß der Blitz dich vor Verdacht sicherstellt; ich aber habe das Feuer schon gesehen, ehe das Gewitter begann.«
Marcantonio richtete sich im Bette auf und sah ihn höhnisch an.
»Dein junger Barbar war betrunken wie ein echter Deutscher und ließ sein Licht brennen.«
»Gut«, entgegnete Barnardo ruhig. »Was heute nacht geschah, ist Nebensache. Aber ein Mord ist begangen worden, der schwerer in die Schale fällt als ein geopfertes Menschenleben.«
»Ich verstehe dich nicht«, sagte Marcantonio mit finsterem Trotz.
»Du verstehst mich wohl. Wer einen Blick in diese Schrift wirft« – er zog den Kodex aus dem Busen – »der muß mich verstehen. Dies ist ein Cicero.«
Marcantonio sagte kein Wort und vermied den Blick seines Richters. Erst nach langer Pause murmelte er: »Bedenke, ich bin auch ein Rucellai.«
»Ich habe es bedacht«, antwortete Bernardo. »Stundenlang bin ich mit mir zu Rate gegangen und habe mich gefragt, was ein Römer an meiner Stelle getan hätte. Brutus ließ seine Söhne schlachten, aber er hätte sie nicht entehrt. Geh, ich hasse dich mehr als den Judas Ischariot. Meine Augen sollen dich nie wiedersehen. Marcantonio, Mörder des großen Cicero, lebe, und wenn du kannst, so trage noch fernerhin deinen ehrlosen Ruhm. Ich aber bringe mit blutendem Herzen der Ehre meines Hauses und der Würde des Gelehrtenstandes, den dein Schandfleck nicht mit besudeln soll, das schwerste Opfer meines Lebens.«
Er trat an die Türe und ließ sich von Lucius, der außen wartete, ein glimmendes Kohlenbecken reichen, das er zu Marcantonios herzlicher Erleichterung auf den Tisch stellte. Nun löste er langsam die durch den Märtyrertod seines Bruders geheiligten Blätter und übergab sie Stück für Stück der Flamme.
»Fahr wohl, liber jocularis«, rief er mit ausbrechendem Schmerz. »Fahrt wohl, ihr goldenen Scherze, die dieser Stümper nicht einmal richtig auszunützen verstand. Ja, die Barbaren vom Schwarzwald hatten recht, dies ist ein Zauberbuch gewesen. O Marcantonio, hättest du es doch besser abgeschrieben, so wäre es uns wenigstens nicht ganz geraubt.«
Endlich verglomm der letzte Funke, und das Becken war hoch angefüllt mit verkohlten Papierresten. Da wandte sich Bernardo ab, und mit der Haltung eines Mannes, der größer ist als sein Schicksal, schritt er aus der Türe. – –
Unter den Strahlen einer milden Septembersonne zog Lucrezias Brautgeleite durch das nördliche Tor von Florenz die Bologneser Straße hinauf. Die Hochzeit war mit einem auch den prunkliebenden Florentinern ungewohnten Pompe gefeiert worden, denn der große Mediceer hatte selbst die Ordnung des Festes übernommen und sein Patenkind zur Kirche geleitet, um zugleich in dem fremden Ritter seinen neuen Freund Eberhard zu ehren. Kein Mißton trübte das Fest, wenn auch Bernardos gelehrte Freunde den Untergang der kostbaren Handschrift bei dem Brand des Waldhäuschens schmerzlich beklagten. Lucius Rufus hatte sein Gedicht doch noch fertig gebracht und es mit etwas veränderten Reimen den veränderten Umständen angepaßt. Bis Bologna ging der festliche Zug; dort nahm die Braut unter reichlichen Tränen, die aber über ein von Glück strahlendes Gesicht flossen, auf ewig von ihren Landsleuten Abschied. In einfachem Reisegewand ritt das schöne Paar, nur von wenigen Knechten begleitet, seine Straße weiter. Junker Veit hatte sein junges Weib auf dem Glauben gelassen, daß sie mit ihm in ein finsteres Barbarenland ziehe, und freute sich ihrer froh enttäuschten Miene, wenn er ihr die segensreichen Fluren seiner Heimat mit den gewaltigen Lärchen- und Fichtenwäldern zeigen würde, nicht so schön zwar wie die Pinien und Zypressen ihres Sonnenlandes, aber noch schön genug für ein Auge, das liebt.
Der Abend versammelte inzwischen die Florentiner Freunde noch zu einer kleinen Nachfeier in den mediceischen Gärten. Man gedachte mit Wehmut des hochherzigen Donato, der als Opfer der Wissenschaft im wilden Lande gefallen war, und der greise Marsilio Ficino pries in einer schönen Rede die Großmut seines Freundes Bernardo, der mit antiker Treue sein Wort gehalten, nachdem der Neid der Götter den bedungenen Preis zerstört hatte.
»Es mag dir nun wohl ein wenig schwer ums Herz sein in deinem einsamen Hause, alter Freund«, sagte der große Lorenzo, indem er Herrn Bernardo teilnehmend die Hand reichte.
Bernardo blinzelte mit den Augen, sei es, daß er eine Träne zerdrückte, oder daß die untergehende Sonne ihn belästigte. »Meine Tochter ist nur ein flüchtiges Scheingebilde«, antwortete er fest. »Sprechen wir von einem Ding der Wesenheit. Was sagt Eure Magnifizenz von der Phädra des Seneca?«