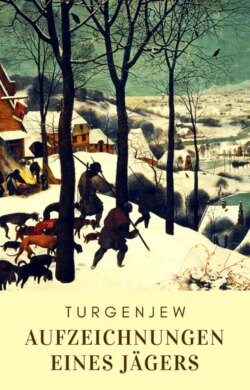Читать книгу Aufzeichnungen eines Jägers - Iwan Turgenjew - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Himbeerwasser
ОглавлениеAnfang August herrscht bei uns oft eine unerträgliche Hitze. Um diese Zeit ist auch der entschlossenste und geduldigste Mensch in den Stunden zwischen zwölf und drei nicht imstande zu jagen, und selbst der ergebenste Hund beginnt ›dem Jäger die Sporen zu putzen ‹, d. h., er folgt ihm im Schritt, die Augen schmerzvoll zusammengekniffen und die Zunge übertrieben hervorgestreckt; auf die Vorwürfe seines Herrn wedelt er nur unterwürfig mit dem Schwanz und zeigt eine verlegene Miene, ist aber nicht vorwärtszubringen. Gerade an einem solchen Tag befand ich mich einmal auf der Jagd. Lange widerstand ich der Versuchung, mich irgendwo, wenn auch nur für einen Augenblick, in den Schatten zu legen; lange trieb sich mein unermüdlicher Hund in den Büschen herum, obwohl er von seiner fieberhaften Tätigkeit auch selbst nichts Vernünftiges erwartete. Die drückende Hitze zwang mich schließlich, an die Erhaltung unserer letzten Kräfte und Fähigkeiten zu denken. So gut es ging, schleppte ich mich zum Flüßchen Ista, den meine geneigten Leser schon kennen, stieg den steilen Abhang hinunter und ging über den gelben, feuchten Sand in der Richtung auf eine Quelle, die in der ganzen Gegend unter dem Namen Himbeerwasser bekannt ist. Die Quelle sprudelt aus einer Uferspalte hervor, die sich allmählich in eine kleine, aber tiefe Schlucht verwandelt hat, und ergießt sich zwanzig Schritte weiter mit lustigem, geschwätzigem Geräusch in den Fluß. Die Abhänge der Schlucht sind mit Eichengebüsch bewachsen; in der Nähe der Quelle grünt ein kurzer, samtweicher Rasen; die Sonnenstrahlen berühren fast nie ihr silbernes, kaltes Naß. So erreichte ich die Quelle; im Gras lag eine Schöpfkelle aus Birkenrinde, die irgendein vorübergehender Bauer zum allgemeinen Nutzen zurückgelassen hatte. Ich stillte meinen Durst, legte mich in den Schatten und sah mich um. An der Bucht, die der Ausfluß der Quelle in den Fluß bildete und deren Wasseroberfläche daher ständig gekräuselt war, saßen mit dem Rücken zu mir zwei Greise. Der eine, kräftig und groß gewachsen, in einem dunkelgrünen, sauberen Kaftan und einer warmen Mütze, angelte; der andere, klein, mager, in einem geflickten, halbseidenen Röckchen und ohne Mütze, hielt einen Topf mit Würmern auf den Knien und fuhr sich ab und zu mit der Hand über seinen grauen Kopf, als wollte er ihn vor der Sonne schützen. Ich sah ihn genauer an und erkannte in ihm den Stjopuschka aus Schumichino. Ich bitte den Leser um Erlaubnis, ihm diesen Menschen vorstellen zu dürfen.
Einige Werst von meinem Gut liegt das große Dorf Schumichino mit der steinernen, den Heiligen Kosmas und Damian geweihten Kirche. Dieser Kirche gegenüber prangte einst das große Herrenhaus, umgeben von allerlei Anbauten, Dienstgebäuden, Werkstätten, Pferdeställen, Wagenschuppen, Badestuben, Hilfsküchen, Flügeln für die Gäste und Verwalter, Treibhäusern, Schaukeln für das Volk und anderen mehr oder weniger nützlichen Baulichkeiten. In diesem Herrenhaus hatten einst reiche Gutsbesitzer gewohnt, und alles ging in der besten Ordnung, bis eines Morgens dieser ganze Segen bis auf den Grund niederbrannte. Die Herrschaft siedelte auf eine andere Besitzung über, und dieses Gut verödete. Die ausgedehnte Brandstätte verwandelte sich in ein Gemüsefeld, auf dem hier und da Ziegelhaufen, die Überreste der alten Fundamente ragten. Aus den unverbrannten Balken wurde in aller Eile ein Hüttchen zusammengezimmert und mit Planken gedeckt, die man zehn Jahre früher zur Errichtung eines Pavillons im gotischen Stil angeschafft hatte, und in diesem Hüttchen wurde der Gärtner Mitrofan mit seiner Frau Aksinja und mit sieben Kindern angesiedelt. Mitrofan hatte den Auftrag, für den Tisch der Herrschaften, die sich in einer Entfernung von hundertfünfzig Werst aufhielten, Grünzeug und Gemüse beizustellen; Aksinja wurde mit der Aufsicht über eine Tiroler Kuh betraut, die man in Moskau für teures Geld gekauft hatte, die aber leider vollkommen zeugungsunfähig war und daher seit dem Tag ihrer Anschaffung keinen Tropfen Milch gegeben hatte; außerdem wurde ihr ein rauchgrauer Enterich mit dem Schopfe anvertraut, das einzige ›herrschaftliche‹ Geflügel; die Kinder bekamen infolge ihres jugendlichen Alters keinerlei Ämter, was sie übrigens nicht hinderte, furchtbar faul zu werden. Bei diesem Gärtner hatte ich an die zweimal übernachtet und pflegte bei ihm im Vorbeigehen Gurken zu kaufen, die, Gott weiß warum, selbst im Hochsommer sich durch ihre Größe, durch ihren schlechten wässerigen Geschmack und ihre dicke gelbe Rinde auszeichneten. Bei ihm hatte ich auch zum erstenmal Stjopuschka gesehen. Außer Mitrofan mit seiner Familie und dem alten, tauben Küster Gerassim, den eine einäugige Soldatenfrau in einem winzigen Kämmerchen beherbergte, war in Schumichino kein Mensch vom Hofgesinde zurückgeblieben, denn Stjopuschka, mit dem ich den Leser bekannt zu machen beabsichtige, konnte weder als Mensch im allgemeinen noch als einer vom Hausgesinde im besonderen gelten.
Jeder Mensch hat doch sonst irgendeine Stellung in der Gesellschaft oder irgendwelche Beziehungen zu anderen Menschen; jeder Mensch im Hofgesinde bekommt, wenn auch kein Gehalt, so doch wenigstens ein sogenanntes Deputat; Stjopuschka erhielt aber keinerlei Unterstützung, war mit niemandem verwandt, und niemand wußte etwas von seiner Existenz. Dieser Mensch hatte nicht mal eine Vergangenheit; man sprach von ihm nicht; selbst in den Revisionslisten wurde er kaum geführt. Es gingen dunkle Gerüchte, er sei einmal bei jemandem Kammerdiener gewesen; aber wer er war, woher er stammte, wessen Sohn er war, auf welche Weise er unter die Untertanen von Schumichino geraten war, wie er zu seinem halbseidenen Röckchen, das er seit undenklichen Zeiten trug, kam, wo und wovon er lebte – davon hatte absolut niemand eine Ahnung, und offen gestanden kümmerte sich auch niemand um diese Fragen. Großvater Trofimytsch, der den Stammbaum des ganzen Hofgesindes in aufsteigender Linie bis ins vierte Geschlecht hinauf kannte, hatte nur einmal gesagt, daß Stepan, soweit er sich erinnere, mit der Türkin verwandt sei, die der selige Herr, der Brigadier Alexej Romanytsch, aus dem Feldzug mit seiner Bagage heimgebracht hatte. Selbst an Feiertagen, an denen alle Leute beschenkt und nach altrussischer Sitte mit Brot und Salz, mit Buchweizenkuchen – und Schnaps bewirtet wurden, selbst an diesen Tagen kam Stjopuschka nicht zu den aufgestellten Tischen und Fässern, bückte sich nicht vor dem Gutsherrn, küßte ihm nicht die Hand und trank nicht auf das Wohl und vor den Augen des Herrn das Glas, das der Gutsverwalter mit seiner fettigen Hand gefüllt hatte; höchstens gab ihm irgendeine gute Seele im Vorbeigehen den Rest eines Kuchens. Am Ostersonntag tauschte man mit ihm zwar den Osterkuß, aber er schlug seinen fettigen Ärmel nicht zurück und holte nicht aus seiner rückwärtigen Tasche ein rotes Ei hervor, um es, schwer atmend und mit den Augen zwinkernd, den jungen Herrschaften oder sogar der Gnädigen selbst anzubieten. Im Sommer wohnte er in einer kleinen Vorratskammer hinter dem Hühnerstall, im Winter aber in der Vorbadestube; bei strengem Frost nächtigte er auf dem Heuboden. Man hatte sich an seinen Anblick gewöhnt, manchmal gab man ihm auch einen Fußtritt, aber niemand sprach ihn an, und auch er selbst hatte wohl noch nie den Mund aufgemacht. Nach dem Brand hatte dieser vergessene Mensch beim Gärtner Mitrofan Unterschlupf gefunden. Der Gärtner rührte ihn nicht an, sagte ihm nicht: »Wohne bei mir«, jagte ihn aber auch nicht hinaus. Stjopuschka wohnte auch nicht beim Gärtner; er hielt sich nur im Gemüsefeld auf. Er ging und bewegte sich ohne jedes Geräusch; nieste und hustete in die vorgehaltene Hand und nicht ohne Scheu; immer machte er sich wie eine Ameise zu schaffen; und alles nur des Essens wegen. Und in der Tat, hätte sich Stjopuschka nicht von früh bis spät um seinen Lebensunterhalt gekümmert, so wäre er wohl Hungers gestorben. Es ist schlimm, des Morgens nicht zu wissen, wie man am Abend satt werden soll. Stjopuschka sitzt bald am Zaun und nagt an einem Rettich oder saugt an einer Mohrrübe oder zerbröckelt einen schmutzigen Kohlstrunk; ein anderes Mal schleppt er krächzend einen Eimer voll Wasser; bald macht er Feuer unter einem Töpfchen an, in das er irgendwelche schwarze Bröckchen, die er aus seinem Busen holt, hineinwirft; bald klappert er in seiner Kammer mit einem Holz, schlägt einen Nagel ein, um ein Wandbrett für sein Brot anzubringen. Das alles macht er schweigend, gleichsam aus einem Winkel heraus. Wenn man nur hinblickt, ist er schon verschwunden. Plötzlich verschwindet er auch für zwei Tage; seine Abwesenheit wird natürlich von niemandem bemerkt… Ehe man sich's versieht, ist er schon wieder da und legt verstohlen Späne unter einen Dreifuß. Er hat ein kleines Gesicht, gelbe Äuglein, Haare, die bis zu den Augenbrauen herabreichen, ein spitzes Näschen, ungewöhnlich große, wie bei einer Fledermaus durchsichtige Ohren; der Bart sieht so aus, als ob er ihn vor zwei Wochen rasiert hätte und ist niemals länger oder kürzer. Diesen selben Stjopuschka traf ich in Gesellschaft des anderen Greises am Ufer der Ista.
Ich ging auf sie zu, begrüßte sie und setzte mich zu ihnen. Auch im Genossen Stjopuschkas erkannte ich einen Bekannten: Es war der Freigelassene der Grafen Pjotr Iljitsch, Michailo Saweljew, mit dem Zunamen Tuman (Nebel). Er wohnte bei einem schwindsüchtigen Kleinbürger aus Bolchow, dem Besitzer einer Herberge, in der ich recht oft abstieg. Junge Beamte und andere unbeschäftigte Menschen, die durch die Orjolsche Landstraße fahren (die in ihre gestreiften Federbetten vergrabenen Kaufleute haben andere Dinge im Sinn) – können auch jetzt noch in einer geringen Entfernung vom großen Kirchdorf Troïtzkoje ein riesengroßes, zweistöckiges, verfallenes, hölzernes Haus mit eingestürztem Dach und vernagelten Fenstern sehen, das in die Landstraße hineinragt. Zur Mittagsstunde, an einem hellen, sonnigen Tag kann man sich nichts Traurigeres als diese Ruine denken. Hier lebte einst der Graf Pjotr Iljitsch, der durch seine Gastfreundschaft berühmte, reiche Grandseigneur einer alten Zeit. Zuweilen versammelte sich bei ihm das ganze Gouvernement, um bei der betäubenden Musik der Hauskapelle, unter dem Knattern von Schwärmern und römischen Kerzen zu tanzen und sich zu amüsieren; manches alte Mütterchen seufzt wohl jetzt noch, wenn es an diesem verfallenen Herrensitz vorbeifährt, bei der Erinnerung an die vergangenen Zeiten und an die entschwundene Jugend. Lange gab der Graf seine Festmahle, lange ging er mit einem freundlichen Lächeln durch die Schar unterwürfiger Gäste; aber sein Vermögen reichte ihm leider nicht für das ganze Leben. Nachdem er das Letzte verloren hatte, ging er nach Petersburg, um sich eine Stelle zu suchen, und starb in einem Gasthaus, ohne irgendeine Entscheidung erwartet zu haben. Tuman, der sein Haushofmeister gewesen war, hatte noch bei Lebzeiten des Grafen den Freibrief bekommen. Er war ein Mann von etwa siebzig Jahren mit einem regelmäßigen und angenehmen Gesicht. Er lächelte fast fortwährend, wie nur die Menschen aus dem Zeitalter Katharinas zu lächeln verstehen: gutmütig und majestätisch; beim Sprechen spitzte er langsam die Lippen und zog sie wieder ein, blinzelte freundlich mit den Augen und sprach ein wenig durch die Nase. Auch wenn er sich schneuzte oder eine Prise nahm, so tat er es langsam, wie ein wichtiges Werk.
»Nun, Michailo Saweljitsch«, fing ich an, »hast du viel Fische gefangen?«
»Belieben Sie nur ins Körbchen zu schauen: Zwei Barsche habe ich erwischt und an die fünf Stück Äschen … Zeig es, Stjopa.«
Stjopuschka hielt mir das Körbchen hin.
»Wie geht es dir, Stepan?« fragte ich ihn.
»Es … es … es … es geht, Väterchen, man schlägt sich durch«, antwortete Stepan stotternd, als müßte er mit seiner Zunge zentnerschwere Lasten umdrehen.
»Geht es auch Mitrofan gut?«
»Es geht ihm gut, gew… gewiß, Väterchen.«
Der Ärmste wandte sich weg.
»Die Fische wollen nicht recht anbeißen«, begann Tuman, »es ist viel zu heiß; alle Fische haben sich unters Gebüsch verkrochen und schlafen … Stjopa, tu mir mal einen Wurm an den Haken.« Stjopuschka holte einen Wurm aus dem Topf, legte ihn sich auf die flache Hand, schlug einigemal darauf, zog ihn über den Haken, spuckte darauf und reichte ihn Tuman.
»Ich danke dir, Stjopa . .. Und Sie, Väterchen«, fuhr er fort, sich an mich wendend, »Sie belieben zu jagen?«
»Wie du siehst.«
»So, so … Was haben Sie für einen Hund? Ist's ein englischer oder ein kurländischer?«
Der Alte liebte es, sich zuweilen von seiner vorteilhaften Seite zu zeigen: »Auch ich habe etwas von der Welt gesehen!«
»Ich weiß nicht, was es für eine Rasse ist, aber er ist gut.«
»So, so … Belieben Sie auch mit Hetzhunden zu jagen?«
»Ja, ich habe an die zwei Meuten.«
Tuman lächelte und schüttelte den Kopf.
»Das stimmt. Der eine liebt die Hunde, der andere will sie nicht geschenkt. Ich denke es mir mit meinem einfachen Verstand so: Hunde soll man sich sozusagen mehr des Ansehens wegen halten … Dann soll aber alles so, wie es sich gehört, sein: Die Pferde, die Piqueure, alles muß in bester Ordnung sein. Der verstorbene Graf – Gott hab' ihn selig! – war, die Wahrheit zu sagen, niemals Jäger gewesen; aber er hielt sich doch Hunde und fuhr zweimal im Jahr auf die Jagd. Im Hof versammeln sich die Piqueure in roten Röcken mit Tressen und blasen ins Horn; Seine Durchlaucht geruhen zu erscheinen, man führt Seiner Durchlaucht das Pferd vor; Seine Durchlaucht steigen in den Sattel, und der Oberjägermeister steckt die Füße Seiner Durchlaucht in die Bügel, nimmt sich die Mütze vom Kopf und reicht ihm die Zügel in der Mütze. Seine Durchlaucht knallen mit der Hetzpeitsche, die Piqueure schreien, und alle reiten aus dem Hof. Der Leibjäger reitet hinter dem Herrn; er hat an einer seidenen Leine die beiden Lieblingshunde des Herrn und paßt, wissen Sie, auf … Der Leibjäger sitzt hoch im Kosakensattel, hat so rote Backen und rollt die Augen … Natürlich sind auch Gäste dabei. Es ist ein Zeitvertreib, und auch die Würde ist gewahrt… Ach, da hat er sich losgerissen, der Asiate!« rief er plötzlich, die Angel herausziehend.
»Nun, man sagt, der Graf hätte ein lustiges Leben geführt?« fragte ich.
Der Alte spuckte auf den Wurm und warf die Angel aus.
»Er war ein großmächtiger Herr, das weiß man ja. Ihn besuchten, man darf wohl sagen, die vornehmsten Leute aus Petersburg. Gar oft saßen sie mit blauen Ordensschärpen bei Tisch und speisten. Er war aber auch ein Meister im Bewirten. Manchmal läßt er mich kommen und sagt: ›Tuman, ich brauche für morgen lebenden Sterlett; laß welchen anschaffen, hörst du?‹ – ›Zu Befehl, Durchlaucht!‹ – Gestickte Röcke, Perücken, Rohrstöcke, Parfüms, Eau de Cologne erster Sorte, Tabatieren, riesengroße Bilder, die hatte er sich direkt aus Paris verschrieben. Wenn er so ein Bankett gibt – Herr meines Lebens! – Feuerwerk, Spazierfahrten! Man schoß sogar aus Kanonen. An Musikern allein waren vierzig Mann vorhanden. Einen deutschen Kapellmeister hielt er sich; aber der Deutsche bildete sich zu viel ein: wollte mit dem Herrn am gleichen Tisch essen; also befahlen Seine Durchlaucht, ihn mit Gott hinauszujagen: ›Meine Musiker‹, sagte er, ›kennen auch so ihre Sache.‹ Man weiß ja: die Gewalt eines solchen Herrn. Wenn sie zu tanzen anfingen, so tanzten sie bis zum Morgengrauen, und meistens Ecossaise-Matradure … »He, he! Da hab' ich dich, Bruder!« Der Alte zog aus dem Wasser einen kleinen Barsch. »Nimm ihn, Stjopa. – Er war ein Herr, ein wirklicher Herr«, fuhr er fort, die Angel von neuem auswerfend, »und hatte auch ein gutes Herz. Manchmal verprügelte er einen, aber eh man sich's versah, hatte man's schon vergessen. Nur eins ist zu tadeln: Er hielt sich Mätressen. Ach, diese Mätressen, Gott verzeih' mir! Die haben ihn auch zugrunde gerichtet. Meistens wählte er sie sich aus dem niederen Stande. Man müßte meinen, die sollten zufrieden sein. Aber nein, sie verlangten just das Teuerste, was es in Europien gibt! Andererseits: Warum soll er sein Leben nicht genießen? Ist doch ein Herr … aber er hätte sich doch nicht ruinieren sollen. Besonders eine, Akulina hieß sie; jetzt ist sie tot, Gott hab' sie selig! War ein einfaches Mädel, die Tochter eines Zehntmannes von Sitowo – war die böse! Den Grafen ohrfeigte sie sogar. Sie hatte ihn ganz behext. Einen Neffen von mir steckte sie unter die Soldaten, weil er Schokolade auf ihr neues Kleid ausschüttete … und nicht nur ihn allein steckte sie unter die Soldaten. Ja … Und doch war es eine gute Zeit!« fügte der Alte mit einem tiefen Seufzer hinzu. Dann senkte er die Augen und verstummte.
»Euer Herr war aber streng, wie ich sehe?« fragte ich nach kurzem Schweigen.
»Das war damals Sitte, Väterchen«, entgegnete der Alte und schüttelte den Kopf.
»Heute gibt's das nicht mehr«, bemerkte ich, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
Er sah mich von der Seite an.
»Natürlich ist es jetzt besser«, murmelte er, indem er die Angel weit auswarf.
Wir saßen im Schatten, aber auch im Schatten war es schwül. Die schwere, glühende Luft war unbeweglich; das heiße Gesicht sehnte sich nach einem Windhauch, aber es kam keiner. Die Sonne stach förmlich vom blauen, dunkel gewordenen Himmel; gerade vor uns, auf dem arideren Ufer leuchtete gelb ein hier und da mit Wermut durchwachsenes Haferfeld, und kein Halm rührte sich. Etwas weiter unten stand ein Bauernpferd bis an die Knie im Wasser und schlug träge mit seinem nassen Schweif; ein großer Fisch schwamm unter einem überhängenden Strauch hervor, ließ Luftblasen aufsteigen und sank langsam in die Tiefe, auf der Wasseroberfläche ein leises Gekräusel zurücklassend. Die Grillen zirpten im bräunlichen Gras, die Wachteln schrien wie widerwillig; Habichte zogen ihre Kreise über den Feldern und blieben ab und zu an einer Stelle schweben, schnell die Flügel schlagend und den Schwanz zu einem Fächer gesträubt. Wir saßen unbeweglich da, wie erdrückt von der Glut. Plötzlich ertönte in der Schlucht hinter uns ein Geräusch: Jemand stieg zur Quelle hinunter. Ich sah mich um und erblickte einen Bauern von etwa fünfzig Jahren. Er war mit Staub bedeckt, mit einem Hemd und Bastschuhen bekleidet und hatte ein geflochtenes Körbchen und einen Bauernkittel am Rücken. Er ging auf die Quelle zu, stillte gierig seinen Durst und erhob sich.
»He, Wlas!« rief Tuman, als er ihn erkannt hatte. »Grüß Gott, Bruder, woher des Weges?«
»Grüß Gott, Michailo Saweljitsch«, erwiderte der Bauer, zu uns herantretend. »Von weit her.«
»Wo hast du denn gesteckt?« fragte ihn Tuman.
»Ich war nach Moskau gegangen, zum Herrn.«
»Wozu?«
»Wollte ihn um was bitten.«
»Um was wolltest du ihn bitten?«
»Daß er mir den Erbzins ermäßigt oder mich auf Frondienst setzt oder mich anderswo ansiedelt. Mein Sohn ist mir gestorben, so werde ich allein nicht fertig.«
»Dein Sohn ist dir gestorben?«
»Er ist gestorben. – Der Selige«, fuhr der Bauer nach kurzem Schweigen fort, »hat in Moskau als Droschkenkutscher gelebt und hat für mich, die Wahrheit zu sagen, den Erbzins bezahlt.«
»Seid ihr denn jetzt auf Erbzins gesetzt?«
»Ja, auf Erbzins.«
»Was hat der Herr gesagt?«
»Was er gesagt hat? Weggejagt hat er mich! ›Wie wagst du es‹, sagt er, ›so einfach zu mir zu kommen? Dazu gibt es den Verwalter! Du bist«, sagt er, verpflichtet, es dem Verwalter zu melden. Und wo soll ich dich ansiedeln? Bezahl«, sagt er, ›erst den rückständigen Zins.‹ Ganz böse ist er geworden.«
»Nun, so gingst du zurück?«
»So ging ich zurück. Ich wollte mich erkundigen, ob der Selige nicht etwas hinterlassen hatte, konnte aber nichts erfahren. Ich sage zu seinem Herrn: ›Ich bin Philipps Vater«, und er sagt drauf: ›Woher soll ich das wissen? Dein Sohn hat auch nichts hinterlassen, er schuldet mir sogar noch Geld.« So ging ich zurück.«
Der Bauer erzählte uns das alles mit einem Lächeln, als wäre die Rede von etwas ganz anderm; aber in seine kleinen, zusammengekniffenen Augen traten Tränen, und seine Lippen zuckten.
»Nun, und jetzt gehst du nach Hause?«
»Wohin denn sonst? Versteht sich, nach Hause. Mein Weib pfeift jetzt wohl vor Hunger in die Faust.«
»Du hättest doch … ich meine …«, begann plötzlich Stjopuschka. Aber er wurde verlegen, verstummte und begann in seinem Topf zu wühlen.
»Wirst du nun zum Verwalter gehen?« fragte Tuman, Stjopoischka nicht ohne Erstaunen ansehend.
»Was soll ich zu ihm gehen? Ich bin ja mit dem Zins im Rückstand. Mein Sohn war vor dem Tode ein ganzes Jahr krank und hat darum für mich den Zins nicht bezahlt. Aber das macht mir nicht viel Sorge: Von mir ist doch nichts zu holen. Magst es noch so schlau anfangen, Bruder, aber holen kannst du von mir nichts!« Der Bauer lachte. »Was du auch anstellst, Kintiljan Semjonytsch, von mir ist nichts zu …«
Wlas fing wieder zu lachen an.
»Nun, das ist aber gar nicht gut, Bruder Wlas«, sagte Tuman gedehnt.
»Warum soll es nicht gut sein? Nein …« Wlas versagte die Stimme. »So heiß ist's«, fuhr er fort, sich das Gesicht mit dem Ärmel abwischend.
»Wer ist euer Herr?« fragte ich.
»Graf Valerian Petrowitsch.«
»Der Sohn des Pjotr Iljitsch?«
»Der Sohn des Pjotr Iljitsch«, antwortete Tuman. »Der selige Pjotr Iljitsch hat ihm das Dorf, in dem Wlas wohnt, schon bei Lebzeiten geschenkt.«
»Ist er gesund?«
»Ja, Gott sei Dank«, antwortete Wlas. »Ist ganz rot geworden, hat viel Fett im Gesicht.«
»Ja, Väterchen«, fuhr Tuman, sich zu mir wendend, fort, »wenn er ihn noch in der Nähe von Moskau halten wollte; aber er läßt ihn hier sitzen und verlangt von ihm den Zins.«
»Wieviel zahlt ihr denn pro Hof?«
»Fünfundneunzig Rubel«, murmelte Wlas.
»Da sehen Sie es: Die Leute haben fast kein Land, alles, was da ist, ist der herrschaftliche Wald.«
»Und auch der ist, sagt man, verkauft«, bemerkte der Bauer.
»Da sehen Sie es… Stjopa, gib mir mal einen Wurm her. Du, Stjopa! Bist du eingeschlafen?«
Stjopuschka fuhr zusammen. Der Bauer setzte sich zu uns. Wir verstummten wieder. Am ändern Ufer stimmte plötzlich jemand ein Lied an, aber ein so trauriges… Mein armer Wlas machte ein bekümmertes Gesicht…
Nach einer halben Stunde gingen wir auseinander.
Einmal im Herbst hatte ich mich auf der Rückfahrt von der Jagd erkältet und war krank geworden. Glücklicherweise ergriff mich das Fieber erst in der Kreisstadt, im Gasthaus, und ich schickte nach dem Arzt. In einer halben Stunde erschien der Kreisarzt, ein kleingewachsener hagerer Mann mit schwarzen Haaren. Er verschrieb mir das übliche schweißtreibende Mittel, verordnete ein Senfpflaster, steckte sehr geschickt den Fünfrubelschein in den Umschlag seines Ärmels, wobei er jedoch trocken hüstelte und zur Seite blickte, und wollte sich schon endgültig nach Hause begeben, fing aber plötzlich zu reden an und blieb. Das Fieber quälte mich; ich sah eine schlaflose Nacht voraus und war froh, mit einem Menschen sprechen zu können. Man brachte uns Tee. Mein Arzt kam ins Gespräch. Er war gar nicht dumm und drückte sich geschickt und recht amüsant aus. Es ist so merkwürdig auf der Welt: Mit manchem Menschen lebt man lange zusammen und in den freundschaftlichsten Beziehungen, und doch spricht man mit ihm niemals ganz offen, vom Grunde der Seele; einen andern hat man kaum kennengelernt, und schon sagt man ihm oder er uns wie in der Beichte alles, was auf dem Herzen ist.
Ich weiß nicht, womit ich das Vertrauen meines neuen Freundes gewonnen hatte, aber er erzählte mir, so mir nichts, dir nichts, einen recht interessanten Fall; ich aber bringe ihn zur Kenntnis des geneigten Lesers, wobei ich mir die Mühe gebe, die Worte des Arztes wiederzugeben.
»Sie kennen wohl nicht«, begann er mit schwacher, zitternder Stimme (das ist die Wirkung des unvermischten Berjosowschen Tabaks) – »Sie kennen wohl nicht den hiesigen Richter Pawel Lukitsch Mylow? Sie kennen ihn nicht… Nun, es ist ja gleich.« Er räusperte sich und rieb sich die Augen. »Die Sache passierte, wenn ich mich recht besinne, in den großen Fasten, beim richtigen Tauwetter. So sitze ich also bei ihm, dem Richter, und spiele Préférence. Unser Richter ist ein guter Mensch und spielt gerne Préférence. Plötzlich –«; mein Arzt gebrauchte sehr oft das Wort plötzlich, »– meldet man mir: ›Ein Mann will Sie sprechen.‹ – Ich frage: ›Was will er denn?‹ – ›Einen Zettel hat er gebracht, sagt man mir, ›wahrscheinlich von einem Kranken.‹ – ›Gib den Zettel her‹, sage ich. Es stimmt, es ist von einem Kranken. Nun gut, Sie verstehen doch: Das ist ja unser Brot. Die Sache ist aber die: Mir schreibt eine Gutsbesitzerin, eine Witwe, ihre Tochter liege im Sterben, ich solle um Gottes Willen hinfahren, auch Pferde seien nach mir geschickt. Das wäre alles noch gar nichts … Sie wohnt aber zwanzig Werst von der Stadt, es ist Nacht, und die Wege – nicht zu sagen! Auch ist's eine bettelarme Witwe, höchstens zwei Rubel habe ich zu erwarten, und auch das ist noch zweifelhaft; werde mich wohl mit Leinwand oder Graupen bezahlen lassen. Aber Sie verstehen doch: Die Pflicht geht über alles. Da liegt ja ein Mensch im Sterben. Also übergebe ich plötzlich meine Karten dem Gerichtsrat Kalliopin und gehe nach Hause. Ich sehe, vor dem Haus steht ein Bauernwägelchen, furchtbar dicke Bauernpferde, die Haare sind wie Filz, und der Kutscher sitzt vor Ehrfurcht ohne Mütze da. Ich denke mir: Nun, Bruder, deine Herrschaft speist wohl nicht von goldenen Tellern … Sie belieben zu lachen, aber ich muß Ihnen sagen, daß unsereins, armer Mensch, alles in Erwägung ziehen muß … Wenn der Kutscher wie ein Fürst dasitzt, die Mütze gar nicht abnimmt, dazu in den Bart lächelt und auch noch mit der Peitsche spielt – dann kann man sicher zwei Depositenscheine verlangen! Aber hier sehe ich, es riecht nicht danach. Doch ich denke mir: Es ist nichts zu machen, die Pflicht geht über alles. Ich nehme die notwendigsten Arzneien und fahre davon. Glauben Sie mir, wir kamen kaum an. Der Weg ist höllisch: Bäche, Schnee, Schmutz, ausgespülte Stellen, und an einer Stelle hat das Wasser gar den Damm durchbrochen – ein wahres Unglück! Ich komme aber doch an. Ein kleines Häuschen, mit Stroh gedeckt. In den Fenstern ist Licht: Also erwartet man mich. Mich empfängt ein ehrwürdiges, altes Mütterchen, mit einer Haube. ›Retten Sie sie‹, sagt sie, ›sie stirbt.‹ Ich sage: ›Beunruhigen Sie sich nicht. Wo ist die Kranke?« – ›Bitte, hier.‹ – Ich sehe ein sauberes Zimmerchen, in der Ecke brennt ein Lämpchen, im Bett liegt ein Fräulein, vielleicht zwanzig Jahre alt, bewußtlos. Sie glüht förmlich, und sie atmet schwer: hohes Fieber. Da sind auch zwei andere junge Mädchen dabei, ihre Schwestern – ganz erschrocken, in Tränen aufgelöst. ›Gestern‹, sagen sie, ›war sie noch gesund und aß mit Appetit; heute früh klagte sie über Kopfweh, und plötzlich gegen Abend ist sie in diesem Zustand.‹ Ich sage wieder: ›Beunruhigen Sie sich bitte nicht …‹. Es ist, wissen Sie, die Pflicht des Arztes – und mache mich an die Arbeit. Ich lasse sie zur Ader, verordne ein Senfpflaster und verschreibe eine Mixtur., Indessen sehe ich sie an, und wissen Sie: Bei Gott, so ein Gesicht habe ich noch nie gesehen – mit einem Wort, eine Schönheit! Das Mitleid schneidet mir das Herz entzwei. Die Gesichtszüge sind so angenehm, die Augen … Da wird sie, Gott sei Dank, ruhiger; es tritt Schweiß ein, sie kommt zu sich, sieht sich um, lächelt und fährt sich mit der Hand übers Gesicht… Die Schwestern beugen sich über sie und fragen: ›Was ist mit dir?‹ – ›Nichts‹, sagt sie und wendet sich weg … Ich sehe: Sie ist eingeschlafen. Nun sage ich, daß man die Kranke in Ruhe lassen solle. So gingen wir alle auf den Zehenspitzen hinaus, nur ein Dienstmädchen blieb für alle Fälle bei ihr. Im Gastzimmer steht aber schon der Samowar auf dem Tisch, auch Jamaikarum ist dabei: In unserem Berufe geht es eben nicht anders. Man gibt mir Tee und bittet mich, über Nacht dazubleiben … Ich willige ein. Wohin soll ich jetzt noch fahren? Das alte Mütterchen stöhnt immer. ›Was haben Sie?‹ sage ich ihr. ›Sie wird am Leben bleiben, machen Sie sich keine Sorgen und ruhen Sie sich lieber selbst aus, es ist schon nach zwei.‹ – ›Aber Sie werden mich doch wecken lassen, wenn was passiert?‹ – ›Gewiß, gewiß.‹ – Die Alte begab sich zur Ruhe, und auch die jungen Mädchen gingen auf ihr Zimmer; mir richtete man im Gastzimmer ein Bett her. So legte ich mich hin, konnte aber nicht einschlafen – merkwürdig! Ich war doch wirklich müde genug. Aber meine Kranke ging mir nicht aus dem Sinn. Endlich hielt ich es nicht länger aus, stand plötzlich auf; ich denke mir: Ich will mal hingehen und nachschauen, was die« Patientin macht. Ihr Schlafzimmer ist aber neben dem Gastzimmer. Ich stehe also auf und öffne leise die Tür; das Herz klopft mir dabei. Ich sehe, das Dienstmädchen schläft, hat den Mund offen und schnarcht sogar, die Bestie! Die Kranke aber liegt mit dem Gesicht zu mir und hat die Hände nach beiden Seiten geworfen, die Ärmste. Ich komme näher. .. Da öffnet sie plötzlich die Augen und sieht mich an! ›Wer ist das? Wer ist das?‹ – Ich wurde verlegen. – ›Fürchten Sie sich nicht‹, sage ich ihr, ›gnädiges Fräulein, ich bin der Arzt und will nachsehen, wie Sie sich fühlen.‹ – ›Sind Sie der Arzt?‹ – ›Gewiß … Ihre Frau Mama hat mich aus der Stadt holen lassen; wir haben Sie zur Ader gelassen, gnädiges Fräulein; wollen Sie jetzt schlafen, und in zwei Tagen werden wir Sie, so Gott will, wieder auf die Füße bringen.‹ – ›Ach, ja, ja, Doktor, lassen Sie mich, nicht sterben … bitte, bitte.‹ – ›Was haben Sie, Gott sei mit Ihnen!‹ – Sie hat wohl wieder Fieber, denke ich mir; ich fühle ihr den Puls, sie hat wirklich Fieber. Sie sah mich an und ergreift plötzlich meine Hand. ›Ich will Ihnen sagen, warum ich nicht sterben will, ich will es Ihnen sagen, ich will es Ihnen sagen … wir sind jetzt allein; aber bitte, Sie dürfen es niemand … hören Sie …‹ Ich beugte mich über sie; sie nähert ihre Lippen meinem Ohr, ihre Haare berühren dabei meine Wange … ich muß gestehen, mir schwindelte der Kopf – und sie fängt zu flüstern an … Gar nichts verstehe ich … Ach, sie phantasiert ja … Sie flüstert und flüstert so schnell, und es klingt gar nicht wie Russisch. Als sie fertig war, fuhr sie zusammen, ließ den Kopf in die Kissen sinken und drohte mir mit dem Finger. ›Also passen Sie auf, Doktor, keinem Menschen …‹ Ich beruhigte sie einigermaßen, gab ihr zu trinken, weckte das Dienstmädchen und ging hinaus.«
Der Kreisarzt nahm mit wütender Gebärde eine Prise und blieb einen Augenblick lang starr.
»Indessen«, fuhr er fort, »ging es der Kranken am anderen Tag, gegen meine Erwartung, nicht besser. Ich überlegte und überlegte und entschloß mich plötzlich, zu bleiben, obwohl mich andere Patienten erwarteten … Sie wissen doch, man darf seine Patienten nicht negligieren, die Praxis leidet darunter. Erstens befand sich aber die Kranke wirklich in einem verzweifelten Zustand; und zweitens fühlte ich mich, offen gestanden, zu ihr stark hingezogen. Außerdem gefiel mir auch die ganze Familie. Die Leute waren zwar arm, aber doch von einer seltenen Bildung … Der Vater war ein gelehrter Mann und sogar Schriftsteller gewesen; er war natürlich arm gestorben, hatte aber seinen Kindern eine ausgezeichnete Erziehung gegeben, hatte auch viele Bücher hinterlassen. Kam es daher, weil ich mich mit besonderem Eifer um die Kranke bemühte, oder aus einem anderen Grunde, jedenfalls darf ich sagen, daß sie mich im Hause liebgewonnen hatten wie einen Verwandten. Die Wege waren indessen noch schlechter geworden, jede Kommunikation hatte sozusagen aufgehört; selbst die Arzneien konnte man nur mit großer Mühe aus der Stadt beschaffen … Der Kranken ging es nicht besser … Ein Tag verging nach dem anderen … Und da … da …«
Der Kreisarzt schwieg eine Weile. »Ich weiß wirklich nicht wie ich es Ihnen sagen soll …« Er nahm wieder eine Prise, räusperte sich und trank einen Schluck Tee. »Ich will es Ihnen ohne Umschweife sagen, daß sich meine Patientin … in mich, wie man es so nennt … daß sie sich in mich verliebt hat … oder nein, eigentlich nicht verliebt … übrigens aber … wirklich …«
Der Kreisarzt senkte den Kopf und errötete.
»Nein«, fuhr er lebhaft fort, »von Verliebtheit war natürlich nicht die Rede! Jeder Mensch muß doch seinen Wert kennen. Sie war ein gebildetes, kluges und belesenes Mädchen, ich habe sogar mein Latein fast ganz vergessen. Und was das Äußere betrifft« – der Kreisarzt sah mich mit einem Lächeln an, »so kann ich damit wohl nicht prahlen. Aber als Dummkopf hat mich der liebe Gott auch nicht in die Welt gesetzt: Was weiß ist, werde ich nicht schwarz nennen; ich verstehe einiges von den Dingen. Ich hatte zum Beispiel sehr gut begriffen, daß Alexandra Andrejewna – keine Liebe zu mir empfand, sondern nur eine sozusagen freundschaftliche Zuneigung, eine Art Achtung. Es ist zwar möglich, daß sie sich selbst darin täuschte, aber sie befand sich in einer solchen Lage, Sie können es sich selbst denken … Übrigens«, fügte der Kreisarzt hinzu, der alle diese abgebrochenen Sätze in einem Atem und in sichtlicher Verwirrung gesprochen hatte, »ich bin, glaube ich, zu weit abgeschweift … So werden Sie nichts verstehen … gestatten Sie, daß ich Ihnen alles der Reihe nach erzähle.«
Er trank sein Glas Tee aus und fuhr mit ruhigerer Stimme fort.
»So war es also. Meiner Kranken ging es immer schlimmer und schlimmer. Sie sind kein Mediziner, verehrter Herr, und können nicht begreifen, was in der Seele unsereines vorgeht, besonders in der ersten Zeit, wenn wir zu merken anfangen, daß die Krankheit uns über den Kopf wächst. Wo bleibt dann unser Selbstvertrauen! Man verliert plötzlich jeden Mut. Man glaubt, alles vergessen zu haben, was man einmal gewußt hat, man glaubt, daß der Kranke kein Vertrauen mehr hat und daß auch die anderen schon unsere Ratlosigkeit merken, daß sie uns widerwillig die neuen Symptome mitteilen und uns scheel ansehen, daß sie miteinander tuscheln – mit einem Wort, es ist schlimm! Es gibt doch wohl eine Arznei, sagt man sich, gegen diese Krankheit, und es gilt nur, sie zu finden. Ist es vielleicht diese? Man macht den Versuch, nein, es ist nicht die richtige. Man läßt der Arznei keine Zeit, ordentlich zu wirken … bald greift man nach dieser, bald nach jener. Man nimmt das Rezeptbuch zur Hand und denkt sich, das richtige Mittel steht doch drin! Bei Gott, manchmal schlägt man das Buch aufs Geratewohl auf und denkt sich, vielleicht hilft das Schicksal … Der Mensch liegt indessen im Sterben; ein anderer Arzt könnte ihn sicher retten. Du sagst, es sei ein Konsilium nötig, du wollest die Verantwortung nicht allein tragen. So dumm schaust du aber in solchen Fällen aus! Doch mit der Zeit gewöhnst du dich daran, und es macht dir nichts. Der Kranke ist gestorben, es ist nicht deine Schuld, du bist nach allen Regeln vorgegangen. Noch qualvoller ist aber dieses: Du siehst das blinde Vertrauen, das man dir entgegenbringt, und fühlst dabei, daß du nicht helfen kannst. So ein Vertrauen setzte eben die ganze Familie Alexandra Andrejewnas auf mich: Sie hatten ganz vergessen, daß ihre Tochter in Lebensgefahr schwebte. Ich suche sie auch meinerseits zu überzeugen, daß es nichts Ernstes sei, aber das Herz krampfte sich mir vor Gram zusammen. Um das Unglück voll zu machen, waren die Wege so schlecht geworden, daß der Kutscher mit den Arzneien oft ganze Tage ausblieb. Ich verlasse das Krankenzimmer nicht, kann mich von ihr nicht losreißen, erzähle ihr, wissen Sie, allerlei lustige Anekdoten, spiele Karten mit ihr. Durchwache ganze Nächte. Die Alte dankt mir mit Tränen in den Augen, ich aber denke mir: Ich verdiene diesen Dank nicht. Ich gestehe es Ihnen offen, jetzt brauche ich es nicht mehr zu verheimlichen – ich verliebte mich in meine Kranke. Auch Alexandra Andrejewna hing an mir; außer mir ließ sie niemand zu sich ins Zimmer. Sie spricht mit mir, fragt mich aus, wo ich studiert habe, wie ich lebe, wer meine Verwandten seien, mit wem ich verkehre. Ich weiß, daß sie nicht sprechen darf, aber ich bringe es nicht übers Herz, es ihr zu verbieten. Manchmal fasse ich mich beim Kopf und rufe: ›Was tust du, Verbrecher …?‹ Oder sie nimmt mich bei der Hand, hält meine Hand fest, sieht mich an, sieht mich lange, lange an, seufzt und sagt: ›Wie gut sind Sie!‹ Sie hat so heiße Hände, große, schmachtende Augen. ›Ja‹, sagt sie, ›Sie sind ein guter Mensch, ganz anders als unsere Nachbarn … nein, Sie sind ganz anders… Warum habe ich Sie nicht schon früher kennengelernt – ›Alexandra Andrejewna, beruhigen Sie sich‹, sage ich ihr, ›glauben Sie mir, ich fühle es, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe … aber beruhigen Sie sich … alles wird gut werden, Sie werden gesund werden.‹ – Indessen muß ich Ihnen sagen«, fügte der Kreisarzt hinzu, indem er sich etwas vorbeugte und die Augenbrauen hob, »die Leute verkehrten mit den Nachbarn fast gar nicht, weil die kleineren Leute zu ihnen nicht paßten, aber mit den Reichen zu verkehren ihnen der Stolz nicht erlaubte. Ich sage Ihnen ja: Es war eine außerordentlich gebildete Familie; ich fühlte mich sogar geschmeichelt. Nur aus meinen Händen nahm sie die Arznei … die Ärmste setzte sich mit meiner Hilfe im Bett auf, schluckte die Arznei herunter und sah mich so an, daß mir das Herz stillstand. Indessen ging es ihr immer schlimmer und schlimmer; sie wird sterben, denke ich mir, sie wird ganz gewiß sterben. Glauben Sie es mir, ich könnte selbst ins Grab steigen. Ihre Mutter und die Schwestern beobachten mich und sehen mir in die Augen … und das Vertrauen schwindet. ›Nun? Wie geht es?‹ – ›Es geht nicht schlecht!‹ Aber von ›nicht schlecht« ist nicht die Rede, der Verstand steht mir still. So sitze ich eines Nachts wieder allein neben der Kranken. Das Dienstmädel sitzt auch da und schnarcht, was sie schnarchen kann … Dem unglücklichen Mädel konnte man keine Vorwürfe machen: Sie war zu abgehetzt. Alexandra Andrejewna hatte sich den ganzen Abend sehr schlecht gefühlt: Das Fieber quälte sie. Bis zur Mitternacht hatte sie sich hin und her gewälzt; endlich schien sie eingeschlafen zu sein; jedenfalls lag sie unbeweglich da. In der Ecke vor dem Heiligenbild brennt das Lämpchen. Ich sitze da, das Gesicht gesenkt, schlummere ebenfalls ein wenig. Plötzlich ist es mir, als stieße mich jemand in die Seite; ich wende mich um … Du lieber Gott! Alexandra Andrejewna starrt mich an … die Lippen stehen offen, die Wangen glühen förmlich. ›Was ist Ihnen?‹ – ›Doktor, ich werde doch sterben?‹ – ›Gott bewahre!‹ – ›Nein, Doktor, sagen Sie mir bitte nicht, daß ich leben werde … sagen Sie es nicht … wenn Sie nur wüßten … hören Sie, um Gottes willen, verheimlichen Sie vor mir meinen Zustand nicht!‹ Und dabei atmet sie so schnell. ›Wenn ich sicher wissen werde, daß ich sterben muß … dann werde ich Ihnen alles, alles sagen!‹ – ›Alexandra Andrejewna, ich bitte Sie!‹ – ›Hören Sie, ich habe ja gar nicht geschlafen, ich sehe Sie schon lange an … um Gottes willen … ich vertraue Ihnen, Sie sind ein guter Mensch, ein prächtiger Mensch, ich beschwöre Sie bei allem, was Ihnen heilig ist, sagen Sie mir die Wahrheit! Wenn Sie wüßten, wie wichtig es für mich ist … Doktor, um Gottes willen, sagen Sie mir, mein Zustand ist doch gefährlich?‹ – ›Was soll ich Ihnen sagen, Alexandra Andrejewna, ich bitte Sie!‹ – ›Um Gottes willen, ich flehe Sie an!‹ – »Ich kann es Ihnen nicht verhehlen, Alexandra Andrejewna, daß Ihr Zustand wirklich gefährlich ist, aber Gott ist gnädig …‹ – ›Ich werde sterben, ich werde sterben…‹ Und es schien, als freute sie sich darüber, ihr Gesicht wurde so heiter; ich erschrak. – ›Aber fürchten Sie sich nicht, fürchten Sie sich nicht, der Tod schreckt mich nicht.‹ Sie erhob sich plötzlich und stützte sich auf einen Ellenbogen. ›Jetzt … jetzt kann ich Ihnen sagen, daß ich Ihnen von ganzem Herzen dankbar bin, daß Sie ein guter, prachtvoller Mensch sind, daß ich Sie liebe …‹ Ich sehe sie wie wahnsinnig an; es ist mir ganz unheimlich zumute … ›Hören Sie es, ich liebe Sie …‹ – ›Alexandra Andrejewna, womit habe ich es verdient!‹ – ›Nein, nein, Sie verstehen mich nicht … du versteht mich nicht …‹ Und plötzlich streckte sie die Hände aus, umfaßte meinen Kopf und küßte mich … Glauben Sie mir, ich hätte beinahe aufgeschrien …! Ich fiel in die Knie und barg den Kopf ins Kissen. Sie schweigt; ihre Finger zittern in meinen Haaren; ich höre, sie weint. Ich beginne, sie zu trösten, ihr zuzureden … ich weiß wirklich nicht mehr, was ich ihr alles sagte. – ›Sie werden das Mädel wecken, Alexandra Andrejewna … ich danke Ihnen … glauben Sie mir … beruhigen Sie sich.‹ – »Ist schon gut, ist schon gut‹, sagte sie immer wieder. ›Gott sei mit ihnen allen; gut, sie werden erwachen, gut, sie werden herkommen, es ist mir ganz gleich: Ich werde doch sterben … Aber was fürchtest du? Heb doch den Kopf … Oder Sie lieben mich vielleicht nicht, vielleicht habe ich mich getäuscht … in diesem Falle verzeihen Sie mir.‹ – ›Alexandra Andrejewna, was sagen Sie …? Ich liebe Sie, Alexandra Andrejewna.‹ Sie blickte mir gerade in die Augen und öffnete die Arme. – ›Umarme mich denn …‹ Ich will es Ihnen offen sagen: Ich verstehe nicht, wie ich in jener Nacht nicht den Verstand verloren habe. Ich fühle, meine Patientin richtet sich selbst zugrunde; ich sehe, sie ist nicht bei Besinnung; ich verstehe auch, daß wenn sie nicht glaubte, sie müsse gleich sterben, sie an mich gar nicht gedacht hätte. Wie Sie wollen, es ist doch unheimlich, mit fünfundzwanzig Jahren zu sterben, ohne jemand geliebt zu haben. Das war es, was sie quälte, darum klammerte sie sich in ihrer Verzweiflung an mich – verstehen Sie es jetzt? Aber, sie läßt mich nicht aus ihren Armen los. ›Erbarmen Sie sich meiner, Alexandra Andrejewna, erbarmen Sie sich auch Ihrer selbst!‹ sage ich ihr. – ›Warum‹, sagt sie, ›soll ich mich erbarmen? Ich muß ja doch sterben ….‹ Das wiederholte sie in einem fort. – ›Wenn ich wüßte, daß ich am Leben bleibe und daß ich ein anständiges junges Mädchen sein werde, dann würde ich mich schämen, ich würde mich wirklich schämen … aber so?‹ – ›Wer hat Ihnen denn gesagt, daß Sie sterben werden ?‹ – ›Ach, hör auf, du wirst mich nicht betrügen, du verstehst gar nicht zu lügen, sieh mich nur an.‹ – ›Sie werden am Leben bleiben, Alexandra Andrejewna, ich werde Sie gesund machen; wir werden Ihre Frau Mama um ihren Segen bitten … wir werden uns durch das Band der Ehe verbinden, wir werden glücklich sein.‹ – ›Nein, nein, ich habe Ihr Wort, ich muß sterben … du hast mir versprochen … du hast mir gesagt …‹ Es war mir so bitter, aus vielen Gründen bitter. Urteilen Sie selbst, was man nicht alles erlebt. Man könnte meinen, es sei nichts Wichtiges, und doch tut es weh. Es fiel ihr ein, mich nach meinem Namen zu fragen, nicht nach dem Familiennamen, sondern nach dem Vornamen. Nun habe ich das Unglück, Trifon zu heißen. Jawohl: Trifon, Trifon Iwanowitsch. Alle im Hause nannten mich einfach Doktor. Es ist nichts zu machen, ich sage ihr: ›Ich heiße Trifon, gnädiges Fräulein.‹ Sie kniff die Augen zusammen, schüttelte den Kopf und flüsterte etwas auf französisch, sicher etwas gar nicht Gutes; und dann lachte sie auch, und auch das Lachen war nicht gut. So verbrachte ich mit ihr fast die ganze Nacht. Am Morgen ging ich wie betrunken aus dem Zimmer; erst am Tag, nach dem Tee, kam ich wieder zu ihr. Mein Gott, mein Gott! Sie war nicht mehr zu erkennen, eine Leiche sieht besser aus. Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, daß ich jetzt absolut nicht verstehe, wie ich diese Marter habe aushalten können. Drei Tage und drei Nächte quälte sich noch meine Kranke … und was waren es für Nächte! Und was sie mir alles sagte …! Aber in der letzten Nacht, denken Sie sich nur, ich sitze neben ihr und bitte Gott nur um das eine: Nimm sie schneller zu dir, und auch mich dazu … Plötzlich tritt die alte Mutter ins Zimmer … Ich hatte der Mutter schon am Tag vorher gesagt, daß nur wenig Hoffnung vorhanden sei und daß es gut wäre, den Geistlichen zu holen. Als die Kranke die Mutter erblickte, sagte sie: ›Es ist gut, daß du gekommen bist … schau uns an, wir lieben einander, wir haben einander das Wort gegeben.‹ – ›Was hat sie, Doktor, was redet sie?‹ Ich war ganz starr. ›Sie phantasiert‹ sage ich, ›es ist das Fieber …‹ Sie aber sagt: ›Hör doch auf, eben hast du mir doch ganz was anderes gesagt und hast meinen Ring angenommen … Warum verstellst du dich? Meine Mutter ist gut, sie wird verzeihen, sie wird verstehen; ich aber sterbe, ich brauche nicht zu lügen … gib mir die Hand …‹ Ich sprang auf und lief hinaus. Die Alte erriet natürlich alles.
Ich will Sie jedoch nicht länger ermüden, und es fällt mir auch selbst schwer, mich daran zu erinnern. Meine Kranke starb am nächsten Tag. Gott hab' sie selig!« fügte der Kreisarzt schnell und mit einem Seufzer hinzu. »Vor dem Tode bat sie ihre Angehörigen, hinauszugehen und sie mit mir allein zu lassen. ›Entschuldigen Sie‹, sagte sie mir, ›vielleicht habe ich Ihnen unrecht getan … meine Krankheit … aber glauben Sie mir, ich habe niemand mehr als Sie geliebt … vergessen Sie mich nicht … bewahren Sie meinen Ring …‹«
Der Kreisarzt wandte sich ab; ich faßte seine Hand.
»Ach«, sagte er, »wollen wir doch von etwas anderem reden, oder spielen wir vielleicht eine kleine Partie Préférence? Es ist für unsereinen nicht gut, sich so erhabenen Gefühlen hinzugeben. Unsereins hat nur an das eine zu denken – daß seine Kinder nicht schreien und daß seine Frau nicht schimpft. Ich bin nämlich seither in eine legitime Ehe getreten … Gewiß … Eine Kaufmannstochter habe ich genommen mit siebentausend Rubel Mitgift. Sie heißt Akulina, das paßt gut zu Trifon. Sie ist, offen gestanden, ein böses Frauenzimmer, schläft aber glücklicherweise den ganzen Tag … Nun, wie wäre es mit dem Préférence …?«
Wir setzten uns ans Préférencespiel zu einer Kopeke das Point. Trifon Iwanowitsch gewann zwei und einen halben Rubel und ging spät heim, sehr zufrieden mit seinem Sieg.