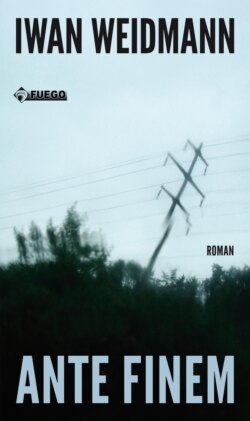Читать книгу Ante Finem - Iwan Weidmann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWIE JEDEN MORGEN in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren verließ Karl, nachdem er sich von Sophie verabschiedet hatte, das Haus. Nur etwas war an diesem Morgen anders. Er war fest entschlossen, nicht mehr zurückzukehren.
Während des ganzen Vierteljahrhunderts, das Sophie bei ihm gelebt hatte, hatte Karl beim Weggehen nicht ein einziges Mal zurückgeblickt. Gleichwohl besaß er eine genaue Vorstellung davon, wie sich der Umriss ihres Körpers kaum erkennbar hinter dem Vorhang ihres Zimmers im ersten Stock abzeichnete, während sie, stets einen Schritt hinter dem Fenster, mit ihrem Blick erst seinem Gang zur Garage und anschließend der Wegfahrt des Wagens folgte.
Karl erinnerte sich an das erste Mal, als er Sophie im Haus zurückgelassen hatte. Wie ihm alle paar Schritte ein neues Bild erschienen war. Als wären seine Gedanken durch eine Ausstellung geschweift. Die meisten Bilder nur streifend, hin und wieder einen Augenblick vor einem verweilend, um dann doch, zögernd manchmal, meist aber entschlossen, weiterzugehen. Und plötzlich war es da, dieses Bild, neben dem alle anderen verblassten.
Seither trug er es in seinem Kopf. Wie er überhaupt alles, an das er sich gerne erinnerte oder dessen Vorstellung er mochte, als Bild in seinem Kopf mit sich trug. Sorgsam arrangierte er jedes Detail, bevor er eine Vorstellung fixierte. Und alles, was seine Netzhaut belichtete, betrachtete er wie durch den Sucher einer Kamera. Zur Erinnerung stets darauf bedacht, den richtigen Ausschnitt vor dem Druck auf den Auslöser zu bestimmen. Wollte er doch weder zu viel auf dem Bild noch etwas Wesentliches auslassen oder, schlimmer noch, anschneiden. Es sei denn, dass Anschneiden oder Weglassen ein eindringlicheres Bild als die Abbildung des Ganzen hätten entstehen lassen.
Für Karl gab es keinen Unterschied zwischen Fotografie und Gedächtnis. Nicht das kleinste Stück Film und nicht den winzigsten Gedanken hat er jemals an ein schlechtes Bild verschwendet. Alles, was er immer hatte werden wollen, war Fotograf. Arzt ist er geworden. Anstatt Bilder zu komponieren, hatte er einem bereits vor seiner Geburt entwickelten Bild entsprochen.
Mehr als die Lustlosigkeit, mit der er das Studium absolvierte, traf den Vater die Leichtigkeit, mit der Karl mit Auszeichnung promovierte. Für die Dozenten kein Wunder, schließlich war er der Sohn von Heinrich Bessler. Dem Heinrich Bessler, dessen Name von der Bessler-Resektion bis zur Magensonde nach Bessler in kaum einem Lehrbuch und keinem Instrumentenkatalog fehlte.
Das Bild von dem Tag, an dem er mit seinem Examensergebnis den Salon der Villa betreten hatte, war wohl das ehrlichste, das Karl von seinem Vater in Erinnerung hatte. Das intime Portrait eines müden Akteurs. Enttäuschung, die nicht vordergründig als Ausdruck erscheint, sondern sich vielmehr als leiser Unterton zu erkennen gibt. Zwar auf den ersten Blick das Bild eines Mannes, der in einem Sessel sitzend mit einer Zeitung in den Händen den Eindruck vermittelt, als würde er Anteil nehmen am Geschehen. Bei näherem Hinsehen sind die Augen jedoch nicht auf eine Zeile gerichtet, sondern blicken scheinbar durch das Papier hindurch, ruhen leer auf einem für den Betrachter nicht auszumachenden Punkt auf dem Boden. So erhält die Zeitung plötzlich eine ganz andere Funktion, scheint der Portraitierte sich aus einer innersten Scham heraus mit dem Papier bedecken, dahinter seine Verletztheit verbergen zu wollen.
Ohne von der Zeitung aufzusehen, meinte Heinrich Bessler, mehr vor sich hin als zu seinem Sohn: »Das Studium macht noch niemanden zum Arzt. Ein Arzt ist sein Leben lang im Werden.«
Dieses Werden hatte bei Heinrich Bessler während des Ersten Weltkriegs seinen populären Höhepunkt erreicht. Zwar hatte er, da Verletzungen der Gefäße zu den häufigsten Amputationsgründen gehörten, schon lange vor Kriegsausbruch wiederholt Versuche der Gefäßrekonstruktion unternommen. Doch erst die große Anzahl an Gefechtsverwundungen ermöglichte ihm, seine bis dahin hauptsächlich an Leichen gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen.
Als Sanitätsoffizier hatte er mit sicherem Blick die Fälle ausgesucht, die von seinen Kollegen als hoffnungslos eingestuft worden waren, für sein Vorhaben jedoch eine gute Perspektive boten. Dabei musste er feststellen, dass seine Nähte in den wenigsten Fällen hielten und von seinen bisherigen Versuchen eigentlich nur die damit erworbene Bewegungsroutine unter der großen Lupe, die er für diese Eingriffe hatte anfertigen lassen, wirklich von Nutzen war. Erst in seiner Lazarettzeit entwickelte er die zum Standard gewordene Gefäßnaht nach Bessler. Auch zeigte sich während dieser Praxis die weitgehende Unzulänglichkeit zur Verfügung stehender Operationsbestecke, aus deren Formulierung zahlreiche Änderungen bestehender Instrumente und Neuentwicklungen hervorgegangen sind. Die weitaus größten Schwierigkeiten bereitete allerdings immer wieder das kleinste Werkzeug. Das damals übliche Federöhr der Nadeln schädigte beim Durchziehen das empfindliche Gewebe, was Heinrich Bessler über die Möglichkeit einer stufenlosen Verbindung von Nadel und Faden nachdenken ließ. 1920 wurde seine atraumatische Nadel-Faden-Kombination patentiert. Gleichen Jahres veröffentlichte er Die Gefäßchirurgie im Frieden und im Felde. Im zweiten Kriegsjahr bekam Heinrich Bessler den Pour le Mérite verliehen. Und wenige Wochen nach Kriegsende wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Oberstabsarzt der Reserve befördert.
Dass nach seinen Eingriffen vielfach doch noch amputiert werden musste und er wegen der häufig gleichzeitigen Nervenschäden meist nur eine teilweise Funktionserhaltung erreichte, Arme schlaff herunterhingen und Beine bloß nachgezogen werden konnten, schadete seinem Ruf gerade in den Schützengräben nicht im Geringsten. Unter den Soldaten hatte sich schnell herumgesprochen, dass der Professor nicht einfach zur Säge griff, sondern erst einmal alles unternahm, um sie ganze Männer bleiben zu lassen.
Was die Zunahme seiner Bekanntheit anging, war Heinrich Bessler ein Kriegsgewinnler. Endlich war er nicht mehr nur in Fachkreisen geachtet, sondern eine prominente Persönlichkeit geworden. Von Müttern und Ehefrauen erhielt er Dankesbriefe. Und Zeitungen und Illustrierte widmeten ihm lange Artikel.
Nur einmal, Jahre später, nachdem er in München aus einer Gruppe vorbeiziehender SA-Männer unvermittelt angerufen worden und einer der Uniformierten herausgetreten war, um ihn erhobenen Armes zu begrüßen, »Heil Hitler, Herr Professor«, und freudig seinen Begleitern vorzustellen, »Kameraden, das ist der Mann, der meine Beine gerettet hat«, hörte Karl seinen Vater, während er vom Tisch aufstand, an dem er während des Abendessens die Begegnung scheinbar unbeteiligt geschildert hatte, leise sagen: »Wahrscheinlich ist es besser, dass man als Arzt nicht immer weiß, wen man gerade behandelt.«
Karl mochte, wie der Kies auf dem Vorplatz unter seinen Schritten knirschte. Das Geräusch, von dem der Gärtner seines Vaters einmal gesagt hatte, dass es sich privilegiert anhöre. Und als hätte er keinen Misston zulassen wollen, hatte er mit der Harke penibel auch die kleinsten Blättchen aus dem Kies entfernt und so ab und an ungewollt ein Muster hinterlassen, das entfernt an einen japanischen Steingarten denken ließ, der eine Eiche umrahmte. Eine Eiche, die schon stand, lange bevor die Villa und die Garage, die ursprünglich als Stallung mit darüber liegender Personalwohnung gebaut worden war, angefangen hatten, ihr Backstein für Backstein die Herrschaft über den Ort abzunehmen.
Von solch akribischer Ordnung hatten sich der Vorplatz und überhaupt das ganze Anwesen inzwischen weit entfernt. An der das Grundstück umgebenden Mauer war Efeu hochgeklettert und hatte sich zu einem immergrünen Vorhang drapiert, der zwar stellenweise etwas lichter fiel, doch über die meiste Strecke von längst verholzten Armen dicht zusammengehalten wurde. Und wie um zu verhindern, dass jemand diesen Efeuvorhang lüftete, hatte sich zu dessen Saum ein undurchdringlicher Stachelverhau aus Brombeerstauden ausgebreitet.
Karl liebte diese Beeren, die Sophie mit Rahm, Honig, Eigelb und etwas Zitronensaft zu einer wunderbar erfrischenden Creme verrührte. Überhaupt gab es nichts, was Sophie zubereitete, das ihm nicht schmeckte. Vor allem die böhmischen Gerichte wie Svíčková oder Karpfen schwarz zu Weihnachten. Und natürlich Buchteln und Marillenknödel. Vielleicht, weil gerade mit dieser Küche etwas von seiner Mutter, auch sie eine gebürtige Tschechin, in dem Haus weiterlebte.
Sie war es auch gewesen, die hinter der Villa einen Kräuter- und Gemüsegarten angelegt und mit der Pflanzung von Obstbäumen einen Ort geschaffen hatte, der zu einem Paradies im Paradies herangewachsen war. Denn gleichwohl schon lange nichts mehr in seinem Wachstum beschnitten wurde, der einst gehegte Rasen längst zur wilden Wiese geworden war, machte das Grundstück keinen verwahrlosten Eindruck. Vielmehr war die Natur durch das Ausbleiben jeglichen Zurechtstutzens einfach der strengen Exaktheit in die eigene Harmonie entwachsen.
Lediglich einmal, irgendwann im Sommer, sowie im Herbst, wenn alle Bäume ihr Laub abgeworfen hatten, ließ Karl den Gärtner aus dem nahen Tutzing kommen. Dieser fuhr dann jeweils, da die Arbeiten alleine unmöglich, wie von ihm verlangt, an einem Tag zu erledigen waren, frühmorgens mit mehreren Hilfsarbeitern auf seinem Lastwagen vor.
Es schmerzte Karl, aber mehr noch schämte er sich und fühlte seine Schuld, wenn er sah, wie Sophie, obwohl sie lange im Voraus wusste, wer da kommen würde, gegen die Panik ankämpfen musste, die sie trotzdem jedes Mal erfasste, wenn sie den lauten Motor vor dem Haus hörte und kurz darauf die Männer von der Pritsche sprangen.
»Du musst mich für sehr undankbar halten«, hatte Sophie einmal an einem solchen Morgen zu Karl gesagt, nachdem er sie im Badezimmer zitternd auf dem Wannenrand sitzend gefunden und unsanft hochgerissen hatte, um mit einer hilflosen Umarmung dieses ungeheure Zittern, das sie gleich einem epileptischen Anfall schüttelte, zu ersticken. Einer Umarmung, die in ihrer unbewussten Heftigkeit augenblicklich zur panischen Umklammerung eines in seinen Gefühlen ebenfalls Untergehenden geworden war, und der sich Sophies Körper nur mit einer Ohnmacht hatte entziehen können. An einem anderen dieser Morgen entschuldigte sich Sophie unter Tränen dafür, dass sie sich aus seinen Armen gewunden und auf ihn eingeschlagen hatte. In solchen Augenblicken schrie es in Karl: »Lügner! Betrüger!« Doch keiner dieser Schreie drang jemals nach draußen.
An diesem herrlichen Septembermorgen spürte Karl nicht nur, wie sich mit jedem Schritt die Steinchen unter den Schuhsohlen verschoben und aneinander rieben, sondern auch vereinzelt dürre Ästchen brechen und hin und wieder eine Eichel bersten. Und weil schon lange niemand mehr sich die tägliche Mühe machte, den Kies auf die freigetretenen Stellen zurückzurechen, tat Karl immer wieder auch einen unhörbaren Schritt auf ganz oder teilweise von Gras bewachsener Erde, was in der Regelmäßigkeit seines Ganges plötzliche Pausen entstehen ließ. Als würde er auf seinem Weg ab und an innehalten – zögern. Doch was Karl vorhatte, war wohlüberlegt. Und zu seinem Entschluss gab es keine Alternative.
Um den Wagen aus der Garage zu fahren, reichte es, wenn er den rechten Flügel des großen Tores öffnete. Aber schon diese Torhälfte zu bewegen, die müden Scharniere unter der jahrzehntealten Last des schweren Holzes immer wieder aus ihrem Ruhestand, aus dem sie dann mit lautem Knacken aufschreckten, zur Arbeit zu zwingen, kostete Karl bereits seit Monaten fast seine ganze Kraft. Und war dieser Anfangswiderstand einmal mehr gebrochen, besann sich das Eisen jeweils derart unvermittelt auf seine Bestimmung, dass er aufpassen musste, wollte er nicht den Stand verlieren und vom Schwung des Torflügels umgerissen werden.
Schließlich, vor etwas mehr als drei Wochen, nachdem Karl die Torhälfte einmal mehr unter größter Anstrengung aufgewuchtet hatte, riss sich sein Körper von den Fäden, mit denen er glaubte, ihn immer wieder über die zunehmend enger gesteckten Grenzen dirigieren zu können. Er hatte nicht den Eindruck, das Bewusstsein verloren zu haben, konnte sich aber auch nicht an den Krach erinnern, den das Aufschlagen des Torflügels auf der Mauer doch verursacht haben musste. Erst nachdem die Backsteine das Holz zurückgeworfen hatten, vernahm Karl das scheinbar unendlich weit entfernte Knarren, das im nächsten Augenblick, als würde Watte aus seinen Gehörgängen gezogen, bedrohlich nahe mit dem Kreischen der Scharniere zu einem einzigen Aufschrei wurde, mit dem der Torflügel nur wenig neben seinem Kopf zum Stehen kam.
Sein erster Gedanke war Sophie. Sofort bemühte er sich, noch benommen und tapsig wie neugeborenes Wild, das instinktiv zum Aufstehen getrieben wird, wieder auf die Beine zu kommen und sich ihrem Blick zu entziehen. Halb aufgestanden begann er bereits, kopfschüttelnd den Staub von seinem Anzug zu klopfen und hoffte, seinem Schwächeanfall damit den Anschein eines harmlosen Ausrutschers geben zu können, wankte, nachdem er den Torflügel an der Wand arretiert hatte, in die Garage und ließ sich hinter das Steuer seines Wagens fallen.
Es war ihm nicht bewusst, dass er den Schlüssel in das Zündschloss steckte. Karl realisierte auch nicht, wie er den Wagen startete und vom Grundstück auf die Straße lenkte. Selbst das plötzlich einsetzende Wippen des Sitzes drang nicht in sein Bewusstsein. Auch nicht, als es zum wilden Rütteln geworden war, das die Federn unter der Polsterung zunehmend heftiger ächzen ließ und seinen Kopf immer schneller hin und her warf. Dazu kreischte zu wütendem Poltern, von Karl genauso ungehört, das Blech. Dann plötzlich Stille.
Bis zum Mittag hatte Karl sich nicht bewegt. Weder schlief er, noch war er wach. Er war einfach ohne jeden Gedanken. Irgendwann ein Klopfen. Augenblicklich auch wieder Schmerzen. Und ein Gesicht: »Hören Sie mich?« Nachdem er das Fenster heruntergelassen und den jungen Mann beschwichtigt hatte, indem er ihm wiederholt versicherte, es ginge ihm gut, er sei selbst Arzt, stieg Karl aus und betrachtete den Schaden. Anschließend fuhr er nach München, um sich in seiner Praxis, in der er schon lange keine Patienten mehr empfing, frisch zu machen und das weiße Hemd zu wechseln, auf dessen Knopfleiste, offenbar aus der winzigen bereits verschorften Wunde an seiner Schläfe, die einzige Verletzung die Karl feststellen konnte, etwas Blut getropft war.
»Es dauert wirklich bloß eine Woche«, versprach der Geschäftsführer der Mercedes-Niederlassung, dem es sichtlich unangenehm war, dass er Karl weder von der Einfachheit der Wiederherstellung der zerkratzten Beifahrerseite, die gut zwanzig Meter an der Backsteinmauer des Grundstücks entlanggeschrammt war, noch von der Schnelligkeit, mit der die Reparatur ausgeführt werden konnte, zu überzeugen vermochte, »vielleicht schaffen wir es auch in vier Tagen«.
Am gleichen Abend fuhr Karl in einem identischen neuen Mercedes 200 in makellosem Arabergrau, der für ihn telefonisch in der Ausstellung einer anderen Niederlassung aufgespürt und sogleich von einem Mitarbeiter nach München überführt worden war, nach Hause.
Nun ging er zum letzten Mal zu der Garage. Dass seit seinem Hinfallen ein Torflügel offenstand, hatte er Sophie gleichentags in einer seiner längst zum Automatismus gewordenen vorauseilenden Erklärungen mit einem lockeren Scharnier begründet, das er, bevor es sich unter nochmaliger Belastung ganz aus der Mauer lösen würde, erst wieder richtig einmauern wolle.
Karl wunderte sich, wie leicht er sich fühlte. Zum ersten Mal musste er sich keine Erklärungen mehr einfallen lassen, Sophie nichts mehr verheimlichen. Doch kaum wurde er sich dieser ungewohnten Leichtigkeit gewahr, spürte er einen Anflug von Traurigkeit. Eine Wehmut, die ihn erst ein paar Schritte umschwirrte, bevor sie ihn als stechender Schmerz durchdrang, an seinen Eingeweiden zog und kurz glauben ließ, er müsse sich erbrechen.
Am liebsten hätte er sich umgedreht und zu Sophie hochgesehen. Aber er konnte es nicht. Genauso, wie er jedes Mal, wenn er ihr die Wahrheit sagen, ihr alles erklären wollte, feststellen musste, dass er dazu gänzlich unfähig war. Er brachte es einfach nicht fertig, aus seiner Rolle auszubrechen, in der als Konsequenz dieser erbärmliche Abgang vorgegeben war. Also wandte er seinen Blick stattdessen über die leicht abfallende Wiese hinweg hinunter zum See.
Es sah aus, als ob sich das Anwesen mit einem eindrücklichen Arrangement von ihm verabschieden, ihm ein letztes Bild mitgeben wollte. Über den Bäumen am anderen Ufer schwebte majestätisch eine riesige perfekt modellierte Kumuluswolke. Um sich in ihrem strahlenden Weiß präsentieren zu können, schien sie fast das ganze Licht der Morgensonne aufzusaugen, so dass der See sich im Dunkel ihres Schattens beinahe verlor. Karl konnte sich nicht erinnern, zu dieser Stunde jemals ein derartiges Licht gesehen zu haben. Vor seinem inneren Auge hatte er sogleich ein anderes Bild: The Big White Cloud von Edward Steichen.
Er schloss die Augen. Nach einer Weile, als er sich als Knabe in kurzen Hosen unten neben dem Bootshaus auf dem schmalen Holzsteg liegend in den Himmel blicken sah, lächelte er. Die Strümpfe bis zu den Schuhen heruntergerollt, die bloßen Unterschenkel vom Stegende baumelnd und die Hände in den Hosentaschen, so hatte er in Kindertagen oft dagelegen, versunken im Rhythmus der Wellen, die leise auf den schmalen Kiesstrand schwappten. Und jedes Mal, wenn eine größere Welle an den Pfosten des Steges brach und einige kühle Spritzer auf seine Haut fanden, genoss er den wohligen Schauer. So daliegend, konnte er minutenlang ohne zu blinzeln in die gleißende Sonne sehen, die dabei immer größer zu werden und auf die Erde zuzurasen schien. Ein Phänomen, so wurde ihm gerade bewusst, das er sich bis heute nicht erklären konnte.
Karl war jetzt achtundsechzig, genauso alt wie das Jahrhundert. Doch der glückliche Augenblick schien ihm, wie so vieles, das in den vergangenen Wochen und Monaten aus der Vergessenheit zurück in seine Erinnerung gefunden hatte, erst gestern gewesen.
Er öffnete die Augen und betrachtete den Steg, der, morsch wie er war, nur noch zum Motiv, schon lange nicht mehr zum Begehen taugte. So wie auch er gerade noch so das Bild des Mannes abgab, der er schon lange nicht mehr war.
Dann kam ihm der Knabe, der eben noch auf dem Steg gelegen hatte, entgegen. Mit gesenktem Kopf, die Daumen in die Träger der Trachtenlederhose eingehakt und gedankenverloren im Takt seiner Schritte gleich einer anfahrenden Dampflokomotive vor sich hin pustend, stapfte er die Wiese hoch. Als er, wie um zu sehen, wer ihn da beobachtete, kurz den Kopf hob, ging sein Blick durch Karl hindurch, der augenblicklich wieder in eine tiefe Traurigkeit glitt. Gleichzeitig überkam ihn das Bedürfnis, dem Knaben über den Kopf zu streichen, ihn in die Arme zu schließen, ihn bei der Hand zu nehmen und mit ihm wegzugehen – ihn irgendwohin zu führen, wo er ein anderer hätte werden können.
Schon früh hatte Karl gemerkt, dass sein Vater für nichts, das nicht irgendwie mit seiner Arbeit zusammenhing, großes Interesse aufbrachte, und dass selbst er davon nicht ausgenommen war, wenn er sich nicht für das väterliche Arztsein, wie dieser es nannte, interessierte. Gleichwohl hatte Karl sein Interesse nie gespielt, um die Aufmerksamkeit des Vaters zu erlangen. Die Medizin war ein weites Feld und seine kindliche Neugier schier grenzenlos. Am liebsten betrachtete er die Illustrationen in den unzähligen Fachbüchern des Vaters. Worauf dieser ihm den Atlas typischer chirurgischer Operationen von Bockenheimer und Frohse schenkte, um ihm mit den Abbildungen ausführlich zu erklären, wie er Menschen wieder gesund machte.
Für Karl war sein Vater ein Held. Mit sechs Jahren kannte er zu dessen Freude bereits einige der gängigsten Operationen und konnte Teile des jeweils erforderlichen Bestecks aufzählen. Heinrich Bessler sah alles so kommen, wie er es sich wünschte. Und Karl war stolz, wenn der Vater sich freute.
Genauso, wie wenn er die Mutter mit der Erinnerung an Zutaten und Mengen eines Kochrezepts, bei dessen Zubereitung er schon geholfen hatte, oder seinen Fortschritten in Tschechisch, das er spielerisch von ihr lernte, verblüffte.
Dem Siebenjährigen hat Heinrich Bessler ein Mikroskop sowie ein Holzkästchen mit unzähligen, auf Traggläsern aufgebrachten Gewebepräparaten mitgebracht. Und die Mutter, die erst Bedenken hatte, »er ist erst sieben, Heinrich, sieben«, wusste nicht, was sie mehr rührte, Karls kindliche Freude oder der väterliche Stolz, mit dem Heinrich Bessler seinem Sohn von der Kopfhaut mit Haarwurzel bis zum Lungengewebe geduldig ein Präparat nach dem anderen ausführlich erklärte, sich scheinbar alles andere vergessend einmal einen ganzen Abend hingebungsvoll seinem nicht mehr aus dem Staunen kommenden Sohn widmete. Immer wieder stießen die beiden mit den Köpfen zusammen und lachten, wenn Karl es nicht erwarten konnte, wieder durchzusehen, nachdem sein Vater ihm beim ungelenken Wechseln der Objektträger geholfen und die Schärfe wieder eingestellt hatte.
Am nächsten Morgen im Badezimmer, er hatte den Wasserhahn schon aufgedreht, bemerkte Karl auf seiner Seife einen dunklen Punkt, den er bei genauem Hinsehen als winzige Fliege erkannte, die offenbar an einem Schaumrest kleben geblieben und eingegangen war. Aufgeregt trug er den Fund in sein Zimmer, wo er das Insekt mit der Spitze eines Buntstiftes barg und anschließend zusammen mit ein bisschen mitgestreifter Seife auf den Rand eines aus seiner Halterung im Präparatekästchen gezogenen Objektträgers strich. Zu seiner Enttäuschung konnte er unter dem Mikroskop dann aber kaum etwas erkennen. Also nahm er, um eine bessere Ausleuchtung zu erhalten, das Gerät vom Schreibtisch und stellte es auf das Fensterbrett, wobei das Tragglas im Schwung der ungestümen Bewegung herunterfiel und zersprang. In kindlicher Verzweiflung glaubte Karl seine Entdeckung schon verloren. Am Boden liegend, den Kopf seitlich, ein Auge zugekniffen, mit dem anderen das Parkett absuchend, fiel sein Blick dann aber auf den Splitter mit dem weißen Seifenstückchen, an dem die Fliege immer noch klebte.
Was er darauf unter dem Mikroskop erblickte, versetzte ihn augenblicklich in eine Aufregung, die weit über das hinausging, was er am Vorabend an Faszination für die Präparate des Vaters empfunden hatte. Der Anblick des winzigen Tierchens ließ ihn ungläubig erstarren. Er konnte sich nicht sattsehen an dem glänzenden mit Härchen übersäten Körper und dem Geflecht aus Äderchen, das die Flügel wie durchsichtige Blätter erscheinen ließ. Am meisten hatte er jedoch über den Kopf gestaunt, der aussah, als würde er eine Brille aus Teesieben tragen. Und während er das Insekt mit der Stiftspitze unaufhörlich drehte und wendete, bis es dabei schließlich einen Flügel verlor, empfand Karl das unbeschreibliche Glücksgefühl des Entdeckers einer neuen Welt.
Dass ihm dabei irgendwann eine Hand sanft über den Kopf strich, bemerkte er erst, als er vom Vater auch angesprochen wurde: »Guten Morgen, mein kleiner Studiosus. Womit beschäftigst du dich schon so früh?«
Sprachlos angesichts dessen, was sich ihm soeben eröffnet hatte, machte Karl, indem er einen Schritt zur Seite tat, dem Vater abwesend Platz. Als dieser an das Fensterbrett trat, knirschte es sandig unter dessen Pantoffeln. Und nach kurzem Durchsehen bemerkte er mit der Geringschätzung des Beleidigten: »Sei vorsichtig, wenn du die Scherben aufnimmst.«
Damals hatte Karl dieses Verhalten des Vaters nichts ausgemacht. Als Kind empfand er bloß manchmal so etwas wie Enttäuschung. Eine Enttäuschung, die jedoch – auch wenn er es so nicht hätte sagen können – mehr ein Mitleid mit dem Vater war. Ein Bedauern, dass dieser nur sehen konnte, was er sehen wollte und in seine Welt nicht einzutreten vermochte. Erst viel später, rückblickend, machte Karl diese Gleichgültigkeit bereits gegenüber seinen kindlichen Interessen – wenn sie auch dazumal, im Gegensatz zur späteren Verachtung für seinen Berufswunsch, immerhin noch eine herzliche gewesen war – manchmal traurig, dann wieder unbändig wütend.
Heinrich Bessler hatte sich damals in Berlin als langjähriger Assistent des vor kurzem verstorbenen Ernst von Bergmann an der Chirurgischen Universitätsklinik habilitiert und stand kurz vor seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Chirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Und natürlich hatte Karl immer wieder auch gefragt, wann er denn einmal mit in die Klinik dürfe, worauf er jedes Mal die Antwort erhalten hatte, mit der Eltern einen Zeitpunkt, den sie für noch nicht gekommen halten, von dem sie aber auch nicht sagen können, wann er eintreten wird, irgendwo in die Zukunft legen: »Wenn du groß genug bist.« Bald an dieses unbestimmte Vertrösten gewöhnt, erwartete Karl, obwohl er die Frage weiterhin regelmäßig stellte, wenn er im Arbeitszimmer des Vaters am Boden liegend eines seiner Fachbücher nach Bildern durchblätterte, auch nicht mehr wirklich eine anderslautende Antwort. Meist blickte er nicht einmal mehr auf.
Dann, eines Abends, irgendwann während der Sommerferien, Karl hatte zwar nicht hingehört, glaubte aber, etwas anderes als die übliche Antwort vernommen zu haben, wiederholte der Vater, als er fragend zu ihm hochschaute, flüsternd, mit an die Lippen gelegtem Zeigefinger und die Augen zur offenstehenden Zimmertüre verdrehend: »Morgen.« Karl sprang sogleich auf und fiel ihm stürmisch um den Hals. Und am liebsten hätte er die gute Nachricht auch gleich der Mutter erzählt. Doch der Vater ermahnte ihn eindringlich, leise zu sein, und nahm ihm das Versprechen ab, dass er damit bis zum nächsten Morgen warten würde.
Als er der Mutter beim Frühstück, erleichtert darüber, seine Freude endlich mit ihr teilen zu können, aufgeregt von dem bevorstehenden Ausflug erzählte, konnte diese nicht fassen, was sie gerade hörte. Karl hatte kaum angefangen, da war sie schon aus der Küche geeilt. Anschließend das einzige Mal, dass er sie dem Vater gegenüber laut werden hörte: »Wieso weiß der Junge nicht, dass du ihn nicht mitnehmen wirst? Waren wir uns nicht gerade einig, dass du es ihm sagst?« Und wie jedes Mal, wenn die Mutter vor Freude oder Ärger außer sich geriet, fing sie an zu böhmakeln, so bezeichnete sie es selbst, wenn ihr tschechischer Akzent durchdrang, was Karl jeweils dazu brachte, sich noch mehr mit ihr zu freuen oder, wie in diesem Augenblick, eine tiefere Betroffenheit zu empfinden.
Karl hatte keine Ahnung, was der Vater gesagt hatte, um die Mutter zu besänftigen. Für ihre Aussprache hatten sie sich ins Schlafzimmer zurückgezogen. Jedenfalls schienen die beiden wenig später versöhnt. Und der Vater gab zu: »Mama hat recht. Ich kann dich nicht einfach so mitnehmen. Aber ihr kommt mich heute Nachmittag zusammen in der Klinik besuchen.«
Karl, der schon befürchtet hatte, dass aus dem Besuch nichts mehr werden würde, rief sogleich freudig: »Fein, alle zusammen.« Fast gleichzeitig stieß er sich mit einem kräftigen Ruck von der Tischplatte ab, rutschte vom Stuhl und schlang den Eltern überglücklich die Arme um die Beine.
Nachdem die Mutter die Wohnungstüre hinter dem Vater zugemacht hatte, ließ sie die Hand einen Moment auf der Klinke ruhen. Die andere legte sie Karl auf den Kopf, der dem Vater im Treppenhaus zum Abschied gerade nachgewunken und dazu erwartungsvoll hinterhergerufen hatte: »Bis heute Nachmittag, bis heute Nachmittag«. Sie war zufrieden mit dem vorgeschlagenen Kompromiss, froh, dass sie dem Jungen seine Freude nicht hatte nehmen müssen und beruhigt, weil sie würde bestimmen können, was er zu sehen bekam und was nicht. Dann, kurz mit den Fingern seine Haare durchwühlend, meinte sie lachend: »Ihr seid mir zwei.«
Nichtsahnend hatte sie, die sich später unaufhörlich bemühte, zwischen den beiden zu vermitteln, »es tut mir weh, zuzusehen, wie die beiden Menschen, die ich am meisten liebe, sich so hassen«, damit die Weiche gestellt, dass Vater und Sohn sich bis zur Unversöhnlichkeit voneinander entfernten, einander immer fremder und verhasster wurden.
Das Stehen war für Karl zu einer hinterhältigen Pein geworden. Auf das quälende Gehen verschaffte es ihm zwar Erleichterung, zog die Schmerzen kurz etwas zurück. Aber nur, um sie dann umso heftiger wieder in seinen Körper zu stoßen. Als würde er gepackt und niedergedrückt, von seinen eigenen Beinen aufgespießt.
Ein halbes Jahr hatte ihm der Kollege noch gegeben. Höchstens. Damals, als er die Symptome nicht mehr ignorieren konnte und sich bestätigen ließ, was er schon wusste: Krebs. Fast vierzehn Monate sind es nun geworden.
Schon lange spritzte er sich heimlich Morphium. Die Schmerzen hätten mehr vertragen. Aber nicht sein Verstand. Immer wieder fragte er sich, ob der Krebs angefangen hatte, ihn aufzufressen, weil selbst die größten Gewissensbisse seinem Verhalten nie etwas hatten anhaben können. Obwohl er natürlich wusste, dass das medizinisch blanker Unsinn war. Trotzdem hockte der Gedanke in seinem Kopf.
Karl war nicht fromm. Seit seiner Kommunion war er in keiner Messe mehr gewesen. Nur manchmal, wenn ihm die Natur – wie gerade – ein besonderes Schauspiel bot, war er ganz und gar überzeugt von einer Schöpfung, die offenbaren wollte, wozu sie fähig war. Darum erstaunte es ihn, dass er sich im Bewusstsein des bevorstehenden Endes genauso zu verhalten begonnen hatte, wie er es als Arzt so oft bei Patienten hatte beobachten können. Dass er nach Erklärungen für das Unerklärliche suchte, wissen wollte, warum es ausgerechnet ihn getroffen hatte, er schließlich sogar Gott anfragte.
Dabei quälte ihn eigentlich viel weniger das Schwinden seiner Zukunft, als die Ungewissheit derjenigen von Sophie. Was sollte aus ihr werden? Hatte er ihr Leben doch so sehr von seinem abhängig gemacht. Fünfundzwanzig Jahre hatte er an alles gedacht, hatte er für jede Möglichkeit und Unmöglichkeit eine Erklärung bereit. Nur sein eigenes Ende hatte er bei seinen Überlegungen nie in Erwägung gezogen.
In den ersten Wochen nach der Diagnose, hatte er Sophie wiederholt abends ein Schlafmittel in den Tee gegeben und dann nachts mit aufgezogenen Spritzen am Bett der Betäubten gestanden. Aber er hatte es nicht fertiggebracht. Hätte es einfach nicht ertragen, auch nur eine Minute in der Gewissheit leben zu müssen, dass sie nicht mehr war. Und jedes Mal, wenn er darauf im Badezimmer das Morphium durch die Nadeln ins Waschbecken presste, schämte er sich, verachtete er sich dafür, dass er es nur deswegen nicht tat.
Theoretisch hatte er sich schon mit der Tötung von Menschen befasst, damals, als er in solche Gespräche verwickelt worden war. Aber nie selbst einen umgebracht, noch nicht einmal dabei zugesehen, obwohl man ihn schon dazu eingeladen hatte – ja, es war tatsächlich von einer Einladung die Rede gewesen. Darum hatte er sich immer gedrückt.
Ein einziges Mal, bei seinem letzten Versuch, hatte Karl sich überwunden, eigentlich vielmehr gezwungen, weiter zu gehen, hielt er, nachdem er den Ärmel von Sophies Nachthemd hochgeschoben hatte, ihren Arm in der Hand und war schon dabei, die Nadel anzusetzen, als ihm plötzlich die Sicht verschwamm.
Ohne jede Empfindung ging er unter, versank er in seiner Leere. Dann, im nächsten Moment, im Nichts plötzlich das Alles. Verdichtet zu ungeheurem Entsetzen. Als hätte ein Hypnotiseur ihm diesen Wahnsinn suggeriert, ihn dann aber gerade noch rechtzeitig aus der Trance zurück ins Bewusstsein geholt, fand sich Karl in dieser Situation, von der ihm unbegreiflich war, wie er in sie hatte geraten können.
Und während er sich klarzumachen versuchte, wie es soweit hatte kommen können, dass er beinahe getan hätte, was doch bei klarem Verstand jenseits nur schon einer Erwägung war, fiel ein Bild in seine Verstörung, das ihn mit einer solchen Zuneigung erfüllte, dass es ihn beinahe zerriss.
In der ersten Nacht, die Sophie bei ihm verbracht hatte, hatte sie fast genauso dagelegen. Auch damals hatte Karl ihr etwas zum Einschlafen gegeben. Anders hätte sie, angsterfüllt wie sie war, trotz Erschöpfung keine Ruhe gefunden. Dann hatte er die Vorhänge des Gästezimmers zugezogen und sich in den in einiger Entfernung zum Bett stehenden Sessel gesetzt, wollte er doch unbedingt bei ihr sein, wenn sie aufwachte, Sophie gleich wieder mit der Versicherung beruhigen, dass sie nun nichts mehr zu befürchten hatte.
Die Schlafende betrachtend hatte er sein Glück nicht fassen können, sich aber auch gefragt, warum sie ausgerechnet zu ihm gekommen war. Denn was wusste sie schon von ihm? Sie waren sich doch erst einmal vor fünfzehn Jahren in Prag begegnet. Dieses Vertrauen war Karl so ungeheuer phantastisch vorgekommen. Schließlich hätte er ja wer weiß was mit ihr anstellen können. Nicht auszudenken, hätte sie sich an den Falschen gewandt. Immer wieder hatten sich seine Gedanken überschlagen und in ohnmächtiger Wut die einschlägigen Negative belichtet. Doch Karl hatte die Bilder nicht sehen wollen und schüttete sie jedes Mal, noch bevor sie fertig entwickelt waren, aus dem Kopf.
Nach all den Jahren, in denen er sie in anderen gesucht hatte, konnte er kaum glauben, dass sie tatsächlich da lag. Und obwohl sie zu ihm gekommen war, Sophie ihn gefunden hatte, war es Karl, der das erlösende Gefühl des Angekommenseins verspürte. Gleichzeitig hatte ihn ein ungeheurer Stolz beschlichen. Ein mächtiges Gefühl, das doch zutiefst kindlich war. Als wäre er wieder Knabe und gerade mit einer Aufgabe betraut worden, die eigentlich nach einem Erwachsenen verlangte.
Schon da hätte Karl am liebsten die Kamera geholt. Gleichzeitig hatte er gefürchtet, würde er aufstehen, sich auch nur etwas bewegen, wäre der Augenblick unwiederbringlich verloren.
Es schien ihm, als wollte das Bild geradezu die von ihm ausgehende Wirkung erzielen – Rührung und zugleich Verunsicherung erzeugen. Ist doch nicht auszumachen, ob es eine Schlafende oder eine Verstorbene zeigt.
Eingesunken ruht ihr dem Betrachter leicht zugeneigter Kopf auf dem aufgeschüttelten Kissen. Das Gesicht ausdruckslos. Der Mund etwas geöffnet. Ihr dunkles, in der Mitte gescheiteltes Haar wie hingelegt in sanften Wellen aus dem Nacken über die kaum bedeckten Schultern fließend. Und wie um den Eindruck einer Inszenierung noch zu verstärken, verliert sich das Weiß der Bettwäsche außerhalb des schwachen Scheins einer sich nicht im Bild befindlichen Lampe in dem mit schweren Vorhängen herbeigeführten Dunkel des Raums. Die Liegende scheint erlöst. Wäre da nicht ihre Hand, die sich krampfhaft an einer Falte des Lakens festhält.
Hatte Karl in dieser ersten Nacht, wohl auch weil er befürchtete, Sophie könnte dabei aufwachen, noch erfolgreich der Versuchung widerstanden, seine Kamera aufzubauen, die Aufnahme nur in seiner Vorstellung gemacht, vermochte ihn beim zweiten Mal nichts mehr zurückzuhalten. Drängte es ihn regelrecht, Kamera und Stativ zu holen und die Schlafende zu portraitieren.
Auf der Treppe zu seinem Studio im Dachgeschoss, die beiden aufgezogenen Spritzen noch in der Hand, wie angeworfen die Erkenntnis, dass das englische to take a picture so unendlich viel treffender als fotografieren aussagte, was er vorhatte. Schickte er sich doch gerade an, heimlich einen Augenblick aus diesem Leben zu nehmen, das er Sophie sowieso schon gestohlen hatte.
Die Schmerzen erinnerten Karl daran, dass er schon viel zu lange da stand. Und er realisierte, wie ihm das Weggehen doch schwerer fiel, ihn mehr Mühe kostete, als er sich vorgestellt hatte, dass nicht nur sein Blick lieber in der Vergangenheit verweilte, als dem winzigen Rest verbleibender Zukunft entgegenzusehen.
Während er sich vom Anblick des Sees löste und der Garage zuwandte, stand in seinen Gedanken plötzlich dieser Satz, den er einmal in einer Trauerrede gehört hatte. Damals hatte er ihn als unpassend und pathetisch empfunden. Vielleicht auch nicht verstanden – nicht verstehen wollen. In der augenblicklichen Szenerie fand Karl jedoch, dass er stimmte, empfand er darüber sogar fast so etwas wie Trost, als er ihn im Gehen, versunken, mehr laut denkend als sprechend, leise wiederholte: »Zurück bleibt die ungerührte Natur.«
Er trug einen Anzug aus dunkelgrauem Flanell und ein weißes Hemd des gleichen Schneiders, bei dem er seit Jahren nach dem leicht abgeänderten Schnitt eines Dreiteilers, den er einmal aus London mitgebracht hatte, nach Maß arbeiten ließ. Auf die dazugehörige Weste hatte er verzichtet. Nicht aber auf die Krawatte. Ein Hemd ohne Binder zu tragen, diesmal einen roten mit einem Gitter aus dunkelblauen Linien, kam für Karl nur ausnahmsweise in Frage. Nicht selten ging er sogar so weit, dass er den Rest seiner Garderobe passend zur Krawatte auswählte, wozu er auf dem Tisch in seinem Ankleidezimmer manchmal ein regelrechtes Durcheinander veranstalten konnte, bis eine Zusammenstellung ihn zufriedenstellte. Dazu trug er, obwohl ihm durchaus bewusst war, dass der Anzug eigentlich nach einem schwarzen Oxford verlangt hätte, zu dunkelbraunen Kniestrümpfen braune Blücher aus Wildleder, die er, wie alle seine Schuhe, ebenfalls in München nach Maß hatte anfertigen lassen.
Man darf sagen, Karl war ein gutangezogener Mann. Manchmal vielleicht etwas unkonventionell, aber weit davon entfernt, ein Dandy zu sein.
Es war noch nicht einmal Eitelkeit, die ihn veranlasste, seiner Garderobe soviel Aufmerksamkeit zu widmen. Er legte einfach auch hier Wert auf Stimmigkeit, auf die er sich, das war ihm bewusst, manchmal auch kaprizieren konnte. Außerdem war er ein aufmerksamer Beobachter, fand an vielem Gefallen und in vielem Inspiration. Beides äußerte sich ebenfalls ganz selbstverständlich schon immer auch in seiner Kleidung.
Bereits als Student, nach einem Segelausflug, hatte er sich von einem Silberschmied winzige Schäkel als Manschettenknöpfe anfertigen lassen. Schon damals nicht aus dem Bedürfnis, anders sein zu wollen, sich abzuheben, sondern einzig und allein, weil sich ihm deren Form für diesen Zweck geradezu aufgedrängt hatte.
Und seit er vor Jahren im Foyer der Oper das rote Futter eines Leopardenmantels hatte aufblitzen sehen, während dieser vom Begleiter der Dame an eine der Garderobieren gereicht wurde, ließ er alle seine Jacken und Westen mit dunkelgrüner Seide füttern.
Wurde Karl, was hin und wieder vorkam, auf einen seiner Einfälle angesprochen, war es ihm unangenehm, dass diese solche Beachtung fanden, kam er sich auf eigenartige Weise ertappt vor. Zumal er gerade bei förmlichen Anlässen nicht von dem abwich, was gesellschaftlich opportun war.
Von der Seeseite auf die Garage zugehend, konnte Karl wegen des offenstehenden Torflügels schon von weitem die lange Motorhaube des väterlichen Mercedes erkennen, der auf der linken Seite des Raums abgestellt war, in dem einst die Kutschen des Erbauers der Villa gestanden hatten und die Pferde angespannt worden waren. Dabei wirkte das matte Grau der dicken Staubschicht in dem durch die seitlichen Fenster einfallenden Licht wie ein Filzüberzug, der exakt auf die Karosserie aufgebügelt worden war, um den darunterliegenden Glanz des dunkelblauen Lacks zu konservieren.
Der Wagen war das Einzige gewesen, für das Karl seinen Vater jemals hatte schwärmen hören. »Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst.« Mit seinem beinahe einen Meter hohen Kühler war er aber vor allem ein gewaltiges Gefährt. Ein Statussymbol, das sich nur wenige vermögende Privatleute leisten konnten. Dass dessen offene Ausführung vorwiegend von Parteigrößen geschätzt wurde, hatte seiner Begeisterung nichts anhaben können. »Kein Wunder. Dieses Automobil repräsentiert die guten Tugenden Deutschlands. Also alles, woran es diesem Pöbel fehlt.«
Schon wenige Wochen nach seiner Auslieferung war dieses Wunderwerk der Technik, das Heinrich Bessler an den Wochenenden auch gerne selbst steuerte, dann aber abrupt zu Stehen gekommen. Es hatte nur etwas Eis gebraucht, um den Wagen in einer Kurve von der Straße abkommen und gegen einen Baum fahren zu lassen. Seither stand er auf inzwischen luftleeren und brüchigen Reifen auf seinem Platz.
Bis auf die eingedrückte Stoßstange, eine größere Delle im rechten Kotflügel, welche die auf ihm angebrachte Lampe etwas schief abstehen ließ, und die herausgebrochene Frontscheibe hatte der Unfall im Winter 1938 dem Wagen nichts anhaben können. Nach der Bergung konnte er sogar wieder angelassen und, nachdem der Kotflügel wieder nach außen gebogen worden war, weggefahren werden.
Es war Frau Riedel, die ihn damals angerufen und völlig verstört gebeten hatte, sofort zu kommen, es sei etwas Schreckliches mit seinen Eltern passiert. Auf seine Frage, was denn vorgefallen sei, bekam er keine Antwort. Stattdessen wurde das Gespräch unvermittelt abgebrochen. Als hätte jemand auf die Gabel gedrückt.
Karl, der annahm, dass eingetroffen sei, was schon lange absehbar war, nämlich dass seine Eltern verhaftet worden waren, weil der Vater keine Gelegenheit ausließ, sein Missfallen über die neuen Machthaber zu äußern, überlegte während der Fahrt fieberhaft, wen er am besten anrufen könnte, um sie wieder freizubekommen.
Als er eine knappe Stunde später seinen Wagen auf das Grundstück lenkte, wurde der Mercedes des Vaters gerade rückwärts in die Garage gefahren. Ein Mann hielt die weinende Frau Riedel, die ihm entgegenlaufen wollte, an den Schultern zurück. Vier weitere auf dem Vorplatz stehende Männer wandten ihre Köpfe in seine Richtung. Einer kam ihm entgegen, öffnete seine Wagentüre und hob gleichzeitig den Arm zum Deutschen Gruß. »Heil Hitler.«
Gestapo. Jetzt war es also passiert. Doch der Mann schien merkwürdig unsicher. »Mein Beileid, Herr Doktor«, sagte er bloß knapp. Und Frau Riedel presste unter Tränen immer wieder laut heraus: »Sie sind tot. Sie sind alle beide tot.«
Noch bevor er sich erklären ließ, was vorgefallen war, schloss Karl die Haushälterin erst zögernd, dann fest in die Arme. Es kam ihm eigenartig vor, nun die Frau zu trösten, die in Kindertagen oft ihn getröstet hatte. Und es irritierte ihn, wie mädchenhaft sie so aufgelöst schien, als sie mit zerzaustem Haar und verweintem Gesicht scheinbar zärtlich zu ihm hochsah und leise schluchzte: »Bürschel, es tut mir so leid.«
Die Mutter war durch die Wucht des Aufpralls aus dem Wagen geschleudert worden und hatte sich das Genick gebrochen. Der Vater, dessen Oberkörper ebenfalls durch die Frontscheibe geschlagen, vom Steuerrad aber zurückgehalten worden war, war an einem Milzriss innerlich verblutet.
Am nächsten Morgen der Anruf von Reichsärzteführer Gerhard Wagner: »Was für ein Verlust.« Selbstverständlich würde sein Vater die Würdigung erfahren, die er verdiene. Nicht zuletzt unzählige Parteigenossen, die es nur seinen überragenden Fähigkeiten verdankten, dass sie nicht das unglückliche Schicksal eines Kriegsversehrten erleiden müssten, sollten unbedingt die Möglichkeit erhalten, ihm die letzte Ehre zu erweisen. »Ich werde mich um alles kümmern.«
(Etwas über zwei Jahre zuvor war Heinrich Bessler zum Rückzug ins Privatleben gezwungen worden, nachdem er auf einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und das Reichsbürgergesetz als »zivilisatorisch unwürdige Legitimation der systematischen Verdrängung von Juden aus dem öffentlichen Leben« angeprangert hatte.)
Fünf Tage später stand der Sarg des Vaters alleine vor dem Altar der Münchner Frauenkirche. Erst als diejenigen, die Heinrich Bessler so verabscheut hatte, vor sich räuspernden Volksgenossen und Volksgenossinnen und surrenden Wochenschaukameras seine Dienste gepriesen hatten, wurde er in die Aussegnungshalle des Nordfriedhofs überführt und neben den der Mutter gestellt.
In die einen Quadratmeter große Aussparung in dem eilends errichteten monumentalen Sandsteingrabmal wurde später ein Bronzerelief von Josef Thorak eingelassen, das den barmherzigen Samariter als Ritter zeigt, der mit erhobenem Schwert neben seinem Pferd stehend heroisch die Bereitschaft bekundet, den mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammengesunken im Sattel sitzenden Verletzten gegen alle Angreifer zu verteidigen.
Karl, der, während er den Nachlass ordnete, auch in der Villa übernachtete, war es unangenehm, von Frau Riedel bedient zu werden. Zusammen mit ihrem Mann, dem Gärtner und Chauffeur, war sie seit der Berufung seines Vaters an die Ludwig-Maximilians-Universität beinahe dreißig Jahre bei seinen Eltern beschäftigt.
Sein Verhältnis zu Erna Riedel war nie das zu einer Haushälterin gewesen. Als er klein war hatten sie sich gegenseitig mit harmlosen Streichen und Neckereien aufgezogen. Und manchmal, wenn er später, wie immer mit den Händen in den Hosentaschen, irgendwo gelegen und seinen Gedanken nachgehangen war, hatte sie ihm im Vorbeigehen mit dem Zeigefinger auf den Bauch getippt und, wenn er dann vor Schreck mit den Beinen hochgezuckt war, lachend gerufen: »Wie ein Schweizer Messer, wie ein Schweizer Messer.«
Und alles, was Karl über Pflanzen und heimische Tierarten wusste, wusste er von Alois Riedel. Er hatte ihn zum Fischen und auf die Jagd mitgenommen, mit ihm immer wieder die zahlreich auf dem Anwesen nistenden Vögel beobachtet und ihm wochenlang geduldig beim Bau seines Baumhauses geholfen.
Eigentlich – und er bereute, dass ihm diese Erkenntnis erst jetzt gekommen war – waren die Riedels, nicht nur wenn die Mutter den Vater auf eine seiner vielen Vortragsreisen begleitet hatte, so etwas wie seine zweite Familie gewesen. Völlig unmöglich, die beiden nun als seine Angestellten zu beschäftigen. Darum war Karl auch mehr als erleichtert, dass sie sein Angebot, ihnen bei der Suche einer eigenen Wohnung behilflich zu sein und das bisherige Gehalt fortan als Rente zu überweisen, als das verstanden, was es für ihn war – die einzige ihm angemessen scheinende Möglichkeit, den beiden seine Dankbarkeit und Zuneigung zu zeigen.
Neben seinem großen Ahnen nahm sich der Mercedes von Karl auch optisch wie ein Enkel aus. Und während er beim Einsteigen in den Durchgang vor den beiden Pferdeboxen blickte, in die er nur wenige Tage nach dem Tod der Eltern die meisten Möbel aus der Villa hatte bringen lassen, realisierte er, dass er für sein Verhalten gegenüber dem Vater das erste Mal ein uneingeschränktes Bedauern empfand.
Das Geräusch des Kieses unter den Reifen, das nach kurzem Knirschen in ein gleichmäßiges Rauschen überging und schließlich, als die vom Profil mitgenommenen Steinchen mit zunehmender Geschwindigkeit gegen die Radkästen geschleudert wurden, zu einem lauten Prasseln anschwoll, glich dem eines Sommergewitters, wenn auf heftigen Regen plötzlich Hagel folgt. Kaum war er in die Straße eingebogen, war das Prasseln vorbei. Lediglich das wiederkehrende Klicken einiger im Profil verbliebener Kiesel war noch leise zu hören, bevor sie sich, einer nach dem anderen, auf dem Asphalt ebenfalls von den Reifen lösten.
Bald hatte Karl den Schatten der riesigen Kumuluswolke hinter sich gelassen. Der See glitzerte, wie er es in der Morgensonne immer tat. Und in dem leichten Wind schillerte das herbstliche Laub, als stünden die Bäume in Paillettenkleidern da. Er kurbelte das Seitenfenster herunter und beschleunigte. Unmerklich verflogen seine Gedanken. Als würde einer nach dem anderen vom eindringenden Fahrtwind erfasst und weggetragen. Bis er nach einem Augenblick ungetrübten Seins realisierte, wie schnell die Landschaft plötzlich vorüberzog.
Neugierig, ob sich dieses Vorüberziehen bildlich festhalten ließ, hatte Karl im Herbst 1936 die Kamera mit einer dafür selbst angefertigten Vorrichtung auf der halb heruntergelassenen Seitenscheibe montiert und im Fahren eine Aufnahme nach der anderen gemacht. Mit den Blenden- und Verschlusseinstellungen der besten Ergebnisse hatte er danach während Tagen auf verschiedenen Abschnitten der Reichsautobahn über fünfzig Filme belichtet. Wirklich zufrieden war er dann gerade mal mit zweiundvierzig Aufnahmen.
Für seinen im Juni 1937 im Verlag Volk und Reich erschienenen Bildband Unterwegs auf der Reichsautobahn mit diesen zweiundvierzig Aufnahmen, auf denen die vorüberziehende Landschaft als bildgewordene Geschwindigkeit zu unterschiedlichen Abfolgen horizontaler Streifen geworden war, wurde er von der Reichskammer der bildenden Küste als »Darsteller der neuen Mobilität« gefeiert. Der großformatige Band gilt heute als Klassiker der modernen Fotografie._1
Farbige Fotografie hat Karl nie interessiert. Wenn er überhaupt so etwas wie einen Dünkel hatte, dann bezüglich Farbfotografie. Er fand sie banal. Selbst die Bilder in seinem Kopf waren schwarzweiß. Doch nun zogen die Aufnahmen von damals vor seinem geistigen Auge in Farbe vorüber. Und am liebsten hätte er sie auch genauso wiederholt – hat er sie doch nie als eigentliche Fotografien betrachtet, sondern immer als eines seiner zahlreichen lichtmalerischen Experimente.
Karl neigte sich vor und schaltete das Radio ein. Aus den Lautsprechern zu Gitarrenklängen irgendwelcher Gesang. Sein fast gleichzeitiges Drücken der nächsten Sendertaste ließ den Zeiger auf eine andere Stelle der Frequenzskala springen und ein Hornkonzert von Mozart erklingen.
Der erneute Durchzug von Wohlbefinden ließ eine dämpfende Türe nach der anderen vor den randalierenden Schmerzen zufallen. Um ihn klingende Farben und farbige Klänge. Wie wunderbar das alles passte. Hin und wieder ein abweichender Hornklang. Viel zu hoch und viel zu lang. Vorbeifliegende Töne. Nichts, das zu Karl durchzudringen vermochte.
Irgendwann zwei grelle Lichter. Gefolgt von einem wachsenden Schatten. Dazu wiederholt tiefe Hornstöße. Widerwillig schob Karl den farbigen Glitzervorhang zu seinem Bewusstsein beiseite. In diesem schlagartig ein erschreckendes Bild, das ihn sogleich die Augen zukneifen und den Kopf einziehen ließ. Dann, in vollkommener Dunkelheit, wie langgezogener Walgesang, alles übertönend sein hinter zusammengebissenen Zähnen in die Kehle gepresster Schrei. Als er die Augen wieder öffnete, saß Karl, mit durchgestreckten Armen das herumgerissene Steuerrad umklammernd, vom auf das Bremspedal gepressten Fuß bis zum Nacken verkrampft, wie verkeilt in seinem quer auf der Fahrbahn stehenden Mercedes.
»Sind Sie lebensmüde«, hörte er eine Stimme brüllen. Dann sah er auf der Beifahrerseite den Kühler eines Lastwagens. Hastig suchte Karl den Rückwärtsgang und lenkte seinen Wagen zurück in die Spur. Jetzt konnte er den aufgebrachten Fahrer auch sehen, der ihn aus der Fahrerkabine anherrschte: »Bringen Sie sich zu Hause um. Nicht auf der Straße.«
Merkwürdig, dachte Karl, nachdem er mit zitternder Hand den ersten Gang eingelegt hatte um weiterzufahren, diese Erleichterung, obwohl er doch sowieso nicht mehr lange zu leben hatte. Gut hatte er nichts mehr zu besorgen, war er schon letzte Woche in München gewesen und hatte alles erledigt.
Im Flur der ehemaligen Praxis hing sein erstes Bild – der positive Abzug einer Röntgenaufnahme seiner Kinderhand. Karl hatte dafür irgendwann ein helles Passepartout und einen schmalen Rahmen aus Eichenholz anfertigen lassen, das eigentliche Rahmen des auf Karton aufgezogenen Abzugs dann aber wie immer selbst erledigt.
Er mochte sich nie darauf verlassen, dass eine Fotografie in einem mit Pappe zugeklebten Rahmen so befestigt war, wie er es sich wünschte. Er wollte die Gewissheit. Ganz abgesehen davon, dass er die Beschädigung oder gar den Verlust gerade dieses Bildes niemandem verziehen hätte. Darum ließ er jeweils aus dem gleichen Karton, den er für ein Passepartout ausgesucht hatte, eine ebenso große Unterlage schneiden. Darauf befestigte er dann die Abzüge mit selbst gefalteten Papierecken oder schnitt, wenn sie wie die Aufnahme aus Kindertagen aufgezogen war, eine passgenaue Öffnung für die Kartons hinein.
Der einstige Schatz des Knaben war längst zum Inventar des Mannes geworden. Losgelöst von der Erinnerung an den Tag, an dem die Aufnahme gemacht worden war. Darum war für Karl zunächst auch völlig unklar, was ihm, kaum hatte er letzten Freitag das Haus in München betreten, auf einmal so bekannt vorgekommen war. Es war das gleiche Gefühl, das er manchmal verspürte, wenn er bei einer Begegnung zwar wusste, dass er eine Person kannte, sich aber weder an deren Namen erinnern konnte, noch daran, wo sie sich schon begegnet waren.
Seife. Ein Hauch von Seife lag in der Luft. Aber nicht allein. Dazu roch es kaum wahrnehmbar nach feuchtem Stein und trocknendem Holz. Irritiert blieb er vor den Briefkästen im Hausflur stehen, legte seinen Kopf in den Nacken und schloss in der gleichen Bewegung, wie eine Puppe, deren Lider sich von selbst senken, wird sie zurückgeneigt, langsam die Augen. Nach jedem kurzen Atemzug wartete er auf ein Bild. Doch statt eines Bildes irgendwann ein Geräusch. Er vermochte nicht zu unterscheiden, ob es durch den Gehörgang oder aus der Erinnerung kam. Und als Karl die Augen wieder öffnete, war es weg. Ein dumpfes Klopfen, das sich in monotoner Regelmäßigkeit mit einem nachhallenden Schlag gegen Metall abgewechselt hatte. So hatte es in Berlin immer geklungen, wenn die Frau des Hausmeisters das Treppenhaus gereinigt hatte, was sie, rückwärts Absatz für Absatz die Treppe hinuntergehend, mit einem feuchten Lappen erledigt hatte, den sie mit einem Schrubber auf jeder Stufe von links nach rechts und wieder zurück wischen ließ, wobei sie mit dem Bürstenkopf jedes Mal gegen die Täfelung und das Treppengeländer gestoßen war.
So auch an jenem Tag, an dem er es kaum hatte erwarten können, mit der Mutter den Vater in der Klinik zu besuchen. Vor dem Mittagessen im Treppenhaus das vertraute Geräusch. Und als die Mutter sich nach dem endlos empfundenen Vormittag endlich mit ihm auf den Weg zur Ziegelstraße machte, war der Geruch schon beinahe verflogen.
Die Treppe hochgehend überlegte Karl, welcher Wochentag es wohl gewesen sein mag. Wahrscheinlich ein Montag oder Freitag. Er öffnete die Türe im ersten Stock. Doch bevor er den Gedanken wieder aufnehmen konnte, ging er unter den Bildern des Tages verloren, die so überraschend in seine Erinnerung fielen, wie vor langer Zeit zwischen die Seiten eines Fotoalbums gelegte Aufnahmen, die man nicht eingeklebt und längst vergessen hatte.
Karl erinnerte sich, dass sie einander, kaum hatten die Mutter und er das Haus verlassen, die Hand gegeben und, wie so oft wenn sie zusammen unterwegs waren, Wer sieht's zuerst? gespielt hatten. Ein Spiel, bei dem es darum ging, abwechselnd etwas zu nennen, von dem anzunehmen war, dass es bald zu sehen sein würde. In der näheren Umgebung kannten sie darum bereits fast jeden Blumentopf. Also hatten sie bald angefangen, Gegenstände, die von Leuten mitgeführt wurden oder zusätzlich eine Farbe zu nennen. Stock oder Zeitung gehörten zu den einfacheren Dingen, bei denen manchmal kaum auszumachen war, wer wessen Hand zuerst gedrückt hatte, um die Entdeckung anzuzeigen. Ein grünes Fahrrad hingegen ließ manchmal so lange auf sich warten, dass Mutter und Sohn anfingen, sich mit immer übertriebeneren Gesten gespielter Enttäuschung gegenseitig zum Lachen zu bringen.
In der Klinik hatte es, nachdem sie sich angemeldet hatten, noch einmal eine Ewigkeit gedauert, bis Karl den Vater in einem langen weißen Kittel endlich den Flur entlangkommen sah. »Papa« rufend war er sogleich von der Bank gerutscht und ihm entgegengerannt. Mit hochgezogenen Augenbrauen und kurz die Hände zu einer Geste anhebend, die gleichzeitig um Entschuldigung und Verständnis bat, schaute der Vater zuerst über den auf ihn zulaufenden Jungen hinweg zur Mutter, bevor er die Arme ausbreitete und in die Knie ging, um ihn zur Begrüßung hochzuheben.
Karl staunte, wie groß die Klinik war. Auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer hatte ihm der Vater einen Raum nach dem anderen gezeigt. Von den Ärzten und Schwestern, denen sie dabei begegneten, wurde er herzlich begrüßt. Und der Vater erklärte ihm, gleich oder einige Schritte weiter, wer die Leute waren und was sie machten. Dann, unmittelbar vor dem Arbeitszimmer, kam ihnen Doktor Dingfelder entgegen, der dem Vater später als Assistentsarzt nach München gefolgt war, und den Karl bereits kannte, da er immer mal wieder zum Abendessen bei ihnen zu Hause eingeladen war. Die Eltern, die ihn beide sehr schätzten, nannten ihn, wenn sie von ihm sprachen, meist scherzhaft den Dings. Wohl deshalb erinnerte sich Karl auch gleich an seinen Namen._2
»Guten Tag, Herr Kollege«, hatte dieser ihn lachend begrüßt und dann, während er ihm die Hand entgegenstreckte, der Mutter und dem Vater ebenfalls grüßend zugelächelt. Karl fing sogleich an, ihm aufgeregt zu schildern, was er bereits alles gesehen hatte. Amüsiert hörte der junge Arzt zu und stellte anschließend fest: »Fehlt eigentlich nur noch ein Blick in den OP.« Natürlich stimmte Karl sofort begeistert zu. »Eine gute Idee«, pflichtete auch der Vater bei, »geht ihr nur.« Dann zeigte er kurz auf die Türe zu seinem Arbeitszimmer. »Ich bin hier.« Und zu Doktor Dingfelder meinte er – wobei sein gespielter Befehlston nicht im Geringsten erkennen ließ, dass er es seiner tiefen Überzeugung entsprechend auch genauso meinte: »Also, dann zeigen Sie meinem Sohn mal seine zukünftige Wirkungsstätte.«
Nachdem sie die beiden Schwestern begrüßt hatten, die noch dabei waren, den Operationssaal aufzuräumen, erklärte Doktor Dingfelder, dass er gerade mit dem Vater einem jungen Mann das Bein habe abnehmen müssen. Karl, der ahnte, was seine an der Türe stehende Mutter sagen würde, zupfte am Kittel von Doktor Dingfelder und gab ihm mit heftigem Winken zu verstehen, dass er ihm etwas ins Ohr flüstern wollte. Als er sich zu ihm gebückt hatte, formte Karl mit beiden Händen einen Trichter und fragte: »Kann ich es sehen?« Doktor Dingfelder lachte. »Ich zeige dir etwas viel Interessanteres.« Er ging zu einer Ablage an der Wand und holte einen Umschlag. »Komm«, forderte er Karl auf und ging zum Fenster. Dann zog er eine Glasplatte aus dem Papier und hielt sie gegen das Licht. »Außen ist dem Bein nichts anzusehen. Die Krankheit ist im Knochen. Um sie zu entdecken, muss man in das Bein hineinblicken.« Er zeigte auf eine dunkle Stelle unterhalb des Kniegelenks. Karl schaute, konnte aber nichts erkennen. Doktor Dingfelder ging neben ihm in die Knie und ließ Karl die dünne Glasplatte halten. Dann zeigte er ihm die Stelle erneut: »Hier.«
Nun sah Karl den dunklen Fleck. Aber eigentlich interessierte ihn viel mehr, wie man dieses Knochenbild machte. »Das ist eine Röntgenaufnahme«, erklärte ihm Doktor Dingfelder. »Dazu wird der Körper mit Strahlen durchleuchtet. Diese Strahlen sind wie ein ganz starkes aber unsichtbares Licht, das Haut und Knochen durchdringt. Und in diesem Licht ist die Krankheit dann zu sehen.«
Karl nickte stumm, konnte sich aber nicht wirklich vorstellen, wie das funktionierte. Doktor Dingfelder stand auf und suchte ein Papier. Auf die Vorderseite zeichnete er den Umriss eines Männchens und auf die Rückseite mit einigen Strichen ein Skelett. Dazu machte er auf einem Strich in Kniehöhe einen Punkt. Mit der Zeichnung ging er zurück zu Karl. »Dieser Mann klagt über Schmerzen im Bein. Was meinst du, was ihm fehlt?« Während Karl ratlos auf das Männchen schaute, hob Doktor Dingfelder das Papier langsam gegen das Licht, bis das Skelett sichtbar wurde. »Das«, rief Karl und zeigte begeistert auf den Punkt. Dann wollte er den Apparat, der Menschen durchleuchten konnte, unbedingt sehen.
»Nur sehen?« Doktor Dingfelder spielte den Enttäuschten. »Ich dachte, wir machen eine Aufnahme von dir.« Karl geriet vor Aufregung ganz aus dem Häuschen. »Bitte keine Umstände wegen uns«, bat die Mutter, der es bei dem Gedanken unwohl war, sie könnten Doktor Dingfelder von Wichtigerem abhalten. »Nicht doch«, entgegnete dieser, »es ist mir ein Vergnügen.«
Mitten im Raum eine hölzerne Liege. Dahinter, an einem Metallständer, ein runder Glasbehälter mit mehreren Hälsen, von denen Drähte abgingen. In einer Ecke ein riesiges Holzgestell, an dem sich mit Drahtzügen auf Metallschienen irgendwelche Vorrichtungen bewegen ließen. Daneben sowie an der Wand, neben einem großen rohrförmigen Behälter, große Kisten mit Anzeigen und Schaltern. Karl verstummte unter dem Eindruck der mysteriösen Apparaturen. Hinter einer verschlossenen Türe, die von dem Raum abging, hörten sie Wasser laufen und eine Männerstimme kündigte an: »Komme gleich.« Kurz darauf wurden sie von einem Mann begrüßt, den Doktor Dingfelder als Doktor Schelling vorstellte.
»Ihre Kunst ist gefragt«, meinte er anschließend und zeigte auf Karl. »Ich habe dem jungen Mann eine Aufnahme versprochen.« Die Mutter, der es schon unangenehm war, wieder mit Frau Professor angesprochen zu werden, schränkte sogleich ein: »Bitte fühlen Sie sich dadurch nicht verpflichtet. Wir möchten Sie keinesfalls aufhalten oder stören.«
Nachdem Doktor Schelling versichert hatte, dass für eine Aufnahme immer Zeit sei, fragte er Karl: »Du willst doch sicher auch wissen, wie das Durchleuchten funktioniert?« Und auf dessen aufgeregtes Nicken zeigte er auf den am Stativ befestigten Glasbehälter. »Das ist die Röntgenröhre. Mit ihr werden die Bilder gemacht. Sie ist so etwas wie eine große Glühbirne. Nur, dass der Strom darin keinen Metallfaden zum Glühen bringt und Licht erzeugt, sondern unsichtbare Strahlen.« Er hob die Hand und bewegte sie, mit ernstem Gesichtsausdruck und leisem Zischen eine Aura des Geheimnisvollen erzeugend, mit gespreizten Fingern, als würde er einen Zaubertrick vollführen, von der Röntgenröhre langsam zum Brustkorb des gebannt schauenden Karl. Dann, im letzten Augenblick, lächelte er und kitzelte ihn kurz, was Karl sich kichernd winden ließ. »Natürlich kann man die Strahlen weder spüren noch hören«, erklärte Doktor Schelling weiter, »aber sie gehen durch den Körper hindurch und bilden sein Inneres ab.«
Er ging zurück in den Raum, aus dem er eben gekommen war, und Karl schaute in glückseliger Erwartung zur Mutter. Keine Minute später kam Doktor Schelling, einen flachen Holzrahmen hochhaltend, wieder zurück, legte diesen vor Karl auf die Liege und fragte: »Welche Hand sollen wir nehmen?« Strahlend hielt ihm Karl die rechte entgegen. Nachdem er sie auf den Holzrahmen gelegt hatte, forderte ihn Doktor Schelling auf, die Finger leicht zu spreizen. »Dann wird es ein schöneres Bild.« Indem er vorsichtig das Stativ etwas näher an die Liege rückte, brachte er die Röntgenröhre in Stellung. »Bereit?« Karl nickte eifrig. Doktor Schelling ging zu dem Kasten an der Wand und drehte an den Schaltern. Darauf kurz ein lautes Summen. »Das war's. Gleich kannst du das Bild sehen.« Er tätschelte Karl sanft die Hand, nahm den Holzrahmen an sich und verschwand wieder in den Nebenraum.
Karl wollte wissen, was Doktor Schelling dort machte. Und Doktor Dingfelder erklärte ihm, dass es sich bei dem Raum um die Dunkelkammer handelte. »Darin wird die lichtempfindliche Glasplatte zuerst in den Holzrahmen gelegt und anschließend wieder im Dunkeln herausgenommen und entwickelt, damit man das Bild überhaupt sehen kann.«
Während sie warteten kam eine Schwester und fragte nach Doktor Schelling. »Richten Sie ihm doch bitte aus, dass ich gleich mit einem Patienten komme.«
Vorsichtig wie einen kostbaren Schatz nahm Karl die entwickelte Glasplatte von Doktor Schelling entgegen und hielt sie gegen das Licht. Der Anblick seiner Handknochen ließ ihn erst wirklich verstehen, wie das Durchleuchten funktionierte. Wenngleich diese Erkenntnis sein Bewusstsein lediglich streifte. Weit mehr als der Vorgang erstaunte Karl nämlich das Ergebnis. Denn nebst aller Faszination fand er das, was er da in Händen hielt, ein schönes Bild.
Die Mutter erinnerte an die bevorstehende Rückkehr der Schwester mit einem Patienten und forderte zum Gehen auf. Betrübt, hätte er sie doch gerne noch länger betrachtet, ließ Karl zuerst die Glasplatte und dann seinen Kopf sinken, drehte sich langsam um und hielt sie Doktor Schelling entgegen. Der ließ sie in einen dünnen Papierumschlag gleiten und gab sie Karl wieder zurück. »Wenn du möchtest, darfst du sie behalten.«
Karl hatte sich in seinem Überschwang noch nicht fertig bedankt, da gab Doktor Schelling zur Mutter blickend zu bedenken: »Obwohl, der Junge könnte sich an den Kanten verletzen. Und das dünne Glas bricht leicht.« Nach kurzer Überlegung fragte er: »Kennen Sie das Hörsaalgebäude der Charité?« Die Mutter bejahte, wobei jedoch nicht nur der fragende Unterton, sondern auch wie sie dazu ihren Kopf zurücknahm und etwas zur Seite neigte, erkennen ließ, dass sie keinen Zusammenhang mit den gerade geäußerten Bedenken herzustellen vermochte. »Im Dachgeschoss befindet sich das fotografische Atelier der Kinderklinik«, beantwortete er die unausgesprochene Frage der Mutter. »Der Fotograf ist mein Schwager. Sagen Sie einfach, Sie kämen von mir und hätten gerne einen Abzug von der Platte.«
Die Mutter schaute hilfesuchend zu Doktor Dingfelder. Und als dieser nicht reagierte, entgegnete sie: »Das ist wirklich außerordentlich freundlich von Ihnen. Und bitte denken Sie nicht, dass ich Ihren Vorschlag nicht zu schätzen weiß. Aber ich möchte nicht auch noch Ihren Herrn Schwager behelligen.«
»Kein Gedanke«, beschwichtigte sie Doktor Schelling. »Hätte ich noch Papier da, würde ich den Abzug nachher selbst anfertigen und Ihrem Gatten mitgeben. Das ist wirklich keine Sache. Glauben Sie mir.«
Im Flur verabschiedeten sie sich auch von Doktor Dingfelder und die Mutter bat: »Seien Sie doch bitte so freundlich und richten Sie meinem Mann aus, dass wir nach Hause gegangen sind.«
Dass es selbstverständlich vernünftiger war, wenn Karl die Röntgenaufnahme auf Papier anstatt als scharfkantiges Glasnegativ besaß – außerdem mochte sie sich auch nicht zieren – hatte die Mutter den Vorschlag von Doktor Schelling annehmen und den Umweg über das nahe Charité-Gelände machen lassen. Nachdem sie die breite Treppe des Hörsaalgebäudes hochgegangen waren, ließ sie den aufgeregten Karl an die Türe des Fotoateliers klopfen. Während sie mit dem Fotografen sprach, stand Karl ganz unter dem Eindruck des Glasdaches, das in einem Bogen in die beinahe bis zum Fußboden reichende Fensterfront überging. Wie durch ein Wolkenloch blickte er zwischen den an beiden Seiten des Raumes an Drahtseilen durchhängenden weißen Tüchern in den Himmel.
»Na, junger Mann, dann gib mir mal die Platte«, holte ihn der Fotograf aus seinem Staunen. Und nachdem er sie kurz etwas mehr als zur Hälfte aus dem Umschlag gezogen hatte, befand er: »Eine schöne Aufnahme.« Er reichte sie an seine Assistentin weiter und versprach: »In ein paar Minuten bekommst du einen perfekten Abzug.« Dann, ohne dass Karl danach gefragt hatte, erklärte ihm der Fotograf: »Das Dach ist aus Glas, damit wir mit Tageslicht fotografieren können.« Und nach einer kurzen Pause fragte er: »Du warst doch bestimmt auch schon bei einem Fotografen, oder?«
Tatsächlich gab es schon einige Aufnahmen von Karl. Kurz nach seiner Geburt hatten seine Eltern die ersten Fotografien von ihm anfertigen lassen. Dazu auch eine, auf der sie zusammen abgebildet waren. Die Mutter sitzend, Karl im Taufkleid in den Armen haltend, daneben der sich mit einer Hand auf die Rückenlehne des Sessels abstützende Vater. Das letzte Mal hatte die Mutter vor etwas über einem halben Jahr wieder Bilder von ihm machen lassen. Für das letzte hatte er sich aus mehreren im Fotoatelier dafür bereitgehaltenen Spielzeugen eines aussuchen dürfen. Karl hatte sich für einen riesigen Stofflöwen entschieden, der eigentlich zusammen mit einer Khakiuniform mit Tropenhelm und Holzgewehr vor entsprechendem Hintergrund für eine koloniale Jagdszene vorgesehen war. Aber er hatte sich einfach auf das Tier gesetzt und seine weiche Mähne gekrault.
»Natürlich«, antwortete Karl und stellte den Umstand auch gleich unter Beweis, indem er auf die mitten im Raum auf einem Holzstativ stehende Kamera zeigte. »Damit werden die Bilder gemacht.«
»Und möchtest du mal sehen, was wir hier für Bilder machen?« Ohne seine Antwort abzuwarten, ging der Fotograf zu dem in einer Mauernische stehenden Holzregal, entnahm einem der Fächer einen Umschlag und reichte Karl daraus das Portrait eines kleinen Mädchens mit Hasenscharte.
Kaum hatte er das Bild in den Händen, spürte Karl, wie sich etwas in ihm zu wiederholen begann. Wie er von der Darstellung ergriffen und in eine zunehmende Verstörung gezogen wurde. Eine Verstörung, die augenblicklich aus Verwirrung und Ratlosigkeit entstanden war. Denn wie konnte es sein, dass etwas, das doch so traurig war, gleichzeitig derart schön sein konnte? Daran bestand für Karl nämlich, auch wenn ihm die Adjektive fehlten, um seine Wahrnehmung zu beschreiben, kein Zweifel. Diese Aufnahme war schön. Von einer Schönheit, die sich aufdrängte und gewürdigt sein wollte. Und beinahe wäre Karl diesem Drang auch wieder erlegen, hätte er seine Empfindung mitgeteilt. Unbewusst wohl auch, weil er sich davon eine Erklärung für dieses Gefühl erhoffte, dessen offensichtlichen Widerspruch er einfach nicht einzuordnen vermochte. Doch dann besann er sich gerade noch und schwieg.
Der Fotograf fasste erneut in den Umschlag und reichte Karl eine weitere Aufnahme, die das Mädchen nach erfolgter Operation zeigte, worauf Karl mit feierlichem Stolz erklärte: »Das kann mein Vater auch.« Der Fotograf lachte. »Ich weiß. Und du? Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Auch Arzt, wie dein Vater?« Darüber hatte Karl sich noch nie Gedanken gemacht. Er mochte es einfach, im Arbeitszimmer des Vaters auf dem Boden liegend in dessen Fachbüchern zu blättern und die Illustrationen zu betrachten.
Vor einigen Wochen war er dabei in einem Band auf Kupferätzungen nach fotografischen Aufnahmen gestoßen. Die Bilder hatten ihn sofort in ihren Bann gezogen. Eines ganz besonders: