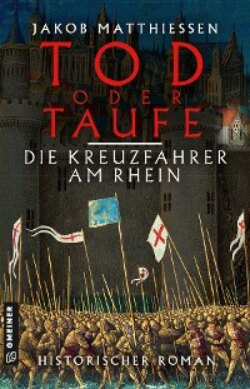Читать книгу Tod oder Taufe - Die Kreuzfahrer am Rhein - Jakob Matthiessen - Страница 11
Teil I: Schatten aus dem Süden Freitag, der 23. Mai Anno Domini 1096 / 28. Ijjar 4856
ОглавлениеMainz – auf dem Synagogenplatz
»Gebt gut acht auf den Ring«, sagte Chaim beim Abschied. Der Rabbi hatte den goldenen Trauring, der schon seit Generationen im Besitz der Gemeinde war, zur Familie des Bräutigams gebracht. Dabei hatten sie die letzten Einzelheiten der Hochzeit besprochen. Und Chaim hatte sich überreden lassen, am Mitzwah-Tanz teilzunehmen, dem letzten Teil der Zeremonie, bevor Braut und Bräutigam endlich eine Weile allein in einem Zimmer verweilen durften.
Er trat aus der Tür und blickte auf den kleinen Platz. Die Sonne stand hoch am Mittagshimmel, die Häuser aus dunklem Holz und Lehm, die ihre Synagoge umschlossen, warfen wohltuende Schatten. Eng zusammengerückt standen sie da, als würden sie das große Steinhaus in ihrer Mitte beschützen wollen. Drei große bogenförmige Öffnungen fanden sich unterhalb des Giebels, das darüberliegende runde Rosenfenster mit dem rötlich schimmernden Glas kam aus Chaims Werkstatt. Erst vor einigen Jahren war ihnen der Bau ihres Bethauses gestattet worden. Jedoch nur unter der Bedingung, dass es nicht direkt an der Straße läge, sondern versteckt in einem Innenhof.
Haus der Beschnittenen wurde ihre Synagoge seitdem von den wohlwollenden Christen genannt. Brutstätte des Teufels war eine andere Bezeichnung, die auch jeder in der Stadt verstand.
Chaim hatte sich gerade dem hohen Eingang ihres Gotteshauses mit den drei breiten Treppenstufen zugewandt, da kam ein Junge aus dem Torbogen zur Lorscher Gasse gerannt. Ein etwas jüngeres Kind folgte dem Buben mit ein paar Schritten Abstand.
»Isaak, ich krieg dich!«, schrie der Jüngere.
»Versuch es doch, Aaron, du Zwerg«, rief Isaak zurück. »Lahmer Zwerg, lahmer Zwerg. Versuch’s doch, versuch’s doch!«
Während des Laufens hatte sich Isaak zu seinem Bruder umgedreht. Es schien, als wolle er den Abstand zu Aaron genau abstimmen. Einerseits sollte sein kleiner Bruder die Verfolgung nicht mutlos aufgeben, andererseits wollte Isaak genug Distanz bewahren, um dessen Knüffen nicht ausgesetzt zu sein. So bemerkte Isaak den Pferdewagen nicht, der mit Speisen und Getränken für die Hochzeit beladen war. Der Kutscher war abgestiegen und bemühte sich, das Gefährt unter den Kran zum Abladen zu bugsieren, sodass die vielen Säcke, Fässer und Kisten endlich im Keller eingelagert werden konnten.
Zunächst drückte er das breite Hinterteil des Pferdes nach vorn, rannte dann fluchend zum Kopf des Tieres und drängte es wieder nach hinten. Das arme Geschöpf wieherte und versuchte, aus den widersprüchlichen Anweisungen des Mannes schlau zu werden. So war der Blick des Wagenführers auf das Pferd und den Kran gerichtet und nicht auf den rennenden Isaak.
Der Rabbi sah das Unglück herannahen. Im allerletzten Augenblick zog er Isaak von dem großen Wagen weg.
Chaim schnaufte. Es hätte nicht viel gefehlt, und der Junge wäre von dem eisenbeschlagenen Rad zermalmt worden.
Langsam beruhigte sich der Herzschlag des Rabbis. Er nahm den Buben auf seinen Arm und ging auf Aaron zu, der vor Schreck auf den Boden geplumpst war. Dabei sprach Chaim streng auf Isaak ein: »Du musst nach vorne schauen, wenn du läufst. Guck, der Wagen dort wäre fast über dich …«
»Isaak, Aaron, rennt doch nicht weg! Ich habe Orli und Bela bei mir, ich kann nicht so schnell«, unterbrach ihn eine kräftige Frauenstimme. Da kam auch schon die Mutter der beiden durch den Torbogen herbeigeeilt. Ihren Säugling Bela trug sie eingebunden in einem Tuch vor der Brust. Die einjährige Orli thronte aufrecht, ebenfalls in ein Tuch gewickelt, auf dem Rücken der Mutter.
»Schalom, Rachel. Hier sind deine beiden Lausbuben«, grüßte Chaim.
»Schalom, Rabbi Chaim, gut, dass ich dich treffe«, brachte Rachel hervor, vom Laufen atmete sie noch schwer. »Hast du einen Moment Zeit?«
Die kleine, kräftige Frau kratzte sich verlegen mit der linken Hand den Nacken. Gleichzeitig zupfte sie mit der rechten ihr abgewetztes Leinenkleid zurecht, an dem ein Riss an der linken Schulter zwar sichtbar, jedoch sorgfältig zugenäht war.
Chaim lächelte freundlich. Er konnte Rachel gut leiden, auch wenn er ab und an über ihre mit manchem Aberglauben gespickte Gottverbundenheit schmunzeln musste. Die Länge des Bartes ihres Mannes Zacharias, dessen Haut doch so empfindlich sei, war Gegenstand langer Erörterungen gewesen. War die Anweisung aus dem zehnten Kapitel des Levitikons, den Bart nicht zu stutzen, nun ein Gebot oder ein Verbot? Und falls es ein Verbot war, wie schwer würde das Kratzen in Zacharias’ Gesicht gegenüber Gottes Willen wiegen? Rachel hatte auf einer Klärung des Sachverhaltes von höchster Stelle bestanden. So hatte diese Frage schließlich selbst den Rat beschäftigt.
Chaim unterdrückte ein Seufzen bei der Erinnerung an all die haarspalterischen Diskussionen. Insbesondere Rabbi Mosche liebte es, sich in solchen Details zu ergehen. Mit welcher Geduld sein älterer Kollege Rachel damals zugehört und alle Aspekte des Bartwuchses und Kratzens ihres Mannes beleuchtet hatte. Da war kein Zweifel: Diese stolze Frau führte ihr bescheidenes Heim nach allen Regeln der jüdischen Sitte. Nun stand sie vor ihm, ihre Haare quollen unter dem halb gelösten Kopftuch hervor, und dicke Schweißperlen standen ihr auf der Stirn.
Eine Unterhaltung mit Rachel könnte lange dauern, dazu hatte Chaim jetzt wirklich weder Lust noch Zeit. Der Domdekan Raimund würde bald in die Synagoge kommen, und Chaim wollte unbedingt den Psalm studieren, den sie gerade bearbeiteten, schließlich war Raimund immer bestens vorbereitet. So antwortete er: »Nein, Rachel, jetzt ist es gerade nicht so gut. Ich muss dringend in die Synagoge.«
»Bitte, Rabbi Chaim, du musst mich anhören. Gestern Nacht ist Zacharias nicht nach Hause gekommen«, insistierte Rachel, während die kleine Orli fröhlich mit ihren Fingerchen am Bindeband des Kopftuchs ihrer Mutter spielte.
»So? Wo wollte Zacharias denn hin?«
»Er ist mit seinem Handwagen frühmorgens Richtung Guntzinheim losgezogen. Am Nachmittag wollte er aber schon zurück sein.« Rachel musste Orlis Hände festhalten, die nun kräftig an ihrem Haarband zogen. »Meister Wendel wollte ihm doch endlich das Geld für die sieben Felle geben, die er vor vier Wochen auf Vorschuss von Zachi erworben hatte. Der Schuster wollte aus dem Leder Schuhe machen und uns dann von dem Erlös bezahlen.«
»Vielleicht ist die Deichsel seines Wagens gebrochen und Zacharias musste unterwegs übernachten.«
»Es ist noch nie passiert, dass er über Nacht nicht heimgekehrt ist«, erwiderte Rachel empört.
Chaim erwog die Möglichkeiten, was geschehen sein könnte. Dass der Trödel- und Kleinwarenhändler nicht heimgekommen war, konnte Tausende von Gründen haben. Jedoch war gerade ein Jude außerhalb des Walls in Gefahr. Die Mauern der Stadt boten Schutz vor Tieren, Wegelagerern und Ausgestoßenen, besonders bei Nacht. Und neuerdings gingen Gerüchte um, dass aufgewühlte Christen sich zu Heeren zusammenrotten würden. Rachels Sorge hatte also einen guten Grund.
Aber was soll ich jetzt machen?, dachte Chaim in seiner Ungeduld. Isaak zappelte auf seinem Arm und der Kutscher war nach wie vor gefährlich am Manövrieren. Er wollte den Jungen daher nicht loslassen. Deshalb fragte er Rachel: »Hast du genug Geld bis morgen?«
Der kleine Aaron war mittlerweile aufgestanden und zog an der linken Hand seiner Mutter. Rachels Blicke wechselten zwischen dem Jungen und Chaim hin und her. Gleichzeitig versuchte sie, mit ihrer Rechten Orli zu beruhigen. »Fünf Silberschillinge hat uns Meister Wendel versprochen. Mittlerweile können wir uns nicht mal mehr Brot kaufen. Zachi war so froh, dass wir nun endlich das viele Geld erhalten würden, das uns der Schuster schuldet.«
Chaim brannte es unter den Füßen, aber er musste der armen Frau helfen. Wenn er Rachel jetzt Geld gäbe, würde er dies jedoch nur unter größten Mühen aus der Armenkasse der Gemeinde zurückbekommen. Dazu brauchte es seit Neuestem die Zustimmung des Rates. Eine reine Formsache in diesem Fall, aber die Zustimmung musste vor der Auszahlung gegeben werden. Chaim fühlte einen Groll gegen diese völlig unnötige Vorschrift in sich aufkommen, dem er nun jedoch keinen Raum geben wollte. Ach, was soll’s, dachte er. Sobald es mit Zacharias’ kleinem Geschäft wieder aufwärtsginge, würde Rachel ihm das Geld unaufgefordert zurückzahlen. Sie würde ihn daran erinnern, wenn er das Ganze längst schon wieder vergessen hätte.
Er wandte sich an den Jungen auf seinem Arm. »Isaak, du musst jetzt brav deiner Mutter folgen, versprichst du das dem Rabbi Chaim?«
Der Junge, der inzwischen an Chaims Schläfenlocken Gefallen gefunden hatte und daraus kleine Zöpfe drehte, nickte gehorsam.
Chaim ließ Isaak hinunter, holte einen Lederbeutel aus seinem Wams hervor, nahm zwei Münzen heraus und legte sie auf seine flache Hand. »Rachel, ich muss jetzt wirklich gehen. Bitte nimm die zwei Pfennige und kauf Brot und auch etwas Wurst für dich und deine Kleinen. Wahrscheinlich gibt es für alles eine ganz einfache Erklärung.«
Rachel schaute Chaim zweifelnd an, sodass der hinzufügte: »Dein Mann kommt sicher bald wohlbehalten zurück. Du darfst das Böse nicht an die Wand malen, sonst kommt es von selbst.«
Bei dem Wort Böse schreckte Rachel unvermittelt zurück. Derweil zogen sowohl Isaak als auch Aaron an Rachels Arm. Sie schaute auf die zwei Münzen in Chaims Hand. Nun fing auch noch die kleine Bela zu schreien an.
Zögernd nahm Rachel das Geld an sich. »Danke, Rabbi Chaim. Ich gebe dir alles zurück, sobald Zacharias wieder zu Hause ist und wir das Geld von Schuster Wendel erhalten haben.«
»Ist schon gut, Rachel. Das hat keine Eile.«
»Kannst du dem Parnas sagen, dass mein Mann nicht nach Hause gekommen ist?«
»Es tut mir wirklich leid, ich muss jetzt gehen. Schalom.« Mit diesen Worten ließ er Rachel und ihre vier Kinder stehen und eilte zum Eingang der Synagoge.
Dort angekommen schlug Chaim das in weiches Leder eingebundene Buch der Psalmen auf und atmete den vertrauten Geruch des kostbaren Pergaments ein. Und während er sich an den wie Perlen aufgereihten Buchstaben und den feinen Bildern erfreute, die sich wie Efeu um die hebräische Schrift rankten, verflüchtigte sich jeder Gedanke an Rachel und ihren Mann.
Mainz – Bischofspfalz, im Schlafraum des Domdekans
Es war eine hohe Kunst, sich der schwarzen Soutane der Benediktiner zu entledigen. Die weiße Kordel mit den zehn Knoten hing bereits am Haken an der Tür. Mit der Gewandtheit jahrzehntelanger Übung griff Raimund mit beiden Händen über Kreuz den schweren Stoff auf Schulterhöhe, beugte sich nach vorn, zog sich zunächst das enge Rückenteil über die Schultern und dann den weiten Rest der Kutte. Dabei vermied er jegliche Berührung des Stoffes mit dem kargen Steinboden seiner Zelle.
Nun stand er da, mit nacktem Oberkörper, nur die weiße Bruoch bedeckte seine Blöße.
Er sah an sich hinunter. Im Gegensatz zur Mehrzahl seiner Mitbrüder hatte er seinen schlanken Körper bewahrt. Die straffe Ordnung des klösterlichen Tagesablaufes war für ihn seit jeher eine wohltuende Stütze, daher musste er die Monotonie des Mönchslebens nicht durch Sinnesfreuden kompensieren. Von dem meist reichhaltigen Klosteressen nahm er nur in Maßen. Aber am Sonntagabend beim geselligen Gespräch mit seinen Brüdern genoss er es, einen Becher Wein zu trinken. Das Kloster am Jakobsberg war allseits bekannt für seine Vinifikation, die sich der roten und weißen Reben von den Hängen der zwei großen Flüsse bediente, die in seiner Stadt zusammenfanden.
Sein Weg sollte ihn heute Mittag zur Synagoge führen. Dabei war es angeraten, unverdächtige Kleidung zu tragen. Schon aus Respekt vor jüdischen Besuchern. Denn obwohl Raimund und Rabbi Chaim für ihr Treffen die Mittagszeit ausgemacht hatten, in der kaum mit Anwesenden zu rechnen war, galt es, vorsichtig zu sein. Die Synagoge stand jederzeit allen in der Gemeinde offen, Gott war schließlich immer da. Und ebenso das Bedürfnis, mit ihm in Kontakt zu treten, hatte Chaim erklärt.
Aber auch christliche Stadtbewohner könnten Anstoß nehmen an einem Mönch auf dem Weg in das Viertel, in dem vorwiegend Juden wohnten, und dies umso mehr, nachdem man ihn im letzten Jahr zum Domdekan bestimmt hatte. Daher schlüpfte Raimund in das grau-grüne Wams, das auf der Pritsche bereitlag, obwohl es nur ein kurzer Fußweg von der Bischofspfalz neben dem Sankt-Martins-Dom zur Synagoge war. Und trotz der seit Wochen andauernden Hitze entschied er sich, auch die Gugel auf dem Kopf zu tragen.
Raimund hängte die Mönchskutte an den Haken zu der Kordel, öffnete die schwere Holztür und schritt an den geschlossenen Zellentüren seiner Mitbrüder vorbei. Das Klappern seiner Sandalen gab den Takt zum Zirpen einer Meise, blühende Rhododendren im menschenleeren Innenhof verbreiteten einen bleiern-süßen Duft. Wenn es so warm war, bevorzugten die Mönche ihre kühlen Zellen zur Mittagsruhe.
Er schritt an dem Kaiserhaus vorbei, in dem der Herrscher über das Frankenreich und seine Fürsten weilten, wenn sie sich zu einem Hoftag in der Mainzer Bischofspfalz versammelten. Heute vermied es Raimund, die Pfalz durch die große Pforte zum Marktplatz zu verlassen. Daher wählte er nicht den direkten Weg über den Michaelishof mit den Ställen und Verwaltungshäusern, sondern wandte sich zum Bischofspalast zu seiner Linken, der einen direkten Zugang zum Dom bot. Er schritt durch die Pforte mit den zwei Säulen und trat in eine große Halle ein.
Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, ließen die schmalen Fenster hoch oben in dem Mauerwerk doch nur wenig Licht hinein. Ein Bildnis Heinrichs IV. auf der gegenüberliegenden Seite nahm zögerlich Gestalt an. Eine weite marmorne Treppe teilte sich nach links und rechts und ließ so Raum für das mannshohe Wandbild des Kaisers. Der stand dort jedoch etwas verloren zwischen all den gerahmten Gesichtern der Geistlichkeit: Seit einigen Jahren prangten Bischof Ruthards zweiundsiebzig Vorgänger an den Wänden hoch über dem Bildnis des Kaisers.
Raimund entschied sich für die rechte Treppe. Oben angekommen blickte er durch ein kleines Fenster in Richtung Michaelishof, wo er die Spitze des alten Wohnturms durch die enge Öffnung erspähen konnte. Obwohl der mächtige Turm von außen sehr robust wirkte, wusste Raimund, dass dessen Inneres in einem erbärmlichen Zustand war. Feuchte hatte sich in alle Winkel eingeschlichen, das Holz war modrig geworden und verbreitete einen muffigen Geruch. Er hatte den Turm als sicheren Lagerplatz für bedeutende Dokumente im Auge, war jedoch mit Bischof Ruthard bisher nicht bezüglich der vorher notwendigen Renovierung übereingekommen. Raimund seufzte kurz, wandte sich nach rechts und passierte den Empfangsraum des Bischofs, vor dem wie immer eine Wache stand. Der lange Gang war ausgefüllt mit goldenen und silbernen Monstranzen, die sorgsam auf Tischen aufgereiht waren. Dazwischen beäugten hölzerne Heilige die Vorbeigehenden, als wären sie vom Himmel abgestellt worden, die kostbaren Reliquien zu bewachen.
Über eine Holzbrücke ging es von dem Bischofspalast hinüber in den Dom.
All die Pracht der Pfalz konnte leicht vergessen machen, dass man sich in einer Festung befand. Neben dem gut gesicherten Tor zum Marktplatz war dieser Übergang die einzige Verbindung nach draußen. Erst letztes Jahr hatte Bischof Ruthard die weitaus prachtvollere Steinbrücke abreißen und durch diese schlichte einziehbare Holzkonstruktion ersetzen lassen. So konnte nun ein Ansturm vom Dom her vereitelt werden. Bei Gefahr verschluckte die Pfalz die Schubbrücke und die Angreifer stünden machtlos vor einem gähnenden Abgrund.
Eine kleine Tür führte in den Altarraum des Domes, durch die er mit seinen Mitbrüdern soeben erst vom Gebet zur Sext gekommen war. Das Mittagslicht zeichnete Streifen in den majestätischen Raum. Christus, ans Kreuz genagelt, blickte stumm auf die wenigen Betenden hinunter. Ein Kranz von Sonnenstrahlen umgab den Körper des Herrn, der, von der Marter seltsam unberührt, hoch über den Menschen schwebte.
Trotz all seiner Bewunderung für die hohe Baukunst empfand Raimund eine merkwürdige Beklemmung angesichts dieses Wahrzeichens erzbischöflicher Macht. Deutlich wohler war ihm in der viel bescheideneren Johanniskirche, die wenige Schritte westlich des Domes innerhalb der Pfalz lag. Dort, vor dem unscheinbaren Bild des Sämanns, der Gottes Botschaft vertrauensvoll über das weite Feld verstreute, betete er am liebsten.
War es, weil auch seine Eltern Bauern waren? Wie so oft tauchten Erinnerungen an seine Mutter ganz unverhofft in seinem Bewusstsein auf. In ihrem erdfarbenen Kleid sah er sie beim Melken der Kühe auf einem Schemel. Sie hielt ihm die noch warme Milch in einem grob geschnitzten Holzbecher an den Mund, aus dem er gierig trank. Der vertraute mütterliche Geruch und der süßliche Geschmack der frischen Milch, die seine Kehle hinunterlief, waren die sinnlichsten Momente eines Kindesglücks, welches einmal da gewesen sein musste. Das war, bevor er als Sechsjähriger in das Kloster auf dem Jakobsberg jenseits der Stadtmauer gebracht worden war. Seitdem hatte er seine Mutter nicht mehr gesehen.
Vermutlich lebte sie nicht mehr, die Bauern hier wurden nicht alt.
Am Ausgang des Doms zog er die Gugel tief ins Gesicht. Schnell schritt er an dem mächtigen Tor zur Bischofspfalz vorbei, hinein in die Straße zum Flachsmarkt, die in Mainz nur die »Lange Gasse« genannt wurde. Aus den zweistöckigen Häusern links und rechts drangen Stimmen, Kinderschreien und -lachen, deftiges Fluchen und das ein oder andere Tischgebet. Nur vor einigen der vielen Läden waren Waren ausgestellt. Er kam zügig voran auf dem sonst so geschäftigen, jedoch in der heißen Mittagszeit fast menschenleeren Weg.
Vor dem Flachsmarkt bog Raimund nach links ab in die Lorscher Gasse und ging auf einen weiten Torbogen zu. Der Durchgang zum Synagogenplatz führte durch eines der wenigen Steingebäude in Mainz, in denen keine Gottesdienste gefeiert wurden, sondern die ausschließlich als Wohnstätten dienten. Auf der rechten Seite des Durchgangs stand Frau Hendlein zwischen den Auslagen ihres Geschäftes. Die Gattin des wohl tüchtigsten Kaufmanns von ganz Mainz grüßte Raimund, indem sie die Hände auf die Brust legte und sich verbeugte. Sie trug ein Kleid aus einem der leuchtenden orientalischen Stoffe, die bei den Städterinnen heiß begehrt waren.
Raimund antwortete mit einem kurzen Nicken und warf einen Blick auf die Auslagen. Neben einem Tischchen mit feinen Lederhandschuhen stand eine marmorne Madonna aus Italien. Marderfelle hingen an einem Haken in der Tür, und in einer Vielzahl von Schalen waren bunte, herrlich duftende Gewürze aus fernen Ländern ausgestellt, die im Rheintal nicht gedeihen wollten. Sogar eine vergoldete Amphore stand neben einem kupfernen Kessel, der aus Afrika zu kommen schien.
Raimund schritt unter dem Torbogen hindurch und blickte auf das Haus aus hellbraunem Sandstein mit dem hohen Giebeldach in der Mitte des Platzes. Die rundliche Ausbuchtung in der Mitte der Hauswand zeigte die Stelle an, an der sich im Inneren der Torahschrein befand. Darüber thronte das runde Rosenfenster aus rötlich schimmerndem Glas. Ein Fuhrmann lud mit einem Kran die letzte Kiste seiner Ladung ab.
Er hatte sich mit Chaim in dem kleinen Holzanbau zur Linken der Synagoge verabredet.
Auf einem Acker nahe Gerstendorf
Ruhig und stetig zog das braune Kaltblut voran, dem trockenen Boden unter ihm zum Trotz. Lenes dunkler Schweif baumelte gemächlich über ihrem breiten Hinterteil. Der Pflug riss eine neue Furche, drei Handbreit neben der, die sie zuvor gezogen hatten. Lene wusste von selbst, wie sie sich bewegen musste, locker lag die Leine über Peters Schulter.
Wegen der Härte des Bodens musste er den Pflug fester halten, als es sonst notwendig war. Immer wieder wollte das Schar ausbrechen, manchmal nach links, in das unbearbeitete Feld, manchmal nach rechts, in eine der Furchen, die sie bereits gezogen hatten. Und Peter musste auch darauf achtgeben, dass er nicht hängen blieb an den großen Steinen, die sich auf dem Feld wie Sterne am Himmel verteilten, denn sonst könnte der eiserne Meißel beschädigt werden.
Er wischte sich den Schweiß aus der Stirn. Seit dem frühen Morgen hatten sie bereits geschuftet und erst ein paar Dutzend Furchen waren gezogen. Der Acker auf dem Rücken des Hügels schaute ihn mitleidlos an.
Wenn er schon pflügen sollte, dann nur mit ihrer Stute Lene, hatte er heute Morgen am Tisch in der Stube gefordert. Vater war einverstanden gewesen. »Nimm sie nur, ich habe heute im Stall zu tun. Pass aber auf, dass das Kumt richtig um ihren Hals liegt, damit sie genug Luft bekommt.« Diese Bemerkung seines Vaters hatte ihn geärgert. Als ob er das nicht selbst wüsste.
Am Ende des Feldes angekommen, lockerte Peter seine verkrampften Schultern. Weil er stetig auf den schwarzbraunen Boden hatte schauen müssen, tat es ihm gut, den Blick schweifen zu lassen, entlang des grünlich schimmernden Flusses und über die Hügel jenseits des Ufers. In weiten Bögen wand sich der Rhein durch die Landschaft. Ruhig floss er daher, von Speyer über Worms und schließlich bis nach Mainz, so wusste es Peter aus den Erzählungen seiner Eltern. Doch die drei großen Städte lagen verborgen hinter Hügeln.
Ach, wie gerne würde er Mainz einmal sehen. Der Turm der großen Kirche sei so hoch, dass er die Wolken kitzle. Das hatte ihm einmal ein altes Weib aus Gerstendorf erzählt, wohin sie jeden Sonntag zur Messe gingen.
Die Konturen des Rheintals verloren sich in der Ferne, verschluckt vom Dunst am Horizont. Aus den Wäldern auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses streckte sich der Turm der Burg Oppenheim wie der Kopf eines Rehs hervor. Etwas unterhalb der Burg mühte sich ein Bauer hinter einem Ochsen über ein Feld. Immer wieder ließ er den großen Stock auf das Tier niederfahren. Gut, dass er die folgsame Lene hatte, dachte Peter.
Ein Fährboot lag auf der anderen Rheinseite halb auf dem Ufersand, der Ferge ruhte in seinem Schatten.
Nur ganz selten war Peter mit dieser Fähre zum großen Markt in Oppenheim über den Rhein gefahren. Meist zusammen mit der Mutter und mit Gänsen und Hühnern, Zwiebelsäcken und ein paar Kisten Kohl. Zu zweit zogen sie dann frühmorgens den schweren Holzwagen den Berg hinauf in die Stadt. Angekommen am Tor zum Markt legte sie ihm gewöhnlich die Hände auf die Schultern und lobte ihn seiner gewachsenen Kräfte wegen.
Heute warteten lange Stunden der Plackerei auf ihn, und trotzdem würden sie erst in ein paar Tagen mit dem Acker fertig werden. Peter seufzte. Lenes große, freundliche Augen blickten ihn fragend an. Zärtlich streichelte er über ihren struppigen Hals und flüsterte ihr zu: »Komm, Lene, wir gehen zur Wasserstelle und ruhen uns im Schatten der Bäume etwas aus.«
Lene nickte mit ihrem zotteligen Kopf. Peter spannte den Pflug ab, und so trotteten sie gemeinsam zu dem kleinen Wäldchen am Feldrand. Nochmals richtete Peter seinen Blick in die Ferne in Richtung Worms. Eine außergewöhnlich große Staubwolke fiel ihm auf. Sie kroch zum Himmel empor, dort, wo der Rhein sich hinter dem lang gestreckten Hügel versteckte. Es ist doch kaum ein Wind zu spüren, wunderte sich Peter.
An der Baumgruppe angekommen, zog es Lene sofort zu dem kleinen Bach. Bald scharrten ihre Hufe durch den steinigen Grund, während sie das frische Wasser gierig einsaugte. Auch Peter genoss das kühle Nass, das er aus seinen Händen schlürfte.
Nachdem sein erster Durst gestillt war, nahm er den großen Ledersack aus Ziegenfell von Lenes Rücken, zog den Korken aus dem hölzernen Mundstück, lehrte den Schlauch aus und ließ das frische Wasser des Baches hineinlaufen. Er lehnte sich an eine große Linde und nahm eine der getrockneten Pflaumen, die ihm seine Mutter am Morgen mitgegeben hatte, aus dem Beutel, den er am Gürtel trug. Saftig und süß, so mochte er es. Bald würde auch sein kleiner Bruder mit dem Essen kommen.
Peter liebte diesen Platz, den er in den Pausen aufsuchte, wann immer er in der Nähe arbeiten musste. Von hier aus konnte er in aller Ruhe das Geschehen auf dem Treidelweg auf der anderen Seite des Flusses beobachten. Heute zogen zwei kleine Händlergruppen am Fluss entlang. Ein schwarzer Ochse war vor den ersten Wagen gespannt, ein massiger Ardenner zog den anderen. Ein Reiter auf einem stolzen Hengst forderte mit ausholenden Armbewegungen, dass man ihm Platz machte.
Flussabwärts trieben zwei Schiffe in Richtung Mainz. In Gegenrichtung mühten sich ein Mann und ein Mädchen, eine kleine Barke an langen Leinen zurück nach Worms zu treideln. Ach, auf einem Schiff zu arbeiten, das wäre schön. Dann könnte man sich ausruhen, wenn es den Fluss hinunterging.
Ein leises Rauschen meinte Peter zu vernehmen, ein Rumpeln und Poltern in der Ferne, aus der Richtung dieser seltsamen Wolke, die näher gekommen war. Unvermittelt stand der Ferge auf und schaute flussaufwärts. Hastig schob er sein Boot in das Wasser, steuerte mit kräftigen Schlägen in den Fluss und ruderte herüber auf die hiesige Seite.
Mainz – im Anbau der Synagoge
Beim Eintritt in den Anbau der Synagoge schlug Raimund der Duft von frisch gebackenem Brot entgegen. Jehudith, die Frau des Rabbis, winkte ihm mit einer mehligen Hand zu. Auch ihre Schürze und Arme waren ganz bestäubt von dem hellen Puder. »Mein Mann erwartet dich bereits. Er brütet in der Synagoge über dem Text, den ihr heute übersetzen wollt.«
Raimund zog sich die Gugel von seinem Kopf und verbeugte sich vor der Frau seines Freundes. Auf einem Tisch neben dem Ofen lag ein großer heller Teigklumpen, in den sie mit der Faust ihrer rechten Hand ein Loch drückte. Aus einem Tonschälchen goss sie eine gräuliche Masse in das Loch hinein und schlug den Teig darüber zusammen. Flink kneteten Jehudiths Hände die zähe Masse, mit kräftigen Bewegungen walkten ihre Handballen wieder und wieder in den Teig hinein. Dann streute sie Mehl auf den Tisch und drückte den Klumpen flach, um den Fladen nochmals zusammenzuschlagen und in rhythmischen Bewegungen weiter durchzukneten.
Fasziniert beobachtete Raimund das geschickte Spiel von Jehudiths Händen. Nach einer Weile der Stille blickte sie ihn fragend an. »Warum schaust du so interessiert, wenn ein Weib seine Arbeit verrichtet?«
»Entschuldige bitte, Jehudith«, erwiderte Raimund. »Aber kennst du das Gleichnis vom Sauerteig? Daran musste ich denken.«
»Nein, das kenne ich nicht.«
Da ertönte eine warme Stimme aus der Tür, die zur Synagoge führte. »Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und unter drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz durchsäuert ward.«
Chaim kam mit ausgebreiteten Armen auf Raimund zu. Seine großen wachen Augen über dem buschigen Bart schauten ihn freundlich an. »Raimund. Wie schön, dich zu sehen.«
»Dein Wissen über unseren Herrn beeindruckt mich immer wieder.« Raimund streckte seine Hand aus, die Chaim, das Angebot der Umarmung dezent zurückstellend, herzlich ergriff.
»Danke. Gerade gestern habe ich in den Berichten eurer Evangelisten gelesen. Ich mag es sehr, wie euer Herr seine kleinen Geschichten erzählt wie die vom Sauerteig. Ganz schlicht und doch verwirrend schön. Dann denke ich, da spricht ein Jude zu mir, rätselhaft und geheimnisvoll«, schwärmte Chaim und fügte dann ernst hinzu: »Aber du weißt, ich kann nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Gott will nicht, dass man ihn teilt.«
Auch wenn Raimund das sehr wohl wusste, versetzte es ihm doch einen kleinen Stich ins Herz. Er hatte seinem Freund eine Funktion als Berater der Kurie zu Fragen des Alten Testaments vermittelt. Dies war sowohl für ihn selbst als auch für Chaim von Vorteil, konnten sie doch so ihre religiösen Gespräche unter einem Mantel der Legalität verbergen. Und natürlich hatte er gehofft, seinem Freund ein wenig Verständnis für die Göttlichkeit Jesu abzugewinnen, die seit dem Konzil von Nicäa vor mehr als siebenhundert Jahren ein kirchliches Dogma war. Aber in diesem Punkt gab Chaim keine Haaresbreite nach. So schaute Raimund nun ein wenig enttäuscht auf Jehudiths Hände, die in emsiger Beharrlichkeit den Teig weiterbearbeitete.
»Mein Freund, da ist ganz viel Gutes in dem, den ihr euren Heiland nennt«, fügte Chaim in versöhnlichem Ton hinzu. Er schloss die Augen und sprach langsam, als wolle er sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen: »Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und unter drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz durchsäuert ward. Wahrlich, dieses schöne Gleichnis hätte einen Platz auch in unserem Talmud verdient.«
Jehudith kicherte. »Ganz gewiss arbeite ich für das Reich Gottes, denn ich bereite das Essen für die Hochzeit meiner Schwester Sarah vor. Fast die ganze Gemeinde wird am Sonntag hier erscheinen. Geht ihr nur euren geistigen Beschäftigungen nach, während ich mich um das Leibliche kümmere.«
»Höre ich da etwa eine Andeutung von Spott, mein Liebes?« Der Rabbi steckte seine Hände in die Seitentaschen seiner braunen Weste, die er über einem mit Stickereien verzierten Wams trug, zog die Augenbrauen hoch und blickte Jehudith an. Dabei musste Chaim sein Haupt nach oben richten. Seine Frau war einen halben Kopf größer als er.
»Ich will es so ausdrücken.« Jehudith legte von dem Teig ein daumengroßes Stück für das Opfer beiseite. »Wenn du mein Brot isst, dann ist es nur recht und billig, wenn du mir danach auch von den Früchten eurer Arbeit erzählst.«
An Raimund gewandt sagte Chaim schmunzelnd: »Du musst wissen, Jehudith mag die Psalmen sehr. Deshalb gefällt ihr deine Idee, sie zu übersetzen. Dann kann sie die Lieder Davids unseren Kindern nicht nur auf Hebräisch, sondern auch in unserer Alltagssprache vorsingen.«
»Du bist zu beneiden, ein solch kluges Weib deine Frau nennen zu dürfen«, antwortete Raimund.
»Nun aber genug der Schmeicheleien. Verschwindet aus meiner Küche und lasst eine einfache Frau ihre Arbeit verrichten. Sonst wird’s ein trauriges Hochzeitsfest am Sonntag werden!«, rief Jehudith lachend.
Freundlich, aber bestimmt schob Chaim seinen christlichen Freund zur Tür, die in die Synagoge führte.
Auf einem Acker nahe Gerstendorf
Da! Reiter auf schwarzen Pferden erschienen hinter dem Hügel auf dem Treidelpfad. Neben ihnen liefen einfache Soldaten. Peter sprang auf. Der Vorhut folgte ein Trupp Berittener mit weißen Fahnen. Er beschirmte seine Augen mit der Hand. Die großen weißen Banner mit dem roten Kreuz. Das mussten die heiligen Ritter sein!
Jetzt tauchte eine Kolonne Wagen auf. Peter kniff die Augen zusammen. Sie schienen mit allerlei Alltagsgerät beladen zu sein. Den Schluss der Karawane bildete Fußvolk. Aber bald kamen schon wieder neue Reiter. Ein wahrer Strom von Menschen, Pferden und Fahrzeugen quoll hinter der Biegung des Rheins hervor.
Seit letztem Jahr schwärmte der Pfarrer von den Gotteskämpfern! Und ganz verrückt vor Aufregung waren die Kinder im Dorf. Befreit Jerusalem, Gott will es, hatte der Papst gefordert. »Jerusalem, Jerusalem, wir befreien Jerusalem!«, riefen die Jungen und Mädchen seit Neuestem, während sie mit Stöcken um den Teich liefen. Und die Alten beklatschten das Treiben ihrer Kinder.
Sogar von Zeichen wurde seit einiger Zeit im Dorf gemunkelt. Ein Komet mit einem Schweif wie ein Schwert hätte sich am Himmel gezeigt. Auch zwei himmlische Reiter wurden geschaut. Einer mit einem großen Holzkreuz, der andere mit einem krummen Säbel. Und, so hatte es der Pfarrer berichtet, der Säbelträger wurde von dem Kreuz zermalmt, blutrote Wolken seien daraufhin am Himmel erschienen.
Peter schnalzte ungeduldig und Lene kam folgsam aus dem Bach getrottet. Er musste unbedingt ein Stück weiter das Feld hinauf, vielleicht konnte er von dort aus noch besser sehen.
Viele Menschen, viel mehr, als Peter je gesehen hatte, marschierten nun über den Handelsweg auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Immer näher kamen die Reiter an der Spitze des Zuges, viele in leuchtenden Kleidern und mit Schwertern. Echte Ritter! Daneben Knappen, die die Lanzen trugen. Vergessen war die Pflugschar. Peter ließ Lene am Feldrand grasen.
Eine Vielzahl von Karren, bunt durcheinandergewürfelt, von Ochsen und Pferden gezogen. Auf den meisten Wagen sah Peter lange Stangen. Zeltstangen! Das mussten Zeltstangen sein. Wie es wohl sein würde, mit Zelten zu lagern? Wild pochte Peters Herz. Je näher der Zug kam, desto deutlicher sah er, wie viele Pilger es waren. Dass es so viele Menschen auf der Welt überhaupt gab! Sapperlot! Und sie zogen an seinem Acker vorbei.
Mainz – in der Synagoge
Eine rote Rose vibrierte auf dem hell gekachelten Steinboden der Synagoge. Geheimnisvoll warf die Sonne ihr Licht durch das runde Giebelfenster mit dem rubinroten Glas. Die hohen weiß verputzten Wände ließen den Raum trotz der wenigen und schmalen Fenster licht und einladend erscheinen. Chaim geleitete Raimund an der achteckigen Bimah vorbei, auf der während des Gottesdienstes der Aufgerufene die heiligen Texte vortrug. Raimund bewunderte die fein ziselierten Bögen, von denen dieser erhöhte Bereich umgeben war. Doch wies ihn Chaim in einen Nebenraum, der sonst dem Talmudunterricht diente.
Wie so oft in den letzten Monaten standen sie gemeinsam an dem Lehrerpult. Raimund griff in sein Wams, entnahm ihm eine schlichte hölzerne Mappe und legte sie neben das in Leder eingebundene Buch, welches aufgeschlagen bereitlag. Ein kunterbunter Papagei umspielte mit seiner Laute die hebräischen Buchstaben, die mit höchster Präzision auf das kostbare Pergament geschrieben waren.
»Lass uns mit dem hundertvierten Psalm weitermachen, der Hymne der Schöpfung«, sagte Chaim. »Wir haben letzten Montag mit dem neunten Vers abgeschlossen.«
Raimund öffnete die Holzmappe, deren Innenseiten von einer honigfarbenen Wachsschicht überzogen waren. Links hatte er den Psalm aus der Übersetzung des großen Gelehrten Hieronymus eingeritzt. »Im zehnten Vers heißt es: Qui emittis fontes in convallibus inter medium montium pertransibunt aquae potabunt omnes bestiae agri expectabunt onagri in siti sua.«
»Dann lass uns auch im Sefer Tehillim nachschauen.« Chaim beugte sich über das Buch der Lieder und deutete auf eine der Zeilen. »Sieh, hier ist die Stelle.«
Chaims Finger fuhren von rechts nach links über eine Zeile mit den hebräischen Buchstaben, ohne das Pergament zu berühren. »Dort heißt es: Há-meschaléach ma’ajaním ba-nechalím, bejn harím jehalechún.«
»Leider sagen mir diese Zeichen nichts«, sagte Raimund mit Bedauern in der Stimme. »Aber im Hebräischen klingt es viel weicher als im Lateinischen. Es ist mehr ein Singen, selbst wenn du es sprichst.«
»Es sind ja auch die Lieder Davids«, antwortete Chaim schmunzelnd. »Nun sag schon, wie hast du es übersetzt?«
Raimund schaute auf die rechte Seite der Wachstafel.
»Auf Gottes Befehl hin füllen sich Auen aus den Quellen,
sie fließen zwischen Bergen,
die Tiere des Feldes trinken,
wilde Esel löschen ihren Durst.«
»Gut getroffen.« Chaim beugte sich nochmals über die Passage im Sefer Tehillim. »Im hebräischen Text steht in etwa: ›Der, der die Quellen sich ergießen lässt in Auen.‹ Den Ausdruck Gottes Befehl, den sollte man vielleicht besser weglassen. Der Satz wird auch zu lang, und der Rhythmus geht verloren.«
Einen Moment lang schloss Chaim die Augen. Er kämmte mit seinen kräftigen Fingern durch seinen Bart und sagte schließlich: »Was hältst du von Du füllst Auen aus den Quellen.«
»Mmmmh, das gefällt mir gut.« Und nach einem Moment des Nachdenkens fügte Raimund hinzu: »So belassen wir es.«
»Der Rest stimmt ganz gut mit dem hebräischen Text überein, wobei man es vielleicht noch flüssiger ausdrücken kann.«
»Hast du einen Vorschlag?«
Chaim schloss erneut die Augen und sagte in einem leichten Singsang:
»Du füllst Auen aus den Quellen,
sie fließen zwischen saftig grünen Berghängen dahin.
Die Tiere des Feldes trinken,
wilde Esel löschen ihren Durst.«
»Saftig grün, ist das deine Erfindung?« Raimund sah auf den Text auf der Wachstafel. »Das steht jedenfalls nicht in der Vulgata. Kommt das im hebräischen Text vor?«
Abrupt öffnete Chaim die Augen und blickte auf das Buch vor sich auf dem Pult. »Nein, das steht nicht dort. Aber ich finde, es klingt so schön und man kann sich die Tiere des Feldes und die wilden Esel auf den grünen Hängen besser vorstellen.«
»Mhhh. Ich weiß nicht.« Raimunds Stirnfalten zogen sich zusammen. »Ich finde nicht, dass wir etwas hinzudichten sollten.«
»Du bist ja mal wieder richtig pedantisch!«, erwiderte Chaim unwirsch, wobei jedoch ein Lächeln seine Lippen umspielte.
»Es ist Gottes Wort, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein«, antwortete Raimund ernst. »Aber lass uns einen Kompromiss schließen. Ich setze eine Klammer um saftig grün, dann können wir das später entscheiden, wenn wir den gesamten Psalm niedergeschrieben haben.«
Raimund nahm einen Griffel aus seinem Wams. Das eine Ende war zugespitzt und das andere abgeflacht. Mit Letzterem rieb er vorsichtig über das weiche Bienenwachs auf der rechten Innenseite der Mappe und die Schriftzeichen verschwanden. Dann drehte er den Griffel um und ritzte mit dem spitzen Ende den Text, den Chaim gerade vorgelesen hatte, in die Fläche ein. Sanft zog die Griffelspitze durch das weiche Wachs und die Buchstaben reihten sich in akkuraten Strichen und perfekten Bögen aneinander.
Kritisch betrachtete Raimund das Geschriebene und reichte Chaim die Wachstafel. Der nickte wohlwollend beim Lesen und gab sie Raimund schließlich mit anerkennendem Blick zurück.
»Lass uns weitermachen.«
Raimund schaute auf die linke Seite der Mappe und las: »Im nächsten Vers heißt es: Super ea volucres caeli habitabunt de medio petrarum dabunt voces. Wie lautet es im Hebräischen?«
Das Tappen von Schritten riss die beiden Gelehrten aus ihrer Arbeit.
Auf einem Acker nahe Gerstendorf
Schier endlos schob sich der Menschenzug auf dem Treidelpfad dahin und immer mehr Gestalten strömten hinter dem Hügel hervor. Doch waren es kaum noch stolze Ritter auf Pferden mit ihren Knappen. Es waren Bauern mit Sensen und Spießen, Ochsenwagen, beladen mit Kisten, Säcken, Gänsen und Hühnern in ihren Käfigen. Mütter zogen ihre Kinder inmitten von Schweinen und Ziegen hinter sich her, Hunde rannten durch die Menge. Dazwischen schienen ein paar Mönche zu singen und zu tanzen.
Staunend beobachtete Peter das Treiben. Was für ein Schauspiel bot sich da direkt vor seinen Augen!
Sein kleiner Bruder Bernhard kam über den Rücken des Hügels gelaufen. Er hielt einen Korb in den Händen. »Peter, Peter! Mutter hat mich geschickt. Ich bring dir das Essen.«
Peter zeigte in Richtung des Treidelpfades. Für einen Augenblick blieb Bernhard stehen. Mit offenem Mund betrachtete er die Menschenmassen, rannte zu seinem älteren Bruder und zog ihn an der Hand. »Komm, komm, schnell nach Hause.«
»Das sind die kämpfenden Wallfahrer, die ins Heilige Land ziehen«, bemerkte Peter wissend. Er lächelte seinem Bruder zu. »Wollen wir uns die Jerusalempilger zusammen anschauen?«
Peter spürte den Druck von Bernhards Fingern in seiner Handfläche. Der Blick seines Bruders schweifte entlang des Rheins, dann schaute er Peter mit unsicheren Augen an. Der lächelte beschwichtigend. »Schau auf diese Menschen. Sie ziehen den weiten Weg in den Orient, weil der Herr der Kirche es von ihnen verlangt hat.«
Bernhard blieb bei seinem Bruder.
Sie inspizierten den Korb, den die Mutter für Peter gefüllt hatte. Ein halber Laib Brot war dort zu finden, eine große geschälte Zwiebel, zwei Äpfel, fünf Karotten und eine Tonschale mit Butterschmalz. Peter riss ein kleines Stück Brot ab und gab es Bernhard, nahm anschließend ein großes Stück für sich selbst, fuhr damit durch das weiche Schmalz und biss genussvoll hinein. Bernhard linste auf den kleinen Lederbeutel an Peters Gürtel. Der lachte, öffnete ihn und gab Bernhard eine Pflaume. Schmatzend lutschte sein kleiner Bruder an der dunkelblauen Frucht.
Bernhard lehnte sich an Peter an, der den Arm um ihn legte. Eng angeschmiegt saßen sie da. Peter spürte, wie das Auf und Ab des Brustkorbs seines Bruders langsam ruhiger wurde, die körperliche Nähe tat auch ihm gut.
Wie ein langer Wurm schlängelte sich die Prozession auf der anderen Seite des Rheins den Pfad entlang. Peter vergaß all die Köstlichkeiten, die Mutter für ihn mitgegeben hatte. Gemeinsam winkten sie den Menschen zu. Das ein oder andere Bauernkind erwiderte ihren Gruß.
Oder wollten sie die beiden zu sich winken? Riefen sie etwa: »So kommt doch mit, ihr zwei!« Oder war dies nur Peters Wunsch? Jerusalem, die Heilige Stadt. Peter war es, als wollten seine Füße den Berg hinunterlaufen. Bernhards Interesse richtete sich dagegen immer mehr auf den offenen Lederbeutel. Er stibitzte eine weitere Pflaume aus dem offenen Säckchen, aber Peter war so mit dem Treiben auf dem gegenüberliegenden Ufer beschäftigt, dass er seinen kleinen Bruder gewähren ließ.
Langsam steuerte der Ferge sein Boot zurück in Richtung des Ufers, an dem die Menschenmassen über den Treidelweg marschierten. Lene genoss derweil ganz unbeteiligt das frische Gras.
Mainz – in der Synagoge
Respektvoll näherte sich David, Jehudiths und Chaims Ältester. In seiner Hand hielt er eine Schiefertafel.
»Sei gegrüßt, David«, sagte Raimund, »wie geht es dir?«
»Entschuldigt bitte vielmals, dass ich störe«, antwortete David, »aber der Parnas hat mich gebeten, diese Nachricht eiligst meinem Vater zu übergeben.«
»Was will Kalonymos von mir?« Chaim stöhnte laut. »Kann das nicht warten? Du siehst doch, dass wir mitten in der Arbeit sind.«
»Er hat gesagt, es sei sehr dringend«, insistierte David und hielt ihm die Schiefertafel vors Gesicht.
Entschuldigend blickte Chaim zu Raimund, nahm die Tafel und las. Bereits nach wenigen Zeilen wurde er ganz ernst und wandte sich an seinen Sohn. »Was hat Kalonymos noch gesagt?«
»Er lässt ausrichten, dass sich der Rat augenblicklich bei ihm treffen soll. Er bittet darum, dass du dich beeilst.«
»Ich komme«, sagte Chaim. »Raimund, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen.«
»Was ist passiert?« Raimund sah ihn besorgt an. Sein Freund konnte sich sicher denken, dass Streitfragen über Talmudauslegung oder innerjüdische Angelegenheiten nicht solcher Eile bedurft hätten.
»Es gibt beunruhigende Nachrichten aus Speyer.« Chaim wollte Raimund nicht vor den Kopf stoßen, aber er hatte eigentlich schon zu viel gesagt. Die Dinge, die im Rat besprochen wurden, mussten absolut vertraulich behandelt werden. Selbst Jehudith dürfte er eigentlich nichts davon erzählen. Aber in ihrem Fall überging er das strenge Gebot. Auf Jehudiths Verschwiegenheit konnte er sich verlassen. Um aus ihr etwas herauszubekommen, müsste man sie foltern.
Raimund schien sich über Chaims Situation im Klaren, daher unterbrach er die peinliche Stille und verbeugte sich. »Bitte lass mich wissen, wenn ich helfen kann.«
»Wir werden deine Hilfe vielleicht bald bitter nötig haben«, antwortete Chaim, erleichtert, dass sein Freund, der Domdekan, ihm vertraute, obwohl er sich so verhalten geäußert hatte.
Chaim zeigte auf ein zusammengefaltetes Leintuch neben dem Tehillim auf dem Pult und sagte: »David, möchtest du das Buch der Psalmen in das Regal zurücklegen? Du weißt ja, wohin.«
David nickte. Chaim sah noch, wie sein Sohn das Leinen nahm, es auf dem Pult auseinanderfaltete und das kostbare Buch auf den ausgebreiteten Stoff legte, den er schließlich sorgfältig über dem Leder zusammenschlagen würde.
Am Ausgang der Synagoge schaute Chaim nochmals hinter sich. Achtsam trug David den Tehillim zu dem kopfhohen Regal an der Seitenwand der Synagoge, in dem sich unzählige Schriftrollen, Bücher und andere Dokumente befanden, wohlgeordnet in verschiedenen Abteilungen. Eine süße Wehmut umfing Chaim, sein Vaterherz sehnte sich danach, dass auch David einmal ein Rabbi werden würde.
Chaim trat auf den Platz vor der Synagoge. Mit schnellen Schritten eilte er den kurzen Weg zum Haus von Kalonymos ben Meschullam, dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Mainz.
Auf einem Acker nahe Gerstendorf
Letztendlich hatte Peter sich losreißen können und war zurückgekehrt zu seiner Arbeit auf dem Feld. Auch Bernhard war nach Hause gegangen, jedoch nicht, bevor er die letzte Pflaume aus Peters Beutel genommen hatte.
Die Ritter mit den Fahnen waren längst hinter der Flussbiegung in Richtung Mainz verschwunden, aber noch immer kamen Menschen von der Wormser Seite, jedoch weitaus spärlicher.
Die Fähre und ein kleineres Boot machten sich gerade daran, den Rhein zum hiesigen Ufer hin zu überqueren. Der Fährmann schob ein Ochsengespann auf seine Ladefläche. Der Wagen trug keinerlei Fracht, aber ein Ritter und sein Knappe gesellten sich zu ihm, nachdem der Ferge das Gespann unter großen Mühen eingeladen hatte.
In dem kleineren Boot saßen einige Mönche in braunen Gewändern. Ein Priester in einer feuerroten Kutte stand am Bug. Aufmerksam tastete der Blick des großen schlanken Mannes die Hügel des diesseitigen Ufers ab, ein großes silbernes Kreuz hing um seinen Hals. Nun schaute er genau in Peters Richtung. Nahm der Priester ihn wahr? Das Kreuz spiegelte das Sonnenlicht zu ihm herüber und eine Welle des Wohlbehagens durchfloss Peters Körper. Dann schweifte der Blick des Mannes weiter.
Das kleine Boot glitt über das Wasser.
Auf ihrer Seite angekommen, verteilten sich die Mönche in der Landschaft. Wie ein schmaler roter Strich zeichnete sich der Priester vor den grünen Wiesen und braunen Feldern ab. Langsam kleiner werdend, bewegte er sich einen Hang hinauf, bis er schließlich in einem Wald verschwunden war.
Mainz – auf der Langen Gasse
Speyer, hatte Chaim gesagt. In Gedanken versunken ging Raimund die Lange Gasse zurück zum Dom. Für den nächsten Morgen war Raimund beim Bischof einbestellt, zusammen mit dem Vogt. Ob das irgendetwas mit der Nachricht an Chaim zu tun hatte? Sein Freund schien seltsam reserviert und bekümmert. Raimund war so damit beschäftigt, sich einen Reim auf die ganze Sache zu machen, dass er beinahe mit einer Waschfrau zusammengeprallt wäre, die einen Zuber Wasser in den Rinnstein gießen wollte. Das Weiblein wollte schon zu einer Schimpftirade ansetzen, als sie den Domdekan trotz seines Wamses erkannte.
Raimund entschuldigte sich knapp. In seinem Kopf durchwalkte er die verschiedensten Möglichkeiten, wie es Jehudiths flinke Hände mit dem Sauerteig getan hatten. Wenn der Vogt involviert war, dann musste es um etwas gehen, das sich außerhalb der Bischofspfalz abspielte. Das gehörte nicht zu seinem Einflussbereich als Domdekan, das lag in der Verantwortung des Propstes. Raimunds Aufgabe bestand normalerweise nur in der Organisation des geistlichen Lebens innerhalb der Domdiözese.
Aber nun befand sich Dompropst Manfried seit einigen Wochen auf Reisen. Lange hatte sich der alte und wegen seines Pflichtbewusstseins allseits geschätzte Stiftskollege danach gesehnt, eine Pilgerreise zum Grab des heiligen Viktor in Xanten anzutreten. Seitdem musste Raimund den Propst vertreten.
Raimund stöhnte vor sich hin. Gerade er, dem das Machtpolitische gleichermaßen fremd wie zuwider war. Ein Empfang beim Bischof zusammen mit dem Vogt? Chaims besorgte Reaktion ließ Raimund mit noch größerem Unwohlsein auf das morgige Treffen blicken. Entsprechend beunruhigt trat er durch das Tor der Bischofspfalz, deren Wachen ihm erst den Weg versperren wollten, da auch sie ihren Domdekan in seinem Wams zunächst nicht erkannten. Erst jetzt bemerkte Raimund, dass er besser den weitaus diskreteren Weg durch den Dom über die einziehbare Holzbrücke genommen hätte.
Mainz – im Haus des Parnas
Noch bevor er klopfen konnte, wurde Chaim die Tür geöffnet.
»Sie warten schon auf dich, oben im Empfangsraum«, raunte ihm die Frau des Parnas zu. Sie war umgeben von einer Duftwolke, die Chaim für einen Moment irritierte. Auch Jehudith machte ab und an Gebrauch von Duftwasser, jedoch zu seinem Gefallen in einer weitaus dezenteren Art.
Beim Gang die Treppe hinauf bestaunte Chaim die Respekt einflößende Gleve, die an der Wand hing, als wolle sie den Weg zu dem großen Saal im ersten Stock weisen. Er widerstand der Versuchung, mit seinen Fingern die Schärfe der Klinge an der Seite dieser furchterregenden Lanze zu erfühlen. Mit seinen kindlichen Bewegungen hatte David, als er noch einige Jahre jünger gewesen war, seinem Vater anhand einer Gartenharke die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten dieses Mordinstruments vorgeführt. Selbst wenn der erste Stich mit der Spitze sein Ziel verfehlen sollte, hatte ihm sein Sohn damals stolz erklärt, könnte man immer noch die Klinge als Haken benutzen und den Gegner durch eine schnelle Zugbewegung umreißen. Mit dem zwei Handbreit langen Schlagdorn, der der Klinge gegenübersaß, ließ sich dann auf den hilflos am Boden liegenden Körper einhacken. Selbst die härtesten Panzerungen würden dem nicht standhalten, hatte David geschwärmt.
Legenden kreisten um diese Waffe des Geschlechts der Kalonymos: Kaiser Otto II. habe diese Waffe dem Ururgroßvater des Parnas vermacht. Dieser habe dem Kaiser das Pferd geschenkt, auf dem er nach der Schlacht bei Cotrone vor den Sarazenen flüchten konnte. Aus Dank habe der Kaiser die Familie aus Lucca eingeladen, sich in Mainz niederzulassen. Dies sei der Anfang ihrer nun so stolzen Gemeinde am Rhein gewesen, so die Legende.
War es Kalonymos selbst, der diese Geschichten verbreitete? Oder waren sie Teil der Überlieferungen, die Menschen befähigten, eine Gemeinschaft wie die ihre zu bilden? Chaim war in jedem Falle froh gewesen, als sich Davids Interesse für Waffen gelegt hatte und er stattdessen anfing, sich für das Schreiben und Zeichnen zu begeistern.
Er trat in den großen Raum, der fast die ganze Etage einnahm. Der Parnas begrüßte ihn an der Tür. Kalonymos’ festen Handschlag angemessen zu erwidern, kostete Chaim Mühe, und er musste seinen Blick nach oben richten, um dem Parnas in die Augen schauen zu können.
Die Sonne warf harte Schattenkanten durch die Fensteröffnungen auf den Dielenboden. In der Mitte des Raumes saßen sich zwei Männer an einem großen Holztisch gegenüber. Mit seinen faltigen Händen hielt der alte Mosche, der zweite Rabbi der Gemeinde, ein kleines Pergament nah an seine Augen. Ein Lächeln grub sich in sein zerfurchtes Gesicht. Ihm gegenüber saß Salomo, ein in Mainz nicht nur von den Juden geschätzter Arzt. Chaim nickte den beiden freundlich zu. Mosche blickte nicht auf, und wie so oft beschlich Chaim ein Gefühl der Verunsicherung. Nahm Mosche ihn aufgrund seiner schlechten Augen nicht wahr oder war es seine Art, ihm gegenüber Verachtung auszudrücken? Der alte Rabbi war doch sonst so warmherzig zu allen in der Gemeinde.
Die letzten Jahre waren von schmerzlichen Auseinandersetzungen mit seinem älteren Kollegen geprägt gewesen. Mosches großes Wissen beeindruckte Chaim immer wieder, jedoch verspürte er gegen dessen überpräzise Auslegung der Torah immer häufiger einen Unwillen, den er selbst bei den Gottesdiensten nur noch schwer verbergen konnte. Die Qualität von Mosches Stimme, der oft als Vorbeter die Torahtexte aus der Bimah vorsang, war jedoch unbestritten. Aus der Fülle seines Leibes entluden sich eine Tiefe und Wärme, die die ganze Gemeinde verzauberten. Und auch Chaim liebte es in diesen Momenten, dem alten Mosche zuzuhören.
Salomo begrüßte Chaim mit einem verschmitzten Lächeln, das dieser zwar nicht zu deuten wusste, das ihm jedoch keinerlei Unbehagen bereitete. Chaim vertraute dem erfahrenen Arzt, der David, Benjamin und Hannah gesund zur Welt gebracht hatte und auch manches Wehwehchen der Kinder mit den Kräutern seines geheimnisvollen, üppigen Gartens lindern konnte. Auch gegen Chaims gelegentliche Schwermut wusste Salomo Rat. Und wenn es nicht anders ging, so fand er mit Sicherheit eine Mixtur, die es Chaim ermöglichte, die Woche bis zum Sabbat zu überstehen. Deshalb strebte Chaim sofort auf den freien Stuhl neben dem Arzt zu. Er legte ihm kurz die Hand auf die Schulter und setzte sich.
Der Kaufmann Schmuel Hendlein stieß als Letzter hinzu. Beim Eintritt wanderte sein Blick flüchtig über die Anwesenden, während er mit besorgter Miene ein paar Sätze mit dem Parnas wechselte. Dann ging er zum Tisch, gab Chaim und Salomo einen freundlichen Klaps auf den Rücken, begab sich zu dem freien Platz neben Mosche und reichte diesem die Hand. Erst jetzt sah Mosche auf, und Schmuels feine, gepflegte Hände versanken in den Pranken des alten Rabbis.
Kalonymos schloss die schwere Eichentür, begab sich zum Kopf des Tisches und zeigte auf ein eingerolltes Pergament, das vor ihm lag. »Liebe Mitglieder des Rates, dieser Brief wurde uns von unseren jüdischen Freunden aus Speyer gesandt.«
Der Parnas schaute jedem der Anwesenden in die Augen. Nachdem er sich der Aufmerksamkeit aller Mitglieder des Rates sicher war, fuhr er fort. »Wir haben viele Gerüchte über das Heer der Unbeschnittenen gehört, auch dass es vor Speyer gelagert hat.«
Er ließ seinen Blick für einen Moment auf Schmuel verweilen. »Manche von uns haben gar schon an Flucht gedacht.«
Schließlich wandte sich der Parnas wieder an den ganzen Rat. »Nun bekommen wir endlich Klarheit. Der Brief enthält wichtige Nachrichten. Hoffnungsfrohe, aber auch besorgniserregende. Deshalb habe ich nach euch schicken lassen. Habt Dank, dass ihr so schnell gekommen seid, und hört nun selbst, was uns die Gemeinde aus Speyer zu berichten hat.«
Der Parnas rollte das Blatt auseinander und las vor. »Liebe Brüder und Schwestern in Mainz! Bewegende Dinge sind geschehen bei uns in Speyer, von denen wir euch in Kenntnis setzen möchten. Elf Gemeindemitglieder haben wir verloren, und viele von uns wurden in schwere Glaubensnöte gebracht. Jedoch schenkte der Eine uns in seiner großen Güte Rettung zu guter Letzt. Aber lasst uns von unserem Geschick berichten, damit ihr Vorsorge treffen könnt.« Kalonymos blickte auf. Sorgenfalten durchzogen sein Gesicht. »Am Sabbat, dem achten Tag des Monats Ijjar, kam die schwere Prüfung des Herrn über uns. Schon seit dem Freitag lagerte das Heer der Unbeschnittenen in Zelten vor unserer Stadt und verbreitete großen Schrecken unter uns. Sie hefteten ein verwerfliches Zeichen, ein Kreuz, an ihre Kleider, sowohl Mann wie Frau, alle die sich bereitfanden, den Irrweg nach dem Grab ihres Messias zu ziehen, sodass die Männer, Frauen und Kinder zahlreicher waren als die Heuschrecken auf der Fläche des Erdbodens. Emicho von Flonheim – seine Gebeine mögen in einer eisernen Mühle zermalmt werden – führte das Heer an. Als sie nun auf ihrem Zuge durch die Städte kamen, in denen Juden wohnten, sprachen sie untereinander: ›Sehet, wir ziehen den weiten Weg, um das Haus der Schande aufzusuchen und uns an den Ismaeliten zu rächen, und siehe, hier wohnen unter uns Juden, deren Väter Christum unverschuldet umgebracht und gekreuzigt haben! So lasset zuerst an ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen unter den Völkern, dass der Name Israel nicht mehr erwähnt werde; oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem Glauben sich bekennen.‹«
Auf Mosches Stirn traten Zornesfalten. »Der Gekreuzigte, der gehängte Bastard, Verderben und Blut bringt er.«
Chaim verschloss die Augen. Musste Mosche solche Worte wählen? Auch ihm war die Vorstellung eines gekreuzigten Messias zutiefst fremd. Noch schlimmer war, dass sie den Nazarener zu einem Gott erhöht hatten. Durch nichts, was in den Schriften stand, war dies zu rechtfertigen. Aber was half es, den, welchen die Christen als ihren Heiland anbeteten, einen Bastard zu nennen? Insbesondere die Kinder schnappten so etwas gerne auf. Und dann verbreiteten sich solche Worte und stifteten Missgunst unter den Städtern.
»Speyer, das sind nur zwei Tagesreisen mit dem Schiff.« Schmuels Bemerkung unterbrach Chaims Gedanken. »Knapp vier Tage mit dem Pferd, sieben Tage zu Fuß.«
Kalonymos ben Meschullam fuhr fort: »Es wurden mehr von den Gottlosen jeden Tag, und sie trieben sich herum in der Stadt, dass es uns bange wurde. Unter der Führung Emichos, er soll auf ewig verflucht sein, wandten sie und einige der Städter sich gegen uns, töteten elf Menschen und zwangen viele, sich zu beschmutzen mit ihrem übel riechenden Wasser.«
»Elf Seelen ermordet in Speyer«, raunte Schmuel.
Mosche fügte hinzu. »Und viele zu ihrer Verderben bringenden Taufe gezwungen. Wir …«
»Wartet, wartet. Lasst mich den Brief zu Ende lesen«, unterbrach der Parnas den alten Mosche. »Als dies Bischof Johann zu Ohren kam, sammelte er seine Krieger und hielt seine Hand über uns. Er gewährte uns Juden Einlass in seine Pfalz und schützte uns vor den Mördern.«
»Seht«, bemerkte Chaim, »wir können dem Bischof vertrauen!«
Schmuels Gesicht war die Erleichterung anzusehen.
»Und er ergriff manche der Aufwiegler und verfügte, dass ihnen die Hand abgeschlagen werde, wie es vom Kaiser Heinrich bestimmt worden war. Durch diesen frommen Bischof wurde uns die Gnade des Herrn zuteil.«
Chaim nickte zufrieden. »Die Hände des Mörders abschlagen, das ist die vorgesehene Strafe nach kaiserlicher Rechtsprechung. Das wird dieses Räubervolk in ihre Grenzen verweisen. Sie werden es nicht noch einmal wagen, sich an unsereinem zu vergehen.«
»Unter Berufung auf den Kaiser gewährte Bischof Johann den übrigen Gemeindemitgliedern in seinen Festungen Schutz«, fuhr Kalonymos fort.
Über Mosches Gesicht zog ein dankbares Lächeln, mit kämpferischem Optimismus raunte er: »Gott ist groß.«
»Der Ewige nahm sich unser an, denn sein Name ist heilig. Und der Bischof verteidigte uns, bis die Horden fortgezogen waren.« Kalonymos ließ das Pergament sinken und atmete tief durch.
Ein betretenes Schweigen lag im Raum. Langsam setzte sich die Nachricht in den Köpfen, und die möglichen Folgen für ihre Gemeinde, die aus den Ereignissen erwuchsen, drängten sich auf.
Mosche ballte die Faust. »Was ist mit denen geschehen, die von ihrem Schmutzwasser besudelt wurden? Müssen die Armen in der Hölle darben?«
»Mich interessiert vor allem, wohin Emichos Heer weitergezogen ist«, warf Schmuel ein.
»Der Brief geht noch weiter, lasst mich bitte zum Ende kommen«, setzte Kalonymos noch einmal an. »Rabbi Mosche bar Jakuthiel, unser Parnas, brachte Rettung. Durch seine Intervention beim Bischof durften all die zum wahren Glauben an den Einen zurückkehren, die gegen ihren Willen getauft worden waren.«
»Des Ewigen Gnade kennt keine Grenzen.« Mosche breitete die Hände aus, als ob er einen himmlischen Segen entgegennehmen würde.
Auf Schmuels Stirn zeigten sich dagegen Schweißperlen. »Ich frage noch einmal. Wohin ist das Heer der Unbeschnittenen gezogen?«
Kalonymos erwiderte: »Das sagt der Brief nicht. Aber der Bote, der ihn brachte, hat ein großes Zeltlager der Feinde Gottes vor Worms gesichtet. Ein wilder Haufen von beiden Seiten des Rheins hätte sich dort versammelt. ›Sie kamen aus allen Himmelsrichtungen und mit jedem Tag wurden es mehr.‹ Das hat er mir noch gesagt, bevor er weiterzog.«
»Sie sind schon in Worms, nur zwei Tagesmärsche entfernt.« Schmuels Stimme überschlug sich.
»Der Bischof von Speyer, der gute Johann, hat eingegriffen. Das wird auch in Worms geschehen, und das würde auch in Mainz so sein. Bischof Ruthard ist auf unserer Seite«, bemerkte Chaim, unsicher darüber, ob seine Stimme die Festigkeit hatte, die er ihr geben wollte.
»Ich hoffe, du hast recht. Ganz sicher hast du recht.« Kalonymos kratzte sich an seinem mächtigen Hinterkopf. »Aber auch wir sollten unseren Teil beitragen, falls Emichos Heer vor Mainz auftauchen sollte. Wir müssen dem Bischof unsere Unterstützung anbieten. Ich schlage vor, wir fordern unsere Männer auf, sich zur Verteidigung der Stadt bereitzuhalten.«
Schmuel zog den Kopf zwischen die Schultern. »Für die Kampferfahrenen unter uns ist dies sicherlich angemessen.« Er richtete sich auf und fügte hinzu: »Aber Geld werden wir auch benötigen, um den Bischof für uns einzunehmen. Er wird sich gut überlegen, ob er das Leben seiner Männer für uns riskieren wird.«
Chaim schüttelte den Kopf. »Es ist seine Pflicht, uns zu schützen. Er hat dem Kaiser gehorsam zu sein.«
»Sei kein Narr! Uns Juden wurde schon viel versprochen«, ereiferte sich Schmuel. »Und wenn es darauf ankam, wurden die Christen zu geknicktem Rohr. Erinnert euch daran, was vor zwölf Jahren geschah, nach dem großen Feuer. Wir Juden sollten es gelegt haben, wurde von einigen der Bürger behauptet, obwohl die Häuser der Unseren mit den anderen gebrannt haben. Daraufhin mussten viele von uns die Stadt verlassen.«
»Die meisten konnten nach Speyer ziehen, wo sie vom damaligen Bischof Rüdiger freundlich aufgenommen wurden«, wendete Chaim ein. »Und es ist noch keine sieben Jahre her, da hat Heinrich bestimmt, dass uns Juden Schutz zu gewähren sei. Zwölf Pfund Gold muss derjenige als Strafe bezahlen, der einen von uns zur Taufe zwingt. Und um ganz sicher zu sein, dass, was der Ewige verhindern möge, einer der Unseren aus freien Stücken ihren Glauben annehmen möchte, so hat der Kaiser bestimmt, dass erst nach drei Tagen die Taufe vollzogen werden darf.«
»Das ist schön und gut, aber lass uns dem Bischof unsere Dankbarkeit erweisen. Eine Spende wird er ganz sicher nicht verachten«, erwiderte Schmuel.
»Euer Mangel an Vertrauen zu Gott ist beschämend«, mischte sich Mosche in die Debatte ein. »Wir müssen uns Gottes Gunst würdig erweisen.«
»Und wie sollen wir das deiner Ansicht nach bewerkstelligen?«, entgegnete Schmuel.
»Wir müssen beten und fasten, die ganze Gemeinde. Bis die Ungläubigen an Mainz vorbeigezogen sind.«
Schmuel stöhnte vernehmlich und verdrehte die Augen.
»Es ist so, wie es immer war: fünf Juden, sechs Meinungen.« Ein resigniertes Lächeln zeigte sich auf Kalonymos’ Gesicht, während er sein mächtiges Haupt abwägend nach links und rechts drehte. Alle Blicke richteten sich auf den Parnas, der schließlich mit undeutbarer Miene verkündete: »Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wir beten und fasten, sammeln Geld für den Bischof und bereiten die Verteidigung vor.«
Schmuel und Mosche nickten.
»Salomo und Chaim, ist es das, was wir machen werden?«, fragte der Parnas.
Salomo überlegte kurz. »Ja.«
»Einverstanden«, sagte schließlich auch Chaim, fügte aber mit einem bitteren Lächeln hinzu: »Ich hoffe nur, dass unsere Männer dem Bischof trotz des Fastens ihre volle Kampfbereitschaft zur Verfügung stellen können.«
»Gott wird ihnen die nötige Kraft geben, das Gebet wird sie stark machen«, erwiderte Mosche im Brustton der Überzeugung.
Chaim unterdrückte ein Seufzen. Urplötzlich überkam ihn der Wunsch, sein Gesicht in Jehudiths Busen zu vergraben. Zwischen ihren zwei sanften Hügeln wollte er verweilen. Diese überschaubare beruhigende Landschaft sollte sein Versteck sein, bis seine Frau zu ihm sagen würde: Mein Schatz, du kannst wieder auftauchen. Der Spuk ist vorbei, die bösen Männer sind weg.
Unsanft riss ihn die Stimme des Parnas zurück in die Wirklichkeit. »Also gut, dann lasst uns eine Bekanntmachung für morgen vorbereiten. Wegen des Sabbats werden fast alle der Unseren in die Synagoge kommen.«
Kalonymos zog eine Wachstafel aus einer Schublade unter der Tischplatte hervor und fragte: »Was sollen wir morgen bekannt geben? Ich warte auf eure Vorschläge.«
Auf einem Acker nahe Gerstendorf
Von der schier endlosen Prozession am anderen Rheinufer waren nur noch ein paar Nachzügler zu sehen, vorwiegend Alte, einige auf Krücken. Sie schienen Essensreste und andere Dinge aufzusammeln, die liegen geblieben waren zwischen Pferdeäpfeln und Ochsenmist.
Die Furchen, die Peter und Lene gezogen hatten, waren so schief und krumm, dass Vater sicher schimpfen würde. Aber wie zum Teufel konnte er auf den blöden Acker achtgeben, wenn die Ritter des Kreuzes direkt vor seiner Nase vorbeizogen?
Nachdem auch die Allerletzten die Biegung des Rheins erreicht hatten, wurde es ein wenig ruhiger in Peters Brust. Er hielt den Pflug nun wieder fest in seinen Händen und blickte aufmerksam zu Boden, um den Steinen auszuweichen. So kamen sie gut voran, und wenn sie zu einer neuen Furche ansetzten, dann streichelte er über Lenes Hals, wie er es immer tat.
Doch der äußere Schein trog. Zwar war das Heer der Pilger nun in Richtung Mainz hinfortgezogen, aber Peters Gedanken verweilten bei dem Heer Gottes. Was diese beneidenswerten Menschen wohl alles erleben würden? Er dagegen musste noch mindestens zwei Tage diesen steinharten Acker pflügen. Während er sich abschuftete, konnten die Pilger die weite Welt sehen und Heldentaten vollbringen. Und sobald er mit diesem Acker fertig war, würde er Unkraut aus dem Flachsfeld rupfen müssen. Ihm tat der Rücken weh, allein wenn er an das dauernde Bücken dachte und die sengende Sonne im Nacken. Ein Buckeln ohne Ende, das war sein Leben.
Lene zog geduldig Furche um Furche. Was unterscheidet mich von diesem Gaul, haderte Peter. Verbissen arbeitete er weiter, bis die Sonne nur noch vier Handbreit über dem Horizont stand. Peter war erschöpft, und Lenes Schnauben zeigte ihm, dass auch sie am Ende ihrer Kräfte war.
»Genug für heute«, bestimmte Peter, und Lene nickte dankbar mit ihrem großen Kopf.
Beim Gang durch die Äcker zu seinem Heim kreisten seine Gedanken weiterhin um all das Wunderliche, was sich an diesem Nachmittag vor seinen Augen abgespielt hatte.
Mainz – in der Langen Gasse
Nachdenklich schritt Chaim durch die Lange Gasse in Richtung des Marktplatzes. Stundenlang hatten sie gestritten, abgewogen und verworfen. Um jedes Wort für die morgige Ankündigung in der Synagoge war es ein entnervendes Ringen gewesen. In seiner Empörung hatte Mosche Ausdrücke von sich gegeben, die schwerwiegende Konflikte hätten heraufbeschwören können: Sohn der Abgesonderten und gehängter Bastard hatte er den Heiland der Christen genannt. In seiner Erregung über den Tod ihrer Glaubensgenossen hatte er ihre Taufe als Beschmutzung mit übel riechendem Wasser und ihre Kirchen als Haus der Unreinheit bezeichnet. Immer wieder musste Chaim auf Mäßigung dringen. Ganz besonders jetzt waren sie doch auf die Hilfe ihrer christlichen Mitbürger aus Mainz angewiesen.
Und Kalonymos wollte alle kampffähigen Männer bewaffnen. Dazu sah auch Chaim die Notwendigkeit, die Nachrichten aus Speyer waren zweifelsohne besorgniserregend. Und noch schlimmer war, dass ein Heer der Unbeschnittenen vor Worms zu stehen schien. Aber bestand nicht die Gefahr, die Christen in Mainz durch waffentragende Juden zu provozieren?
Immerhin war es Chaim gelungen durchzusetzen, dass die Bewaffnung heimlich vonstattenginge.
Erschöpft erreichte er sein Haus am Marktplatz gegenüber dem großen Dom. Er betrat den Laden mit Glaswaren, den sie erst letztes Jahr eröffnet hatten. Einige der reicheren Bürger der Stadt konnten sich die durchsichtigen Becher und Karaffen leisten, und Schmuck mit dem geheimnisvoll funkelnden, farbenreichen Material war ein begehrtes Geschenk für eine Angebetete. So war es Jehudiths Idee gewesen, die Glasprodukte, die in Chaims Werkstatt im hinteren Teil des Hauses hergestellt wurden, den Mainzern in einem Laden vorzuführen.
Die linke Seite stand deshalb unter dem Regiment seiner Frau: Hinter einem Tresen waren bunte Gläser, Pokale und Schalen, Ringe, Broschen und Ohrgehänge in allen Farben in einem großen Wandregal adrett positioniert. Und sogar glasbesetzte Diademe gab es dort. Chaims Bereich war auf der rechten Seite zu finden. Dort waren Fenster aus Glas ausgestellt, die in Mainz bisher nur in seiner Werkstatt hergestellt werden konnten. Schmuel versorgte ihn mit farblosen Glasbarren aus dem Orient, die er in seiner Werkstatt weiterverarbeitete. Nun konnte er endlich kleine durchsichtige Schiebefenster herstellen, die die Kälte weitaus besser abwehrten als die dünnen Pergamente, die man bisher in die Fensterrahmen spannte. Und man war sogar in der Lage, die Konturen der Häuser und Menschen durch das Glas zu sehen. Der Rohstoff war sündhaft teuer, aber für die Wohlhabenden waren seine neuen Fenster nicht unerschwinglich.
Beim Eintritt in den Laden nickte er Jehudith kurz zu, die mit einem Kunden beschäftigt war. Sie blickte fragend zu ihrem Mann hinüber. Chaim wies mit dem Finger auf die Treppe hinauf zu ihrer Wohnung und formte mit dem Mund ein lautloses »Später«. Er setzte sich an den großen Küchentisch und wechselte ein paar Worte mit David, der sich jedoch schnell wieder zu Hannah und Benjamin gesellte. Kurze Zeit später kam Jehudith, begrüßte ihn mit einem für seinen Geschmack viel zu flüchtigen Kuss und fragte: »Und? Wieso gab es so plötzlich eine Ratssitzung? Ist etwas passiert?«
Ernst schaute er in die Augen seiner Frau und sagte leise: »Schlimme Nachrichten aus Speyer. Mosche war eine Plage und Kalonymos mal wieder übereifrig.«
»Na, so ist es doch schon immer gewesen.«
»Dem Herrn sei Dank ist Salomo vernünftig geblieben in dem ganzen Schlamassel. Aber ich hatte das Gefühl, da war etwas, mit dem er nicht rausrücken wollte. Er hat mich so merkwürdig angeschaut und dabei gegrinst. Kannst du dir einen Reim darauf machen?«
Eine leichte Röte zeigte sich auf Jehudiths Gesicht. Geschwind wandte sie sich zur Küche um und antwortete im Gehen: »Ich bring dir erst einmal etwas zu essen. Setz dich hin und ruh dich aus. Magst du etwas Wein?«
Chaim ließ sich auf den Stuhl fallen. »Gerne, mein Schatz.«
Schon kam Jehudith mit dem Rotweinkrug. Sie reichte ihm einen Tonbecher und ein Messer aus dem Wandregal. Chaim schenkte sich ein und nahm einen ordentlichen Schluck, während Jehudith ein Holzbrett mit Kümmelbrot, Pflaumenmus und einem Stück der harten Wurst, die er so mochte, aus der Küche hereintrug. »Du kannst mir heute Abend mehr von der Sitzung des Rates erzählen. Ich muss wieder nach unten, die Frau des Metzgers in der Krämergasse wartet.«
Bevor sie zur Treppe hinunter zum Laden entschwand, kraulte sie Chaim kurz den Nacken. Der brummte wohlig vor sich hin. »Aaaahhhhh, tut das gut.«
»Räum die Sachen bitte nachher in die Küche.«
Schmunzelnd blickte Chaim seiner Frau nach. Drei schwere Geburten lagen hinter ihr, und kein Kind hatten sie verloren. Auch dank Salomo. Alle drei Kinder hatten anfangs mit hohem Fieber zu kämpfen gehabt, die Kräuter des Arztes, mit dem sie nun schon seit vielen Jahren befreundet waren, hatten jedoch jedes Mal schnell Linderung gebracht.
Jehudiths Hüften waren mit den Jahren fülliger geworden, wie auch der Umfang seines Bauches gewachsen war. Und ihre Brüste waren nicht mehr die zwei jungen Rehzwillinge, die unter den Rosen weideten, wie er sie in den ersten Jahren ihrer Ehe mit Worten aus dem Hohelied liebkost hatte. Die Spuren des Stillens dreier Kinder ließen sich nicht verbergen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock, hatte er ihr aus diesem alten Lied vorgesungen, als David endlich auf der Welt gewesen war, und Jehudiths Brüste zunächst kaum Milch geben wollten.
Aber sein Verlangen nach Jehudith, das hatte er nicht verloren. Ebenso wenig wie seine Begeisterung für das Schir ha-Schirim, das Lied der Lieder, wie das Hohelied auch genannt wurde. Noch immer nannte er sie meine Rose von Scharon. Und auch Jehudiths Lust war frisch geblieben. Nach den Geburten hatte er sie in Ruhe gelassen und gewartet, bis sie sich ihm wieder genähert hatte.
Mit großem Hunger verspeiste Chaim die guten Dinge, die ihm von Jehudith aufgetischt worden waren. Seit dem Frühstück hatte er nichts mehr zu sich genommen. Die Wurst war würzig, das Brot angenehm weich und schmackhaft und das Mus lieblich süß. Der Wein legte sich wohltuend um seine düsteren Gedanken an die Ereignisse in Speyer. Satt und ein wenig beruhigter räumte er zu guter Letzt die übrig gebliebenen Speisen in die Kammer.
Er hatte noch zwei Stunden Zeit, in seiner Werkstatt im Hinterhaus nach dem Rechten zu sehen.
Peters Heim nahe Gerstendorf
Aus der Ferne sah Peter sein mit Stroh gedecktes Heim, in dem er zusammen mit Vater und Mutter, seinem Bruder Bernhard und der kleinen Mathilde, ihrem Pferd Lene, drei Kühen und zwei Ochsen lebte. Die Hühner und Schweine waren in ihrem eigenen Stall untergebracht, etwas abseits des Hauses. Erst letzten Sommer hatte der Vater ihn gebaut. Alle waren froh, dass der Schweinegestank nun nicht mehr aus dem Raum direkt gegenüber der Stube drang. Dort stand jetzt nur noch Lene mit den Kühen und Ochsen.
Die Stube war der Schlaf- und Essraum der Familie. Im Winter rückten sie eng zusammen um die Feuerstelle. Dort schliefen sie auf Stroh. Manchmal jedoch verbrachte Peter die Nacht neben Lene. Seit diesem Frühling verzog er sich auch gern in die Grubenhütte etwas abseits des Hauses, in der das Werkzeug lagerte und wo der Vater seine Schmiedearbeiten durchführte.
Er ließ Lene aus dem Bach trinken, der an ihrem Haus entlangführte. Dort konnte sie noch etwas in der Abendsonne stehen, das Gras an dieser Stelle schmeckte ihr besonders gut. Erst nach der Mahlzeit würde er sie in ihren Stall führen. Nachdem er mit Lene ein paar letzte Worte gesprochen und ihr zum Abschied über das Fell gestreichelt hatte, begab er sich ins Haus.
An der Tür empfing ihn eine Stimme, die ihm unbekannt war. »Gott segne dich, du musst Peter sein.«
Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit des fensterlosen Raumes. Der Feuerplatz war neben einer blakenden Talglampe die einzige Lichtquelle im Raum. Am Tisch saß der Priester in der roten Kutte, den er heute Mittag von seinem Acker aus beobachtet hatte. Dieser richtete abermals das Wort an ihn. »Setz dich zu uns, Peter. Du musst erschöpft sein. Der Pflug ist schwer und der Boden sicher hart, so wenig wie es in den letzten Wochen geregnet hat.«
Die Stimme des Mannes war sanft, er rollte das R so weich, dass es einem ganz warm ums Herz wurde. Wie fremd war doch dieser leuchtend rote Stoff in ihrem Haus, den der Priester an seinem schlanken Körper trug. Und wie fein die Sandalen. Seine Hände waren unglaublich sauber. Peter kam sich erbärmlich vor mit seinen dreckigen Füßen, auf denen er heute barfuß durch den Acker gestapft war.
Mutter rührte einen Getreidebrei über dem Feuer, während sein Vater die Gunst der Stunde nutzte und mit dem hohen Besuch am Tisch Met genoss, den es sonst nur am Sonntag zu trinken gab. Scheu setzte sich Peter hinzu, und sein Vater schenkte auch ihm etwas von der goldenen Köstlichkeit in einen Holzbecher.
»Wir werden immer mehr, seitdem Papst Urban alle Christenmenschen zur Befreiung Jerusalems aufgerufen hat«, sagte der fremde Mann. »Vor vier Wochen waren wir knapp zweihundert, jetzt sind wir fast zweitausend auf dem Weg in die Heilige Stadt.«
»Was denkt Ihr, wann werden die Ritter Jerusalem erreichen?« Vater füllte Peters Becher mit Wasser aus einem großen Tonkrug auf.
»Wohl nächstes Jahr im Frühling. Gott will, dass wir zuerst hier im Rheinland für Ordnung sorgen.«
»Herr, was meint Ihr damit?«, erkundigte sich Peters Vater.
»Reden wir lieber von Jerusalem«, überging der fremde Mann die Frage. »Aus allen Ländern kommen die Ritter und das Fußvolk dem Aufruf unseres Papstes nach. Wir werden die Sarazenen im Handstreich besiegen.«
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Die Gesellen hatten in Chaims Abwesenheit alle Arbeiten fehlerfrei ausgeführt. Zu seinem Missfallen ließen sie ihn jedoch wissen, dass der Bischof einmal mehr bezüglich der Domfenster hatte nachfragen lassen.
Das rote Rosenfenster, das er für die Synagoge gefertigt hatte, war auch unter den Christen nicht unbemerkt geblieben. Nun war es der Wunsch des Bischofs, dass in seinem Dom die gläsernen Bildnisse den Raum mit farbigem Licht ausfüllten. Und Chaim war der Einzige in ganz Mainz, der so etwas vielleicht schaffen konnte. Da war der hohe Herr sogar bereit, den Dienst eines Juden anzunehmen.
Die Seitenöffnungen des großen Bauwerks, die im Winter und bei starkem Regen mit Teppichen verschlossen wurden, waren hoch und breit. Die Druckverhältnisse der Mauern waren kompliziert, veränderten sich mit der Temperatur, und der Wind presste mit all seiner Macht gegen die großen Flächen. Daher wollte Chaim nicht zu viel versprechen.
Doch der Bischof bestand darauf, sich und all seine Vorgänger verewigt zu sehen. Und schlimmer noch, ein Bild des Gekreuzigten sollte ein Fenster im Altarraum zieren. Zwar reizten Chaim die Herausforderungen eines solchen Auftrags, aber auch das Ungemach in der Gemeinde gab ihm zu denken. Unser Christenfreund Chaim schmückt nun die Häuser der Unreinheit, würde es wohl heißen. Rabbi Chaim stellt Bilder des Gehängten her. Daher hatte Chaim beim letzten Gespräch mit dem Bischof in allen Details auf die technischen Probleme hingewiesen. Der Bischof hatte ungehalten reagiert und wohl auch durchschaut, dass Chaim die vorgesehenen Motive wenig zusagten. Seitdem ließ Ruthard hartnäckig nachfragen. Lange würde Chaim sich nicht mehr erwehren können.
Daher verfolgte er mit Raimund neben der Psalmenübersetzung heimlich eine weitere Idee, welche in Richtung des Wunsches des Bischofs ging: Die Fensteröffnungen in der Johanniskirche waren weitaus kleiner, und an diesen wollte sich Chaim zunächst versuchen. Auf den sechs Fenstern auf der Westseite der Kirche sollten Gleichnisse des Nazareners dargestellt werden. An Skizzen dafür wollte er noch etwas arbeiten.
Peters Heim nahe Gerstendorf
Mit offenem Mund beobachtete Peter den hohen Besuch. Der Dorfpfarrer pflegte ab und an vorbeizuschauen, um Honig und Met abzuholen. Und als die Großmutter im Sterben lag, war er gekommen, um ihr die letzte Salbung zu spenden. Peter mochte ihren dicken, redseligen Pfarrer, der auch manchen guten Witz zu erzählen wusste. Aber von diesem schlanken Mann in seiner roten Kutte mit dem großen silbernen Kreuz über der Brust strömte ein Glanz aus, wie es Peter vorher nie erlebt hatte. Und dieser Mann hatte ihn gegrüßt, hatte sogar seinen Namen gekannt.
»Hohe feste Mauern umschließen die Heilige Stadt, viel höher als die Mauern von Mainz«, mischte sich Peters Mutter ein, die die Gedanken ihres Sohnes wohl erraten hatte. »Das habe ich auf einem Bild im großen Dom gesehen. Viele Menschen werden ihr Leben lassen in Eurem Krieg.«
»Gott ist auf unserer Seite, daher werden wir gewinnen. Und wer sein Leben hergibt im heiligen Kampf, dem werden alle Sünden vergeben. Das hat Papst Urban feierlich verkündet.«
»Mmh«, war alles, was Peters Mutter darauf antwortete. Dann sagte sie: »Der Brei ist fertig. Etwas Besseres können wir Euch in unserer bescheidenen Hütte leider nicht anbieten, aber dick ist er und honigsüß. Unsere Bienen waren besonders fleißig im vergangenen Jahr.«
Sie stellte den dampfenden Kupfertopf mit den drei Beinen auf den Tisch und schöpfte den nussfarbenen Brei in die Holzschalen. Anschließend ging sie vor die Tür und rief: »Bernhard, Mathilde, kommt zu Tisch! Das Essen ist fertig!«
Die beiden Kinder kamen lachend angerannt und stoppten abrupt, als sie den Fremden sahen. Die Mutter blickte auf die beiden und zog die Augenbrauen nach oben. Peters Geschwister verbeugten sich und setzten sich still links und rechts neben ihrem Bruder auf die Bank. Zärtlich legte Peter seine Arme um Mathilde, die sich an ihn schmiegte. Mutter setzte sich zu Vater, der den Priester fragte: »Möchtet Ihr, Herr, das Tischgebet sprechen?«
Der Mann in der roten Kutte faltete die Hände und seine geschmeidige Stimme erfüllte die Stube. »Der Herr segne diese Speise. Er erbarme sich euer, erlasse euch die Sünden und führe euch zum ewigen Leben. Amen.«
Die Holzlöffel klackerten in den Schalen und ein gefräßiges Schweigen erfüllte eine Zeit lang den Raum. Jedes seiner Geschwister aß mit einem eigenen Löffel, in den von Peter hatte sein Vater eine Haselnuss am oberen Ende des Griffes eingeschnitzt.
»Ein wohlschmeckender Brei, Weib«, durchbrach der Mann die Stille. »Wir brauchen gute Köchinnen auf unserer Reise und auch starke Männer.«
Mutters Gesicht zeigte keine Regung.
»Jerusalem, wart Ihr schon einmal dort?«, fragte Peters Vater.
»Ja, ich war schon dort. Eine Stadt, so schön wie ein Gedicht. Wie heißt es in einem Psalm des Herrn:
Vergesse ich dein, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verfaulen.
Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich nicht dein gedenke,
wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein.«
»Höchste Freude«, wiederholte der Vater träumerisch. »Höchste Freude.«
»Reich und üppig ist das Land. Die Böden tragen dreimal Frucht im Jahr. Saftige Feigen, schwarze und grüne Oliven und süße Aprikosen wachsen in großer Zahl. Mit den Schätzen der Sarazenen werden wir bald Kirchen und Burgen im Heiligen Land erbauen. Ein neues Reich in Gottes Gnade werden wir dort errichten.«
»Erzählt bitte mehr vom Heiligen Land«, bat Peter, der gebannt an den Lippen des fremden Mannes hing.
»Es wird bald dunkel und Ihr müsst sicher noch einen weiten Weg gehen«, unterbrach ihn die Mutter. Sie legte die Hand auf das Bein ihres Mannes und sah ihn mit ernsten Augen an.
Der Vater erwiderte den Blick, nickte und richtete sich auf. »Mein Weib hat recht, die Dämmerung wird bald hereinbrechen und zum Dorf ist es ein gutes Stück.«
»Was ist mit dir, Peter? Willst du nicht mit uns ziehen?«, fuhr der Priester ungerührt fort. »So einen wie dich können wir gut gebrauchen. Willst du nicht die weite Welt entdecken? Trockene Böden beackern, ist das alles, was du aus deinem Leben machen willst?«
»Wir brauchen unseren Sohn hier«, antwortete Peters Vater unwirsch. »Und er verspürt auch nicht den Wunsch, in Euren Krieg zu ziehen.«
»Nun, für Großes müssen Opfer gebracht werden.« Der Priester ließ sich keinen Ärger anmerken. »Abenteuer und die Schätze der Sarazenen erwarten dich, mein Sohn.« Ernst und freundlich richtete der fremde Mann in der roten Kutte seinen Blick auf Peter. »Und die Frauen der Sarazenen mit ihrer …«
»Wärt Ihr so freundlich, einen Segen für unser Haus zum Abschied zu sprechen?«, unterbrach die Mutter den Priester.
»Nein, bitte bleibt«, erwiderte Peter.
Patsch! Das laute Knallen einer Ohrfeige schallte durch den Raum.
»Widersprich deiner Mutter nicht!«, schimpfte der Vater.
Peter lief rot an vor Scham. Er biss die Zähne aufeinander, sein Blick wurde starr. Erschrocken schlug die Mutter die Hand vor den Mund. Peter sprang auf. Der Vater wollte ihn noch festhalten. »Bleib hier!«
Aber Peter riss sich los und rannte aus der Stube. Auf der Bank vor ihrem Haus setzte er sich nieder.
Nach einiger Zeit hörte er den Priester sprechen. »Habt Dank für dieses gute Mahl. Glück und Segen komme über dieses Haus.«
Beim Verlassen der Stube sang der Mann leise vor sich hin:
»Vergesse ich dein, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verfaulen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich nicht dein gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein.«
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Die Frau des Metzgers hatte sich in ein Halskettchen mit roten und grünen Glasperlen verguckt. Nach kurzer Verhandlung war der Verkauf besiegelt und Jehudith konnte fünf Schillinge als Einnahme verbuchen. Entsprechend zufrieden hatte sie den Laden verschlossen und sich an die Vorbereitungen des Sabbatmahls gemacht.
Benjamin, ihr Kleinster, war glücklich, David und Hannah beim Spielen beobachten zu können, sodass sie in aller Ruhe den Bohneneintopf mit Rindswurst vorbereiten konnte, den sie heute auftischen wollte. Sie hatte sich dafür ein saftiges Hüftstück von dem jüdischen Metzger bringen lassen, das sie nun in Sonnenblumenöl über der Feuerstelle in einem Kessel anbriet. Sie fügte eine Handvoll Thymian aus ihrem kleinen Hintergarten hinzu und schimpfte wie gewöhnlich über den Rauch, der nur ungenügend durch den Schacht nach draußen abzog.
Für Benjamin zerstampfte sie einen Apfel und vermischte das Mus mit etwas Hirse, Milch und Honig. Sie schüttete die geschnittenen Bohnen in den Kessel und goss nach einigen Minuten etwas von dem billigen Rotwein nach. Eine Dampfwolke entstieg dem Kessel und bald schon kam zum Aroma der Kräuter der herbe Duft von angebratenem Fleisch und erfüllte ihre Wohnung.
Peters Heim nahe Gerstendorf
Auf der Bank vor der Hütte kämpfte Peter mit den Tränen, als der Priester in der roten Kutte aus dem Haus ins Freie trat und ihn aufmunternd anlächelte. »Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder, Peter.«
Dann wurde der Blick des Mannes ernst. »Denk an die heiligen Pflichten, die Gott uns abverlangt. Ein neues Reich in Christi Namen werden wir gründen. Und denk an die Schätze der Sarazenen, die uns bald gehören werden. Denk an die Kirchen und Burgen, die wir damit bauen können. Und ein hübscher starker Mann, wie du es bist, der darf auch Träume haben, die sich ein Priester verwehren muss. Drum denk du ruhig an die sagenumwobene Schönheit der Frauen des Orients mit ihrer sanften braunen Haut.«
Noch lange schaute Peter dem Mann nach. Die leuchtend rote Kutte erschien immer verschwommener in der Dämmerung, versteckte sich zuweilen hinter Bäumen, tauchte wieder auf, nur um kurz danach wieder verdeckt zu werden. Bevor der Priester ganz hinter dem Hügel verschwand, drehte er sich ein letztes Mal um und winkte ihm zu.
Peter hörte die Mutter mit dem Vater in der Stube schimpfen. »Du hättest ihn nicht so züchtigen sollen. Vor dem Priester, das macht ihn nur aufsässiger.«
»Willst du zulassen, dass er dir widerspricht?«, erwiderte der Vater und fügte mit kleinlauter Stimme hinzu: »Ich habe es gut gemeint.«
»Du Narr, du warst doch auch einmal jung.«
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Nach getaner Arbeit stieg Chaim erschöpft, aber zufrieden die Treppe zur Wohnung empor. Er hatte einen der Entwürfe für Raimunds Fenster fertigstellen können, und es war ihm sogar noch etwas Zeit geblieben, mit dem Psalm weiterzukommen, bei dessen Übersetzung er mit seinem Freund am Mittag unterbrochen worden war. Seine Sorgen über das Heer der Irrenden hatte er während seiner Arbeit an den Skizzen ganz vergessen.
Ihre Stube war von einem herrlich herben Duft erfüllt. Jehudith stand an der Feuerstelle und rührte in dem Kessel. David verteilte die Holzteller und Glasbecher auf dem Tisch, aus denen alle außer Benjamin am Sabbat zu trinken pflegten, und erzählte ihm derweil begeistert von einem neuen Murmelspiel. Hannah schmiegte sich an ihren Vater und kämpfte sich schließlich hinauf auf seinen Schoß.
»David, stell auch den Kidduschbecher auf Papas Platz«, hörte Chaim Jehudith aus der Küche rufen. »Das Döschen mit dem Salz und der Teller mit den Sabbatbroten liegen hier bei mir auf dem Tisch.«
David tat, was ihm aufgetragen worden war, und setzte sich dann rechts neben seinen Vater.
Jehudith stellte den dampfenden Kessel in die Mitte des Tisches und setzte Benjamin auf den erhöhten Stuhl, von dem er alles beobachten konnte. Damit er nicht herunterfiel, band sie ihm ein Stofftuch um den Bauch, das sie dann an der Lehne festmachte. Sie ging nochmals in die Küche, entzündete einen Holzspan an der Feuerstelle und nahm Hannah, die Chaims Schoß entglitt, an die Hand. Die beiden wandten sich der Kommode zu, auf der bereits die zwei Sabbatkerzen standen.
Jehudith drückte den Span, an dessen anderen Ende ein kleines Flämmchen brannte, in Hannahs Hand und führte sie zu der Kerzenspitze. Mit leuchtenden Augen beobachtete Hannah, wie sich die Kerzen entzündeten. Gemeinsam mit ihrer Mutter sprach sie den Segen und das Sabbatmahl konnte beginnen.
In der Nähe von Peters Heim
Nachdem in der Stube wieder Ruhe eingekehrt war, setzte sich seine Mutter zu Peter auf die Bank. Sie legte den Arm um seine Schultern, aber er machte sich ganz steif.
Er wollte weg, nur noch weit weg.
Nach einer Weile hielt er es nicht mehr aus und entzog sich der Nähe seiner Mutter. Zunächst ging er langsam in Richtung des Hügels, dann lief er den Weg hinauf. Unter seinen nackten Füßen spürte er den trockenen Boden und das Stechen der Steine in seinen Fußsohlen. Dieser Schmerz tat ihm gut. Schließlich rannte er, rannte, so schnell er konnte, als könne er die Schmach wegrennen.
Peter erreichte die Hügelspitze und hielt an. Unter ihm schleppte der große Fluss sein Wasser Richtung Mainz. Er hockte sich nieder. Jetzt erst flossen die Tränen aus seinen Augen, Rinnsalen gleich. Er legte sich mit dem Bauch auf den Boden und schlug mit der Faust in das trockene Gras, bis er schließlich keine Kraft mehr hatte.
Nach einiger Zeit richtete er sich auf, schaute noch einmal auf den mächtigen Strom und ging langsam und mit hängendem Kopf zurück zu ihrem Haus.
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Jehudith hatte sie alle mit einer neuen Nachtischkreation überrascht: ein Honigkuchen mit geraspelten Mandeln und Rosinen, die sie am Tag zuvor in einem Wacholderlikör eingelegt hatte. Sie wurde überschwänglich gelobt, nicht nur von Chaim, sondern auch von David und Hannah. Benjamin zeigte seine Freude durch aufgeregte Armbewegungen in Richtung der Mandel- und Rosinenkrümel, die auf dem Teller übrig geblieben waren. Vielleicht war er aber auch enttäuscht darüber, dass seine Mutter diese köstlichen Krümel abkratzte, bevor sie den Kuchen in sein Mündchen führte.
Chaim fühlte sich satt und zufrieden. Jehudith zwinkerte ihm zu, zum Zeichen, dass er nun den Abschlusssegen sprechen sollte. Er füllte den Kidduschbecher ein letztes Mal und tat wie ihm geheißen.
David und Hannah maulten ein wenig, aber der strenge Blick seiner Frau genügte, damit die beiden ins Kinderzimmer abzogen.
Chaim stand auf und räumte den Tisch ab, während Jehudith Benjamin ins Bett brachte. Als er allein in der Küche war, geriet seine gute Laune ins Wanken, die er während des gesamten Sabbatmahls im Kreise seiner Familie empfunden hatte. Die Schattengesichter der Ratssitzungen schlichen sich in seine Gedanken zurück.
Beim Hinaufgehen ins Dachgeschoss kam er an dem Zimmer der Kinder im zweiten Stock vorbei und hörte sie und David das Maariw, das Nachtgebet, sprechen.
»Schma Jisrael, Adonaj elohejnu, Adonaj echad!«, sprach David.
»Höre, Israel! Adonaj ist unser Herr, Adonaj ist eins«, antwortete Jehudith.
Wie lange würden sie dieses Gebet in Mainz noch sprechen dürfen? Es half nichts, diese missliebigen Ahnungen stiegen immer wieder in Chaim auf, sosehr er sie zu verscheuchen wünschte. Bedrückt ging er hinauf in die Dachkammer, in der er mit Jehudith nächtigte.
Er setzte sich auf einen Hocker am Fenster. Sie wohnten in einem der wenigen dreistöckigen Häuser in Mainz. Vom Dachboden aus konnte er seine Blicke über die Stadtmauer bis zum Hafen schweifen lassen. Auf dem Turm am Zugang zum Hafen standen die üblichen zwei Männer der Stadtwache. Nichts deutete auf eine bevorstehende Gefahr hin.
Er stand auf und sprach das Schma Jisrael. Es fiel ihm zunächst schwer, seine Gedanken auf das Gebet zu richten. So brabbelte er mehr, als dass er mit seinem Herzen bei der Sache war.
Er versuchte, seinen Geist in den Rhythmus des Singsangs zu zwingen. Bei der Amidah, dem Achtzehngebet, gelang es ihm schließlich, in Schwingung mit den heiligen Worten zu kommen.
»Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter,
Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs,
großer starker und furchtbarer Gott,
der Du beglückende Wohltaten erweisest und Eigner des Alls bist.«
Chaim befand sich nun im Zustand des Einverständnisses mit dem großen Plan des Schöpfers aller Dinge. Er genoss dieses Gefühl der Geborgenheit in all seinem Unwissen und trotz all der Fremdheit, mit der Gott ihm zuweilen entgegentrat. Er schwang mit in Gottes Wollen, wie der Samen einer Pusteblume, der dem Wind eine Zeit lang widerstehen mag, sich aber irgendwann löst, ja lösen muss, um endlich über die Wiesen zu schweben und neue Frucht hervorbringen zu können.
Mit jeder Zeile des Gebets verflog etwas von seiner Angst, sie verlor an Gewicht, leichter und leichter wurde ihm im Herzen. Alles würde gut werden, alles hatte seine Ordnung, er konnte loslassen, die Dinge geschehen lassen. Geradezu heiter war ihm, als er zur zwölften Bitte kam.
»Den Verleumdern sei keine Hoffnung,
und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen,
alle mögen sie rasch ausgerottet werden,
und die Trotzigen schnell entwurzle, zerschmettere, wirf nieder
und demütige sie schnell in unseren Tagen.
Gelobt seist Du, Ewiger,
der Du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst!«
Das Gebet entglitt ihm erneut. Die Auseinandersetzungen mit Mosche kamen ihm in den Sinn, der auf einer anderen, schärferen Version der zwölften Bitte beharrte. Die freche Regierung mögest du eilends ausrotten in unseren Tagen, so sollte es im Gottesdienst heißen, und, schlimmer noch, die Nazarener und die Ketzer mögen umkommen in einem Augenblick. Warum diese Unversöhnlichkeit, die nur neuen Hass erzeugte? All die zähen Diskussionen im Rat kochten in ihm hoch. Er hatte sie so satt.
Erneut konnte Chaim seine Gedanken bezwingen und kam zurück in den Fluss, in das Schweben, das er gerade heute so ersehnte, das er gerade jetzt brauchte. Und so fiel alle Last des Tages von ihm ab, und er beendete das Gebet, wenn auch nicht glücklich, so doch ruhiger, gelassener.
»Verleihe Frieden, Glück und Segen, Gunst und Gnade und Erbarmen
uns und ganz Israel, Deinem Volke, segne uns, unser Vater,
uns alle vereint durch das Licht Deines Angesichts,
denn im Lichte Deines Angesichtes gabst du uns, Ewiger, unser Gott,
die Lehre des Lebens und die Liebe zum Guten.«
Er blieb einen Moment sitzen, genoss den warmen Abend und schaute hinaus in Richtung des mächtigen Flusses, der ruhig und kraftvoll sein Wasser hin zum großen Meer fließen ließ.
Chaim stand auf, füllte Wasser aus dem Tonkrug neben der Kommode in die große Schale auf der marmornen Platte und entkleidete sich. Mit einem Lächeln zog er die oberste Schublade auf und nahm einen der gelben Schwämme heraus. Sündhaft teuer waren diese toten Überreste von seltsamen Lebewesen, für die Taucher an den Küsten Griechenlands sich tief ins Meer vorwagen mussten. Es gab sie nur bei Schmuel, und das wusste der schlaue Kerl auszunutzen. Chaim hasste das Feilschen, aber in diesem Fall konnte er nicht anders. Er hatte Jehudith mit diesem porösen und gleichsam weichen Wirrnis zu ihrem Hochzeitstag überrascht – und Schmuel schließlich mit einem Satz Gläser bezahlen müssen.
Freudig hatte Chaim ihr gezeigt, wie diese gelben Ballen das Wasser in sich aufnahmen und wie weich man mit ihnen über die Haut streichen konnte. »Das Dreißigfache seines Gewichtes saugt ein solcher Schwamm auf«, hatte er ihr stolz verkündet. Jehudith hatte ihn ausgelacht, weil er immer so exakt mit Zahlen war. Aber ihr Lachen war in Liebe getaucht gewesen, sie hatte sich riesig gefreut.
Chaim musste an all dies denken, als er den weichen Ballen in die Schale tauchte, der sofort begann, das Wasser gierig in sich aufzunehmen.
Er rieb sich gründlich ab. Das kühle Wasser erfrischte ihn, zog ihn hinaus aus der seligen Gleichmut, in die ihn das Gebet geführt hatte. Er genoss seine Nacktheit und verzichtete darauf, sich abzutrocknen. Stattdessen setzte er sich auf den Hocker am Fenster und betrachtete den langsam dunkler werdenden Himmel durch das offene Fenster.
Die Sterne gossen ein zartes Leuchten über die Stadt aus, während sich die Geräusche des Hafens nach und nach in der Stille der Nacht verloren.
An diesem lauen Maiabend trocknete seine Haut rasch. Er setzte sich auf das Bett, in dem David, Hannah und Benjamin gezeugt und geboren worden waren. Mit dem Rücken lehnte er sich an das hölzerne Kopfende, zog sich die helle Leinendecke über seinen Körper und wartete in freudiger Erregung auf seine Frau.
Am Bach bei Peters Heim
Peter ging zunächst zum Bach, mit einem kurzen Wiehern kam Lene auf ihn zugetrabt. Längst wäre es für das Kaltblut an der Zeit gewesen, im Stall zu sein. Nach all den Stunden allein sehnte sich die Stute nach der Wärme der anderen Tiere. Peter nahm den Zügel und zog Lene mit sich, ohne ihr braunes Fell zu streicheln, wie es sonst seine Gewohnheit war. Vom Stall ging er in das gedrungene Grubenhaus, rollte sich in eine Decke ein und drehte sich zur muffigen Holzwand.
Nun merkte Peter, wie die schwere Arbeit auf dem Acker ihm in den Knochen steckte. Und die Ohrfeige seines Vaters hatte sich wie ein Brandzeichen in seine Seele eingeprägt.
Er konnte nicht einschlafen. So viele Eindrücke waren heute auf ihn eingestürzt. Der Strom von Pilgern. Dieser seltsame Fremde in der roten Kutte, der gar seinen Namen kannte. Und dann dieser demütigende Schlag, das laute Klatschen der Hand seines Vaters in seinem Gesicht.
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Nach einiger Zeit vernahm Chaim Jehudiths leise Schritte, die die Treppe hinaufkamen. Als sie die Schlafkammer betrat, setzte er zu einer freundlichen Begrüßung an. Doch legte seine Frau einen Finger auf die Lippen und flüsterte ihm zu: »Die Kinder schlafen endlich alle.« Behutsam schloss sie die Tür und setzte sich zu Chaim aufs Bett. »Nun erzähl mir in allen Einzelheiten, was ihr im Rat besprochen habt?«
Chaim zögerte zunächst. Dann sagte er: »Ein Heer der Unbeschnittenen hat in Speyer für Unruhe gesorgt.«
»Christenkämpfer? Darüber gab es viel Gerede in der Gemeinde, einige denken sogar an Flucht. Das erschien mir jedoch alles sehr aufgebauscht«, bemerkte Jehudith. »Die wollen doch Jerusalem erobern. Warum Speyer? Geht es darum, Leute anzuheuern oder Geld zu erpressen?«
»Wahrscheinlich beides. Jedoch haben sie dort elf der Unseren ermordet.«
Jehudith sog scharf Luft ein. »Das ist ja furchtbar.« Sie schwieg einen Moment. »Also ist doch etwas dran an dem, was die Leute reden.«
»Die Mörder wurden jedoch, dem Ewigen sei Dank, von Bischof Johann bestraft.«
»Das ist gut. Das hat diese Irren hoffentlich gelehrt, unsereinem Respekt zu zollen.«
Chaim schnaubte. »Sie haben wohl einige der Unseren zu ihrer Taufe gezwungen. Aber als das Heer weiterzog, erlaubte der Bischof unseren Brüdern und Schwestern, zum Glauben an den Einen zurückzukehren.«
»Dann scheint es ja nicht ganz so schlimm zu sein.«
»Ich bin jedenfalls besorgt.«
»Speyer wird diesen Teufeln hoffentlich eine Lehre sein.« Jehudith betrachtete ihren Mann. Ihre Lippen kräuselten sich. »Hab keine Angst, der Eine wird uns beschützen. Erzähl mir lieber, was du mit Raimund übersetzt hast.«
Jehudiths Augen leuchteten vor Neugierde.
Chaim war dankbar, dass seine Frau das Thema wechselte. Er wollte sie nicht noch mehr belasten, und auch er sollte sich die Zukunft nicht allzu schwarz malen. Jehudith würde sicher recht behalten, schließlich schien die Sache in Speyer aufgrund des Eingreifens des Bischofs einigermaßen glimpflich ausgegangen zu sein.
So kam es ihm gelegen, dass er ihr nicht von dem Heer vor Worms erzählen musste. »Wir waren ja leider wegen der Sitzung des Rates gezwungen, unsere Arbeit abzubrechen. Aber ich könnte dir den Anfang des Psalms vortragen.«
»Sehr schön. Vorher mache ich mich kurz fein.«
Jehudith stand auf und begab sich zur Kommode mit der großen Schale. Sie schüttete das Wasser aus dem Fenster und füllte aus dem Tonkrug frisches nach. Dann zog sie ihr Kleid über den Kopf und stand, nur mit ihrem Leinenhemd bekleidet, den Rücken zu Chaim gewandt am Fenster. Silbern leuchtete ihre Haut im zarten Licht des Mondes und der Sterne.
Sie nahm den Schwamm, wusch sich langsam über ihr Gesicht und den Hals. Anschließend entledigte sie sich ihres Hemdes und rieb mit dem gelben Ballen über ihre kräftigen Schultern, sodass das Wasser ihr über den Rücken rann. Chaim beobachtete das Rinnsal, das ihre Wirbelsäule hinunterlief und zwischen den Pobacken zu versiegen schien. Er merkte, wie sein Geschlecht sich wohlig regte.
Jehudith rieb sich über die vollen Brüste und den Bauch. Danach stellte sie ihren linken Fuß auf den Hocker am Fenster, dafür musste sie sich etwas zur Seite drehen. Langsam ließ sie den Schwamm über ihren Schenkel gleiten. Natürlich wusste sie, dass Chaims Blick nun auf ihren Brüsten ruhen würde. Er lächelte. Sie stellte den anderen Fuß auf den Schemel, ließ das Wasser auch über ihr rechtes Bein rinnen, wischte nach und legte den Schwamm schließlich zurück in die Schale. Abschließend nahm sie ein frisches Leintuch aus der Kommode, wickelte es sich um und verknotete es über ihren Brüsten.
Sie kämmte sich durch ihr langes schwarzes Haar. Jedes Mal, wenn der Kamm hängen blieb, gab sie ein leises Stöhnen von sich. Köstlich, dachte Chaim. Er mochte es, wenn ihre Haare vom Kamm befreit zurückwippten. Schließlich nahm sie das Tuch von ihrem Körper und rieb sich Gesicht, Arme und Füße trocken.
Chaim war angenehm erregt. Aber er wusste, dass es ratsam war, seine Lust noch einige Zeit zu zügeln. Jehudith schlüpfte zu ihrem Mann unter die Decke und schaute ihn mit großen Augen an. »Nun, fang an.«
»Womit?«
»Mit eurer Übersetzung.«
»Ahh … Also gut. Raimund hat es aufgeschrieben, ich habe heute Nachmittag sogar noch ein paar weitere Zeilen übersetzt. Ich glaube, ich kann es auswendig hersagen.«
Chaim blickte tief in Jehudiths braune Augen und sprach:
»Lobe Ihn, meine Seele!
Gott, mein Gott, Du bist sehr groß,
Pracht und Glanz sind Deine Kleider,
Er trägt das Licht wie einen Mantel,
spannt den Himmel wie eine Plane,
baut auf dem Himmelsmeer Seine Burg.
Wolken macht Er zu Seiner Kutsche,
reist auf den Flügeln des Windes.
Winde macht Er zu Seinen Boten,
loderndes Feuer zu Seinem Diener.
Er baut die Erde auf festen Grund,
dass sie in Ewigkeit nicht schwankt.«
Jehudith hatte sich inzwischen an Chaim geschmiegt, und er legte seinen Arm zärtlich um seine Frau.
»Hast sie mit dem Meer bekleidet.
Über die Berge traten die Wasser.
Als Du drohtest, flohen sie,
Deine Donnerstimme schreckte sie auf.
Berge stiegen, Täler sanken,
dorthin, wo Du den Grund gelegt.
Grenzen hast Du für sie gezogen,
dass sie nicht kommen, die Erde zu fluten.
Du füllst Auen aus den Quellen,
sie fließen zwischen saftig grünen Berghängen dahin.
Die Tiere des Feldes trinken,
wilde Esel löschen ihren Durst.
Darüber wohnen die Vögel des Himmels,
singen zwischen den Zweigen.
Berge tränkst Du aus Deiner Burg,
füllst die Erde mit Deinen Früchten.«
»Herrlich! Der Ewige wird uns beschützen in allen Gefahren.« Ein seliges Lächeln lag über dem Gesicht seiner Frau. »Es ist so schön, diesen Psalm in unserer Alltagssprache zu hören. Bitte sag Raimund, wie sehr ich seine Arbeit schätze.«
»Das werde ich machen, meine Rose von Scharon«, antwortete Chaim.
Am Bach bei Peters Heim
Nach langer, langer Zeit übermannte Peter endlich die Erschöpfung und er fiel in einen unruhigen Schlaf. Tief in ihm arbeiteten all die Bilder weiter, während er sich schwitzend und gleichzeitig frierend von einer Seite zur anderen wälzte. In etwas, das weder ganz Traum noch ganz Wunschgemälde war, formten sich die Bilder zu etwas Neuem.
Vor den Mauern einer großen Stadt sah er sich einem massigen braunen Bären gegenüberstehen. Strahlend blau war der Himmel, und der Sand brannte unter seinen nackten Füßen. Langsam schlich das zottige Ungetüm um ihn herum, belauerte ihn aufmerksam. Ritter bildeten einen Kreis um sie, schlugen mit ihren Schwertern langsam im Takt auf ihre Schilde. Auch Peter hielt ein Schwert in seiner Hand, mit dem er den Bären auf Abstand halten konnte.
Eine junge Frau wurde zu ihm in den Ring gestoßen. Sie stolperte und fiel auf den heißen Boden. So lag sie da, hilflos, bemitleidenswert, gleichzeitig süß anzusehen mit ihrer braunen Haut und den langen schwarzen Locken.
Unruhig witternd riss der Bär seinen mächtigen Kopf in die Höhe und wendete sich der Schönen zu. Angstvoll sprang das Mädchen auf und versteckte sich hinter Peters Rücken. Das laute Brüllen des Ungetüms ging ihm bis ins Mark.
Die Schläge der Ritter wurden schneller. Der Bär kam langsam näher, dann richtete er sich zu seiner vollen Größe auf. Das metallische Hämmern der Schwerter war nun ein einziger dröhnender Trommelwirbel. Plötzlich ließ sich das Raubtier auf Peter fallen. Blitzschnell hob der das Schwert, sodass dessen Spitze sich dem Bären mitten in die Brust bohrte. Peter taumelte, konnte sich jedoch gerade noch auf den Füßen halten. Der pelzige Fleischkoloss fiel in den Sand. Röchelnd lag das Tier vor ihm und schleuderte seine Schnauze vor Schmerz hin und her.
Dunkelrotes Blut quoll aus der Wunde, versickerte augenblicklich im hellen Sand und färbte den Boden in einem schmutzigen Rot. Peter ließ den Bären nicht aus den Augen. Die junge Frau hatte ihre Arme um seinen Bauch gelegt, ihre weichen Brüste rieben sich wohlig an seinem Rücken.
Peter konnte den Schwertgriff fassen, riss die Klinge aus der Brust des Bären und setzte an zum Gnadenstoß. Während das scharfe Metall in den Hals des Tiers eindrang, verwandelte sich dessen Schnauze in einen Mund und eine Nase. Das Fell des Ungetüms wurde glatt und hell. Es war nun das verzerrte Gesicht seines Vaters, dessen Augen ihn anstarrten, gleichermaßen verwundert und entsetzt. Stöhnend wand er sich vor ihm, während Peter die Klinge langsam aus seinem Hals zog. Ein letztes Zucken ging durch den Körper seines Vaters, bis sich seine Augen schließlich starr gen Himmel richteten.
Schweißgebadet wachte Peter auf. Aber schon kurz darauf fand er endlich in den ersehnten Schlaf.
Mainz – in Jehudiths und Chaims Haus
Jehudiths Kopf lag entspannt an der Schulter ihres Mannes, der seinen Arm locker um sie geschlungen hatte. Eigentlich war es nun der rechte Moment, seine Frau zu küssen, aber sie wich seinem Blick aus. Ihr verschmitztes Grinsen sagte Chaim, dass da etwas war, das sie ihm mitteilen wollte.
Jehudith schloss die Augen. »Ich glaube, ich weiß, warum Salomo dich so merkwürdig angeschaut hat, als du ihn heute im Rat getroffen hast.«
»So?«
»Hannah hatte Bauchschmerzen.«
»Ah ja.« Chaim hatte nicht die geringste Ahnung, worauf seine Frau hinauswollte.
»Und uns ist der Kräutersud ausgegangen, den ich in solchen Fällen den Kindern gebe.«
»Hm.«
»Deshalb bin ich heute Morgen zu Salomo gegangen. Der hat mir ein Säckchen getrockneten Fenchel mitgegeben.«
»Und, haben die Kräuter geholfen?«, fragte Chaim, mehr, um in Jehudiths Spiel mitzuwirken, als aus wirklichem Interesse.
»Ja, Hannah ging es schon am Nachmittag viel besser.«
»Sehr schön. Aber war das der Grund für sein Grinsen?« Chaim war verwirrt, dieses Rumgestottere war ganz und gar nicht Jehudiths Art. Die Klarheit ihrer Worte war nicht nur bei den Kindern gefürchtet.
»Ähm … wohl nicht«, druckste Jehudith weiter herum.
»Was war dann der Grund?«, fragte Chaim mit Engelsgeduld.
»Ich habe mit Salomo über dies und das gesprochen.«
»Aha.«
»Nun ja, ich habe ihm erzählt, dass ich immer ziemlich genau nach dreiunddreißig Tagen meine Blutungen bekomme.«
Chaim konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Schon oft habe ich unserem Schöpfer dafür gedankt, dass der Zeitraum deiner reinen Tage länger ist als bei den meisten anderen Frauen. Und auch dafür, dass du das immer so genau einschätzen kannst. Wir sind wirklich gesegnet.«
Jehudith lächelte. »Meine letzte Monatsblutung war am sechsten Ijjar. Ich mache dann immer eine Kerbe in den Kalender in der Küche. Daher weiß ich das so genau.«
Natürlich war es Chaim nicht entgangen, dass seine Frau am Dienstag letzter Woche für das rituelle Reinigungsbad die Mikwe aufgesucht hatte. Seit dem Tag war ihnen nach der Niddah, wie die zwölf Tage der Schonung nach der ersten Blutung genannt wurden, wieder die Möglichkeit der Vereinigung gegeben. Aber abgesehen von dem Abstimmen der Zeiten der Reinheit und der Schonung redeten sie normalerweise nicht über diese Dinge, das war eigentlich Frauensache. So blickte Chaim Jehudith ratlos an und sagte mit gespielter Empörung: »Ich hoffe nur, dass unsere Kinder das mit dem Kalender nicht wissen. Oder willst du, dass die ganze Familie diese Dinge mitverfolgt?« Mit jeder Sekunde wuchs Chaims Lust. Als Jehudith schwieg, konnte er seine Ungeduld kaum noch beherrschen. »Nun spann mich nicht weiter auf die Folter, worauf willst du hinaus?«
Jehudith gab vor, von der Unruhe ihres Mannes keine Notiz zu nehmen. »Das bedeutet, dass ich am neunten Siwan wieder bluten werde«, dozierte sie, als würde sie einem Schüler das kleine Einmaleins beibringen.
»Und? Komm zur Sache, mein Liebes.« Chaim verdrehte die Augen und zählte die Balken an der Decke.
Das Grinsen seiner Frau ging von einem Ohr zum anderen. »Salomo hat gesagt, dass genau fünfzehn Tage vor der nächsten Blutung die beste Zeit sei.«
Chaim wurde es zu bunt, er zeigte mit der Hand nach oben und platzte heraus: »Schatz. Die beste Zeit wofür? Deine Sprache ist so dunkel wie die Balken an unserer Decke.«
Zärtlich nahm Jehudith den Kopf ihres Mannes in ihre warmen Hände und zog ihn zu sich hinunter. Er spürte ihre weichen Lippen auf seinem Mund. Ihre Zunge berührte seine Lippen, und bereitwillig öffnete er sie. Langsam dämmerte es ihm, worauf seine Frau hinauswollte, und seine Anspannung löste sich. Frei und sorglos gab er sich Jehudith hin.
So fühlten die beiden sich als Teil von Gottes großem Plan. Sie würden sich nun verewigen in dem großen Geschichtswerk, das Generation für Generation, Geschlecht für Geschlecht der Welt Seinen herrschaftlichen Willen einprägte und Seine Größe und Schönheit abbildete in all der Fülle des Lebens.