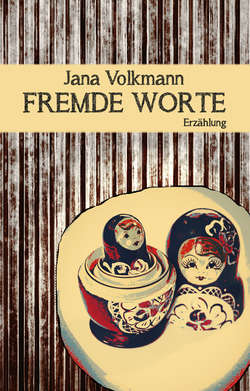Читать книгу Fremde Worte - Jana Volkmann - Страница 7
1. Spielmeisterin
ОглавлениеDer Antiquar hatte sie immer noch nicht durchschaut. Dafür gab es zwei gute Gründe:
Erstens war es fast unmöglich, sich bei dieser Menschenmenge auf einzelne Gesichter zu konzentrieren; obwohl sie jeden Sonntag hier war, hatte sie nicht das Gefühl, er erkenne sie wieder. Er wirkte allerdings auch nicht sehr interessiert. Grundsätzlich – weder an ihr noch am Rest seiner Kundschaft. Der Antiquar schaute in der Regel höflich in die Ferne oder in seinen Kaffeebecher. Fragen beantwortete er knapp und präzise, ansonsten war er zu keinem Gespräch bereit und wirkte auf angenehme Art abwesend. Sie hatte oft darüber nachgedacht, was sein Gesicht über ihn verraten mochte. Sie fand, er sehe aus, als versuche er, sich an etwas zu erinnern, das ihm immer wieder entglitt, sobald er es zu fassen bekam. Allerdings schien er nicht besonders verzweifelt darüber zu sein. Seine Versuche hatten nichts Verbissenes, es war wohl eher eine Art Übung, die er schon so oft wiederholt hatte, dass sie ihm ganz leicht zu fallen schien. Nur zwei kleine senkrechte Falten kurz über der Stelle, wo seine runde Brille auf der Nase auflag, deuteten darauf hin, dass ihm das Grübeln nicht nur Freude bereitete. Vielleicht dachte er aber auch einfach an gar nichts. Manche Leute bekamen das hin und kriegten trotzdem Falten.
Zweitens war sie einfach geschickt. Sie täuschte vor, eine Kundin zu sein wie alle anderen hier, auf der Suche nach einem Buch, vielleicht nach einem ganz bestimmten, vielleicht auch nicht. Jedenfalls nach einem Buch. Sie nahm Buch für Buch aus den Pappkisten, sah sich zuerst den Titel an, dann den Klappentext, dann den Preis, anschließend blätterte sie ein wenig und tat, als lese sie ganze Passagen. Sie spielte dabei genau das richtige Maß an Interesse vor, wirkte weder gelangweilt noch allzu begeistert. Überhaupt war sie bei ihren Besuchen am Bücherstand ganz nebenbei eine passable Schauspielerin geworden, fast fiel sie auf sich selbst herein. Erst ganz zum Schluss schlug sie wie beiläufig, wie versehentlich die leere Seite zwischen Impressum und Vorwort auf. Und dann die leeren Seiten innen am Buchdeckel. Auf diese Weise dauerte ihre Suche viel länger als nötig, aber das war eben Teil des Spiels, sie hatte die Regeln selbst erfunden, und nun wollte sie sich den Spaß nicht nehmen lassen, sie einzuhalten, egal, wie viel Zeit es kostete. Zu dem Spiel gehörte es auch, ein paar unbrauchbare Bücher beiseitezulegen und gegen die neugierigen Blicke der anderen Kunden zu verteidigen, nur um sie am Schluss doch wieder in die Kisten zurückzustellen. Außerdem hatte sie sich angewöhnt, halbherzig zu feilschen und hin und wieder nach einem Titel zu fragen, der garantiert nicht in den Kisten zu finden war.
Hanna erinnerte sich dunkel an früher, als sie tatsächlich noch gelesen hatte, richtig gelesen. Ganze Bücher. Sie wusste noch, wie es war, in der Handlung eines Romans zu Hause zu sein oder eine zarte Freundschaft für die Figuren zu empfinden. Sätze zu unterstreichen, um sich an sie zu erinnern, und weil man sie sich ja doch nicht merken konnte, ersetzte eine dünne schiefe Bleistiftlinie das Einprägen, das Auswendiglernen.
Hanna las seit einer Weile keine Bücher mehr. Sie machten sie müde. Die Handlungen interessierten sie nicht, die Figuren waren ihr fremd und schienen lächerlich, sie kannte sich in den Wörtern nicht mehr aus. Sie fügten sich zu keiner Geschichte mehr zusammen, zwischen den Buchdeckeln wartete keine andere Welt mehr, und erst recht nicht so etwas wie ein Zuhause.
Die wirklichen Geschichten, die, die es noch zu lesen lohnte, setzten sich aus wenigen Wörtern zusammen. Sie wirkten nicht, als seien sie mühelos geschrieben, waren fehlerhaft, lückenhaft, nie zu Ende erzählt und nicht richtig begonnen. Sie waren in Handschrift auf eine leere Seite geschrieben. Sie hatten nur einen einzigen Adressaten, sie waren immer bloß für dich und verbargen sich schamhaft vor dem Rest der Welt. Sie waren nicht für Hanna gedacht. Sie las sie doch, und sie empfand eine Freude dabei, die in dem einfachen System aus Schenken und Beschenktwerden nicht vorgesehen war. Die nicht verboten war, aber auch nicht ganz erlaubt. Es gab ja niemanden, der wütend werden oder sich peinlich berührt fühlen könnte. Niemanden, der ihr verbieten könnte, die Widmungen zu lesen und ihrer Bedeutung hinterherzuspüren. Die Bedeutung lag irgendwo jenseits der Buchstaben, die da handschriftlich ins Weiße geschrieben waren. Jenseits der sparsamen, spärlichen Wörter.
Hanna hatte aufgehört, Romane zu lesen, und angefangen, Widmungen zu lesen. Sie erinnerte sich gut an den Moment, als es begann. Der Übergang war nicht fließend gewesen, nicht schleichend, und er war nicht ohne Weiteres wieder rückgängig zu machen. Es war, wie wenn man einen Zopf abschneidet, mit einer Schere, so scharf, dass man nur einmal zudrücken muss. Ausgelöst wurde all das durch einen Zufall in einem Antiquariat auf der Frankfurter Allee. Hanna hatte enttäuscht vor den Regalen gestanden: so viele Bücher, und keins wollte sie interessieren. Die Bücher waren dort so günstig, und Hanna hatte den Laden so gern, dass sie trotzdem nicht mit leeren Händen heimgehen wollte. Außerdem war Sonntag. Um noch etwas zum Lesen für den Abend zu finden, hätte sie sonstwohin gemusst, am ehesten zu einer Bahnhofsbuchhandlung, wo sie das Zehnfache für ein Buch hinblättern müsste, das auch nicht interessanter wäre. Mit dem Sonntagsgedanken im Kopf hob sie ein Buch aus dem Regal, dessen Rücken nicht mehr zu entziffern war, so oft war es schon auf- und wieder zugeklappt worden. Sie schlug es auf und fand gleich auf der ersten Seite, unter dem Titel, eine wildromantische Nachricht. Die zweieinhalb Zeilen, mit aufgeregt zittriger Hand geschrieben, erzählten von einer so verrückten Liebesgeschichte, dass der Inhalt von Knut Hamsuns „Mysterien“ sie nur enttäuschen konnte, obwohl auch das eine vollkommen irre Liebesgeschichte war, die Hanna früher mit Sicherheit gefallen hätte. Laurie war die Schenkerin des Buches, der Beschenkte hieß Ivo. Ivo und Laurie war sie immer noch ein wenig dankbar. Laurie für die verrückte Liebesgeschichte und Ivo dafür, dass er sie nicht einfach für sich behalten hatte, denn das war nun mal das Schicksal der meisten Widmungen. Darum machte es ja einen solchen Spaß, sie zu lesen. Hanna setzte jedes Mal ein Naturgesetz außer Kraft, wenn sie eine solche Widmung las und sich von den Geschichten einspinnen ließ, die sie mal deutlich, mal gar nicht deutlich erzählten. Damals hatte sie die Widmung gleich im Laden gelesen und beim Bezahlen so auffällig gelächelt, dass die Verkäuferin sich mit ihr freute, ohne zu wissen, weshalb. Den Roman hatte sie daheim sofort begonnen. Dreimal hatte sie die erste Seite gelesen, bis sie sich eingestand, dass es an der Zeit war für eine neue Beschäftigung, und in ihr ging eine Schere zu, trennte sie von einer anderen Hanna.
Sie hatte ihre Grenzen immer enger um sich herum gezogen. Sie wollte nicht teilen, nicht einmal ihre Begeisterung für die Widmungen. Sie ahnte, dass es nicht dasselbe wäre, wenn ihre Freude nicht mehr diebisch im Geheimen bliebe; dass etwas mit den Widmungen geschehen würde, wenn jemand anderes sie las. Jemand anderes, dem sie trivial vorkamen und der Hannas Lesegewohnheiten verschroben, langweilig oder einfach total bescheuert fand. Sie erzählte niemandem davon. Dass es zu diesem Zeitpunkt auch gerade niemanden gab, der an ihren Flohmarktschätzen oder den Fundstücken aus dem Antiquariat besonderes Interesse zeigte, kam ihr nur gelegen. Wenn eine Freundin sie fragte, was sie gerade lese, fiel ihr immer irgendein Titel ein, der langweilig genug war, das Gespräch gleich wieder zu beenden. Sie zog behutsam einen Bannkreis um sich und die besonderen Bücher, bis kein Platz mehr für andere darin war. Niemand durfte mit hinein in ihre Geschichten, in ihr geheimes zweites Zuhause zwischen den Buchdeckeln. Die, von denen sie sich entfernte, waren ihr im Grunde schon vorher fern gewesen. Lauter ehemalige Kommilitoninnen, frühere Mitbewohner oder Leute, die sie bei einem Job kennengelernt hatte. Sie hörten alle auf anzurufen, einer nach dem anderen. Es waren schleichende, wortlose Abschiede, die niemandem von ihnen wehtaten und die sie wohl alle insgeheim ein wenig erleichterten, obwohl das natürlich niemand sagen würde, denn wenn sie es sagen würden, müssten sie es auch erklären, und es fiel ihnen allen schwer, einen Grund zu finden, weshalb sie sich plötzlich so ungeheuer fremd vorkamen. Hanna fragte sich ab und zu, ob man sich auf Partys nach ihr erkundigte. Ob man über sie sprach. Und wer. Und was sie redeten, wenn sie redeten, ob sie sich Sorgen machten, ob sie sie vermissten oder ob sie sie einfach wunderlich fanden. Ob sie sich besser fühlten ohne sie oder schlechter. Am wahrscheinlichsten war, dass sie überhaupt nicht von ihr sprachen. Wenn sie sich vorstellte, worüber und über wen sie stattdessen redeten, über alles und jeden nämlich, nur eben nicht über sie, kam ihr die ganze Welt unerreichbar fern vor, als sehe sie nur durch ein Fenster hinein. Eines, das von innen fest verriegelt war. Das waren die Momente, in denen die Widmungen ihr wie ein zweites, ein anderes Fenster erschienen. Eines, das weit offenstand, in das man hineinkriechen und sich in aller Ruhe umsehen konnte.
Es gab melodramatische Widmungen, bemüht komische, solche, die von Vertrautheit und Verbundenheit und Freundschaft erzählten. Sie waren oft peinlich. Und oft richtig gut. Alle waren anders, nie glichen sie einander. Auch wenn sich manche Floskeln wiederholten: Da war immer noch ein bisschen mehr als ein simpler Glückwunsch oder ein schmuckloser Gruß. Allein schon die verschiedenen Handschriften waren häufig gesprächiger als das, was die Wörter sagten. Gesprächig waren sie jedenfalls alle, eine Ausnahme war Hanna nie untergekommen. Auch die knappen und hastigen. Selbst die lust- und lieblosen. Die Widmungen waren Hannas Seifenoper und ihre Tragödie, ihre Telenovela, ihr Laienspiel. Groteske, Burleske und Melodram. Ihre Reality Show. Oft alles zugleich. Vor allem aber waren sie ihr Heim in einer anderen Welt, ihre Möglichkeiten.
Von Autoren persönlich signierte Exemplare interessierten sie überhaupt nicht, im Gegenteil. Autoren interessierten sie generell nicht mehr. Wenn sie ehrlich war, fand sie Autoren sogar zunehmend unsympathisch. Wenn sie an die Lesungen dachte, die sie früher einmal besucht hatte, mit Signierstunde, einem Glas Wein im Anschluss und der Möglichkeit zu einem Gespräch, kam sie sich ganz verschwendet vor an diese Abende. Nein, die Widmungen, die sie dazu bewogen, noch immer Büchersammlerin zu sein, sahen ganz anders aus. Sie nahmen sich nicht wichtig. Genau deshalb waren sie es.
Wer verkaufte ein Buch, das er von seinem Vater zum Abitur bekommen hatte, wer gab den Lieblingsroman weg von einer, die ihn liebte? Wer schenkte einem anderen Gedichte – hat er sie auch vorgelesen oder hat er sie bloß gekauft und weggeben, womit seine Rolle schon zu Ende erzählt gewesen wäre? War es leicht gewesen, sich von dem Buch zu trennen? War der Beschenkte tot oder pleite oder bloß mit jemand anderem glücklich? Aus den Fragen wuchsen ganze Geschichten heraus, schnell wie ein Gewitter, wie die magische Bohnenranke aus dem englischen Märchen oder die Kürbispflanzen im Garten von Hannas Oma. Unberechenbar und unaufhaltsam und wild. Die Widmungen waren das Wurzelwerk. Sie hielten Hannas Geschichten im Boden fest, sodass sie bis in die Wolken wachsen konnten, ohne fortzufliegen. Sie wurden alle im Präteritum erzählt, wie beinahe jede Geschichte. Wenn Hanna die Bücher in den Händen hielt, hatten sie längst aufgehört, Geschenke zu sein. Sie waren nur noch Vergangenheit. Eine Erinnerung an Bindungen, Freundschaften, Liebschaften, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch vergangen waren und die sich nur mit ausgesprochen viel Fantasie von einer Außenstehenden wie Hanna rekonstruieren ließen. Hanna liebte das sehr, die Erinnerungen anderer Leute, und sie fühlte sich wohl in ihrer Rolle als Dritte, die weder den Verfasser der Widmung kannte noch den Beschenkten und somit niemandem eine Rechtfertigung schuldete, weshalb sie ihre Sonntage am liebsten zwischen abgegriffenen, aussortierten, heimatlosen Buchdeckeln verbrachte. Sich selbst schuldete sie auch keine Rechtfertigung. Eine Beschäftigung musste schließlich jeder haben, und ihre tat niemandem weh, kostete wenig Geld und ging keinen etwas an.
Anfangs war sie nicht wählerisch gewesen. Sie hatte sich auch gefreut, wenn sie zwischen den Seiten ein vergessenes Lesezeichen entdeckt hatte. Manche legten Zeitungsausschnitte in die Bücher, Rezensionen zum Beispiel, oder ein Interview mit der Autorin. Einkaufszettel waren als Lesezeichen auch recht beliebt, oder Postkarten, leere Briefumschläge oder die Rechnung aus der Buchhandlung. Diese vergessenen Gegenstände erzählten natürlich auch kleine Geschichten, aber Hanna wurde schnell klar, dass Widmungen doch etwas ganz anderes waren, nicht so zufällig und austauschbar wie diese Fundsachen, die jederzeit zwischen den Seiten herausfallen konnten, ohne dass man es auch nur bemerkte. Und darum hatte sie sich spezialisiert, hatte die Spielregeln erdacht und weiterentwickelt und streng darauf geachtet, dass sie eingehalten wurden. Sie war die Meisterspielerin und die Schiedsrichterin.
Mit den Fingerspitzen strich sie an einem Taschenbuch entlang. Die Seiten waren weich und stockfleckig, der Buchrücken vom vielen Aufschlagen zerfurcht, selbst im Deckel war ein Eselsohr. Es war beinah unangenehm, das Buch zu berühren, so, wie man sich manchmal scheut, sehr alte Menschen anzufassen, und sich dann dafür schämt, umso heftiger die fleckigen Hände schüttelt und umso kräftiger umarmt. Sie strich mit Bedacht noch mal über den Buchschnitt und schlug es beherzt auf. Hannas Verdacht bestätigte sich: Das war kein Buch, das jemand geschenkt bekommen hatte. Die waren nur selten derart zerlesen, meist wirkten sie eher verdächtig gut erhalten. Sie überlegte kurz, es trotzdem zu kaufen, allein weil es sonst wahrscheinlich niemand täte. Ein Buch in einem solchen Zustand, kein bekannter Titel, der Name der Autorin sagte Hanna etwas, aber sie konnte ihn nicht zuordnen. Keine Chance, ein Fall für die Altpapiertonne auf irgendeinem Hinterhof. Hanna legte das Buch beiseite, aber dann besann sie sich auf die Spielregeln und stellte es in die Kiste zurück, aus der sie es gezogen hatte, setzte ihren Blick auf, den sie immer aufsetzte, wenn sie eine Buchkäuferin spielte, die sich umentschied, und griff nach einem Buch, das besser in Schuss schien.
Nach welchen Kriterien der Antiquar die Bücher für den Flohmarkt auswählte, war Hanna nicht ganz klar. Es gab allerdings keine Krimis, keine Fantasyromane und keine fremdsprachigen Titel, keine Rezeptbücher und keine Bildbände; die Sachbücher waren erlesen und dementsprechend nicht zahlreich. Damit kam der Stand ihren Interessen sehr gelegen. Krimis und Kochbücher wurden selten verschenkt, Bildbände schon, aber dann in aller Regel ohne Widmung.