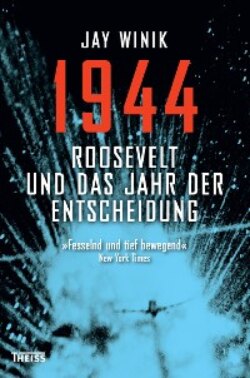Читать книгу 1944 - Jay Winik - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auftakt Der Große Sphinx 22./23. November 1943
ОглавлениеDiese Landschaft, die sich bis zum Horizont erstreckte, gehörte zu den ruhigsten und erhabensten der Welt. Jedoch war sie, am Rande der Sahara auf einem Felsplateau gelegen, auch eine der gefährlichsten. In den Sommermonaten flimmerte und wogte das sonnendurchtränkte Gelände rings um den Großen Sphinx bei Temperaturen von über 40 Grad. Unerfahrene Reisende verloren die Orientierung, waren sie doch nie zuvor solch erbarmungsloser Hitze, solch entnervendem Durst, solch unerbittlicher Stille oder einer derart pfadlosen Wüste begegnet. So gleißend war das vom Sand reflektierte Licht, dass das Auge seinen blendenden Schein nicht ertragen konnte. Sogar das Wetter trieb hier ein seltsames Spiel mit Raum und Zeit. Gegen Ende März kam der gefürchtete Chamsin, ein stürmischer, heißer Wüstenwind, der körnigen Staub mit sich führte und das Plateau von Gizeh oft bis zu 50 Tage lang nahezu unbewohnbar machte. Ganze Schafherden waren im Lauf der Jahre in diesen höllischen Stürmen verschwunden, wie auch zahllose Menschen, einfach vom Sand verschluckt. Der sagenumwobene Große Sphinx selbst, eines der ältesten Monumente der Welt, hatte über ein Jahrtausend lang verborgen unter Bergen von Treibsand gelegen.
Hier, unter dem weiten blauen Himmel, lagen der Reiz der Antike und der Zauber der Geschichte beieinander, überlagerten sich verschiedene Kulturen auf faszinierendste Weise. Einst waren die Pharaonen durch diese Lande gewandelt, ebenso wie Königin Kleopatra und der mächtige Caesar. Antike römische Senatoren in fließenden weißen Togen wurden mit Gold, Silber und zahlreichen anderen Reichtümern in Hülle und Fülle überhäuft, während in späteren Jahrhunderten heilige Männer sich im Gebet geißelten und Menschenmassen den Nil säumten, um ihre Führer hochleben zu lassen oder ihre Bezwinger zu bewundern. Das mittelalterliche Kairo, das sich entlang der Nil-Ufer erstreckte, war eine der weltweit größten Städte. Sie wurde zur Trophäe für das arabische Kalifat und später Herrschaftsgebiet der osmanischen Sultane. Auch Napoleon kam hierher und wollte diese magische, mystische Region unterwerfen, blieb aber letztlich ohne Erfolg. Wie so viele andere Reiche hatte auch dieses, das sich über die Wüste und entlang der Flussufer erstreckte, Höhen und Tiefen erlebt und war am Ende größtenteils verblichen. Selbst der Bau des Suezkanals reichte nicht aus, um den Niedergang Ägyptens gänzlich in einen Aufschwung zu verkehren. Auch im 20. Jahrhundert blieb das Land ein Pfand größerer Mächte, diesmal als strategischer Preis im globalen Gerangel zwischen England und Frankreich.
Doch obwohl die Pracht des ägyptischen Reiches im Herbst des Kriegsjahrs 1943 längst verschwunden war, hatte es nichts von seiner atemberaubenden Rätselhaftigkeit eingebüßt. Ägypten war noch immer ein Land der Farbe, der überwältigenden Sonnenuntergänge und prächtiger tropischer Gärten, goldgelber Felder und einer Fülle von Blumen. Palmen wiegten sich im Wind, Esel zogen Karren und schleppten Bündel. Die Moscheen mit ihren Minaretten waren voll mit Gläubigen und die lebhaften Straßen ein Sammelsurium aus Kaffeebuden und üppigen Gewürzbasaren, durchzogen vom Rufen der Händler und den Fetzen politischer Gespräche. Kairo selbst war ein dicht bevölkertes Labyrinth, der Anblick von Schlangenbeschwörern und Fakiren war allgegenwärtig, ganz zu schweigen vom überwältigenden Duft des ägyptischen Alltags. Und in ihrem Umland blieb die reiche Vergangenheit stets präsent.
Im Südwesten der Stadt erhoben sich die berühmten Pyramiden wie antike Wolkenkratzer oder künstliche Berge über den Horizont. Jahrhundertelang hatten Muslime, Christen und Juden die Geschichte dieser gewaltigen steinernen Gipfel vergessen und sich stattdessen auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt: Es seien die uralten Getreidespeicher des biblischen Patriarchen Josef. Aber nicht alle teilten diese Ansicht. Mehr als ein Herrscher war überzeugt davon, dass die Pyramiden uralte Goldlager verbargen. Einmal hatte ein Kalif aus Bagdad seinen Truppen befohlen, die Cheops-Pyramide anzugreifen. Ein andermal erließ ein Herrscher ein Dekret zum Abriss der Pyramiden. Acht Monate lang mühten sich Bohrer und Steinmetze ab, jeden Tag einen oder zwei der riesigen Steinquader zu entfernen, gaben aber schließlich schon auf, als sie, wie ein Chronist schrieb, noch sehr „weit von dem entfernt waren, was sie sich vorgenommen hatten“. Fortan wurden die Pyramiden im Wesentlichen in Ruhe gelassen, aber nicht so der Sphinx. Als die Osmanen ihr ägyptisches Reich in die vermeintliche Obhut der Mameluken gaben, benutzten diese sein verletzliches Antlitz für Zielübungen.
Bei der Öffnung der Pyramiden im 19. Jahrhundert waren es dann in erster Linie westliche Abenteurer, welche die verbliebene Beute mitgehen ließen. Statuen, Mumien, Gemälde und antike Steine wurden in Kisten verpackt und von ägyptischen Häfen aus in die Hauptstädte Europas verfrachtet. Als endlich ein junger Winston Churchill eintraf, um die Pyramiden zu malen, waren ihre Geheimnisse bereits größtenteils entschlüsselt und ihre Schätze im Britischen Museum ausgestellt.
Unverändert geblieben waren hingegen das unwirtliche Gelände aus Treibsand und der weite Himmel. Des Nachts glänzten die großen Sterne hell, wie sie es seit Jahrtausenden taten. Dem antiken Mythos zufolge entsprach die hoch droben schimmernde Milchstraße einem „Nil am Himmel“, der toten Pharaonen den Weg ins Jenseits wies.
Wer allerdings im Jahr 1943 nach oben blickte und diesen Sternenpfad sah, dachte vermutlich nicht an uralte Legenden. Seit der Zweite Weltkrieg wütete, waren die Wege ins Jenseits überfüllt. Alle drei Sekunden wurde ein weiteres Menschenleben auf Erden ausgelöscht. Derweil waren in Kairo abermals massenhaft Menschen aus dem Westen eingetroffen.
Knapp über ein Jahr war es her, dass deutsche Verbände unter General Erwin Rommel das 240 Kilometer von Kairo entfernte El Alamein erreicht hatten, von wo aus sie vorhatten, den Suezkanal zu erobern und durch Britisch-Palästina nach Norden vorzurücken, um sich mit Einheiten der Wehrmacht, die von der Sowjetunion aus nach Süden vorstießen, zu vereinigen. Stattdessen hatte Englands General Bernard Montgomery sie in einer brutalen Schlacht gezwungen, sich in die relative Sicherheit Libyens und Tunesiens zurückzuziehen. Dies war der erste bedeutende Sieg der Alliierten über Deutschland und der erste Wendepunkt eines Krieges, der jetzt erneut nach Ägypten gekommen war.
An diesem Nachmittag näherte er sich dröhnend in Gestalt einer dunklen Auto-Karawane, die sich in Richtung Pyramiden und Sphinx schlängelte. Drinnen saßen die wichtigsten Protagonisten der alliierten Kriegsanstrengung: Admiräle, Generäle, Ärzte und die zwei Männer, in deren Händen das Schicksal der westlichen Demokratie lag – Winston S. Churchill und Franklin D. Roosevelt.
Es war der 23. November, und ein kühler Wind strich über die angedeuteten Wellen im Sand. Die Regierungschefs Großbritanniens und der Vereinigten Staaten besichtigten Sehenswürdigkeiten und gönnten sich eine Pause vom Kairoer Gipfel – für die Alliierten das erste und wichtigste von drei solcher Treffen in diesem Krieg. Der Ausflug zu den Pyramiden war eine Idee von Churchill gewesen, die er mit feurigem Blick und voller Wärme und Humor in seiner heiseren Stimme – er litt an einer Erkältung –, enthusiastisch verkündet hatte. Kaum hatte der Premierminister die Idee beim Tee in der Präsidenten-Villa zur Sprache gebracht, war Roosevelt so begeistert gewesen, dass er versuchte, aus seinem Stuhl aufzustehen – ein seltenes Versehen –, nur um schmerzlich festzustellen, als er die Griffe umfasste und seine Knöchel sich weiß verfärbten, dass er es nicht vermochte. „Mr. President“, insistierte ein hartnäckiger Churchill mit dröhnender Stimme, „Sie müssen einfach mitkommen und den Sphinx und die Pyramiden sehen. Ich habe alles arrangiert.“
Im letzten Moment wurde ein einheimischer Fremdenführer besorgt, um ihnen den Weg zu weisen. Sie fuhren bei Sonnenuntergang los, als die Temperatur schon fiel und die abendlichen Schatten länger wurden. Im Osten auf dem Plateau standen die drei Pyramiden, und im Westen lag ein königlicher Friedhof, der mehr als 4000 Mumien barg. Aber es war das Rätsel des Großen Sphinx mit seinem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Königs, das Roosevelt und Churchill am meisten faszinierte. Moderne Ägypter haben den Großen Sphinx von Gizeh Abu Hol getauft, was so viel bedeutet wie „Vater des Schreckens“, aber für jene, die ihn erbauten, war der Sphinx ein dauerhaftes Symbol der Güte, humorvoll und ehrfurchtgebietend. Während sie nun den Sphinx aus „jedem Blickwinkel“ musterten, sannen die beiden Männer über sein unergründliches Lächeln, seine fehlende Nase und seine rätselhaften Adlerschwingen nach. Dann folgten ihre Augen seinem selbstsicheren starren Blick über die trostlose Ebene von Gizeh und weit darüber hinaus. Was hatte er zu erzählen?, fragte sich Churchill.
Als die Sonne hinter den Pyramiden versank, wurden Roosevelt und Churchill, normalerweise die geistreichsten Plauderer, merkwürdig still. Koptische Mönche hatten den Wind, der auf dem Plateau wehte, einst die „Stimme der Ewigkeit“ genannt. Es war, als hätten Roosevelt und Churchill inmitten dieses schrecklichen Krieges, weit entfernt von den Schlachtfeldern Europas, Nordafrikas und des Pazifiks, ausgerechnet gemeinsam einen Ort des Innehaltens gefunden, an dem die Zeit stehengeblieben war.
Während die Minuten verstrichen, durchzog ein tröstliches Abendrot den Himmel – eine schmale, rosafarbene Linie über dem Horizont, die das Ende dieses Tages und die langsame Heraufkunft des nächsten anzeigte. Als Churchill seinen Blick vom Sphinx löste, verkündete er leise und mit Glückstränen in den Augen: „Ich liebe diesen Mann.“
Der stets charmante Roosevelt blinzelte bloß im schwächer werdenden Licht und gab nichts von sich preis. Er war in vielerlei Hinsicht ebenso undurchschaubar wie der Sphinx mit seinem verschlossenen und leidenschaftslosen Wesen. Daher war es äußerst passend, dass die Geschichtsschreibung diesen Gipfel später die „Sphinx-Konferenz“ taufte. In den Tagen und Monaten, die auf dieses Treffen folgten, sollte Roosevelt einige der folgenreichsten und schmerzlichsten Entscheidungen des gesamten Krieges treffen.1
Dieselbe Spätnovembersonne ging auch über Adolf Hitlers „Festung Europa“ unter. Und als die Dämmerung hereinbrach, stieg, knapp 1000 Kilometer nordöstlich von Berlin, von Luftwaffenstützpunkten in England ein tiefes Brummen zum Himmel auf. Stundenlang rollten Flugzeuge in Startposition, und Welle auf Welle alliierter Maschinen hob ab. Die Stimmen von Hunderten Piloten kamen krächzend über die Bordsprechanlagen, während Hunderte weiterer Flieger sich in ihre Cockpits setzten und ihre Drehzahlanzeiger prüften. Manche Besatzungsmitglieder gingen noch einmal rasch die Anweisungen im Falle eines Absturzes durch, während wieder andere Karten studierten. Die Bodencrews standen draußen, blickten in den halb dunklen Himmel hinauf und staunten darüber, wie viele Flugzeuge dort oben kreisten. 764 Maschinen hatten sich jetzt in der Luft versammelt und flogen in enger Formation davon.
Als die Flugzeuge an Höhe gewannen, gerieten sie in dichte Wolken – eine Armada aus 469 schweren Lancaster-Bombern, 234 Halifax- und 50 Stirling-Bombern, eskortiert von einem Juwel der Royal Air Force, elf erstaunlich schnellen Mosquitos, die beinahe zur Gänze aus leichtem Holz bestanden. Nach der Überquerung des Ärmelkanals flogen sie in niedriger Höhe, um dem deutschen Radar zu entkommen. Binnen 30 Minuten hatten sie die nördlichen Niederlande hinter sich gelassen und überflogen auf ihrem Weg tief in den deutschen Luftraum die Höhenzüge des Harzes. Sie wussten bereits, was sie erwartete. Der nächtliche Angriff vom 22./23. November war der zweite Einsatz und die vierte Nacht in der Schlacht um Berlin, einer konzertierten Luftoffensive aus 16 Angriffen auf das Nervenzentrum des NS-Staates, die verheerendsten Angriffe auf die deutsche Hauptstadt in diesem Krieg.
Berlin, die am stärksten geschützte Stadt des „Dritten Reiches“, schien wie eine undurchdringliche Festung. Sie verfügte über ein hochmodernes Netz aus Luftabwehrstellungen, darunter drei Flaktürme aus Beton. Zerplatzten die tödlichen Flakgranaten, schlitzten rasiermesserscharfe Splitter die Flugzeuge auf und schnitten durch ihre Unterseiten aus Aluminium wie heiße Messer durch Butter. Außerdem besaß Berlin einen Ring aus äußerst treffsicheren 8,8-cm-Flugabwehrkanonen und eine Kommandozentrale, die sich ausgerechnet im Zoologischen Garten befand. Flakscheinwerfer suchten den Himmel über der Hauptstadt ab, und lautstarke Rauchgeneratoren pusteten stinkende Schwaden in die Luft, um die Stadt während der Angriffszeiten zu verbergen. Sogar Tarnnetze waren zwischen Gebäuden aufgespannt, die es Piloten, Bord- und Bombenschützen erschwerten, einzelne Straßenzüge zu erkennen.
Doch dieser sorgfältigen Abwehrmaßnahmen zum Trotz hatte die deutsche Bevölkerung im Juli mit den konzentrierten amerikanischen und britischen Luftangriffen auf Hamburg jäh jedes Sicherheitsgefühl verloren. Diese Reihe von Bombardements hatte in der alten hansischen Hafenstadt, die Hitlers Tor zur Welt darstellte und deren Häuser größtenteils aus Holz bestanden, einen unersättlichen Feuersturm entfacht. Flammen züngelten an Mauern und Dächern empor und sprangen rasch von einem Häuserblock auf den nächsten über, wobei sie alles in ihrem Weg verzehrten. Eine Frau berichtete, ohne zu übertreiben, ganze Stadtteile seien „in ein Flammenmeer getaucht“ gewesen. Nach vier Tagen hatten die Alliierten etwa 43.000 Zivilisten getötet, und halb Hamburg lag in Schutt und Asche. Chaos war die Folge: Traumatisierte Flüchtlinge wurden über Berlin in die relative und – wie sich zeigen sollte – nur vorübergehende Sicherheit des Ostens geschickt, und es dauerte nicht lange, bis auch die Berliner unbedingt aus der Stadt heraus wollten, bevor die alliierten Bomber kamen. Die waren bereits am 18. November mit aller Macht aufgetaucht.
Dieses Mal machten die alliierten Verbände in einem Konvoi, der sich Kilometer über den Himmel erstreckte, Anstalten, ihre Angriffe auf die westlichen Bezirke der Stadt zu konzentrieren. Nachdem sie die nordeuropäische Tiefebene passiert hatten, schwenkten sie nach Nordosten um und flogen über die Wälder entlang der Elbe. Als sie etwa 80 Kilometer vor Berlin waren, hielten die Bomber wie üblich für den Überraschungseffekt Funkstille ein und fingen ruhig an, ihre Ziele auszusuchen. In einer Höhe von 10.000 Fuß, wo die Luft merklich dünn und eisig war, näherten sich die Lancaster den Außenbezirken der Stadt und schickten sich an, 7000 Pfund Bomben abzuwerfen. Die Bombenschächte wurden geöffnet, es folgte ein schrilles Pfeifen, als die Geschosse fielen, dann eine Serie donnernder Schläge, als sie ihre Ziele trafen, gefolgt von einer Fontäne in den Himmel spritzender Rauchpilze. Wie ein Bombenschütze später triumphierend erzählte, jubelte er, als sein Flugzeug seine explosive Fracht ausklinkte. „Dies“, stellte er fest, „war Hitlers Stadt!“
Unten am Boden erbebte die Metropole bis in ihre Grundfesten. Überall barsten und stürzten Mauern ein. Durch die Straßen flogen Ziegel und zerbrochenes Glas. Die Luft war lärmerfüllt von Türen, die aus ihren Angeln gerissen wurden, von klirrenden Fenstern und ganzen Bauwerken, die einstürzten, zerdrückt wie Papiertüten. Noch hoch oben blitzten die Explosionen so hell, dass die Cockpits der Bomber kurz von einem strahlenden, fast blendenden gelborangenen Licht erfüllt waren, als flögen die Piloten direkt in die Sonne, nur um sofort wieder von Dunkelheit umgeben zu sein. Als die Luftabwehrstellungen ihre Gegenangriffe starteten, mussten die alliierten Piloten durch feindlichen Artilleriebeschuss, allgegenwärtiges Flakfeuer, Explosionen vom Boden und dichten schwarzen Rauch fliegen. Mit jeder Minute, die der Angriff andauerte, stiegen die alliierten Verluste. Zahlreiche Besatzungsmitglieder, auch Piloten, wurden von der Flak und vom deutschen Maschinengewehrfeuer getroffen oder durch Erfrierungen behindert – manche hatten während des Kampfstresses in ihre Overalls uriniert, und in den ungeheizten Cockpits gefror die Flüssigkeit bei Temperaturen von häufig minus zehn Grad Celsius. Irgendwann schien das Geflecht des deutschen Flakfeuers am Himmel dicht genug zu sein, um darüber zu laufen. Daraus gab es für viele Flugzeuge kein Entkommen, sie verwandelten sich in Feuerbälle.
In der Stadt darunter waren die Berliner fassungslos über die schiere Wucht der Angriffe. In manchen Straßen loderten die Brände so hell, dass sie die Nacht zum Tag machten. Während der bläuliche Rauch aus den Fenstern getroffener Häuser nach oben quoll, fürchteten die Leute, lebendig begraben oder von den fallenden Bomben getötet zu werden, und fragten sich allmählich, ob wenigstens ihre sterblichen Überreste geborgen würden. Wer konnte, strebte hastig den öffentlichen Bunkern zu, die viele nicht erreichten. Während die Sirenen heulten und der Nachthimmel vom pausenlosen Luftabwehrfeuer erleuchtet wurde, suchten die Menschen sich in Sicherheit zu bringen, und in ihrer Verzweiflung schoben und drängelten und trampelten sie sich bald gegenseitig zu Tode.
Für die Berliner sollte es keine Ruhepause geben, denn unaufhörlich nahten weitere Flugzeuge. Die Angriffe und das Blutbad dauerten Stunden. Dabei konnten die Menschen hören, wie Flugzeuge und Bomben unheilvoll immer näher kamen, wie die Explosionen sich quer durch die Stadt fortpflanzten, jede ein bisschen lauter, ein bisschen näher und ein bisschen stärker als die voraufgegangene. „Überall brennt es“, schrieb ein Berliner verzweifelt, „ständig stürzen Ruinen ein.“ Selbst Propagandaminister Joseph Goebbels gestand in einem Tagebucheintrag vom 24. November: „Das Bild, das sich […] bietet, ist geradezu trostlos. Es brennt noch lodernd an allen Ecken und Enden.“ Verängstigte Bewohner taumelten durch die Straßen, die Gesichter in Schals gehüllt, während sie sich keuchend einen Weg zwischen eingestürzten Mauern, über zerbrochenes Glas und durch Wolken von Staub bahnten. Überall rauchten Trümmerhaufen, barsten Wasserleitungen und lagen Wracks von Straßenbahnen, alles war erfüllt von heißer Luft und dem Geruch nach Rauch und verkohlten Ziegeln, der Himmel war übersät von alliierten Flugzeugen.
Ganze Straßenzüge waren ausgelöscht. Das Diplomatenviertel brannte ab. Die Bahnhöfe erhielten schwere Treffer. Ebenso das Zeughaus und die Musikakademie. Der gesamte Bezirk Tiergarten mit seinen eleganten Villen und einem 210 Hektar großen Park wurde zerstört. Als der Rauch sich lichtete, umfasste die Liste der verwüsteten Ziele die Staatsoper, das Deutsche Theater, die Nationalgalerie, das Hotel Bristol, die Charité, das Städtische Krankenhaus, eine Entbindungsklinik und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Auch die iranische, italienische, französische und slowakische Botschaft waren betroffen, ebenso der Potsdamer Bahnhof. Am schmachvollsten für die Deutschen war die Tatsache, dass das Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion ebenso schwer beschädigt wurde wie die Kaserne der Kaiserlichen Garde. Manche Anwohner sahen in stummem Entsetzen zu, während andere hysterisch schoben und drängelten und sich in den Bunker auf dem Gelände des Zoologischen Gartens quetschten. Weitere Menschen schrien unterdessen auf den Bahnsteigen der S-Bahn oder in den Zügen oder irrten unter Schock einfach ziellos umher. Doch am schlimmsten getroffen wurden die Randbezirke. Der Anblick von Menschen, die lebendig begraben worden waren, von verkohlten, verkrusteten Körpern, geschrumpft auf die Größe kleiner Kinder, und von Leichen, die überall auf den Straßen herumlagen, war grässlich. Wie ein Schlachtfeld sähen die Straßen aus, stellte ein Gestapo-Beamter fest. Selbst der berühmte Zoologische Garten lag in Trümmern.
Für die Menschen am Boden blieben die Bombenangriffe fortan eine Tortur, ein unerträglicher Chor nächtlicher Explosionen, dem einzig das Prasseln der Brände entsprach. Alldieweil begann ein merkwürdiger „Regen“ zu fallen, schimmernde Stanniolstreifen, die langsam vom Himmel auf die Straßen herabschwebten. Die Alliierten warfen sie ab, um das deutsche Radar in die Irre zu führen. In dieser Situation boten selbst die Schutzräume nicht immer eine sichere Zuflucht. Ein erschrockener junger Anwohner beobachtete, wie die Decke seines Bunkers für einige Minuten in Zeitlupe zu beben, zu schwanken und zu wackeln begann, bis sie einstürzte. Er gehörte zu den wenigen, die lebend aus den Trümmern geborgen wurden.
In der ganzen Stadt dröhnten die Explosionen weiter, oftmals in Achterserien – irgendwann merkten auch die Berliner, dass jedes Flugzeug in seiner Bombenwiege acht Sprengkörper mitführte –, und wenn die alliierten Maschinen für den Heimflug nach Westen abdrehten, sahen die Besatzungen noch 20 Minuten lang den roten Feuerschein am Himmel über Berlin.
Ging am Morgen die Sonne auf, bot sich ein verheerender Anblick. Wegen der aus den brennenden Häusern aufsteigenden Rauchwolken konnten die Menschen kaum atmen. Verängstigte Bewohner taumelten durch die Straßen, stolperten über Scherben und Schutt, der allerorten unter den Füßen knirschte. Die Überreste Hunderttausender von Leben traten nun eindrücklich zutage: zerschmetterte Kronleuchter, Scherben von Vasen und Kristallschalen und Berge zerschlagenen Porzellans. Unterdessen loderten die Brände weiter, und der Himmel selbst hatte sich schmutziggelb verfärbt. Bei der Besichtigung der rauchenden Trümmer meinte Goebbels, man sehe nichts als Mauerreste und Schutt.
Am Ende der Woche war das Leben in Berlin zur Hölle auf Erden geworden. Fast eine halbe Million Deutsche war obdachlos, und etwa 10.000 waren verletzt. Die Toten wurden in Aulen und Turnhallen aufgebahrt, wo sie ihrer Identifizierung harrten. Allein in dieser einen Woche waren 4000 Menschen getötet worden. Nichtsdestotrotz gaben sich Hitlers strammste Anhänger unverzagt: In der ganzen Stadt setzten Nationalsozialisten kleine Fahnen und Hakenkreuze oben auf die Trümmer.
Während die Bombardierung der Reichshauptstadt durch die Alliierten Millionen von Bürgern im besetzten Europa, die vom skrupellosen NS-Regime drangsaliert wurden, neue Hoffnung machte, erschütterte sie den Glauben der Deutschen an die Fähigkeit ihres Staates, sie zu schützen. Hermann Göring, Hitlers designierter Nachfolger und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, hatte geschworen, dass nicht eine einzige feindliche Bombe auf den heiligen Boden der deutschen Hauptstadt fallen würde. Aber, wie ein amerikanischer General geprahlt hatte, „in 60 Sekunden [kann] die gesamte Anstrengung von 100 Jahren zerstört werden“. Mit einem Gefühl der Vorahnung fasste ein Berliner die Stimmung der Stadt nach der gnadenlosen Luftoffensive zusammen: „Wir sind unseren Feinden schutzlos ausgeliefert“, murmelte er.
Und während die alliierten Flugzeuge in die relative Sicherheit des britischen Luftraums zurückkehrten, hatten Roosevelt und Churchill natürlich weiterhin genau das im Sinn.2
Doch es gab auch jene, welche die Bomber noch nicht erreicht hatten, so verzweifelt sie auch warteten und so inständig sie um ihr Eintreffen baten. Sehnsüchtig blickten sie gen Himmel und fragten sich: Wann kommen die Alliierten?
Weit entfernt von den Schlachtfeldern und von der Diplomatie in Kairo, nur einen Tag bevor die Alliierten ihren Luftangriff auf Berlin starteten, schleppten sich mehr als 500 holländische Bürger an einem kleinen Hain mit kahlen Obstbäumen vorbei und begaben sich eine Rampe hinunter zu einem von Erdhügeln umschlossenen Raum. Einige schluchzten, aber von den meisten war nur ein leises Murmeln und das Geräusch erschöpft vorwärts stapfender Füße zu hören. Die Kleinsten wurden auf Hüften getragen oder von einem älteren Kind an die Hand genommen. Die Alten und Kranken bewegten sich langsam, mit schon zum Boden hin gebeugten Knochen. Unterwegs stießen rund 165 Polen zu ihnen. Die meisten hatten Angst, aber wovor genau, das wussten nur wenige.
Der Raum, der sie erwartete, war ungewöhnlich kalt. Die schweren Türen schlugen hinter ihnen zu. An den gescheuerten Wänden waren schwache Kratzspuren zu sehen.
Eine junge Polin fing laut an zu schreien: „Das deutsche Volk wird […] teuer bezahlen für unser Blut. Nieder mit Unzivilisiertheit und Grausamkeit in Gestalt von Hitlers Deutschland!“ Beinahe gleichzeitig knieten die Polen sich auf den Boden, fassten einander an den Händen und fingen an zu beten. Dann ertönte ein anderes Geräusch – Gesang. Es war haTikwa („die Hoffnung“), die informelle Nationalhymne des jüdischen Volkes. „Solange ist unsere Hoffnung nicht verloren/zu sein ein freies Volk, in unserem Land“, sangen die Holländer. Dann fielen die Polen ein, fanden einen passenden Refrain. „Noch ist Polen nicht verloren“, sangen sie, die Worte ihrer eigenen Nationalhymne. Hunderte von Stimmen schwollen im Innern dieses einen Raumes an: „Solange ist unsere Hoffnung … nicht verloren.“
Unmittelbar jenseits der Wände war das Rumpeln ankommender Lastwagen zu hören. Sie waren mit dem Symbol des Roten Kreuzes markiert, dem universellen Zeichen der Hilfe für die Kranken, die Verwundeten, die Verschleppten und die Vertriebenen. Aber es sollte nicht sein. Während die nackten Kinder zitterten – 166 von ihnen befanden sich jetzt im Raum –, erreichte der Gesang einen Höhepunkt. Draußen auf dem harten Untergrund stehend, begannen die Wachen hastig, Dosen von den Rotkreuz-Lastern zu laden. Derweil klappten SS-Männer seelenruhig ein Guckloch auf.
Auf dem Dach oben klimperte etwas. Das Gas fing an, nach unten zu strömen, und das Schreien hob an.
So sah sie aus, die westliche Welt an der Wende zum Jahr 1944, dem Jahr der Entscheidung. Es war diese Welt, die Franklin D. Roosevelt und die Alliierten zu retten versuchten, als die drei Großmächte – die USA, die Sowjetunion und Großbritannien – zum ersten Mal für dreieinhalb spannungsgeladene Tage in Teheran zusammenkamen.3