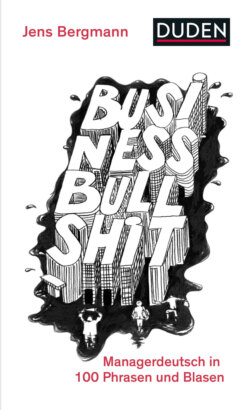Читать книгу Business Bullshit - Jens Bergmann - Страница 6
ОглавлениеBUSINESS BULLSHIT
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
»Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.«
Karl Kraus, »Die Fackel«, 19251
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein fasste »den ganzen Sinn« seines berühmten, 1921 erschienenen Werks »Tractatus logico-philosophicus« im Vorwort so zusammen: »Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.«2 Bedauerlicherweise war Wittgensteins Mission kein Erfolg beschieden; Abermillionen Menschen verstoßen tagtäglich gegen sein Gebot. Noch nie waren so viele Worthülsen im Umlauf wie heute – so viele nebulöse Schlagworte (neudeutsch: Buzzwords) und Plastikwörter3, die alles und nichts bedeuten können.
Im Englischen gibt es eine treffende Bezeichnung für diese Art von Sprachmüll: Bullshit. Wir haben im Deutschen keinen ähnlich starken Ausdruck. Blödsinn, Quatsch oder Humbug treffen es nur ungefähr. Geprägt haben den Begriff britische Soldaten im Ersten Weltkrieg, um sich über Befehle ihrer Offiziere lustig zu machen, die großen Wert auf Äußerlichkeiten wie perfekt sitzende Uniformen und auf Hochglanz gewienerte Schuhe legten – selbst wenn derartiger Drill von überlebenswichtigem militärischem Training abhielt. Damit werden zwei wesentliche Eigenschaften von Bullshit deutlich: Er ist sinnentleert und irreführend.
Während des Zweiten Weltkriegs nannten Angehörige der neuseeländischen Luftwaffe ihr Hauptquartier »Bullshit Castle« – eine Bezeichnung, die Jahrzehnte später der Daimler-Chef Jürgen Schrempp für die von seinem Vorgänger errichtete ungeliebte Konzernzentrale in Stuttgart-Möhringen verwenden sollte. Großunternehmen waren denn auch die entscheidenden Institutionen, in denen sich Bullshit als »soziale Praxis« durchsetzte, wie der Organisationsforscher André Spicer schreibt.4 »Während des 19. Jahrhunderts entwickelten wir Systeme für Massenproduktion, Distribution und Konsumtion von Gütern. Im 20. Jahrhundert wurden auch Dienstleistungen industrialisiert. Im 21. Jahrhundert ist Bullshit industrialisiert worden.«5
Für die Wissenschaft ist Bullshitologie ein relativ neues Forschungsgebiet. Zu den Pionieren zählt der US-amerikanische Philosoph Harry G. Frankfurt. Er vergleicht Bullshit in seinem 1986 im Original erschienenen gleichnamigen Essay mit »achtlos hergestellten, minderwertigen Produkten«6 und sieht in der »fehlenden Verbindung zur Wahrheit – in dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, wie die Dinge wirklich sind – (…) das Wesen des Bullshits«.7 Bei dieser Definition fällt einem unweigerlich Donald Trump ein, der US-Präsident, der so viel Unsinn verbreitet hat wie kein anderer Staatsmann vor ihm. Es ist bezeichnend, dass Trumps unglaubliche Karriere maßgeblich auf seine Rolle als großspurig auftretender Unternehmer in einer Fernseh-Reality-Show zurückgeht (»The Apprentice«), in der er live Leute feuern durfte – nachdem er mit seinen eigenen Immobilien-Deals eine Reihe spektakulärer Pleiten hingelegt hatte.8
Bullshit hat zwar kaum Substanz – so wie Exkremente, denen fast alle Nährstoffe entzogen sind –, aber zahlreiche Funktionen, die ihn nützlich und attraktiv erscheinen lassen. Bullshit …
• hilft dabei, sich wichtig zu machen: Hört her, ich habe den Durchblick, behauptet der Bullshitter. Weil häufig niemand die Mühe auf sich nimmt, nachzufragen oder zu widersprechen, kommt er mit dem Bluff durch.
• ist lukrativ. Zahllose Berater, Coaches, Speaker, Gurus und Jungunternehmer sind im Bullshit-Business tätig. So kam die Risikokapitalfirma MMM Ventures bei einer Analyse von 2830 europäischen → Start-ups – deren Geschäft auf → künstlicher Intelligenz beruhen sollte – zu dem Ergebnis, dass rund 40 Prozent dieser Firmen keine Technik anwenden, die diese Bezeichnung annähernd verdient.9 Großen Erfolg beim Handel mit leeren Worten hat laut Jeffrey Pfeffer, Organisationsexperte an der Stanford Graduate School of Business, die »Leadership Industry«. Damit sind Seminare, Workshops, Trainings und Konferenzen gemeint, die Managern Führungskompetenz vermitteln sollen. Allein in den USA geben Unternehmen dafür jährlich rund 25 Millionen Dollar aus. Die Leadership Industry hat für ihre Kundschaft ein Standardrezept parat, das sich so zusammenfassen lässt: »Seien Sie vertrauenswürdig und authentisch, dienen Sie anderen (besonders denen, die für Sie und mit Ihnen arbeiten), seien Sie bescheiden und zeigen Sie einfühlsames Verständnis und emotionale Intelligenz.«10 Doch dummerweise taugen diese Ratschläge nichts, so Pfeffer. Denn sie beruhen auf einer idealen Unternehmenswelt, nicht auf der realen. So klinge etwa Authentizität – also der Ausdruck wahrer Gefühle – gut, sei aber für Führungskräfte kontraproduktiv. Sie müssten vielmehr auf die Anforderungen der jeweiligen Situation und die Menschen in ihrer Umgebung eingehen: »Jeder von uns spielt eine Reihe unterschiedlicher Rollen in seinem Leben, und die Menschen verhalten sich in jeder dieser Rollen anders und denken anders. Daher hat es keinen Sinn, Authentizität zu fordern.«11 Dass von den entsprechenden Anbietern so viel »Leadership Bullshit«12 verbreitet wird, liegt laut Pfeffer auch am Qualifikationsprofil der meisten Berater, Speaker und Coaches. Diese haben entweder nie wirklich eine Führungsposition innegehabt, waren als Chefs erfolglos oder aber geben Tipps, die im Widerspruch zu ihrer früheren Praxis als Manager stehen.
• stärkt das Gruppengefühl durch leeres Gerede. Die Verwendung bestimmter Modebegriffe signalisiert Zugehörigkeit zum Kreis jener Eingeweihten, die wissen, was gerade angesagt ist. Wer das entsprechende Vokabular nicht benutzt, kennt oder gar aus guten Gründen ablehnt, bleibt außen vor.
• ist konsensfähig. Da die Bedeutung der einschlägigen Buzzwords nebulös bleibt, können sich viele darauf einigen. Diese »unklärbare Unklarheit«13, so der Sozialphilosoph Gerald A. Cohen, immunisiert Bullshit auch gegen Einwände – es ist schwierig, einen Pudding an die Wand zu nageln.
• hilft dabei, Geschäftigkeit vorzutäuschen. In der heutigen Arbeitswelt ist rastlose Aktivität angesagt. Offenkundiger Leerlauf, gründliches Nachdenken ohne powerpoint-taugliches Ergebnis oder gar Mußestunden sind verdächtig. Die Produktion, Konsumtion und Distribution von Business Bullshit sind probate Mittel, um busy zu erscheinen.
• ist leicht zugänglich. Das gilt auch für Begriffe technischen oder wissenschaftlichen Ursprungs wie zum Beispiel → Lernkurve, → Quantensprung, → künstliche Intelligenz, → Big Data oder Blockchain – denn den Hintergrund und die eigentliche Bedeutung muss nicht kennen, wer mitreden will. Im Gegenteil: Ein tieferes Verständnis solcher Begriffe könnte irritieren; nachplappern genügt.
• entlastet. Wer Moden folgt, ist auf der sicheren Seite. Das gilt für neue Kleider wie für leere Worte.
• lässt sich leicht in die Welt setzen. Die Widerlegung von Bullshit ist dagegen viel aufwendiger, weshalb sie oft unterbleibt.
• eignet sich dazu, die eigene Position zu stärken oder zu verteidigen. Führungskräfte wenden bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit für diese Zwecke auf – und greifen dabei gern auf einschlägiges Vokabular zurück.
• stärkt die »Inkompetenzkompensationskompetenz«, ein Begriff, den der Philosoph Odo Marquard prägte.14 In Organisationen neigt man nach wie vor zu Beförderungen nach dem Peter-Prinzip, also dem Aufstieg trotz Unfähigkeit. Dies ist einer der Gründe, weswegen viele Führungskräfte mit ihrem Job überfordert sind, auch in kommunikativer Hinsicht. »Bullshit ist immer dann unvermeidbar«, schreibt Harry G. Frankfurt, »wenn die Umstände Menschen dazu zwingen, über Dinge zu reden, von denen sie nichts verstehen.«15
• sorgt für vermeintlichen Durchblick und spendet Trost in einer komplexen, undurchsichtigen Welt nach dem Prinzip: Orientierung durch Desorientierung.
• lässt alte Ideen wie neu erscheinen, Oberflächliches tiefgründig, Unsinn bedeutsam.
• klingt oft angenehm, beruhigend, vielversprechend: → gut aufgestellt, → Work-Life-Balance,→ am Ende des Tages, → ich bin ganz bei Ihnen.
• erlaubt es, wortreich nichts zu sagen, Unschönes zu beschönigen oder über den Widerspruch zwischen Schein und Sein hinwegzutäuschen.
• ist unverbindlich und wird eher toleriert als offensichtliche Lügen.
Bullshit ist allgegenwärtig und verführerisch: Politiker nutzen Bullshit ebenso wie Managerinnen, ehrgeizige Angestellte, Verbandsfunktionäre, Kirchenleute, Journalisten, Sportlerinnen, Künstler, Wissenschaftlerinnen und Intellektuelle. Wir alle tun es. Dank des weltweiten digitalen Netzes und der sogenannten sozialen Medien war es zudem noch nie so leicht wie heute, jedweden Unfug maximal zu verbreiten.
Eine gesellschaftliche Kraft nimmt bei der Herstellung, Verarbeitung und Verbreitung allerdings eine besondere Rolle ein: die Wirtschaft. Unternehmen sind so etwas wie die Superspreader von Bullshit. Das mag verwundern, gelten Firmen doch als der Effizienz und dem nüchternen Kalkül verpflichtet. Doch das ist erstens ein Mythos, und zweitens gibt es gute Gründe dafür, dass die Wirtschaft so viel Sprachmüll produziert.
Image und Ich: die Tücken der Inszenierung
Werbung gehört seit je zur Ökonomie, denn wer seine Produkte verkaufen will, muss sie anpreisen. Das gilt für Aale-Dieter auf dem Hamburger Fischmarkt genauso wie für multinationale Konzerne auf dem Weltmarkt. Reklame ist ein gigantisches Geschäft. Die globalen Ausgaben dafür lagen laut der Mediaagentur Zenithmedia im Jahr 2018 bei rund 613 Milliarden US-Dollar. Seit 2010 sind sie im Schnitt um 5,9 Prozent jährlich gestiegen – und damit deutlich stärker als das weltweite reale Bruttoinlandsprodukt. Um im allgemeinen Dauerrauschen Aufmerksamkeit zu erreichen, müssen Firmen immer größere Anstrengungen unternehmen.
Mit der Wahrheit hat es die Werbung noch nie so genau genommen. Sie will Lust auf Konsum zu machen, indem sie profane Produkte mit Bedeutung auflädt, ein besseres Leben oder zumindest Distinktionsgewinne verspricht, wie der legendäre Sparkassen-Werbespot aus dem Jahr 1995, in dem der Protagonist einen Angeber – dank einer sogenannten Schlauer-Anlegen-Beratung – mit seinen Besitztümern übertrumpfen kann: »Mein Haus – mein Auto – mein Boot«. Informative Produktwerbung, nicht zu verwechseln mit dem → Content Marketing, ist in Zeiten austauschbarer Produkte die Ausnahme. Ebenso rar ist unterhaltsame Reklame. Stattdessen dominiert aus Mangel an Substanz und Originalität – Bullshit.
Besonders humbughaltig ist sogenannte Imagewerbung. Unternehmen und andere Organisationen belassen es nicht dabei, einfach nur ihre Waren und Dienstleistungen ins beste Licht zu rücken. Sie wollen als Ganzes glänzen. Mit dieser Aufgabe beschäftigen sich in Kommunikationsabteilungen, Werbe- und PR-Agenturen deutlich mehr Personen (mit erheblich höheren Budgets) als in Presse, Funk, Fernsehen und Online-Medien. Die meisten größeren Firmen verwenden viel Mühe auf das Aufhübschen ihrer Fassade beziehungsweise ihrer »Schauseite«, so der Soziologe und Organisationsforscher Stefan Kühl. Allerdings ist eine einigermaßen glaubwürdige öffentliche Inszenierung eine Kunst, die nur wenige beherrschen. Als Faustregel kann gelten, dass der Widerspruch zwischen Schein und Sein nicht allzu groß sein sollte. Friedrich Nietzsche drückte es so aus: »Blas dich nicht auf: Sonst bringet dich zum Platzen schon ein kleiner Stich.«16
Etliche Manager sehen das erstaunlicherweise anders. Das krasseste Beispiel lieferte der Ölkonzern BP, der sich Ende der 1990er-Jahre um ein neues Bild in der Öffentlichkeit bemühte. Zunächst wurde das Logo verändert, das nun weniger technisch, dafür mehr wie eine freundliche grüngelbe Sonne aussah. Dazu kam ein neuer Slogan: BP sollte nun nicht mehr für British Petroleum stehen, sondern für Beyond Petroleum (»jenseits des Erdöls«). Mit einer schätzungsweise 200 Millionen US-Dollar teuren Kampagne stellte man sich als Firma dar, die mit Riesenschritten in eine grüne Zukunft aufbrach. Das stimmte allerdings nicht. Der Konzern investierte, gemessen am Umsatz, nur lächerliche Summen in erneuerbare Energien und betrieb sein traditionelles Geschäft ohne Rücksicht auf Mensch und Natur weiter – was etliche Skandale nach sich zog. Der Tiefpunkt war im April 2010 erreicht, als die Ölplattform »Deepwater Horizon« im Golf von Mexiko explodierte. Elf Arbeiter starben, 85 Tage lang floss Öl ungebremst ins Meer. Das Desaster kostete den Konzern laut der britischen Tageszeitung The Guardian 65 Milliarden US-Dollar für Säuberungsarbeiten, Kompensations- und Strafzahlungen. Immerhin hat sich der Slogan Beyond Petroleum seitdem erledigt.
Dass Unternehmen anfällig für Kommunikationsunfälle sind, liegt auch an ihrem Führungspersonal. An der Spitze von Firmen stehen meist äußerst selbstbewusste Betriebswirte, Juristen oder Ingenieure, deren kausales Denken sich nur schwer mit der Sphäre der öffentlichen Kommunikation verträgt, wo ganz andere Regeln gelten und Emotionalität eine große Rolle spielt. Aus dieser Gemengelage ergibt sich folgende Formel:
Kommunikatives Unvermögen x (starkes Sendungsbewusstsein + hohe finanzielle Schlagkraft) = großer Bullshit-Ausstoß.
Die vermehrten Investitionen ins Image sind nicht zuletzt Reaktionen auf höhere gesellschaftliche Erwartungen an die Wirtschaft. Diese Ansprüche werden von den Unternehmen – jedenfalls rhetorisch – aufgegriffen, auch um strengere staatliche Regulierung abzuwehren. Mittlerweile gibt es in fast allen Großunternehmen Abteilungen für → Compliance (regelkonformes Verhalten), → Corporate Social Responsibility (gesellschaftliche Verantwortung), → Nachhaltigkeit und Diversity (Vielfalt in der Belegschaft), deren mehr oder weniger segensreiche Tätigkeiten in umfangreichen Berichten dokumentiert werden. Zudem lassen sich Firmen gern als ökologisch und sozial korrekt sowie als vorbildliche Arbeitgeber von entsprechenden Anbietern zertifizieren, um der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass sie nur Gutes im Schilde führen. »Dem Betrachter«, sagt der Organisationsforscher Kühl, werde ein stimmiges und harmonisches Gesamtkunstwerk präsentiert, »während im Inneren der Organisation improvisiert, gestritten und nicht selten auch gepfuscht wird«.17
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der entsprechenden Unternehmen wissen am besten, dass zwischen Schauseite und Realität eine gewaltige Lücke klafft – ganz wie in den besten Familien. Nach außen hin herrscht Friede, Freude, Eierkuchen, intern fliegen die Fetzen. Allerdings – dies markiert eine weitere Eskalationsstufe des Impression Management – werden solche Fassaden oder die sprichwörtlichen Potemkinschen Dörfer mittlerweile auch für die Belegschaften errichtet. Zum Beispiel in Form von Unternehmensleitbildern, -werten oder -kulturen, mit denen sich alle Mitarbeiter im Betrieb beschäftigen und zu denen sie sich bekennen sollen. Als Zweck (neudeutsch → Purpose genannt) moderner unternehmerischer Tätigkeit gilt heute nicht mehr die Steigerung des Shareholder Value (vulgo: Gewinnmaximierung), sondern ein → positiver Beitrag zur Gesellschaft – ohne die nach wie vor geltenden Spielregeln des Kapitalismus infrage zu stellen. Bei → Start-ups gehört die Mission Weltverbesserung zum rhetorischen Standardprogramm.
Diese neuen Anforderungen und Ansprüche machen Unternehmen zu einer idealen Bühne für Blender und Schwätzer, vor allem in Vorgesetztenpositionen. Zwischen ihnen und ihrem unfreiwilligen Publikum gilt ein unausgesprochener Deal: Der Chef tut so, als habe er etwas zu sagen, seine Untergebenen tun so, als hörten sie ihm zu. Mitarbeiter, die ihren Verstand ungern beim Pförtner abgeben, sind von solchem Firmentheater eher unangenehm berührt.
Die Überfrachtung des Wirtschaftslebens mit unrealistischen Ansprüchen spiegelt sich nicht zuletzt in den Stellenanzeigen wider. Darin schmücken Unternehmen auch anspruchslose Jobs in den schönsten Farben aus. Umgekehrt warten die Aspiranten mit dem gesamten Arsenal der heute gewünschten Social Skills auf: von → Teamfähigkeit über → Kreativität bis hin zur → Resilienz. Wer solche Blasen und Phrasen ernst nimmt, ist selbst schuld. Das gilt generell für Business Bullshit.
Der Elefant im Raum: das Unbehagen in der Organisation
Qualifizierte Angestellte genießen heute viele Freiheiten. Die Hierarchien sind häufig flacher, die Entscheidungsspielräume größer geworden. In den meisten Firmen gibt es keine strengen Kleidervorschriften mehr, man duzt Kollegen und Vorgesetze, kann – zumal nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie – daheim arbeiten und dem → CEO auf Twitter folgen.18 Der Mitarbeiter darf mehr Mensch sein als früher, zahlt dafür aber einen Preis. Die psychischen Anforderungen sind höher, die Kommunikation nimmt mehr Raum ein als früher, Zwischentöne und Zwischenmenschliches spielen eine größere Rolle. Nach der beruflichen Funktion rückt nunmehr die Person ins Zentrum des Interesses, was mancher als anstrengend oder übergriffig empfindet.
Zudem ist der oder die moderne Angestellte mit paradoxen Anforderungen konfrontiert. So soll er oder sie → kreativ sein – allerdings nur im vorgegebenen Rahmen. Man soll sich als → Intrapreneur, also wie ein Unternehmer im Unternehmen, für den Betrieb einsetzen – obwohl dazu die notwendigen Mittel fehlen und ohne die entsprechende Entlohnung. Angestellte sollen sich mit der ganzen Persönlichkeit in die Firma einbringen – aber die betrieblichen Abläufe möglichst nicht mit Privatangelegenheiten stören. Diese Widersprüche verstärken eine Empfindung, die Torsten Meiffert, Trainer und Coach für Führungskräfte, in Anlehnung an Sigmund Freud als »Unbehagen in der Organisation« bezeichnet. Es resultiere daraus, »dass unsere Persönlichkeit nie mit der Rolle, die wir in Organisationen einnehmen, zusammenfällt«.19
Denn Unternehmen, so freundlich sie sich auch geben mögen, verfolgen Ziele, denen sich ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterordnen müssen. Bei Berufsanfängern lässt sich beobachten, wie hoch diese Anpassungsleistung ist. Jeder und jede Erwerbstätige weiß zudem, dass im Alltag viele Aufgaben anfallen, die wenig Freude bereiten: Routinetätigkeiten, Fehlersuche, Auseinandersetzungen mit Kollegen, Vorgesetzen oder Kunden, Mehrarbeit, sobald irgendwo ein Problem auftritt. Auch kann die Erfahrung kränken, dass es im genuinen Interesse von Unternehmen ist, jeden Mitarbeiter jederzeit ersetzen zu können. Nicht zuletzt wären da noch die Zumutungen der Zwangsgemeinschaft: Um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, verbringen wir viel Zeit mit Menschen, die wir uns nicht freiwillig ausgesucht hätten. Man muss, wie in einer Familie, miteinander klarkommen und zudem noch gemeinsam etwas schaffen.
Das Unbehagen in der Organisation war früher Allgemeingut, gern auch in gereimter Form: »Wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt.« Erwerbstätigkeit galt als notwendiges Übel, wenn nicht als Fron. Nur wenige Menschen hatten den Eindruck, sich beruflich verwirklichen zu können. In der postindustriellen Gesellschaft wird dagegen unisono das Idealbild des Genussarbeiters➤ beschworen, der jeden Tag beschwingt ans Werk geht, Kunden, Kollegen und Vorgesetzte glücklich macht, die Menschheit insgesamt voranbringt und sich im Laufe seiner Karriere immer weiter selbst vervollkommnet.
Je stärker Arbeit idealisiert wird, desto größer die Enttäuschung. Und desto intensiver werden die Anstrengungen des Managements, dieses Unbehagen zu tabuisieren, so Meiffert: »Es darf und soll nicht an die Oberfläche kommen, aus Angst, mehr Verunsicherung zu erzeugen als abzubauen.«20 Aus diesem Grund verwenden Führungskräfte und ihre für die Kommunikation zuständigen Mitarbeiter heute viel Energie darauf, gebetsmühlenartig allerlei Fabeln zu verbreiten, die das jeweilige Unternehmen als harmonische Großfamilie erscheinen lassen. Zu solchen Mythen zählt der Arbeits- und Betriebspsychologe Wolfgang Grunwald unter anderem:
• »Es wird nur nach sach-rationalen Kriterien entschieden.
• Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden gleich behandelt und haben die gleichen Chancen.
• Das Topmanagement hat aufgrund seines hervorragenden Wissens und seiner exzellenten Fähigkeiten den Überblick und somit alles im Griff.
• Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Kapital und der Gewinn.
• Es gibt eine Unternehmensstrategie, und sie ist allen Mitarbeitern bekannt.
• Mitarbeiter der zweiten und dritten Führungsebene können bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen mitentscheiden.
• Es gibt keine ›Seilschaften‹; alle wichtigen Entscheidungen werden transparent getroffen.
• Managemententscheidungen sind rational und strategisch fundiert; es gibt kein muddling through und keinen Versuch und Irrtum.«21
Die Psychologisierung der Arbeit
Frederick Winslow Taylor (1856–1915) setzte vor mehr als 100 Jahren die später nach ihm benannte wissenschaftliche Betriebsführung durch. Führungskräfte sollten ihre Untergebenen nicht mehr aus dem Bauch heraus anleiten, sondern – so der Titel seines programmatischen Werks – nach den Prinzipien des Scientific Management. Darunter verstand der Maschinenbauingenieur Taylor die Zerlegung der Arbeitsabläufe in kleinste Einheiten, sodass die Beschäftigten sie ohne geistige Anstrengung in ständiger Wiederholung so effizient wie möglich erledigen konnten. Was wie in welcher Zeit zu schaffen war, ermittelten die Vorgesetzten und machten entsprechende Ansagen.
Der Taylorismus setzte sich mit der Fließbandfertigung weithin durch, stieß aber auf zum Teil erbitterten Widerstand der Arbeiter und erwies sich für viele Unternehmen als weniger profitabel als gedacht. Denn Menschen mögen es nicht, wie willenlose Roboter behandelt zu werden. Außerdem wurden die Leistungsvorgaben häufig so manipuliert, dass sie kaum zu schaffen waren. Durch die strikte Trennung von Kopf- und Handarbeit ignorierte man zudem wertvolles Erfahrungswissen der Beschäftigten.
Gefragt waren daher subtilere Anreizsysteme und Formen der Kontrolle. Dazu bot sich die damals noch relativ junge Disziplin Psychologie an mit ihren zentralen Versprechen, Menschen in den Kopf schauen und sie in die gewünschte Richtung lenken zu können. Neben der Psychotechnik – etwa Auswahlverfahren zur Berufseignung – hielten bereits in den 1930er-Jahren therapeutische Praktiken Einzug in Unternehmen. So bemühten sich psychologisch geschulte Wissenschaftler und Berater, durch Teambuildingmaßnahmen die Laune der Beschäftigten zu heben – und damit die Produktivität zu steigern (siehe Kapitel 5).
Einen Schub erhielt diese Entwicklung durch den Psychoboom der 1970er-Jahre. Er begann in den USA – wo es Ende der 1960er-Jahre bereits 200 therapeutische Schulen gab – und erfasste bald die gesamte westliche Welt. Fast alle dieser Schulen grenzten sich von der akademischen Psychologie ab. Es entstand ein neuer, weitgehend unregulierter Markt mit Angeboten zur Selbsterfahrung und -optimierung mit fließendem Übergang zur Esoterik. Der Psychoboom erreichte mit einiger Verzögerung auch die Firmen, vor allem die Personalabteilungen.22
Psychologische Begriffe und Techniken wie → Coaching, → Achtsamkeits- und → Resilienztraining sind heute fester Bestandteil der Wirtschaftswelt. In vielen Firmen erinnern Rituale und Sprache frappierend an Selbsterfahrungsgruppen der 1960er- und 1970er-Jahre. Für die Unternehmen hat die Psychologisierung der Arbeit eine wichtige Funktion: Sie soll die Organisation vor tiefergehenden Fragen schützen, die an ihre Substanz gehen könnten. Aus diesem Grund werden sowohl die Probleme als auch die Lösungen stets im Individuum verortet.
Interessanterweise kommen in Unternehmen sowohl als seriös geltende psychologische Tests, Konzepte und Praktiken zum Einsatz als auch unseriöse wie beispielsweise das sogenannte → Neuro-linguistische Programmieren. Es scheint sogar, als seien Scharlatanerien besonders attraktiv fürs Management.
Welche Folgen das haben kann, schildert der Organisationsforscher André Spicer in seinem Buch »Bullshit Business«23 anhand eines bemerkenswerten historischen Falls. Aus der Zerschlagung des US-Telefonmonopolisten AT&T im Jahr 1984 waren etliche »Baby Bells« genannte Unternehmen hervorgegangen, unter anderem Pacific Bell in Kalifornien. Das dortige Management sollte die Firma nun konkurrenzfähig machen, sah sie dafür aber noch nicht ausreichend gewappnet. Einen entscheidenden Schwachpunkt erkannte die Führung in der nicht mehr zeitgemäßen Unternehmenskultur: Die Beschäftigten dächten nicht gewinnorientiert, agierten nicht wie → Intrapreneure.
Um das zu ändern, wurde mit Charles Krone ein Spezialist für Organisationsentwicklung angeheuert. Er sollte das → Mindset der rund 70 000 Beschäftigten einer Generalüberholung unterziehen. Krone war ein Anhänger des russischen Esoterikers Georges Gurdjieff, der eine radikale Kritik am modernen Menschen und dessen psychischer Verfassung formuliert hatte. Ihm zufolge sind wir willenlose Geschöpfe, die, Schlafwandlern gleich, durchs Leben taumeln. Um uns aus diesem Zustand zu befreien, müssen wir an uns selbst arbeiten und einen höheren Bewusstseinszustand erreichen.
Dieses Konzept übertrug Krone auf die Beschäftigten von Pacific Bell, die sich dank seines »Kroning« genannten, groß angelegten Trainingsprogramms von alten Automatismen lösen und zu neuen Ufern aufbrechen sollten. Ein wesentlicher Bestandteil war eine von den Teilnehmern bald »Kronese« genannte Sprache mit bis dato unüblichen Begriffen wie alignment (das Einschwören der Mitarbeiter auf die Unternehmensziele), end state vision (Idealvorstellung für die Zeit nach dem → Change-Prozess), paths forward (»Wege in die Zukunft«) oder purposefulness (bewusstes Verfolgen von Zielen).
Charles Krone und sein Team rüttelten das Unternehmen ordentlich durch. Manch einer fand den Neuanfang spannend, aber es zeigten sich bald auch Nebenwirkungen. So führte der hermetische Jargon dazu, dass man Außenstehenden nicht mehr vermitteln konnte, was bei Pacific Bell eigentlich vor sich ging. Zudem fraßen die zahlreichen → Meetings sehr viel Zeit. Und obwohl das Trainingsprogramm »in eine New-Age-Sprache der psychischen Befreiung verpackt war, wurde es mit den Drohungen eines autoritären Konzerns durchgesetzt«, schreibt Spicer. »Viele Angestellte verspürten unangemessenen Druck, sich an dem Programm zu beteiligen.«24 Wer sich darüber beschwerte, Kritik übte oder sich weigerte mitzumachen, bekam Ärger.
Für Pacific Bell erwies sich Kronings Programm als teurer Ausflug: Die Firma gab allein in einem Jahr rund 40 Millionen US-Dollar für die psychologische Runderneuerung aus. Diese enormen Kosten, der sonderbare New-Age-Ton und das autoritäre Gehabe führten zu einer Untersuchung durch die kalifornische Kommission für öffentliche Versorgungsbetriebe und zur Beendigung des Programms. Pacific Bell verlegte sich wieder auf konventionelle Methoden der Organisationsentwicklung.
Kroning war gescheitert, Kronese aber triumphierte. Die oben genannten Phrasen wie end state vision und purposefulness seien heute Paradebeispiele für »die leere Sprache, die in E-Mails und Konferenzräumen von Unternehmen, Behörden und Nichtregierungsorganisationen zirkuliert«, so Spicer.25 Tatsächlich habe sich der von Charles Krone früh propagierte, unverständliche Managementjargon weithin durchgesetzt.
Es gab allerdings auch eine erfreuliche Nebenwirkung: Einer der Mitarbeiter von Pacfic Bell zu Zeiten von Kroning war Scott Adams. Er entwickelte dort während endloser → Meetings die Comic-Figur Dilbert, die unter dem alltäglichen Wahnsinn des Büroalltags leidet – und in der sich Millionen Fans der Cartoons bis heute wiedererkennen.
Der heißeste Scheiß: Managementmoden
»Die Mode ist des Kapitalismus liebstes Kind: Sie ist aus seinem innersten Wesen heraus entsprungen und bringt seine Eigenart zum Ausdruck wie wenig andere Phänomene des sozialen Lebens unserer Zeit.«26 Das schrieb der Soziologe und Volkswirt Werner Sombart vor mehr als 100 Jahren, und es gilt nach wie vor. Rasch wechselnde Trends, Vorlieben und Geschmäcker befeuern den Konsum, weil durch sie an sich noch brauchbare Dinge plötzlich gestrig aussehen und Neues her muss – wer will schon altmodisch wirken? Mit Moden lässt sich zudem ein »fiktiver Vorsprung«27 vortäuschen, wo ein tatsächlicher nicht möglich ist. Trends lassen sich beliebig ausrufen und sind lukrativ für diejenigen, die sich an ihre Spitze setzen.
Das gilt ganz offensichtlich für das Geschäft mit Textilien, aber auch für viele andere Produkte, Dienstleistungen und Kulturtechniken, etwa für Managementkonzepte. Wie Firmen geführt werden, welche Sprache dort gesprochen wird, auch dies unterliegt modischem Wandel. Ein Wissenschaftler, der sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt, ist der Ökonom und Organisationsforscher Alfred Kieser. Er hat festgestellt, dass Managementideen kommen und gehen wie Minirock, Hipster-Vollbart oder Arschgeweih.
Deutlich wird das Phänomen in der Rückschau. So war Qualität in den 1980er- und 1990er-Jahren ein großes Thema in der Industrie. Man pries das Total Quality Management (TQM) und die Six-Sigma-Methode, die eine fehlerfreie Produktion ermöglichen sollten. Dafür gab es einen ökonomischen Grund, denn japanische Hersteller punkteten mit zuverlässigen Autos und nahmen europäischen und amerikanischen Unternehmen Marktanteile ab. »Konzepte wie das Total Quality Management waren eine Antwort (…) auf diese Herausforderung«, sagte Kieser in einem Interview mit dem Magazin brand eins.28 Ein zweiter entscheidender Faktor sei soziologischer Natur: Bei TQM und Six Sigma handle es sich um Trends, die auf ähnliche Weise durchgesetzt werden wie Modestile in der Textilindustrie. »Es gibt Modeschöpfer, die den jeweiligen Trend kreieren, und Multiplikatoren, die ihn verbreiten und popularisieren, dazu zählen vor allem Unternehmensberater, aber auch Wissenschaftler, Manager, Sachbuchautoren oder Journalisten. Und es gibt die Kundschaft, die sich Vorteile davon verspricht, mit der Mode zu gehen, ohne sich eigene Gedanken zu machen oder gar Verantwortung zu übernehmen.«29
Einer der prominentesten Propagandisten von Six Sigma war Jack Welch, von 1981 bis 2001 Chef von General Electric (GE). Das Magazin Fortune kürte ihn 1999 zum »Manager des Jahrhunderts«. Führungskräfte von GE schwärmten davon, dass Six Sigma – eine Methode, bei der es um die Messung und Analyse von Geschäftsvorgängen mit statistischen Methoden geht – zur gemeinsamen Sprache des Mischkonzerns geworden sei. Das Manager Magazin schrieb, Welch habe »das Qualitätsdenken bei GE rigoros durchgesetzt, hat mit einer an Besessenheit grenzenden Intensität sichergestellt, dass jeder der 300 000 GE-Mitarbeiter Six Sigma lebt«.30 Für Jack Welch lohnte sich die Rolle des Managementvordenkers: Er setzte exorbitante Vergütungen sowie Pensionsansprüche durch und »presste das Unternehmen«, so Kieser, »aus wie eine Zitrone«31.
Heute ist GE nur noch ein Schatten seiner selbst. Alfred Kieser sieht in der Fixierung auf das Qualitätsmanagement eine Ursache dafür, denn das Null-Fehler-Prinzip sei »in gewisser Weise innovationsfeindlich, weil es nur auf bewährte Produkte und Verfahren angewendet werden kann. Wer keinen Fehler machen will, fängt nichts Neues an«.32 Von Six Sigma redet heute kaum noch jemand: Es ist typisch für solche Trends, dass sie fremd und fragwürdig wirken, wenn die Zeit über sie hinweggegangen ist.
Die Managementmodeschöpfer von heute preisen → Agilität als Konzept der Stunde. Unternehmen sollen ihre Hierarchien schleifen, um mit je nach Anforderung zusammengesetzten Teams blitzschnell agieren und reagieren zu können. Alfred Kieser hält nicht viel von diesem Hype, im Gegensatz zum Qualitätsdiskurs fehle dem schwammigen Begriff → Agilität der reale ökonomische Kern. »Unternehmen sind per se hierarchische Organisationen, es gibt immer jemanden, der letztlich entscheidet, und sei es der Eigentümer.« Wenn Firmen, die hip sein wollten, auf Hierarchien verzichteten, liefe im Zweifel alles auf diese eine Person zu. Wenn etwas passieren sollte, was gegen ihren Willen wäre, würde sie eingreifen. Deshalb, so Kieser, »mühen sich die Mitarbeiter solcher Unternehmen, vor jeder wichtigen Entscheidung herauszufinden, was diese letzte Instanz wohl denken und wollen könnte. Offiziell gibt es keine Hierarchie, in Wahrheit und in den Köpfen aber sehr wohl. Das führt nicht zu Agilität, sondern zum Gegenteil.«33
Dass sich auch offenkundig fragwürdige oder kontraproduktive Trends samt der zugehörigen Buzzwords durchsetzen können, ist auf – ganz altmodische – Machtverhältnisse zurückzuführen. »Für Führungskräfte, die beispielsweise in einem Unternehmen arbeiten, das Agilität auf seine Fahnen geschrieben hat, ist es extrem nahe liegend, zumindest so zu tun, als hielten sie das Konzept für sinnvoll«, sagt Kieser. »Sonst müssten sie Nachteile fürchten.«34
Meine Arbeit ist sinnlos: Bullshit-Jobs
David Graeber, Ethnologe und politischer Aktivist, der an der London School of Economics lehrte, veröffentlichte im Jahr 2013 in einer kleinen anarchistischen Zeitschrift einen polemischen Aufsatz über das von ihm so genannte Phänomen der Bullshit-Jobs.35 Zur Überraschung des Autors stieß der Text im Netz auf enorme Resonanz. Es meldeten sich viele Menschen, die von ihrer als sinnlos empfundenen Arbeit berichteten, vor allem Büro- und Verwaltungsangestellte sowie Führungskräfte. Graeber veröffentlichte Zitate aus diesen Online-Antworten auf Plakaten in der Londoner U-Bahn. Dort konnten Pendler auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise lesen: »Es ist, als wäre da draußen jemand, der nutzlose Jobs erfindet, nur um uns zu beschäftigen.«36 Unter dem Hashtag #Bullshitjobs gab es auf Twitter viele weitere Reaktionen. Das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov griff das Thema in einer Umfrage auf: 37 Prozent der Teilnehmer gaben an, mit ihrer Arbeit keinen nützlichen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.
Graeber hatte – ähnlich wie Scott Adams mit seiner Comicfigur Dilbert – einen Nerv getroffen. Ein Bullshit-Job ist nach Graebers Definition einer, der so sinnlos ist, dass die Person, die die entsprechende Tätigkeit ausübt, diese nicht vor sich selbst rechtfertigen kann. Sie ist überzeugt davon, dass niemand ihren Job vermissen würde, wenn es ihn nicht mehr gäbe – oder dass dies sogar besser für die Welt wäre. Doch weil die wirtschaftliche Existenz der meisten Menschen von ihrer Arbeit abhängt, können sie solche Wahrheiten nicht offen aussprechen. Sie müssen so tun, als sei ihr Job notwendig, nützlich und wichtig. Dieser Rechtfertigungszwang erzeugt wiederum große Mengen Sprachmüll, sozusagen Bullshit zweiter Ordnung.
Ein wichtiger Multiplikator von Blasen und Phrasen ist das mittlere Management. Die meisten Angehörigen dieser Berufsgruppe sehen ihre Arbeit zwar nicht als sinnlos an, verzweifeln aber oftmals an ihrer Mission impossible: Sie sollen Vorgaben von oben nach unten durchsetzen, was häufig nicht funktioniert, weil das Topmanagement unrealistische Ziele vorgibt oder nicht einschätzen kann, was in der Praxis machbar ist – und sich zudem als beratungsresistent erweist. Die Folgen müssen die Mittelmanager ausbaden: Sie bekommen Druck von oben und von unten und noch Spott dazu. In Vorstandsetagen lästert man gern über die sogenannte Lehm- beziehungsweise Lähmschicht, die angeblich verhindert, dass die eigenen genialen Ideen nach unten durchdringen.
Trost finden ehrgeizige Führungskräfte unterer Hierarchie-Ebenen in Bullshit. Dieser Personenkreis beschäftigt sich am eifrigsten mit gerade angesagten Leadership- oder New-Work-Konzepten, liest die entsprechenden Ratgeber, besucht Konferenzen und ventiliert die einschlägigen Buzzwords. Die Mittelmanager sehen darin eine Chance, sich zu profilieren, und hoffen vergeblich darauf, dass ihnen irgendein Business-Guru einen Ausweg aus ihrer beruflichen Zwickmühle weisen wird.
Wie man ein Vakuum mit leeren Begriffen füllt
Der sonderbare Wirtschaftsjargon hat sich inzwischen weit über sein Kerngebiet hinaus verbreitet. Er kursiert auch in Behörden, Krankenhäusern, Universitäten, Sportvereinen, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Medien und vielen weiteren Institutionen. Die Bullshit-Expansion begann Anfang der 1990er-Jahre. Der Eiserne Vorhang war gefallen, der sogenannte real existierende Sozialismus sang- und klanglos untergegangen. Mit ihm schienen sich gesellschaftliche Utopien generell überlebt zu haben. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama prophezeite in seinem 1992 erschienenen gleichnamigen Buch gar das »Ende der Geschichte«: Fortan würde sich der Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft ganz von allein endgültig und überall auf der Welt durchsetzen.
Das ideologische Vakuum füllte eine selbstherrlich auftretende Wirtschaftselite mit der Botschaft, dass an ihrem Wesen die Welt genesen solle und der Markt alles regle. Anstelle der politischen Entwürfe von einst, so der Sprachkritiker Roland Kaehlbrandt, trat »der Diskurs der Betriebswirtschaftslehre, des Managements«37. Doch dieser Diskurs war den Vordenkern nicht genug. »Statt sich auf Aussagen über das, was man versteht, zu beschränken, sieht man sich genötigt, Aussagen über höhere Sinnfragen zu machen. Dabei kommen dann Visionen heraus oder Visionäre.« Wirtschaft sei zwar wichtig, aber nicht ausreichend, so Kaehlbrandt, »um einer Gesellschaft Ziele und Werte zu vermitteln. Deshalb die verzweifelte Suche nach neuen Begriffen. Deshalb auch greifen Manager in ihrer Not pikanterweise sogar auf das Polit-Vokabular der Siebzigerjahre zurück, das wieder frei ist, weil es keine Linke mehr gibt. In vielen Unternehmen ist Kulturrevolution ein beliebter Begriff. Interessante Umdeutungen.«38
Während in Firmen umgerubelter Agitprop Einzug hielt, → Rebellen und Systemveränderer gefeiert wurden, machten sich andere Institutionen freudig den Wirtschaftsjargon zu eigen. So firmierte das gute alte Arbeitsamt in Arbeitsagentur um. Die Erwerbslosen – die dort in der Regel nicht freiwillig vorsprechen und auch mit keiner zuvorkommenden Behandlung rechnen dürfen – nannte man fortan Kunden. Um Investoren und Touristen buhlende Länder beauftragten Werbeagenturen mit einem zeitgemäßen Nation Branding. An Arbeitslose erging die Aufforderung, als Ich-AG Unternehmer ihrer selbst zu werden. Und ein gestandener Kirchenmann wie der Hamburger Hauptpastor Axel Denecke beschrieb seine Tätigkeit auf einmal so: »Ich bin Dienstleister im geistlichen Sinn und konkurriere mit anderen Anbietern auf dem Markt für Sinn-Angebote.«39
Die Begeisterung für die Marktwirtschaft hat sich nach der im Jahr 2007 einsetzenden Weltfinanzkrise – dem Beinahe-Super-GAU des Kapitalismus – gelegt und ist aufgrund der Corona-Pandemie, deren ökonomische Folgen nur durch beispiellose staatliche Interventionen gemildert werden konnten, noch weiter abgeebbt. Doch der Business Bullshit hat diese Krisen ohne Beulen und Kratzer überstanden; er gibt sich quicklebendig und setzt sich selbst in Institutionen mit eigener Fachsprache wie dem Militär durch. So bezeichnete der Brigadegeneral Markus Kreitmayr, Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr, die skandalumwitterte Truppe in lupenreinem Managerjargon als »strategisches Asset«.40
Selbst in traditionsreichen Lehranstalten herrscht heute ein sonderbarer Ton. So preist sich die Schule Liebefeld Steinhölzli in der Berner Gemeinde Köniz in ihrem »Leitbild«41 als »Unternehmen« an. »Wie in jedem Betrieb«, heißt es dort, »bilden die Produktionsfaktoren die Grundlage für die Prozesse und damit für die angebotenen Produkte. Eine Besonderheit des ›Betriebs‹ Schule besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits die Kunden sind, andererseits aber auch zu den Produktionsfaktoren gehören, die maßgeblich auf die Prozesse und Produkte Einfluss nehmen können. (…) ›Wir produzieren Qualität‹ lautet der Leitsatz, ein Konzentrat unserer Überlegungen und unser oberstes Ziel. Natürlich bezieht sich dieser Anspruch auf unsere Produkte.«
In zumindest einem Fall scheint das Qualitätsversprechen, nimmt man das humanistische Bildungsideal als Maßstab, katastrophal fehlgeschlagen zu sein. Denn einer der Schüler beziehungsweise »Produktionsfaktoren« der Schweizer Schule war Kim Jong-un ➤, der für sein rücksichtsloses Sozialverhalten bekannte Diktator Nordkoreas.
Business Bullshit ist mittlerweile so übermächtig, allgegenwärtig und selbstverständlich geworden, dass der Jargon kaum hinterfragt wird. Darum soll es in den folgenden Kapiteln anhand von 100 einschlägigen Begriffen, ihren Funktionen und ihrer Geschichte gehen.
➤ Der Begriff geht auf Max Webers zentrales Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« von 1904/05 zurück. Darin beschreibt er den Bedeutungswandel der Arbeit im Europa der Neuzeit – vom Zwang zur lebenserfüllenden Aufgabe.
➤ Kim Jong-un besuchte die Schule von 1998 bis 2001 unter dem Decknamen Un Pak. Die Schweizer Sonntagszeitung enthüllte 2012 seine wahre Identität. Sie hatte eine biometrische Untersuchung anhand eines Schulfotos in Auftrag gegeben. Diese kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Jungen mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit um Kim Jong-un handelte. Über den Fall berichtete unter anderem der Tagesanzeiger: https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/wie-kim-jonguns-schweizer-eltern-in-die-usa-fluechteten/story/11856287 (abgerufen am 07.09.2020).