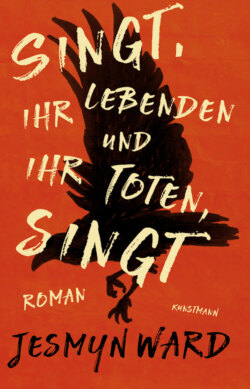Читать книгу Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt - Jesmyn Ward - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel LEONIE
ОглавлениеGESTERN ABEND, nachdem ich mit Michael telefoniert hatte, rief ich Gloria an und bekam noch eine Schicht. Gloria ist die Besitzerin der Country-Bar oben am Waldrand, wo ich arbeite. Ein abgelegener Schuppen, aus Tuftsteinen und Sperrholz zusammengehauen und grün gestrichen. Ich hab den Laden zum ersten Mal gesehen, als ich mit Michael einen Ausflug an den Fluss machte; wir parkten meist unter einer Brücke an der Straße, die über den Fluss führt, und gingen dann zu Fuß weiter, bis wir zu einer Stelle kamen, wo man gut baden kann. Was ist das denn?, fragte ich und zeigte darauf. Ich dachte, ein Wohnhaus kann es kaum sein, obwohl es geschützt unter den Bäumen lag. Zu viele Autos parkten auf der sandigen Grasfläche davor. Das ist das Cold Drink, sagte Michael; er roch nach Hartbirnen, und seine Augen waren so grün wie die Bäume. Wie Barq’s und Coke?, fragte ich. Jap. Er sagte, seine Mama sei mit der Besitzerin zusammen zur Schule gegangen. Jahre später, als Michael schon im Gefängnis war, habe ich seine Mama angerufen, und Gott sei Dank ging sie ans Telefon und nicht Big Joseph. Er hätte gleich wieder aufgelegt, statt mit mir zu sprechen, der Niggerin, mit der sein Sohn Kinder hatte. Ich erzählte Michaels Mutter, dass ich Arbeit brauchte, und bat sie, bei der Besitzerin ein gutes Wort für mich einzulegen. Es war unser viertes Gespräch überhaupt. Zum ersten Mal haben wir miteinander geredet, als Michael und ich anfingen, uns regelmäßig zu treffen, das zweite Mal war, als Jojo geboren wurde, und das dritte Mal, als Michaela geboren wurde. Trotzdem sagte sie Ja, und dann sagte sie, ich solle hinfahren, hoch zum Kill, dahin, wo Michael und seine Eltern herkommen und wo die Bar ist, und mich bei Gloria vorstellen, also machte ich das. Gloria stellte mich zuerst für eine Probezeit von drei Monaten ein. Du bist fleißig, sagte sie lachend, als sie mir mitteilte, dass sie mich behalten würde. Sie trug dicken Lidstrich, und wenn sie lachte, sah die Haut um ihre Augenwinkel wie ein kunstvoll gearbeiteter Fächer aus. Sogar fleißiger als Misty, sagte sie, und die wohnt schon fast hier. Und dann wedelte sie mit dem Arm und schickte mich wieder nach vorne in die Bar. Ich nahm mein Tablett mit den Drinks, und aus drei Monaten wurden drei Jahre. Nach meinem zweiten Tag im Cold Drink hatte ich kapiert, warum Misty so viel arbeitete: Sie war jeden Abend auf Droge. Lortab, Oxycodon, Koks, Ecstasy, Crystal Meth.
Als ich gestern Abend im Cold Drink zur Arbeit erschien, muss Misty schon einiges intus gehabt haben, denn nachdem wir gefegt und gewischt und alles dicht gemacht hatten, sind wir noch in ihr rosa MEMA-Häuschen gegangen, in dem sie seit Hurricane Katrina wohnt, und sie hat einen Eightball herausgeholt.
»Er kommt also nach Hause?«, fragte Misty. Misty war dabei, alle Fenster aufzumachen. Sie weiß, ich höre gern die Geräusche von draußen, wenn ich high bin. Ich weiß, sie kokst nicht gern alleine, deshalb hat sie mich eingeladen und deshalb öffnete sie die Fenster, obwohl die feuchte Frühjahrsnachtluft sich im Haus breitmacht wie Nebel.
»Jap.«
»Du bist bestimmt total froh.«
Das letzte Fenster ging hoch und rastete ein, und ich starrte hinaus, während Misty sich an den Tisch setzte und mit dem Zerkleinern und Teilen anfing. Ich zuckte die Achseln. Ich war überglücklich gewesen, als der Anruf kam, als ich Michaels Stimme Worte sagen hörte, die ich mir monatelang, jahrelang, erträumt hatte, so glücklich, dass sich mein Innerstes anfühlte wie ein Teich, in dem es von Tausenden Kaulquappen wimmelt. Aber dann, kurz bevor ich aus dem Haus ging, schaute Jojo, der mit Pop im Wohnzimmer saß und eine Jagdsendung guckte, zu mir hoch, und für den Bruchteil einer Sekunde sah sein Gesicht, die Art, wie seine Züge sich in Falten legten, genauso aus wie Michaels nach einem unserer schlimmsten Streits. Enttäuscht. Todtraurig, weil ich wegging. Und ich konnte dieses Bild nicht abschütteln. Es tauchte während der gesamten Schicht immer wieder vor mir auf, setzte mir so sehr zu, dass ich Bud Light statt Budweiser oder Michelob statt Coors zapfte. Und dann ging mir Jojos Gesichtsausdruck nicht mehr aus dem Sinn, weil ich wusste, dass er insgeheim hoffte, ich würde ihn mit einem Geschenk überraschen, mit etwas anderem als diesem hastig gekauften Kuchen, irgendeinem Ding, das nicht nach drei Tagen weg sein würde: einem Basketball, einem Buch, einem Paar High Tops von Nike, damit er endlich ein zweites Paar Schuhe besaß.
Ich beugte mich zum Tisch hinunter. Schnupfte. Ein scharfes Brennen fuhr mir bis in die Knochen, und dann vergaß ich. Die Schuhe, die ich nicht gekauft hatte, den wachsbekleckerten Kuchen, den Anruf. Das Kleinkind, das zu Hause in meinem Bett schlief, während mein Sohn auf dem Fußboden lag, nur für den Fall, dass ich nach Hause kommen und ihn aus dem Bett werfen würde, wenn ich ins Zimmer wankte. Scheiß drauf!
»Überglücklich.« Ich sagte das Wort ganz langsam. Zog jede Silbe in die Länge. Und plötzlich war Given wieder da.
Die Kinder in der Schule zogen Given wegen seinem Namen auf. Eines Tages geriet er deswegen im Schulbus in einen Streit, prügelte sich auf den Sitzen mit einem stämmigen rothaarigen Jungen in Camouflage-Klamotten. Frustriert und mit einer dicken Lippe kam er nach Hause und fragte Mama: Wieso habt ihr mir diesen Namen gegeben? Given? Der hat überhaupt keinen Sinn. Geschenkt, was soll das denn heißen? Und Mama hockte sich vor ihn hin, strich ihm über die Ohren und sagte: Given, weil sich das auf den Namen deines Papas reimt: River. Und Given weil ich schon vierzig war, als ich dich bekommen habe. Dein Papa war fünfzig. Wir dachten, wir könnten keine Kinder bekommen, aber dann wurdest du uns geschenkt: also Given. Er war drei Jahre älter als ich, und als er und der Camouflage-Junge sich raufend über die Sitzreihen wälzten, holte ich mit meiner Schultasche aus und traf Camo am Hinterkopf.
Gestern Abend hat er mich angelächelt, dieser Given-nicht-Given, dieser Given, der jetzt schon fünfzehn Jahre tot ist, dieser Given, der jedes Mal auftauchte, wenn ich eine Line zog oder eine Pille einwarf. Jetzt setzte er sich auf einen der leeren Stühle zu uns an den Tisch, beugte sich vor und legte die Ellbogen auf die Tischplatte. Er beobachtete mich, wie immer. Er hatte Mamas Gesicht.
»So sehr, hm?« Misty zog den Schnodder in ihrer Nase hoch.
»Jap.«
Given rieb sich den rasierten Kopf, und ich entdeckte noch mehr Unterschiede zwischen den Lebenden und diesem chemischen Hirngespinst. Given-nicht-Given atmete nicht richtig. Er atmete überhaupt nicht. Sein schwarzes Hemd war ein stiller, von Mücken umschwärmter Teich.
»Und wenn Michael sich verändert hat?«, sagte Misty.
»Hat er nicht«, sagte ich.
Misty warf ein zusammengeknülltes Papiertuch weg, mit dem sie den Tisch abgewischt hatte.
»Was guckst du an?«, fragte sie.
»Nichts.«
»Quatsch.«
»Keiner starrt was so Cleanes so lange an, ohne was anzugucken.« Misty wedelte mit einer Hand in Richtung des Kokains und zwinkerte mir zu. Sie hatte sich die Initialen ihres Freundes auf den Ringfinger tätowieren lassen, und ganz kurz sahen sie wie Buchstaben aus, dann wie Käfer, dann wieder wie Buchstaben. Ihr Freund war schwarz, und diese Liebe über Hautfarbengrenzen hinweg war einer der Gründe, warum aus uns so schnell Freundinnen geworden waren. Misty sagte oft, dass sie beide, soweit es sie betraf, so gut wie verheiratet waren. Sie sagte, sie brauche ihn, weil ihre Mutter sich einen Dreck um sie scherte. Misty hat mir erzählt, dass sie ihre Periode gekriegt hat, als sie in der vierten Klasse war, mit zehn, und weil sie keine Ahnung hatte, was mit ihr los war, während ihr Körper sie verriet, lief sie den halben Tag mit einem blutigen Fleck hinten auf der Hose herum, der sich langsam ausbreitete wie ein Ölteppich. Ihre Mutter schlug auf dem Parkplatz der Schule auf sie ein, so peinlich fand sie das. Der Rektor rief die Polizei. Nur ein Beispiel dafür, wie sehr ich sie enttäuscht habe, sagte Misty.
»Ich wollte es spüren«, sagte ich.
»Weißt du, woran ich erkenne, dass du lügst?«
»Woran denn?«
»Du wirst totenstill. Alle bewegen sich die ganze Zeit, wenn sie sprechen, wenn sie schweigen, sogar im Schlaf. Schaun weg, schaun einen an, lächeln, runzeln die Stirn, sowas alles. Wenn du lügst, bist du totenstill: ausdrucksloses Gesicht, schlaffe Arme. Wie ’ne Leiche, echt. Sowas hab ich noch nicht gesehn.«
Ich zuckte die Achseln. Given-nicht-Given zuckte die Achseln. Sie lügt nicht, sagte er tonlos.
»Siehst du manchmal Sachen?«, fragte ich. Es ist schon raus, ehe ich die Worte denken kann. Aber in dem Moment ist Misty meine beste Freundin. Sie ist meine einzige Freundin.
»Wie meinst du das?«
»Wenn du drauf bist?« Ich wedelte mit der Hand, so wie sie es gerade getan hatte. In Richtung des Koks, das jetzt nur noch ein trauriges kleines Häufchen Staub auf dem Tisch war. Gerade noch genug für zwei oder drei Lines.
»Das ist es also? Du siehst Zeugs?«
»Nur Striche. Wie Neonlicht oder sowas. In der Luft.«
»Guter Versuch. Du hast dir sogar die Mühe gemacht, mit den Händen zu zucken. Also, was siehst du wirklich?«
Ich hätte ihr am liebsten eine geknallt.
»Hab ich doch grad gesagt.«
»Klar, und das war schon wieder gelogen.«
Aber ich wusste, es war ihr Haus, und wenn es hart auf hart kam, dann bin ich Schwarz und sie Weiß, wenn uns also jemand streiten hörte und die Polizei rief, dann wäre ich diejenige, die im Gefängnis landen würde. Nicht sie. Beste Freundin hin oder her.
»Given«, sagte ich. Es war mehr ein Flüstern als sonst irgendwas, und Given beugte sich vor, um zu verstehen, was ich sagte. Schob seine Hand über den Tisch, schob eine schlanke, knochige Hand zu mir herüber. Als wollte er mir helfen. Als könnte er zu Fleisch und Blut werden. Als könnte er meine Hand ergreifen und mich hier herausbringen. Als könnten wir nach Hause gehen.
Misty sah aus, als hätte sie in etwas Saures gebissen. Sie beugte sich vor und zog noch eine Line.
»Ich bin ja keine Expertin oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man von diesem Zeug hier eigentlich keine Sachen sehen sollte.«
Sie lehnte sich zurück, fasste ihr Haar zu einem dicken Bündel zusammen und warf es über ihre Schulter. Bishop findet meine Haare toll, hatte sie mal über ihren Freund gesagt. Kann die Hände kaum davon lassen. Das war eine von den Sachen, die sie ganz unwillkürlich machte, mit ihrem Haar zu spielen, ohne zu merken, wie ungezwungen es wirkte. Wie ihr Haar das Licht reflektierte. Was für eine selbstzufriedene Schönheit es ausstrahlte. Ich hasste ihr Haar.
»Auf Acid vielleicht«, fuhr sie fort. »Oder Meth. Aber von dem hier? Nie und nimmer.«
Given-not-Given runzelte die Stirn, imitierte ihr mädchenhaftes Spiel mit ihren Haaren und formte mit den Lippen die Worte: Was weiß sie schon? Seine linke Hand lag immer noch auf dem Tisch. Ich konnte nicht danach greifen, obwohl alles in mir sich danach sehnte, seine Haut, sein Fleisch, seine trockenen harten Hände zu spüren. Als wir Kinder waren, hat er unzählige Male im Bus für uns gekämpft, uns in der Schule oder in der Nachbarschaft verteidigt, wenn andere Kinder mich auslachten und behaupteten, Pop sähe aus wie eine Vogelscheuche oder Mama sei eine Hexe. Dass ich genauso aussähe wie Pop: wie ein verbrannter, mit Lumpen umhüllter Stock. Mir drehte sich der Magen um wie ein Tier, das sich vor dem Einschlafen in seinem Bau wälzt, immer wieder, auf der Suche nach Trost und Wärme. Ich steckte mir eine Zigarette an.
»Echt«, sagte ich.
Jojos Geburtstagskuchen hält sich nicht gut: Am nächsten Tag schmeckt er schon, als wäre er fünf Tage alt statt einem. Er schmeckt wie nasse Pappe, aber ich esse trotzdem weiter. Ich kann nicht anders. Meine Zähne kauen und mahlen, obwohl ich nicht genug Spucke habe und meine Kehle sich gegen das Schlucken wehrt. Das Koks hat bewirkt, dass ich seit gestern Abend ununterbrochen kaue. Pop redet mit mir, aber ich kann an nichts anderes denken als an meinen Unterkiefer.
»Du brauchst die Kinder nirgendwohin mitzunehmen«, sagt Pop.
An den meisten Tagen ist Pop ein jüngerer Mann. Genauso wie Jojo für mich an den meisten Tagen immer noch fünf ist. Ich schaue Pop nicht an und sehe, wie die Jahre ihn gebeugt und zerknittert haben: Ich sehe ihn stattdessen mit weißen Zähnen und geradem Rücken und Augen, die so schwarz und glänzend sind wie sein Haar. Ich habe Mama einmal erzählt, dass ich dachte, Pop würde sich das Haar färben, und sie hat die Augen gerollt und gelacht, damals, als sie noch lachen konnte. Ist alles echt, hat sie gesagt. Der Kuchen ist so süß, dass er fast bitter schmeckt.
»Doch«, sage ich.
Ich könnte nur Michaela mitnehmen, das ist mir klar. Es wäre einfacher, aber ich weiß genau, wenn wir vor dem Gefängnis stehen und Michael rauskommt, dann wäre ein Teil von ihm enttäuscht, wenn Jojo nicht dabei wäre. Jojo sieht jetzt schon viel zu sehr so aus wie ich und Pop, mit seiner braunen Haut und den dunklen Augen, mit der Art, wie er geht, wie er auf den Fußballen wippt und alles an ihm aufrecht wirkt. Wenn Jojo nicht mit uns dort stehen und auf Michael warten würde, dann wäre das, na ja, nicht richtig.
»Und was ist mit der Schule?«
»Es sind doch nur zwei Tage, Pop.«
»Schule ist wichtig, Leonie. Der Junge muss was lernen.«
»Er is schlau genug, um zwei Tage zu verpassen.«
Pop verzieht das Gesicht, und solange die Grimasse anhält, sehe ich doch das Alter in seinem Gesicht. Die Falten des Alters, das ihn unerbittlich hinabzieht, genau wie Mama. In die Gebrechlichkeit, die Bettlägerigkeit, auf die Erde, ins Grab. Es geht abwärts.
»Es gefällt mir nicht, dass du ganz allein mit den beiden auf die Straße willst, Leonie.«
»Die Strecke ist nicht kompliziert, Pop. Wir fahren immer nach Norden und dann wieder zurück.«
»Man kann nie wissen.«
Ich presse die Lippen zusammen und spreche durch die Zähne.
Mein Kiefer schmerzt.
»Uns wird nichts passieren.«
Michael ist jetzt drei Jahre im Gefängnis. Drei Jahre und zwei Monate. Und zehn Tage. Er hat fünf Jahre gekriegt, mit der Möglichkeit zur vorzeitigen Entlassung. Aus dieser Möglichkeit ist jetzt Wirklichkeit geworden. Gegenwart. Ich zittere innerlich.
»Alles in Ordnung?«, fragt Pop. Er schaut mich so an, wie er seine Tiere anschaut, wenn etwas mit ihnen nicht stimmt, wie er sein Pferd anschaut, wenn es hinkt und neu beschlagen werden muss, oder wenn eins seiner Hühner sich seltsam und wie toll aufführt. Er erkennt den Defekt und ist fest entschlossen, ihn auszumerzen. Die empfindlichen Hufe des Pferdes zu panzern. Das Huhn zu isolieren. Ihm den Hals umzudrehen.
»Jep«, sage ich. Mein Kopf fühlt sich an wie mit Auspuffgas gefüllt: leicht und heiß. »Alles okay.«
Manchmal glaube ich, ich weiß, warum ich jedes Mal Givennicht-Given sehe, wenn ich high bin. Als ich zum ersten Mal meine Periode hatte, setzte sich Mama mit mir an den Küchentisch, nachdem Pop zur Arbeit gegangen war, und sagte: »Ich habe dir etwas zu sagen.«
»Was denn?«, sagte ich. Mama sah mich streng an. »Ja Ma’am«, sagte ich da und schluckte meine ursprünglichen Worte hinunter.
»Als ich zwölf war, kam die Hebamme Marie-Therese zu uns nach Hause, um meine jüngste Schwester auf die Welt zu holen. Sie saß kurz in der Küche, wies mich an, Wasser zu kochen, und packte ihre Kräuter aus, und da fing sie an, auf die Bündel zu zeigen und wollte von mir wissen, was ich glaubte, welche Wirkung die verschiedenen getrockneten Pflanzen hatten. Ich sah sie mir an, und ich wusste es, also sagte ich: Das hier hilft bei der Nachgeburt, das hier stillt die Blutung, das wirkt gegen die Schmerzen, und das hier lässt die Milch schneller einschießen. Als würde mir jemand ins Ohr summen und mir verraten, wozu die Kräuter gut waren. Sofort erklärte sie, ich hätte eine besondere Gabe in mir. Während meine Mama nebenan hechelte, legte Marie-Therese ganz in Ruhe ihre Hand auf mein Herz und betete zu den Müttern, zu Mami Wata und zu Maria, der Gottesmutter, dass ich lange genug leben möge, um zu sehen, was ich sehen sollte.«
Mama legte eine Hand auf ihren Mund, als hätte sie etwas erzählt, das sie lieber nicht verraten sollte, so als könnte sie ihre Worte wieder einfangen und in sich aufsaugen, damit sie durch ihre Kehle nach unten rutschten und sich im Magen in nichts auflösten.
»Und?«, fragte ich.
»Ob ich sehe?«
Ich nickte.
»Ja«, sagte Mama.
Ich hätte am liebsten gefragt: Und was siehst du? Aber ich tat es nicht. Ich hielt den Mund und wartete, dass sie weitersprach. Vielleicht hatte ich Angst vor dem, was sie mir erzählen würde, wenn ich fragte, was sie sah, wenn sie mich anschaute. Würde ich jung sterben? Vergeblich nach Liebe suchen? Oder falls ich lange lebte, würde ich von harter Arbeit und einem schweren Leben gebeugt sein? Alt und bitter werden, die Lippen verzerrt vom Geschmack dessen, was mir das Leben aufgetischt hatte: Senfblätter und unreife Kakifrüchte mit dem beißenden Aroma unerfüllter Versprechen und schlimmer Verluste?
»Kann sein, dass du’s auch hast«, sagte Mama.
»Wirklich?«
»Ich glaub, man hat’s im Blut, wie Schlick im Flusswasser. Sammelt sich in den Kurven und Windungen, lagert sich auf versunkenen Baumstämmen ab.« Sie wedelte mit den Fingern. »Kommt im Lauf der Generationen immer wieder an die Oberfläche. Meine Mama nicht, aber ich hab sie mal drüber reden hören, dass Tante Rosalie, ihre Schwester, die Gabe hatte. Dass sie von Schwester zu Kind zu Cousine wandert. Um gesehen zu werden. Und genutzt. Zeigt sich meist so richtig, wenn man zum ersten Mal blutet.«
Mama zupfte mit den Fingernägeln an ihrer Lippe herum und klopfte dann auf den Küchentisch.
»Marie-Therese selbst hat Sachen gehört. Brauchte eine Frau bloß anzusehen, und schon hörte sie das Singen: Ob sie schwanger war, konnte ihr sagen, wann sie ein Kind kriegen würde, welches Geschlecht das Baby haben würde. Konnte ihr sagen, ob ihr Probleme bevorstanden und wie sie die vermeiden konnte. Konnte einen Mann ansehen und ihm sagen, ob der Schnaps schon seine Leber zerfressen und seine Eingeweide getrocknet hatte wie Würste, erkannte es am Gelb in seinen Augen, am Zittern seiner Hände. Und noch was anderes hat sie gesagt. Dass alle Lebewesen für sie von tausend Stimmen umgeben waren und dass sie immer den lautesten folgte, weil die am wahrscheinlichsten waren. Dass sich die klarsten Stimmen vom Gewirr der restlichen abhoben. Sie hörte Laute, die vom Gesicht einer Frau im Haushaltswarenladen kamen: Flip hat mir die Wange aufgeschlitzt, weil ich mit Ced getanzt habe. Vom Ladenbesitzer, bei dem das eine Bein sang: Das Blut wird schwarz und staut sich, die Zehen faulen. Hörte, wie der Bauch einer Kuh sagte: Das Kalb kommt mit den Füßen zuerst raus. Dass sie die Stimmen zum ersten Mal gehört hat, als sie in die Pubertät kam. Und als sie es so erklärt hat, wurde mir klar, dass ich auch schon Stimmen gehört hatte. Als ich noch jünger war, beklagte sich meine Mama, weil sie Bauchweh hatte, von den Magengeschwüren. Ich konnte sie hören, sie sagten, Wir essen und fressen, essen und fressen; ich war verwirrt und fragte Mama immer wieder, ob sie hungrig war. Marie-Therese gab mir Unterricht, sie brachte mir alles bei, was sie wusste, und als dein Pop und ich geheiratet haben, war das meine Arbeit. Ich war damit beschäftigt, Babys auf die Welt zu holen und Leute zu behandeln und Gris-Gris-Beutel zu nähen, als Schutz.« Mama rieb sich die Hände wie beim Waschen. »Aber jetzt ist nicht mehr viel. Außer den Alten kommt keiner mehr zu mir.«
»Du kannst ein Kind auf die Welt holen?«, fragte ich sie. Das andere, was sie gesagt hatte, über die Gris-Gris-Beutel, stand unausgesprochen zwischen uns auf dem Tisch, so selbstverständlich wie eine Butterdose oder eine Zuckerdose. Sie lächelte, blinzelte und schüttelte den Kopf, und das alles bedeutete nur eins: Ja. In dem Moment wurde Mama für mich mehr als meine Mutter, mehr als die Frau, die mich anhielt, vor dem Schlafengehen den Rosenkranz zu beten, und mich ermahnte: Vergiss nicht, zu den Müttern zu beten. Sie hatte mehr getan als ihre Mutterpflicht, als sie mich mit selbstgemachter Salbe einrieb, wenn ich Ausschlag hatte, oder mir besonderen Tee kochte, wenn ich krank war. Dieses kleine Lächeln war ein Hinweis auf die Geheimnisse in ihrem Leben, all die Dinge, die sie gelernt und gesagt und gesehen und erlebt hatte, die Heiligen und die Geister, mit denen sie gesprochen hatte, als ich noch zu klein war, um ihre Gebete zu verstehen. Das kleine Lächeln verzog sich zu einem Stirnrunzeln, als Given zur Tür hereinkam.
»Junge, wie oft soll ich dir noch sagen, zieh die dreckigen Stiefel aus, wenn du ins Haus kommst.«
»Sorry, Ma.« Er grinste, beugte sich zu ihr, gab ihr einen Kuss, richtete sich dann wieder auf und ging rückwärts wieder nach draußen. Er war ein Schatten hinter der Fliegengittertür, während er sich mit den Füßen die Schuhe abstreifte. »Dein Bruder hört nicht mal, was ich zu ihm sage, ganz zu schweigen von dem, was die Welt singt. Aber du vielleicht schon. Wenn du anfängst, Sachen zu hören, sagst du mir Bescheid«, sagte sie.
Given hockte sich auf die Treppe und schlug seine Schuhe gegen das Holz, um den Lehm abzuklopfen.
»Leonie«, sagt Pop.
Ich wünschte, er würde mich anders nennen. Früher hat er mich »Mädchen« genannt. Wenn wir die Hühner gefüttert haben: Mädchen, ich weiß, dass du die Körner noch weiter werfen kannst. Wenn wir im Gemüsegarten Unkraut gejätet haben und ich stöhnte, weil mir der Rücken wehtat: In deinem Alter weißt du gar nicht, was Schmerzen sind, Mädchen, bei deinem jungen Rücken. Wenn ich Zeugnisse mit mehr Einsen und Zweien als Dreien nach Hause brachte: Bist ein kluges Mädchen. Er lachte, wenn er es sagte, manchmal lächelte er auch nur, und manchmal sagte er es mit einem neutralen Gesichtsausdruck, aber es fühlte sich nie wie ein Tadel an. Jetzt nennt er mich nur noch bei meinem Vornamen, und jedes Mal, wenn er ihn ausspricht, klingt es wie eine Ohrfeige. Ich werfe den Rest von Jojos Geburtstagskuchen in den Müll, fülle ein Glas mit Leitungswasser und trinke es sofort aus, um Pop nicht ansehen zu müssen. Ich spüre, wie mein Kiefer bei jedem Schluck knackt.
»Ich weiß, du willst nett sein und den Jungen abholen. Aber dir ist schon klar, dass er sonst in den Bus gesetzt wird, oder?«
»Er ist der Daddy von meinen Kindern, Pop. Ich muss ihn abholen.«
»Und seine Mama und sein Papa? Was, wenn die ihn abholen wollen?«
Daran hatte ich nicht gedacht. Ich stelle das leere Glas ins Waschbecken und lasse es dort stehen. Pop wird sich beschweren, weil ich mein Geschirr nicht abwasche, aber meistens schimpft er mit mir nicht wegen zwei Sachen auf einmal.
»Wenn sie ihn abholen wollten, hätte er mir das gesagt. Hat er aber nicht.«
»Warte doch, bis er wieder anruft, ehe du dich entscheidest.«
Ich erwische mich dabei, wie ich mir den Nacken massiere, und höre damit auf. Mir tut alles weh.
»Nein, das geht nicht, Pop.«
Pop geht einen Schritt von mir weg und schaut an die Küchendecke.
»Du musst mit deiner Mama reden, ehe du losfährst. Ihr sagen, dass du wegfährst.«
»Ist es so ernst?«
Pop greift sich einen Küchenstuhl und ruckelt daran, rückt ihn gerade, wird dann still.
Given-nicht-Given blieb den ganzen Abend bei mir, als ich bei Misty war. Er folgte mir sogar noch zum Auto und setzte sich auf den Beifahrersitz, stieg einfach durch die Tür ein. Als ich von Mistys Schotterauffahrt auf die Straße fuhr, blickte Given geradeaus. Auf halbem Weg nach Hause, auf einer der dunklen zweispurigen Landstraßen, wo der Asphalt so abgefahren ist, dass die Reifen knirschten und ich dachte, die Straße sei gar nicht gepflastert, wich ich einem Opossum aus. Es erstarrte mit buckligem Rücken im Scheinwerferlicht, und ich hätte schwören können, dass ich es fauchen hörte. Als meine Brust sich wieder entspannte, sich nicht mehr wie ein Kissen voller heißer Stecknadeln anfühlte, schaute ich wieder zum Beifahrersitz rüber, und Given war nicht mehr da.
»Ich muss hin. Wir müssen hin.«
»Warum?«, sagt Pop. Es klingt fast sanft. Die Sorge um uns macht seine Stimme eine Oktave tiefer.
»Weil wir seine Familie sind«, sage ich. Eine brennende Linie zieht sich von meinen Zehenspitzen über den Bauch hoch bis in meinen Hinterkopf, ein Hauch von dem, was ich gestern Abend gespürt habe. Und dann geht es weg, und ich bin starr, still, in einem Tief. Pop presst die Lippen fest zusammen, und er wird zu einem Fisch, der am Haken zieht, an der Angelschnur, gegen etwas kämpft, das viel stärker ist als er. Und dann ist es vorbei, und er blinzelt und schaut weg.
»Er hat mehr als eine, Leonie. Die Kids haben auch mehr als eine«, sagt Pop, und dann entfernt er sich von mir und ruft nach Jojo. »Junge«, sagt er. »Junge. Komm mal her.«
Die Hintertür knallt zu.
»Wo bist du, Junge?«
Es klingt wie eine Umarmung, so als würde Pop es singen.
»Michael kommt morgen raus.«
Mama drückt die Handflächen aufs Bett, zieht die Schultern hoch und versucht, ihr Becken zu heben. Sie verzieht das Gesicht.
»Tatsächlich?« Ihre Stimme ist leise. Nur ein Hauch.
»Ja.«
Sie lässt sich zurück ins Bett fallen.
»Wo ist dein Pop?«
»Draußen, mit Jojo.«
»Ich brauche ihn.«
»Ich muss noch einkaufen. Ich sag ihm Bescheid.«
Mama kratzt sich am Kopf und atmet hörbar aus. Ihre Augen schließen sich zu Schlitzen.
»Wer holt Michael ab?«
»Ich.«
»Und wer noch?«
»Die Kinder.«
Jetzt schaut sie mich wieder an. Ich wünschte, ich könnte das zischende Brennen wieder spüren, aber ich bin jetzt ganz runter und fühle mich nur noch leer. Hohl und ausgetrocknet. Beraubt.
»Deine Freundin fährt nicht mit?«
Sie meint Misty. Unsere Männer sind im gleichen Gefängnis, daher fahren wir alle vier Monate zusammen hoch. Ich hatte gar nicht dran gedacht, sie zu fragen.
»Ich hab sie nicht gefragt.«
Hier auf dem Land aufzuwachsen, hat mich einiges gelehrt. Zum Beispiel, dass nach dem ersten großen Überschwang des Lebens die Zeit an allem nagt: Sie lässt Maschinen rosten, Tiere so altern, dass sie Fell und Federn verlieren, sie lässt Pflanzen welken. Etwa einmal im Jahr sehe ich es auch bei Pop, sehe, wie er mit den Jahren immer schlanker wird, wie die Sehnen hervortreten und mit jedem Jahr fester und steifer werden. Wie seine indianischen Wangenknochen deutlicher hervortreten. Aber seit Mama krank ist, habe ich gelernt, dass Schmerzen das auch bewirken können. Sie können einen Menschen auffressen, bis er nur noch Haut und Knochen ist, mit einer Maserung aus Blut. Können einem die Eingeweide wegzehren und einen an den falschen Stellen anschwellen lassen: Mamas Füße unter der Decke sehen aus wie Ballons, die zum Bersten voll mit Wasser sind.
»Solltest du tun.«
Ich glaube, Mama versucht, sich auf die Seite zu drehen, ich sehe, wie sie sich anstrengt, aber dann rollt einfach nur ihr Kopf zur Seite, und sie schaut die Wand an.
»Mach den Ventilator an«, sagt sie, also rücke ich Pops Stuhl weg und schalte den Kastenventilator ein, der im Fenster klemmt. Die Luft bläst heulend durchs Zimmer, und Mama dreht das Gesicht wieder mir zu.
»Du fragst dich bestimmt…«, sagt sie und hält inne. Ihre Lippen sind dünn. Daran erkenne ich es am deutlichsten. An ihren Lippen, die immer voll und weich waren, vor allem, als ich noch ein kleines Mädchen war und sie mich auf die Schläfe geküsst hat. Oder auf den Ellbogen. Die Hand. Manchmal, nach dem Baden, sogar auf die Zehen. Jetzt sind diese Lippen in dem eingesunkenen Areal ihres Gesichts nur noch farblich abweichende Hautstellen.
»… warum ich nicht schimpfe.«
»Ein bisschen«, sage ich. Sie schaut auf ihre Zehen.
»Pop is stur. Du bist stur.«
Ihr Atem geht stotternd, und mir wird klar, dass es ein Lachen ist. Ein mattes Lachen.
»Ihr regt euch immer auf«, sagt sie.
Sie schließt wieder die Augen. Ihr Haar ist so schütter, dass ich ihre Kopfhaut sehen kann: blass, von blauen Adern durchzogen, wellig und furchig, uneben wie eine selbstgetöpferte Schale.
»Du bist jetzt erwachsen«, sagt sie.
Ich setze mich hin und verschränke die Arme. Dadurch treten meine Brüste leicht hervor. Ich erinnere mich an den Schrecken mit zehn, als sie anfingen zu wachsen, vorstanden wie kleine Steine. Wie ich diese fleischigen Knoten als Verrat empfand. Als hätte mich jemand angelogen darüber, wie das Leben sein würde. Als hätte Mama mir nie gesagt, dass ich erwachsen werden würde. In ihren Körper hineinwachsen würde. Zu ihr heranwachsen würde.
»Du liebst, wen du liebst. Du machst, was du willst.«
Mama schaut mich an, und nur ihre Augen sehen in dem Moment voll aus, so rund wie immer, wenn ich mich nah genug zu ihr beuge, beinahe nussbraun, und in den Augenwinkeln sammelt sich Wasser. Das Einzige, was die Zeit nicht aufgefressen hat.
»Du wirst fahren«, sagt sie.
Jetzt weiß ich es. Weiß, dass meine Mutter Given folgen wird, dem Sohn, der zu spät gekommen und zu früh gegangen ist. Ich weiß, dass meine Mutter im Sterben liegt.
Given spielte in seinem letzten Schuljahr, im Herbst vor seinem Tod, leidenschaftlich und zielstrebig Football. Jedes Wochenende kamen Scouts von regionalen und staatlichen Colleges, um ihn spielen zu sehen. Er war groß und muskulös, und sobald er das Leder in der Hand hatte, flogen seine Füße nur so über den Boden. Obwohl er es mit dem Football sehr ernst meinte, war er, wenn er nicht auf dem Platz war, äußerst gesellig. Er hat zu Pop mal gesagt, seine Teamkameraden, Schwarze und Weiße, wären wie Brüder für ihn. Dass es ihm so vorkam, als zöge die Mannschaft jeden Freitagabend in den Krieg, als würden sie gemeinsam zu etwas Neuem werden, etwas, das größer war als sie selbst. Pop schaute auf seine Schuhe und spuckte ein braunes Rinnsal in den Sand. Given sagte, er wollte mit seinen weißen Teamkameraden hoch zum Kill fahren, zu einer Party, und Pop riet ihm davon ab: Sie schaun dich an und sehn das Fremde, Junge. Spielt keine Rolle, was du siehst. Kommt nur drauf an, was sie tun, hatte Pop gesagt und dann den ganzen Priem ausgespuckt. Given hatte mit den Augen gerollt, sich an die Kühlerhaube des 77er Nova gelehnt, den sie gerade für ihn reparierten, und gesagt: Okay, Pop. Zu mir hochgeschaut und mir zugezwinkert. Ich war nur froh, dass Pop mich nicht reingeschickt hatte, froh, dass ich ihnen Werkzeuge reichen und Wasser holen und beim Arbeiten zusehen durfte, denn ich wollte auf keinen Fall ins Haus gehen, weil ich fürchtete, Mama könnte mir mal wieder eine ihrer Lektionen in Pflanzenkunde erteilen wollen. Kräuter und Arzneien, hatte sie zu mir gesagt, als ich sieben wurde, das kann ich dir beibringen. Ich hoffte, irgendjemand, Big Henry oder einer der Zwillinge, würde vorbeikommen, von der Straße oder aus dem Wald auftauchen, damit noch jemand da wäre, mit dem wir reden konnten.
Given hörte nicht auf Pop. Ende des Winters, im Februar, beschloss er, mit den Weißen Jungs oben im Kill jagen zu gehen. Er sparte Geld und kaufte sich einen schicken Bogen. Er hatte mit Michaels Cousin gewettet, dass er mit Pfeil und Bogen schneller einen Bock erlegen könnte, als der mit einem Gewehr. Michaels Cousin war ein kleiner Typ mit einem schielenden Auge, der Cowboystiefel und Bier-T-Shirts wie eine Uniform trug; er war der Typ, der mit Highschool-Kids rumhing und mit Schülerinnen ausging, obwohl er schon Anfang dreißig war. Given trainierte mit Pop. Übte stundenlang hinten auf dem Grundstück schießen, obwohl er lieber Hausaufgaben hätte machen sollen. Fing an, genauso aufrecht wie Pop zu gehen, jede Faser in ihm so straff gespannt wie sein Bogen, bis er schließlich mit dem Pfeil genau in die Mitte der zwischen zwei Kiefern gespannten Leinwand traf, die fünfzig Meter entfernt war. Er gewann seine Wette in der Morgendämmerung eines kalten, bedeckten Wintertages, teils weil er richtig gut war, teils weil alle anderen, die ganzen Jungs, mit denen er Football spielte, in der Umkleide raufte und auf dem Spielfeld bis zum Umfallen gemeinsam schwitzte, an diesem Morgen schon zum Frühstück statt Orangensaft Bier getrunken hatten, weil sie glaubten, Given würde verlieren.
Damals kannte ich Michael noch nicht; ich hatte ihn ein paar Mal in der Schule gesehen, mit seinen dicken blonden Locken, die fast schon verfilzt aussahen, weil er sie nie kämmte. Seine Ellbogen, Hände und Füße waren aschfahl. Michael ging an dem Morgen nicht mit zum Jagen, weil er keine Lust hatte, so früh aufzustehen, aber er hörte davon, als sein Onkel mitten am Tag zu Big Joseph kam, während der Cousin langsam wieder nüchtern wurde und ein Gesicht machte, als habe er etwas Faules gerochen, eine vergiftete Ratte, die die Winterkälte ins Haus getrieben hatte, und der Onkel sagte: Er hat den Nigger erschossen. Dieser verdammte Blödmann hat den Nigger erschossen, weil er ihn besiegt hat. Und dann, weil Big Joseph jahrelang Sheriff gewesen war: Was machen wir jetzt? Michaels Mama sagte, sie sollten die Polizei rufen. Big Joseph beachtete sie gar nicht, und sie fuhren alle zusammen zurück in den Wald, liefen eine Stunde lang tief hinein und fanden Given, der ausgestreckt und reglos auf den Kiefernnadeln lag, in einer Pfütze aus dunklem Blut. Um ihn herum überall Bierdosen, die die Jungs hastig weggeworfen hatten, als sie abgehauen waren, nachdem der Cousin mit dem Schielauge gezielt und abgedrückt und der Schuss die Stille zerrissen hatte. Sie waren in alle Richtungen geflohen, wie die Kakerlaken vor dem Licht. Der Onkel hatte seinem Sohn eine runtergehauen, und dann noch eine. Du verdammter Idiot, hatte er gesagt. Es ist nicht mehr so wie früher. Und der Cousin hatte die Hände gehoben und gemurmelt: Er hätte verlieren sollen, Pa. Hundert Meter weiter lag der Bock auf der Seite, einen Pfeil im Hals, einen zweiten in der Flanke, genauso kalt und steif wie mein Bruder. Ihr Blut schon fast geronnen.
Jagdunfall, sagte Big Joseph, als sie wieder zu Hause waren und am Tisch saßen, das Telefon in der Hand, ehe der Vater des Cousins, genauso klein wie sein Sohn, aber mit synchronen Augen, die Polizei anrief. Jagdunfall, sagte der Onkel am Telefon, während das Licht der kühlen Mittagssonne durch die Vorhänge schnitt. Jagdunfall, sagte der schieläugige Cousin vor Gericht, das gute Auge auf Big Joseph gerichtet, der hinter dem Anwalt des Jungen saß, mit einer Miene so reglos und hart wie ein Porzellanteller. Aber sein schwaches Auge schweifte zu Pop und mir und Mama herüber; wir saßen alle nebeneinander hinter dem Staatsanwalt, einem Staatsanwalt, der sich auf einen Deal einließ, bei dem der Cousin zu drei Jahren in Parchman und zwei Jahren Bewährung verurteilt wurde. Ich frage mich, ob Mama wohl ein Summen von dem kranken Auge des Cousins vernommen hat, in seinem Umherwandern Reue gespürt hat, aber sie schaute nur durch ihn hindurch, während ihr ununterbrochen die Tränen über die Wangen liefen.
Ein Jahr nach Givens Tod pflanzte Mama einen Baum für ihn. An jedem Todestag einen, sagte sie mit vor Kummer brechender Stimme. Wenn ich lang genug lebe, wird hier ein Wald stehn, sagte sie, ein raunender Wald. Der von Wind und Blütenstaub und Schädlingsbefall erzählt. Dann schwieg sie, setzte den Baum in die Mulde und fing an, die Erde um die Wurzeln festzuklopfen. Ich hörte sie durch ihre Fäuste: Die Frau, die Marie-Therese unterrichtet hat – die konnte sehen. Alte Frau, sah fast Weiß aus. Tante Vangie. Sah die Toten. Marie-Therese hatte die Gabe nich. Ich auch nich. Sie grub ihre roten Fäuste tief in die Erde. Ich träum davon. Ich träum davon, Given zu sehn, wie er in seinen Stiefeln zur Tür reinkommt. Aber dann wach ich auf. Und sehe nichts. An der Stelle fing sie an zu weinen. Dabei weiß ich, dass es da is. Gleich hinter dem Schleier. Sie kniete so lange dort auf dem Boden, bis ihre Tränen versiegt waren, dann richtete sie sich auf und wischte sich übers Gesicht, beschmierte es überall mit Blut und Erde.
Vor drei Jahren, nach dem Koksen, habe ich Given zum ersten Mal gesehen. Es war nicht meine erste Line, aber Michael war gerade ins Gefängnis gekommen. Ich hatte mir angewöhnt, es oft zu tun; jeden zweiten Tag beugte ich mich über einen Tisch, schob Lines zusammen und inhalierte. Ich weiß, das war falsch: Ich war schwanger. Aber ich war wehrlos gegen das Verlangen, zu spüren, wie mir der Koks in die Nase stieg, direkt ins Gehirn schoss und allen Kummer und alle Verzweiflung über Michaels Abwesenheit wegbrannte. Als Given zum ersten Mal auftauchte, war ich auf einer Party im Kill, und mein Bruder kam einfach hereinspaziert, ohne Kugellöcher in der Brust oder im Hals, unversehrt und langgliedrig wie immer. Aber nicht grinsend. Er trug kein Hemd, und sein Nacken und Gesicht waren gerötet, so als wäre er gerannt, aber seine Brust war reglos wie Stein. So reglos wie er gewesen sein muss, nachdem Michaels Cousin ihn erschossen hatte. Ich dachte an Mamas kleinen Wald, an die zehn Bäume, die sie in einer immer größer werdenden Spirale bislang gepflanzt hatte, einen an jedem Todestag. Ich starrte Given an und knirschte mit den Zähnen, bis mein Zahnfleisch wund wurde. Ich verschlang ihn mit meinen Blicken. Er versuchte, mit mir zu reden, aber ich verstand ihn nicht, und er wurde immer frustrierter. Er setzte sich vor mir auf den Tisch, direkt auf den Spiegel mit dem Koks darauf. Ich konnte mich nicht mehr runterbeugen, ohne mit dem Gesicht in seinem Schoß zu landen, also saßen wir nur da und starrten uns an, und ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, damit meine Freunde nicht dachten, ich hätte den Verstand verloren. Sie grölten die Countrysongs mit, knutschten unbekümmert wie Teenager in dunklen Ecken oder liefen mit untergehakten Armen in Zickzackreihen nach draußen in die Dunkelheit. Given guckte mich an wie damals, als wir klein waren und ich die neue Angelrute zerbrochen hatte, die er gerade erst von Pop bekommen hatte: mordlüstern. Als ich runterkam, rannte ich fast zu meinem Auto. Ich zitterte so stark, dass ich kaum den Schlüssel ins Zündschloss bekam. Given stieg neben mir ein, auf den Beifahrersitz, wandte den Kopf und starrte mich mit steinerner Miene an. Ich höre auf, sagte ich. Ich schwöre, ich werde es nie wieder tun. Er fuhr mit mir bis nach Hause, und ich ließ ihn im Auto sitzen, während die Sonne aufging und den Rand des Horizonts in weiches Licht tauchte. Ich schlich in Mamas Schlafzimmer und betrachtete sie im Schlaf. Staubte ihren Altar ab: ihren Rosenkranz, der über der Marienfigur in der Ecke hing, machte mich an den blaugrauen Kerzen, den Flusskieseln, den drei getrockneten Rohrkolben und der einzelnen Yamswurzel zu schaffen. Als ich Givennicht-Given zum ersten Mal sah, erzählte ich meiner Mama nichts davon.
Durch einen Telefonanruf bei Michaels Eltern würde ich alles erfahren, was ich wissen musste. Ich könnte einfach zum Hörer greifen, die Nummer wählen und beten, dass Michaels Mutter ranging. Es wäre unser fünftes Gespräch, und ich würde sagen: Hallo, Mrs Ladner, ich weiß nicht, ob Sie Bescheid wissen, aber Michael kommt morgen raus, und ich und die Kinder und Misty fahren ihn abholen, Sie brauchen also nicht hin, okay, Ma’am, auf Wiederhören. Aber ich will nicht, dass Big Joseph rangeht und einfach auflegt, nachdem ich nur in die Sprechmuschel geatmet habe, ohne ein Wort zu sagen, während er auch kein Wort sagt. Immerhin könnte ich dann sicher sein, dass er Mrs Landner rangehen lassen würde, wenn ich es noch mal versuchte, damit sie sich mit dem Anrufer rumschlagen müsste, wer es auch sein mochte: Witzbold, Geldeintreiber, verwählt, die Schwarze Kindsmutter von seinem Sohn. Aber ich will mit alldem nichts zu tun haben: will weder in abgehackten Sätzen mit Michaels Mutter reden noch Big Josephs bleiernes Schweigen ertragen. Deshalb fahre ich landeinwärts zum Kill, den Kofferraum mit großen Wasserkanistern und Baby-Feuchttüchern und Schlafsäcken und Taschen mit Klamotten vollgepackt, um eine Nachricht in den Briefkasten am Ende ihrer Auffahrt zu stecken, eine atemlose Nachricht. Dasselbe, was ich hastig gesagt hätte. Ohne Punkt und Komma. Unterschrieben mit: Leonie.
Michael hatte noch nie ein Wort mit mir gesprochen. Eines Tages in der Schule, ein Jahr nach Givens Tod, setzte sich Michael in der Mittagspause neben mich auf den Rasen, berührte meinen Arm und sagte: Tut mir leid, dass mein Cousin so ein blöder Idiot ist. Ich dachte, das war’s. Dass Michael nach dieser Entschuldigung weggehen und nie wieder mit mir sprechen würde. Aber so war es nicht. Er fragte mich ein paar Wochen später, ob ich mit ihm Angeln gehen wollte. Ich sagte Ja und spazierte einfach durch die Haustür hinaus. Es war nicht mehr nötig, mich wegzuschleichen, meine Eltern waren völlig in ihrer Trauer versunken. Auf die Spinne fixiert: blind für das Netz. Als Michael und ich uns zum ersten Mal trafen, gingen wir mit unseren Angeln auf den Pier hinaus, weg vom Strand; ich hatte Givens Angel dabei und trug sie vor mir her wie eine Opfergabe. Wir redeten über unsere Familien, über seinen Vater. Er sagte: Er’s alt – ’n alter Dickschädel. Mehr brauchte er nicht zu sagen, ich wusste auch so, was er meinte. Er wäre stocksauer, wenn er wüsste, dass ich mit dir hier bin und dass ich dich küssen werde, bevor der Abend rum ist. Oder, kürzer gesagt: Nigger bleiben für ihn Nigger. Und ich schluckte die bittere Galle, dass sein Vater so war, und ließ sie durch mich hindurchgleiten, denn der Vater ist nicht der Sohn, dachte ich. Denn wenn ich Michael in der scheckigen Dunkelheit unter dem Laubendach am Ende des Piers anschaute, konnte ich den Schatten von Big Joseph in ihm erkennen; ich betrachtete seinen langen Hals und seine langen Arme, seinen schlanken, muskulösen Körper, den schmalen Brustkorb, und ich konnte sehen, wie die Jahre ihn aufweichen und seinem Vater angleichen würden. Wie Fett ihn umlagern würde, wie er sich in seinem stattlichen Knochengerüst einrichten würde, ähnlich wie ein Haus sich in die Erde schmiegt. Ich musste mir immer wieder sagen: Sie sind nicht gleich. Michael beugte sich über unsere Angeln, und seine Augen veränderten ihre Farbe wie die Wolkenberge am Himmel vor einem Unwetter: tiefdunkles Blau, Wassergrau, Spätsommergrün. Er war gerade so groß, dass sein Kinn, wenn er mich umarmte, auf meinem Kopf lag und ich unter ihm geborgen war. Als gehörte ich dorthin. Und ich wollte Michaels Mund auf mir spüren, denn von dem Moment an, als ich im Schatten des Schulschildes gesessen hatte und ihn über den Rasen auf mich zukommen sah, hatte er mich gesehen. Hatte durch Haut in der Farbe von Kaffee ohne Milch, durch schwarze Augen und durch pflaumenbraune Lippen hindurchgeschaut und mich gesehen. Sah die wandelnde Wunde, die ich war, und kam, um Balsam für mich zu sein.
Big Joseph und Michaels Mutter wohnen auf einem Hügel, in einem niedrigen Landhaus mit weißen Wänden und grünen Rollläden. Es wirkt groß. In der Auffahrt stehen zwei Lieferwagen, strahlen neue, glänzende Pick-ups, die die Sonne reflektieren und Lichtblitze in alle Richtungen schicken. Ein roter Lieferwagen und ein weißer. Drei Pferde grasen auf den parzellierten Wiesen, die ans Haus angrenzen, und eine Schar Hühner rennt über den Hof, duckt sich unter die Pick-ups und verschwindet hinter dem Haus. Ich fahre rechts ran und halte kurz vor ihrem Briefkasten; der grasbewachsene Seitenstreifen am Straßenrand ist hier nicht so breit und grenzt an einen mindestens hüfttiefen Graben, sodass ich aussteigen und zu Fuß zum Briefkasten gehen muss, statt einfach dicht ranzufahren und meinen Zettel vom Wagen aus einzuwerfen. Es ist ein paar Tage her, seit es zuletzt geregnet hat. Als ich zum Kasten gehe, knirscht das trockene Gras unter meinen Füßen. Es sind keine anderen Autos auf dieser Straße unterwegs. Sie wohnen weit oben im Kill, wo bloß noch wenige Häuser und Wohnwagen auf den weiten Feldern stehen, am Ende einer Sackgasse.
Gerade als ich die Briefkastenklappe öffne, höre ich ein Summen, das zu einem Brummen anschwillt, aus dem ein Dröhnen wird, und dann kommt ein Mann auf einem riesigen Aufsitzrasenmäher mit Verdeck ums Haus gefahren, eins von diesen superteuren Modellen, die so groß wie ein Traktor sind. So einer kostet so viel wie mein Auto. Ich lege den Zettel in den Briefkasten. Der Mann fährt auf das nördliche Ende der Grasfläche zu, biegt nach links ab und fährt langsam in Richtung Straße. Er will anscheinend den Rasen von oben nach unten mähen, in langen, geraden Streifen.
Ich fasse den Türgriff an, ziehe die Autotür auf, und sie quietscht, als Metall gegen Metall schabt. »Mist.«
Er schaut hoch. Ich steige ins Auto.
Der Rasenmäher wird schneller. Ich drehe den Schlüssel um. Der Motor stottert und geht aus. Ich drehe den Schlüssel zurück, starre auf das Armaturenbrett, als könne ich den Motor zum Anspringen bringen, wenn ich nur lange genug hinschaue. Vielleicht hilft Beten.
»Mist, Mist, Mist.«
Ich drehe den Schlüssel erneut um. Der Motor heult auf und springt an. Der Mann, der, wie ich jetzt erkenne, Big Joseph ist, hat seinen Plan, zuerst den oberen Teil des Gartens zu mähen, aufgegeben und fährt jetzt diagonal über die Grasfläche, um schneller bei mir und dem Briefkasten zu sein. Und dann zeigt er mit dem Finger, und ich sehe das Schild, das knapp einen Meter vom Briefkasten an einen Baum genagelt ist. Betreten verboten.
Er beschleunigt.
»Verdammt noch mal!«
Ich schalte auf Drive, schaue nach hinten, ob die Straße frei ist, und sehe ein Auto kommen, einen grauen SUV. Angst steigt in mir auf, bis zu den Schultern, dann den Nacken hoch, brodelnd und erstickend. Ich weiß gar nicht, wovor ich mich fürchte. Was kann er schon machen, außer mich zu beschimpfen? Was kann er tun? Ich bin nicht in seiner Auffahrt. Gehört der Straßenrand nicht dem County? Aber bei dem Tempo, mit dem er mich mit dem Rasenmäher ansteuert, der Art und Weise, wie Big Joseph auf den Baum zeigt, wie dieser Baum, eine Sumpfeiche, aufragt und seine Äste, die fast schwarzen Äste mit den Millionen von dunkelgrünen Blättern bis über die Straße ausbreitet, der Entschlossenheit, mit der dieser Mann auf mich zugerast kommt, muss ich unweigerlich an Gewalt denken. Ich steige aufs Gaspedal und lenke den Wagen auf die Straße, das Auto hinter mir schlingert und hupt, aber das ist mir egal. Die Automatik wechselt jaulend von einem Gang in den nächsten. Ich schwenke herum und beschleunige. Der graue SUV ist in eine Auffahrt gefahren, aber der Fahrer winkt aus dem Fenster, und Big Joseph fährt unter dem Baum durch, hält am Briefkasten, wo ich gerade gewesen bin, klettert von seinem Mäher und geht mit großen Schritten auf den Kasten zu. Er hat vom Mähersitz etwas mitgenommen, ein Gewehr, das dort gelegen hat, etwas, das er immer dabei hat und mitnimmt, falls er im Wald auf rammelnde Wildschweine stößt. Aber nicht ihretwegen diesmal. Meinetwegen.
Als ich an ihm vorbeifahre, strecke ich meinen linken Arm aus dem Fenster. Balle die Hand zur Faust. Hebe den Mittelfinger. Ich sehe meinen Bruder auf seinem letzten Foto: eins von seinem achtzehnten Geburtstag, auf dem er mit dem Rücken an der Küchentheke lehnt, während ich ihm den Süßkartoffel-Pekannusskuchen, seinen Lieblingskuchen, hinhalte, damit er die Kerzen ausblasen kann; er hat die Arme vor der Brust verschränkt, das Lächeln in seinem schwarzen Gesicht ist weiß. Wir lachen alle. Ich beschleunige so stark, dass die Reifen durchdrehen, es nach verbranntem Gummi riecht und eine Qualmwolke aufstiebt. Ich hoffe, Big Joseph kriegt einen Asthmaanfall. Ich hoffe, er erstickt daran.