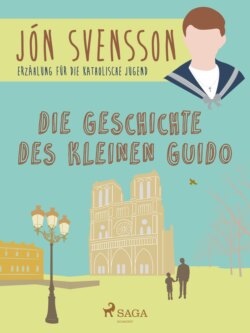Читать книгу Die Geschichte des kleinen Guido - Jón Svensson - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Guidos erste Lebensjahre.
Оглавление„Welche Zartheit, welche Frische in dieser Kinderseele!“
(Kardinal Cerretti.)
Der kleine Guido de Fontgalland gehört einer reichen, vornehmen Pariser Familie an. Er ist geboren am 30. November 1913.
Seine beiden Eltern, der Graf und die Gräfin de Fontgalland, wohnen in Paris, rue Vital Nr. 37.
Man darf nicht denken, Guido sei von Anfang an ein kleiner Heiliger gewesen, dem nichts Dummes und Unrechtes eingefallen wäre. O nein! Seine Mutter bemerkt in einer kleinen Lebensgeschichte, die sie kurz nach dem Tode ihres Kindes geschrieben hat, Guido sei zwar prächtig herangewachsen, er habe aber daneben manche Unarten an sich gehabt, wenigstens in den ersten Kinderjahren.
Tatsächlich war der kleine Junge von Natur aus ein kleiner Brausekopf, ein unruhiges Bürschlein, das immer etwas treiben musste, und das zuweilen die Geduld seiner Mutter auf eine harte Probe stellte. Eines ist jedoch untadelig an ihm gewesen: er war immer sehr ehrlich, aufrichtig, offen und zuverlässig.
Wenn er in seiner ungestümen Art irgend etwas verbrochen hatte, dann ging er sofort zu seiner Mutter, klagte sich selbst seiner kleinen Untaten an und nahm jede Strafe, die ihm dafür auferlegt wurde, bereitwillig auf sich.
Wie alle gesunden Kinder hat er schon früh alles wissen wollen, und er bestürmte darum seine Mutter und alle, die um ihn waren, täglich mit tausend Fragen.
Als er acht Monate alt war, lernte er sein erstes Wort aussprechen. Es hiess nicht, wie bei den meisten Kindern, „Mama“, sondern „Sesu“. So sprach er nämlich damals den Namen Jesus aus.
So jung er noch war, hatte er doch von seiner Mutter bald gelernt, dass der kleine Jesus sein allerbester Freund sei.
Von da an bewahrte das kleine Kind eine unaussprechlich zarte Zuneigung und Liebe zum „kleinen Jesus“ — „Le petit Sésu“, wie er ihn damals nannte.
Und als er grösser wurde, behielt er die Gewohnheit bei, den Heiland immer „den kleinen Jesus“ zu nennen.
Bevor er gehen konnte, führte ihn das Kindermädchen oft in seinem kleinen Kinderwägelchen draussen spazieren. Sooft sie ihm auf dem Wege vom Jesuskind sprach, sandte der kleine Strampler ein Kusshändchen zum Himmel hinauf.
Guido wurde grösser, lernte gehen und sprechen, und mit dem Alter wurde er immer lebhafter und unbändiger. Aber auch seine Liebe zum Heiland nahm immer zu.
Schon steht das Büblein kräftig vor uns und streckt sich, als ob es über alles hinauswachsen wollte. In dem weissen Gesichtchen schimmert ein frisches Rosa; sein dichtes Haar ist kastanienbraun, die Stirn schön und edel, und seine Augen sind ungewöhnlich gross und dunkelblau.
Wie ein kleiner Engel sieht er aus, und er bleibt trotz seiner Wildheit die Freude seiner Eltern und Grosseltern. Er hatte oft die drolligsten Einfälle, und alle, die ihn kannten, hatten den kleinen Spassmacher lieb.
Als er in seinem dritten Jahre war, hörte er, dass er bald einen kleinen Bruder bekommen werde.
Guido freute sich sehr darüber, denn mit der Ankunft des kleinen Bruders hoffte er einen lieben Spielkameraden zu erhalten. Er betete von nun an täglich beim Morgen- und Abendgebet, dass der kleine Bruder bald kommen möge, und ganz besonders, dass es auch wirklich ein richtiger Bruder werde, nicht aber eine Schwester.
„Aber warum willst du denn keine Schwester, Guido?“ fragte ihn seine Mutter.
„Weil ich die kleinen Mädchen nicht leiden kann“, sagte Guido.
„Und warum denn nicht?“
„Weil man immer nachgeben muss, wenn man mit ihnen spielt“, antwortete er; „mit einem kleinen Bruder ist es aber anders. Er wird immer das tun, was ich will.“
Man sieht, ein wenig herrschsüchtig konnte der kleine Guido in seinen ersten Lebensjahren schon sein.
Sein Gebet wurde erhört: am 16. Mai 1916 kam ein nettes kleines Brüderchen, und es wurde Markus genannt.
Das erste Zusammentreffen der beiden Brüder war putzig.
Als Guido das winzig kleine Kind erblickte, rot, dick, mit geschlossenen Augen und offenem Mund..., schaute er es erst eine lange Weile schweigend an. Schliesslich sagte er ganz enttäuscht:
„Wie! Soll das da mein Brüderchen sein? Das kleine Ding, das sich da so bewegt...?“
„Aber gewiss, Guido.“
„Ja, wann werden wir dann zusammen spielen können, wir beide?“
Man versuchte ihm klar zu machen, dass Markus noch zu klein sei. Er müsse noch wachsen und allerlei lernen.
Das alles schien Guido zunächst nicht sehr zu gefallen, und er erwiderte:
„Das wird aber lange dauern mit so einem. Könnte man ihn nicht umtauschen gegen einen grösseren?“
Davon wollte aber die Mutter nichts wissen, und Guido musste sich zufrieden geben mit dem kleinen Markus, wie er war.
Da übrigens das neue Brüderchen seinem älteren Bruder einen gewaltigen, mit blendend weissem Plüsch überzogenen Bären als Geschenk mitgebracht hatte, fand Guido sich damit ab.
Der Bär, den er „Mumuth“ nannte, musste den kleinen Markus als Spielkamerad vorläufig ersetzen, bis dieser gross genug sein würde.
Bald darauf sollte Markus getauft werden. Guido war natürlich dabei und schaute aufmerksam zu.
Als er plötzlich sah, dass der Geistliche Wasser aus einem Gefäss auf den Kopf des kleinen Bruders zu giessen anfing, konnte Guido sich nicht mehr zurückhalten; er fuhr wie wild auf und rief mit seiner durchdringenden, hellen Kinderstimme in die Kirche hinein:
„Ich will nicht, dass man meinen kleinen Bruder nass macht, er wird sich erkälten!“
Den Andächtigen, die in der Kirche waren, wird es wohl nicht ganz leicht gewesen sein, bei einer solchen Unterbrechung ihren Ernst zu bewahren.
Aber da war nichts zu machen; so war nun einmal der kleine Guido: er dachte nicht lange hin und her. Wenn ihm etwas nicht passte, dann sagte er es gerade heraus.
Zuweilen ging er zu seinem kleinen Bruder hin, um zu sehen, wie es mit dem Wachsen vorangehe. Er schüttelte den Kopf und fand, dass er nur kleine Fortschritte mache.
Eines Tages, nach so einem Besuche, ging Guido in sein Zimmerchen zurück, stellte seinen Bären vor sich auf den Boden und fing mit ihm zu plaudern an. Er meinte, er sei allein. Hinter der Zimmertür stand jedoch jemand, der alles mitanhörte, was Guido zu seinem vierbeinigen Spielkameraden sagte:
„Du, Mumuth! redete er ihn an, „weisst du was! Mein kleiner Bruder, der schreit, der schläft, dann beisst er die Mutter.... Das ist doch kein Leben, so was...“
Man sieht, der kleine Junge war kein Kopfhänger.
Einer seiner schönsten Vorzüge war, wie gesagt, seine Wahrheitsliebe. Alle, die ihn gekannt haben, sagen, dass er nie gelogen habe, nicht einmal im Scherz.
Kurz vor seinem Tode konnte er von sich selbst die wunderschönen Worte sagen:
„Nie habe ich eine Unwahrheit gesagt.“
Jeder, der ihn kannte, wusste, dass Guido damit nicht prahlen, sondern nur seine Freude an der Ehrlichkeit aussprechen wollte. Von ganz klein an, sagt seine Mutter, nahm er es immer peinlich genau mit der Wahrheit. Das ging so weit, dass er lieber grosse Schmerzen dulden wollte, als eine Unwahrheit sagen.
Einmal wollten die Besuche im Hause der Eltern nicht aufhören. Die Mutter wusste bald nicht mehr, wo ein und aus. Deshalb sagte sie zu ihrem Zimmermädchen:
„Wenn jemand an der Tür klingelt und nach mir verlangt, dann sage, ich sei ausgegangen.“
Kaum hatte die Gräfin diesen Befehl gegeben, als Guido aufsprang, ihr um den Hals fiel und rief:
„O Mutter, warum zwei Unwahrheiten sagen, die deine und die des Zimmermädchens? — Weisst du, Mutter, ich möchte lieber Zahnweh haben, als so etwas tun.“
Zahnweh war die einzige Krankheit, die Guido bis dahin kannte. — Und diesen Schmerz zog das wahrheitsliebende Kind dem Schatten einer Unwahrheit vor.
Niemals suchte er seine Fehler zu vertuschen oder sich auf unehrliche Weise zu entschuldigen. Wenn er beim Spielen irgend einen Gegenstand aus Unachtsamkeit zerbrochen hatte, was ihm leider oft genug passierte, dann ging er mutig zu seiner Mutter hin, um ihr jedesmal zu sagen: „Ich habe es getan!“ obwohl er wusste, dass er dafür einen scharfen Verweis oder auch eine empfindliche Strafe bekommen werde.
Und wenn er dann gestraft worden war, zum Beispiel durch Entziehung von Nachtisch beim Mittagessen, so rutschte der kleine dreijährige Junge gleich nach der Mahlzeit von seinem Stuhl herunter, um fortzugehen, sobald die süsse Speise aufgetragen wurde.
„Warum gehst du schon fort?“ fragte die Mutter.
„Ich darf ja keinen Nachtisch bekommen.... Deshalb will ich auch nicht davon essen.“
Einmal tummelten sich die beiden Kinder im Garten herum. Man hatte ihnen verboten, mit den Treibhausgiesskannen zu spielen.
„Es wäre aber doch so spassig, ein wenig Wasser auf die Pflanzen zu giessen...!“ meinten die beiden Wildfänge.
Und wirklich gaben sie der Versuchung nach. „Einmal ist keinmal!“ dachten sie wohl. Und während das Kindermädchen auf einem Stuhl schlummerte, liefen sie hin, um die verbotenen Giesskannen zu nehmen. Diese hatten aber in der brennenden Mittagssonne gestanden und waren so heiss, dass die kleinen Sünder sie nicht anfassen konnten.
Am Abend lobte das Kindermädchen, welches nichts von dem beabsichtigten kleinen Streich gemerkt hatte, die beiden Knaben, dass sie den ganzen Tag so brav und gehorsam gewesen seien.
Dieses unverdiente Lob konnte Guido aber nicht ertragen. Er erhob einen energischen Einspruch und sagte:
„Nein, Fräulein, wir sind ungehorsam gewesen. Wir haben die Giesskannen holen wollen. Sie waren aber so heiss, dass wir sie nicht anrühren konnten. So ist es gewesen.“
Man hätte dem Abendgebet der beiden Kinder beiwohnen sollen! — Sie beteten laut bis zur Stelle, wo es heisst: „...erforschen wir uns über die Fehler, die wir heute begangen haben....“
Da entstand zuerst eine Pause. Sie dachten nach. — Wenn dann die Fehler und Sünden nicht rasch genug zum Vorschein kommen wollten, da halfen sie sich gegenseitig, und die Andachtsübung wurde immer lauter und lauter:
„Wie!“ sagte Markus zu Guido, „du meinst brav gewesen zu sein? Aber du hast mir doch mein Spielzeug zerbrochen. Du hast auch zu dem Zimmermädchen Denise ‚dumm‘ gesagt. Und dann hast du mir eine Ohrfeige gegeben....“
Der kleine Angeklagte, der immer bei der Wahrheit bleiben wollte, meinte die Sachen richtigstellen zu sollen. Er belehrte den kleinen Bruder:
„Dein Spielzeug, Markus? Das war nur, um zu sehen, was drinnen war. — Und die Denise? Es ist keine Sünde, sie ‚dumm‘ zu nennen, denn sie ist doch ganz schrecklich dumm. — Und wenn ich dir eine Ohrfeige gegeben habe, so habe ich es nur deshalb getan, weil du sie verdient hast. — Das waren doch keine Sünden, Markus.“
Auf diese Gründe konnte der kleine Markus natürlich keine Antwort finden.
Obgleich es sich hier nur um kleine Kindereien handelt, zeigen doch die Worte des noch ganz kleinen Guido, wie er bestrebt war, immer redlich zu sein und geradeaus zu gehen und über sein kindliches Tun und Handeln sich Rechenschaft zu geben.
Als Guido in der Biblischen Geschichte lernen sollte, wie Jakob seinen alten Vater Isaak täuschte, erklärte er entrüstet:
„Das will ich nicht lernen, denn Jakob hat eine Unwahrheit gesagt.“
Guidos Wahrheitsliebe zeigte sich auch durch die peinlichste Redlichkeit in Geldsachen.
Seine Mutter erzählt, dass er sie oft um Geld bitten musste, als er Gymnasiast geworden war. Er brauchte Schreibmaterialien: Bleistift, Radiergummi, Löschpapier u. dgl. Aber nie unterliess er es, ihr nach dem Einkauf den Rest des Geldes zurückzubringen. Nie wäre es ihm eingefallen, auch nur das kleinste Geldstück für sich zurückzubehalten, um sein Taschengeld zu vermehren.
In dem Schrank, worin Guido sein Spielzeug aufbewahrte, sieht man heute noch unter anderem auch ein grosses Kinderbuch mit Geschichten und vielen bunten Bildern.
Wenn man sich das Buch ansieht und darin herumblättert, da entdeckt man, dass der kleine Junge neben der Überschrift einer jeden Geschichte sein Urteil mit Bleistift niedergeschrieben hat.
Dieses Urteil besteht immer nur aus den Worten: Vraie oder Pas vraie, das heisst: „Wahr“ oder „Nicht wahr“.
Einmal jedoch war er nicht ganz klar darüber, was er dazu sagen sollte. Und da schrieb er ganz ehrlich hinter die Worte „Nicht wahr“ den Zusatz: „Aber ich bin dessen nicht sicher.“ Er wollte niemand unrecht tun und nahm es daher auch mit seinem „Wahr“ und „Nicht wahr“ sehr genau.
Ich könnte noch eine Menge von Tugenden anführen, welche die Lauterkeit und den Seelenadel des kleinen Guido ins hellste Licht stellen. Aber das Schönste an ihm waren ja nicht die ungewöhnlichen Taten, sondern seine Treue in allen Dingen, auch in den kleinsten.