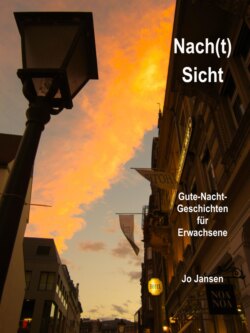Читать книгу Nach(t)Sicht - Jo Jansen - Страница 3
Allein allein
Оглавление„Noch eine Runde Ramazzotti!“
Zustimmendes Gelächter erklang, als Michi sich wieder zu uns setzte und der Kellnerin zuwinkte.
Er legte sein Handy auf den Tisch und zuckte die Schultern: „Sorry, war wichtig.“
„Du warst eine halbe Stunde weg und hast die besten Witze verpasst,“ versuchte ich dem Bruder meines Freundes ein schlechtes Gewissen einzureden.
„Ja, wir haben nur von dir gesprochen“, pflichtete Frank mir bei und alle lachten.
„Sechs Ramazzotti, bitteschön.“ Die Bedienung war schnell, erhoffte entweder ein gutes Trinkgeld oder dass wir bald verschwänden. Vielleicht auch beides. Immerhin waren wir die einzigen Gäste, wenn man von einem älteren Ehepaar absah, das gleich nach dem Abendessen auf seinem Zimmer verschwunden war, wo vermutlich das „Musikantenstadl“ wartete. Zu dieser Jahreszeit war nicht mehr viel los im Schwarzwald. Umso mehr Spaß hatten wir heute gehabt, bei bestem Spätherbstwetter über die Höhen zu wandern, mit den Füßen raschelndes Laub aufzuwirbeln und immer wieder das herrliche Panorama zu fotografieren.
Frank und ich waren erst seit wenigen Wochen zusammen und auf diesem Ausflug lernte ich die ersten Mitglieder seiner Familie kennen. Michi, den jüngsten Bruder, und seine Freundin Anna. Beate, die große Schwester, mit ihrem Lebensgefährten Robert. Sie alle waren nett, unsere Gespräche jedoch über Belanglosigkeiten nicht hinausgegangen. Fast so, als hielte ein unausgesprochenes Misstrauen sie noch zurück.
„Prost, auf die Familie“, rief mein Freund. Während wir alle unsere Gläser erhoben, dachte ich: Wie süß, er zählt mich wohl schon mit dazu. Dass ich mit diesem Gedanken völlig daneben lag, sollte ich bald merken.
Der Ramazzotti brannte in meinem Hals, ich konnte spüren, wie er heiß die Kehle hinablief und sich in meinem Magen wohlige Wärme ausbreitete. Robert erzählte einen weiteren Witz, doch ich hatte Mühe, ihm zu folgen. Mein Kopf fühlte sich seltsam an, wie in Watte gepackt, sodass nicht nur die gesprochenen Worte schwer zu mir durchdrangen, sondern auch meine Gedanken wie in Zeitlupe zu laufen schienen. Mir wurde schlecht.
„Ich glaub, ich muss mal“, flüsterte ich Frank zu, während ich mich langsam erhob. Schwindelig war mir nun auch noch. Frank strich einmal kurz über meine linke Hand und folgte weiter Roberts Erzählung.
Der Weg von der Gaststube zu den Toiletten kam mir endlos und wahnsinnig anstrengend vor. Ich schwitzte mehr, als bei der Besteigung des Feldbergs heute Mittag. Allerdings war es kalter, Gänsehaut verursachender Schweiß, der mir in kleinen Bächen den Rücken hinab rann. Wie lange ich in der kleinen Kabine hockte, weiß ich nicht mehr. Das schachbrettartige Muster des Fußbodens, winzige schwarze und weiße Karos, grub sich jedenfalls unauslöschlich in mein Gedächtnis ein.
Nachdem ich mein Gesicht gewaschen und den Mund ausgespült hatte, um den Geschmack des Erbrochenen loszuwerden, erblickte ich im Spiegel ein beinahe fremdes, blasses Gesicht. Die dunkelblonden, schulterlangen Haare hingen strähnig herab. Meine Beine fühlten sich an wie Pudding, ich wollte nur noch ins Bett.
Unser Tisch in der Gaststube stand leergeräumt da, die anderen waren wohl schon aufs Zimmer gegangen. Wie im Fieber bewegte mich in Richtung Treppe, um Frank zu folgen.
„Moment junge Frau.“ Die Bedienung kam hinter dem Tresen hervor. Stumm reichte sie mir den Zimmerschlüssel. Ich war so fertig, dass ich mir gar nicht die Frage stellte, warum Frank nicht mit dem Schlüssel hinaufgegangen war. Mühsam schleppte ich mich bis in die zweite Etage, jede Stufe ein Kampf, den mich nur die Aussicht auf das warme Bett und Franks starke Arme gewinnen ließ.
Schwankend stand ich vor der Zimmertür und stellte fest, dass der Schlüssel nicht passte. Ich klopfte. Nichts passierte. Legte mein Ohr an die Tür, vielleicht verriete mir das Rauschen der Dusche, dass Frank im Bad war. Lediglich das Rauschen des Blutes dröhnte in meinem Kopf.
„Kann ich Ihnen helfen?“ Die Kellnerin kam um die Ecke, nahm mir den Schlüssel aus der Hand und fasste mich vorsichtig am Arm.
„Die 217 ist da vorn, zwei Türen weiter.“ Bevor ich mich darüber wundern konnte, hatte sie bereits das Zimmer aufgeschlossen und mich sanft hinein geschoben.
„Gute Nacht.“
„Gute Nacht“, murmelte ich, stolperte im Dunklen vorwärts, bis ich an das Bett stieß und lang darauf hinfiel. So blieb ich liegen und musste sofort eingeschlafen sein.
Spatzen schilpten und tippelten vor dem Fenster und, wie es sich anfühlte, auch in meinem Kopf.
„Frank?“ Meine Hand glitt suchend über das Bett, auf dem ich immer noch bäuchlings lag, in meinen stinkenden Klamotten von gestern Abend. Nachdem ich ins Leere griff, schlug ich langsam die Augen auf, blinzelte. Mein Blick fiel auf eine schräge Wand mit Dachgaube. Die Vorhänge waren zugezogen und ließen nur diffuses Licht ins Zimmer scheinen. Es genügte, um mich zwei Dinge erkennen zu lassen: Das Bett war schmal und außer mir lag niemand darin. Und, dies war nicht unser Zimmer.
Die Spatzenbande in meinem Kopf hinderte mich daran, vor Schreck aufzuspringen. Ich wollte zu Frank. Sofort. Er musste mich doch schon vermisst haben und Gott weiß was von mir denken. Langsam erhob ich mich und war nun froh, voll angekleidet zu sein, inklusive Turnschuhen an den Füßen. Ihre Schnürsenkel wären jetzt unerreichbar fern für mich. Mit vorsichtigen Schritten schlich ich zur Tür und sah ich mich dabei im Zimmer um. Es war winzig, ein Einzelzimmer, das ich nie zuvor gesehen hatte. Doch was war das? Neben der Tür schimmerte ein vertrauter grüner Fleck – meine Jacke hing an der Garderobe. Ich war sicher, sie gestern vor dem Abendessen in dem anderen, nämlich Franks und meinem, Zimmer gelassen zu haben. Warum sie nun hier hing, verstand ich nicht. Das musste ein Missverständnis sein.
Ärger machte sich in mir breit. Diese dumme Bedienung. Sie hatte mich in das falsche Zimmer geleitet. Das musste ich klären, sofort. Zweihundertfünfzehn. Ich war mir sicher, dass Frank und ich gestern dort hineingegangen waren. Das große Doppelbett hatte Vorfreude auf die gemeinsame Nacht in mir geweckt und nun stand ich hier. Allein in einem Einzelzimmer. Vielleicht hatte Frank sich gestern Abend ebenfalls schlecht gefühlt, den Schlüssel von innen stecken lassen und mein Klopfen nicht gehört? Es würde für das Chaos ja wohl eine logische Erklärung geben, über die wir gleich gemeinsam lachen könnten. Ich pochte erneut an die Tür mit der Nummer 215. Niemand öffnete. Langsam machte ich mir Sorgen. Vielleicht wusste sein Bruder mehr. Er und Anna hatten das Zimmer genau gegenüber bezogen, Nummer 208. Auch dort reagierte niemand auf mein Klopfen. Ebenso nebenan, 210, wo Beate und Robert abgestiegen waren. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Beunruhigt eilte ich die Treppe hinab. Hoffte, die anderen beim Frühstück zu finden.
In der Gaststube waren sie nicht. Mir tönte ein freundliches „Guten Morgen“ von dem älteren Ehepaar entgegen, das gerade frisch und rosig das Lokal verließ. Vielleicht hätte ich gestern auch das Musikantenstadl dem Ramazzotti vorziehen sollen? Die Bedienung war nirgends zu sehen, also durchquerte ich den leeren Frühstücksraum. An der Rezeption checkten die beiden Alten gerade aus. Unruhig hielt ich mich im Hintergrund, trat ich von einem Fuß auf den anderen und war froh, als sie endlich winkend in Richtung Parkplatz verschwanden. Ich sah ihnen nicht nach, sondern wandte mich direkt an den Wirt.
„Guten Morgen.“ Ich versuchte, mir den Ärger nicht sofort an meiner Stimme anmerken zu lassen. Es gelang mir nicht, wie mir die hochgezogenen Brauen des Mannes verrieten.
„Guten Morgen Frau Witt. Haben Sie gut geschlafen?“, fragte er mit unbewegter Miene.
„Nein“, knurrte ich und dann brach es aus mir heraus. Dass es ja wohl nicht sein könne, dass man mich nachts in ein falsches Zimmer steckte, wo denn meine Freunde wären und wer überhaupt schuld sei an dem ganzen Chaos. Der Wirt hörte mir schweigend zu, zog nur wiederholt die Augenbrauen hoch. Als ich fertig war, kam er hinter dem Rezeptionstresen hervor, zeigte auf den Frühstücksraum und sprach langsam, wie eine Mutter zu ihrem kleinen Kind:
„Kommen Sie, ich hol uns erst mal einen Kaffee.“
Wenig später floss das bittere Gebräu, in das ich ganz viel Zucker gerührt hatte, meine Kehle hinunter. Ich schüttelte mich. Der Wirt war ein dicklicher Mann, von dem etwas Gemütliches ausging. Er saß mir gegenüber und beobachtete den Löffel, mit dem er in seiner Kaffeetasse herumrührte, als gäbe es nichts Wichtigeres zu tun. Gerade wollte ich meine Fragen wiederholen, da hob er den Blick und sah mir direkt in die Augen.
„Frau Witt, ich weiß nicht, was genau sie letzte Nacht gemacht haben. Aber sie sind gestern allein hier angekommen.“
Zum Glück saß ich schon, sonst hätte ich mich jetzt erst einmal setzen müssen.
„Das ist nicht wahr.“ Trotzig und scharf schossen die Worte aus meinem Mund. „Wir kamen zu sechst an, drei Pärchen. Sie selbst haben uns die Zimmerschlüssel ausgehändigt, für Frank und mich die 215.“
Der Mann schüttelte den Kopf.
„Da war niemand sonst. Nur das alte Ehepaar, das soeben abgereist ist.“
Die Kellnerin, die uns am Abend bedient hatte, kam aus der Küche herbei, sah mich mit einer Mischung aus Mitleid und Empörung an und bestätigte seine Worte.
„Sie waren allein und haben gestern Abend ziemlich viel Ramazzotti getrunken. Zuviel, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.“
Langsam wurde ich richtig wütend.
„Ich weiß zwar nicht, was das hier soll, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will zu meinem Freund. Vielleicht ist ihm ja etwas zugestoßen.“
Immer mehr redete ich mich in Rage, sodass die Kellnerin es vorzog, wieder in der Küche zu verschwinden, während der Wirt mich nur noch stumm und feindselig ansah. Schließlich brachte mein nicht enden wollender Redefluss ihn dazu, sich zu erheben und mit mir zum Zimmer 215 hinauf zu gehen.
„Nur, damit Sie endlich Ruhe geben“, sagte er und schloss die Tür auf, vor der ich schon mehrfach vergebens gestanden hatte. Ich lief hinein und blieb wie erstarrt stehen. Das Zimmer sah genau so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Allerdings war es leer und unbenutzt, von Frank oder unserem Gepäck keine Spur. Da war der Balkon, von dem man einen herrlichen Blick auf die Umgebung hatte – und auf den Parkplatz hinter dem Haus. Mit einem Sprung war ich an der Balkontür, riss sie auf und spürte, wie der starke Arm des Wirtes mich packte und zurückzerrte.
„Nun ist aber genug.“ Mit wütend aufgerissenen Augen starrte er mich an. Dachte er etwa, ich wollte springen?
„Ähm, nein, Sie verstehen mich falsch“, versuchte ich mich aus seiner Hand zu winden, die meinen Oberarm wie ein Schraubstock umklammert hielt. „Ich wollte nur einen Blick auf den Parkplatz werfen.“
Misstrauisch lockerte er den Griff etwas, wich aber nicht von meiner Seite, als ich den Balkon betrat. Ein Blick auf den Parkplatz genügte, um mir die Tränen in die Augen schießen zu lassen. Dort unten stand ein einziges Auto, ein kleiner schwarzer Polo. Meiner. Das war unmöglich, denn ich hatte ihn zu Hause gelassen, in meiner Garage. Wir waren mit Franks BMW hergefahren.
Wenig später befand ich mich wieder in dem Zimmer, in dem ich die Nacht verbracht hatte, Nummer 217. Vom Wirt hatte ich keine weiteren Antworten bekommen. Entweder war das hier die „Versteckte Kamera“ oder ich begann, mit Anfang dreißig, komplett durchzudrehen. Im Kleiderschrank fand ich eine braunkarierte Reisetasche. Meine Reisetasche, wie ich unschwer an dem Mini-Plüschhäschen erkennen konnte, das vom Reisverschluss herab hing und genau so ratlos in die Welt sah, wie ich mich fühlte. Wenigstens hatte ich jetzt frische Wäsche. Ich duschte, wusch mir die Haare und zog mich um. Besser fühlte ich mich trotzdem nicht. Nichts ergab einen Sinn und ich hatte immer noch das Gefühl, nicht klar denken zu können. Meine Handtasche fehlte. Ich war sicher, sie gestern mit in das gemeinsame Zimmer genommen zu haben. Zum Glück fand ich meine Kreditkarte und den Autoschlüssel in meiner Jackentasche. So konnte ich wenigstens die Hotelrechnung bezahlen - ein Einzelzimmer mit Frühstück, Abendessen, diverse Getränke, darunter allein sechs Ramazzotti. Niemals hatte ich soviel getrunken, hatte jedoch keine Lust, dies mit dem unfreundlichen Wirt zu diskutieren.
Resigniert und kampfbereit zugleich checkte ich aus. Wenn man mich hier so auflaufen ließ, würde ich eben anderswo weitersuchen. Im Polo, auf dem Beifahrersitz, lag meine Handtasche. Ein Anflug von Erleichterung überkam mich. Meine Geldbörse, die Hausschlüssel, Fotoapparat und Handy, alles noch da. Natürlich, mein Handy. Ich war anscheinend völlig durch den Wind, dass ich nicht eher daran gedacht hatte. Sofort würde ich Frank anrufen, seine Nummer hatte ich unter Favoriten abgespeichert. Angelika, Büro, Mutti … fertig. Kein Frank. Fieberhaft drückte ich auf dem Handy herum, öffnete das Menü Kontakte. Auch dort gab es keinen Frank. Ich hatte mir seine Handynummer nie gemerkt, da ich sie eingespeichert und sicher glaubte. Mein Magen krampfte sich zusammen, mir wurde kotzübel. Gerade noch rechtzeitig konnte ich die Autotür öffnen. Der Kaffee von vorhin, mit dem vielen Zucker, landete in hohem Bogen auf dem Parkplatz.
Wie lange es dauerte, bis ich mich halbwegs wieder gefasst hatte, weiß ich nicht. Wie ein Häufchen Elend saß ich heulend im Auto auf dem Parkplatz. Meine Gedanken wirbelten durcheinander, nichts ergab einen Sinn. Irgendwann kam ich auf die Idee, meine beste Freundin anzurufen. Angelika. Sie war vor einigen Wochen in die Schweiz gezogen, ganz ans andere Ende, rund vierhundert Kilometer weg von mir. Dort lebte sie jetzt mit ihrem Mann, einem Schweizer, und erwartete im Februar ein Baby. Obwohl wir uns früher fast täglich trafen, hatten wir uns seit ihrem Umzug nicht einmal gesehen. Ich war kurz danach Frank begegnet und so verliebt, dass ich jedes Wochenende am liebsten mit ihm verbrachte. Angelika beschäftigte sich damit, die Wohnung einzurichten. Ihre Gedanken drehten sich fast nur noch um das Baby und ihr Leben in der Schweiz. Immerhin telefonierten wir ab und zu. So hatte Angelika sich mit mir gefreut, dass ich in Frank wohl endlich dem Richtigen begegnet war.
Mit zitternden Fingern hielt ich das Telefon ans Ohr. Geh ran!, flehte ich. Zwar wollte sie am Wochenende gern ihre Ruhe haben, würde aber hoffentlich meine Nummer auf dem Display erkennen.
„Nadine. Schön, dass du anrufst“, begrüßte sie mich erfreut. Der Klang ihrer Stimme hatte etwas Tröstendes in diesem Albtraum. Es fiel mir schwer, ihr mit wenigen Worten zu berichten, was vorgefallen war. Wenn ich es schon nicht verstand, wie wirr musste es dann erst für sie klingen? Zumindest gelang es ihr, pragmatisch zu denken.
„Du musst da weg. Fahr nach Hause. Ich setz mich in den Zug, dann kann ich heute Abend bei dir sein. Übermorgen hab ich sowieso noch etwas in Konstanz zu erledigen.“
Der letzte Satz mochte geschwindelt sein, aber das war mir in dem Moment egal. Sie kam. Meine beste Freundin hatte Zeit für mich, gerade jetzt, wo ich sie am meisten brauchte.
An die Fahrt durch den Schwarzwald konnte ich mich später nicht mehr erinnern. Immerhin gelang es mir, den schmalen, kurvenreichen Straßen unfallfrei zu folgen. Am frühen Nachmittag parkte ich mein Auto mit einer gewissen Erleichterung vor dem Haus, in dem ich wohnte. Das hier war bekanntes Terrain, bald käme Angelika, alles würde gut. An diesen Gedanken klammerte ich mich, das wollte ich glauben. Der vertraute Geruch meiner Wohnung nahm mich in den Arm, gab mir Sicherheit. Schluchzend saß ich auf dem Klo, ein Ort, der für mich schon immer der Inbegriff des nach Hause Kommens gewesen war. Ich zwang mich zur Ruhe, musste logisch vorgehen. Mit einer Tasse Tee setze ich an meinen Schreibtisch, fuhr den Computer hoch und öffnete das Mailprogramm. Es gab da ein paar sehr persönliche Mails von Frank. Das heißt, es hatte sie gegeben, wie ich wenig später feststellen musste. Weder fand ich seine Mails an mich, noch meine gesendeten Antworten. Wie konnten sie verschwinden? Niemand, außer mir, kannte das Passwort meines Computers und nur ich besaß Schlüssel zu meiner Wohnung. Das hatte ich bisher geglaubt.
Verunsichert sah ich mich um. War während meiner Abwesenheit etwa jemand hier gewesen? Wo war der kleine, weiße Porzellanelefant geblieben, den Frank mir auf dem Flohmarkt gekauft hatte? Ganz sicher hatte er am Freitag noch auf meinem Schreibtisch gestanden, als ich die Wohnung verließ. Hektisch lief ich durch die Räume und suchte nach weiteren Beweisen meiner Beziehung zu Frank. Seine Zahnbürste im Badezimmerschrank – weg. Die CDs, die er mir geschenkt hatte – ebenfalls weg. Das gerahmte Foto von uns beiden auf dem Nachtschrank – auch fort. Mir kamen schon wieder die Tränen. Auf dem Foto hatte Frank mich im Arm gehalten. Mit Selbstauslöser aufgenommen, zwei glücklich lächelnde Menschen, den Bodensee im Hintergrund.
Doch halt. Ich war aber auch ein Dummchen. Die Kamera. Auf der Speicherkarte mussten die Fotos von der gestrigen Wanderung mit Frank, Michi, Anna, Beate und Robert sein. Vor Aufregung zitterten meine Hände schon wieder so stark, dass es mir erst beim dritten Versuch gelang, die Speicherkarte in den Computer zu schieben. Ich hätte es mir sparen können. Es waren nur Landschaftsaufnahmen vom Schwarzwald darauf. Wunderschön, aber ohne einen einzigen Menschen.
Ich wurde immer panischer. Irgendeinen Beweis für unsere gemeinsame Zeit wollte ich finden. Der Fotoordner meines Computers ...
Er war leer.
Alles gelöscht.
Komplett. Damit waren auch die Fotos, die Frank allein oder gemeinsam mit mir zeigten, verschwunden. Zu dumm, dass ich unser gemeinsames Fotoalbum erst zu Weihnachten anfertigen wollte und daher noch keine Papierabzüge existierten. Wobei, wenn es die gäbe, wären sie jetzt wohl auch fort. Wer hatte sich diese Mühe gemacht und vor allem, warum? Was wurde hier gespielt? Diese Frage stellte ich mir immer und immer wieder.
Wir hatten uns Anfang Oktober ganz zufällig kennengelernt. Ich saß lesend in einem Café. Frank kam an meinen Tisch und fragte, ob ich das Buch empfehlen könnte. So kamen wir ins Gespräch, unterhielten uns zunächst über Bücher, dann über hundert andere Themen. Er war mir sofort sympathisch und darum sagte ich erfreut zu, als er mich für den nächsten Tag zu einem Spaziergang einlud. Da er in Heidelberg lebte und ich am Bodensee, sahen wir uns bisher nur an den Wochenenden. Ich zählte nach. Fünfmal insgesamt. Bereits am ersten Wochenende hatte ich mich in ihn verliebt. Zwar war mir Frank manchmal seltsam distanziert vorgekommen, doch das hing wohl mit seinem Beruf zusammen. Die Hirne von Softwareingenieuren ticken anders, hatte er mir lachend erklärt, als ich ihn darauf ansprach.
Um kurz vor sechs Uhr abends stand ich aufgeregt am Bahnhof. Noch nie hatte ich die Ankunft meiner besten Freundin so sehr herbeigesehnt. Die Zeiger der Bahnhofsuhr schlichen mit einer an Sadismus grenzenden Langsamkeit über das Zifferblatt, eine Runde, die nächste und noch eine. Endlich fuhr der Zug ein und kurz darauf lagen wir uns in den Armen. Angelikas Bauch war sichtbar gewachsen und sie strahlte die pure Vorfreude aus. Trotzdem lag ehrliche Besorgnis in ihrer Stimme, als sie wenig später auf meinem Sofa saß und mich bat, alles noch einmal ganz genau zu erzählen. Das tat ich, auch wenn die Geschichte dadurch nicht verständlicher wurde, weder für sie noch für mich. Gerade die Sache mit den verschwundenen Fotos und E-Mails kam mir selbst so unwirklich vor. Wie konnte ich erwarten, dass Angelika mir glaubte?
„Und du hast wirklich keinen Beweis, dass dieser Mann in den letzten Wochen Teil deines Lebens war?“ Angelika zog die Stirn in Falten, wie immer, wenn sie angestrengt nachdachte. In ihren Augen las ich eine einzige Frage: Warum?
„Hattet ihr Streit? Verlangte er Dinge von dir, die du nicht tun wolltest? Könnte eine andere Frau dahinter stecken?“
Jedes Mal schüttelte ich verneinend den Kopf und wurde immer mutloser.
„Alles war ganz harmonisch.“ Ich überlegte. Er war doch genauso verliebt in mich, wie ich in ihn, oder?
„Und selbst wenn es da etwas Dunkles in ihm gibt, das ich übersehen haben sollte – dann macht man vielleicht Schluss, aber doch nicht so. Seine Geschwister und die Freunde scheinen ja mit drin zu hängen. Ich komme mir vor wie in einem zweitklassigen Agententhriller.“
Mir lief schon wieder eine Träne über die Wange. Verdammt! Meine Hilflosigkeit wandelte sich mehr und mehr in Wut. Auf den, der mir das angetan hatte.
„Über Festnetz kannst du ihn nicht erreichen?“
Das liebte ich an meiner Freundin, sie dachte mit.
„Nein, er hat nur Handy, sagte er. Die Nummer weiß ich dummerweise nicht auswendig, sie war ja sicher eingespeichert, dachte ich.“
„Die Telefonliste deines Handys, da müsste sie doch auftauchen, wenn auch namenlos.“
„Auch die Einträge wurden gelöscht.“
„Hm. Du warst bei ihm zu Hause, sagtest du?“
„Ja, einmal. Wir haben uns sonst immer bei mir getroffen. Er hat nur eine winzige Wohnung in Heidelberg und wir waren doch beide so gern hier am See unterwegs.“
„Die Adresse weißt du noch?“
„Ja.“ Eifrig begann ich zu nicken. „Ja, das ist es, wir fahren hin.“
„Okay, Süße, aber erst morgen. Mutter und Kind brauchen ihren Schlaf und du siehst auch völlig fertig aus.“
Obwohl ich am liebsten sofort losgefahren wäre, musste ich Angelika recht geben.
Am nächsten Morgen war ich bereits vor dem Hellwerden wach. Während ich die werdende Mutter noch schlafen ließ, saß ich an meinem Schreibtisch und grübelte. Ich sah keinen, wirklich keinen Grund, dass Frank so ein falsches Spiel treiben sollte. Und seine Geschwister, der Wirt und die Kellnerin im Hotel, was hatten sie damit zu tun?
Nach einem kurzen Frühstück stiegen wir in mein Auto und fuhren los, vom Jagdfieber gepackt. Es war Sonntagvormittag und auf der Autobahn wenig Verkehr. So dauerte es keine drei Stunden, bis wir Heidelberg erreichten und einen Parkplatz am Rande der Altstadt fanden. Von dort liefen wir die letzten paar hundert Meter zu Fuß.
„Hier ist es. Frank Egermeier.“ Ich atmete tief durch, war einerseits froh, dass sich Franks Klingelschild nicht ebenfalls in Luft aufgelöst hatte, bekam andererseits auch Angst vor dem, was mich erwarten könnte.
„Wenn er mich nun auslacht und sagt, dass unsere Beziehung nur ein Irrtum war?“, jammerte ich.
Angelika legte mir beruhigend den Arm um die Schulter.
„Ich bin ja bei dir.“
Bevor ich es mir eventuell anders überlegen konnte, streckte sie die Hand aus und drückte auf den Klingelknopf neben der Haustür.
Nichts passierte. Jetzt schob ich mich vor, drückte ebenfalls, Dauerklingeln. Er schlief sonntags gern lang, doch das sollte ihn aus dem Bett treiben.
Keine Reaktion. Enttäuscht und ratlos sah ich meine Freundin an. Sie visierte kurzerhand die beiden anderen Klingelknöpfe an und schellte dort.
„Ja?“, tönte es fragend und misstrauisch von oben. Wir blickten hinauf und sahen eine ältere Dame, die sich in der zweiten Etage gefährlich weit aus dem Fenster lehnte, um einen Blick auf uns zu werfen.
„Wir wollten eigentlich zu Herrn Egermeier, aber vielleicht können Sie uns auch weiterhelfen“, flötete Angelika mit zuckersüßer Stimme.
Die Alte streckte ihren Hals noch weiter heraus, sodass ich unwillkürlich einen Schritt zurücktrat. Dann verschwand sie im Inneren des Hauses und wenige Augenblicke später kündete der Summer davon, dass uns Einlass gewährt wurde. Schwerfällig stieg Angelika die Stufen empor und ich folgte ihr. In der ersten Etage blieb sie kurz stehen, um zu verschnaufen, strich sich dabei über den Bauch. Nun konnte ich nicht anders und klopfte vorsichtig an die Tür. „Frank?“ Keine Reaktion.
Stattdessen klang es von oben: „Da ist niemand.“ Die alte Dame kam uns langsam entgegen, wobei sie auf jeder Stufe so komisch wackelte, was auf eine kaputte Hüfte hindeutete. Mit unverhohlener Neugier musterte sie Angelikas Babybauch.
„Was wollen Sie denn von Herrn Egermeier?“ Dabei blickte sie Angelika argwöhnisch und neugierig zugleich an.
„Also“, meldete ich mich stattdessen zu Wort, „ich bin seine, ähm, Freundin.“
Nur unwillig wandte die Alte ihren Blick von Angelika zu mir. Das Misstrauen darin schien noch stärker als vorher.
„Dann sollten Sie wissen, dass er schon seit Mai in Amerika ist, junge Frau.“
„Sind sie sicher?“ entfuhr es mir und damit hatte ich in ihren Augen völlig verspielt. Vorsichtig schob Angelika sich weiter in den Vordergrund, strich schon wieder über ihren Bauch, was jetzt ziemlich theatralisch wirkte. Nun fasste sie sich auch noch an die Stirn, wie in einer billigen Komödie, und seufzte: „Ach, mir wird so komisch. Könnte ich wohl einen Schluck Wasser haben, bitte?“
„Kommen Sie Kindchen, kommen Sie!“ Die alte Dame lief die Treppe schneller hinauf, als sie hinunter gewackelt war, und bedeutete Angelika immer wieder mit der Hand, ihr zu folgen. Meine Freundin blinzelte mir kurz zu und ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. An ihr war eine Schauspielerin verloren gegangen.
„Hier entlang, in die gute Stube.“ Frau Pötsch, so las ich auf dem Türschild, ließ uns auf einem roten Plüschsofa Platz nehmen. Eine braun getigerte Katze strich neugierig um unsere Beine. Angelika erholte sich nach ein paar Schlucken Wasser erstaunlich schnell und lenkte das Gespräch vorsichtig wieder fort von Schwangerschaft und Baby und hin zu Frank Egermeier. Die alte Dame erhob sich und nahm ein gerahmtes Foto von der Anrichte. Liebevoll strich sie darüber, bevor sie es Angelika reichte. Ich war für sie Luft, wie es schien.
„Das ist er.“ Stolz schwang in ihrer Stimme mit, als sie auf einen kräftigen, blonden, vielleicht achtzehnjährigen jungen Mann mit Sakko und Schlips zeigte. Meine Freundin sah sie verständnislos an: „Wer?“
„Na, Frank. Mein Enkel. Da hat er gerade Abitur gemacht. Er studiert Medizin und ist jetzt für ein Jahr in Chicago.“ Ich schüttelte den Kopf und Angelika knuffte mich unauffällig in die Seite, dass ich jetzt bloß meinen Mund halten sollte.
„Wie alt ist ihr Enkel denn jetzt?“ Wieder diese zuckersüße Stimme, sie hatte es echt drauf.
„Vierundzwanzig.“
„Und ihr Enkel war nicht zwischendurch auf Besuch hier, zum Beispiel im Oktober?“, hakte Angelika vorsichtig nach.
„Ach nein, er kann ja nicht einfach herfliegen, das ist zu teuer.“ Die alte Dame seufzte. „Dabei habe ich ihn gerade im Oktober sehr vermisst, als ich für zwei Wochen im Krankenhaus lag.“
„Oh je, wer hat sich denn da um ihre Katze gekümmert?“, fragte Angelika mitleidig.
Frau Pötsch lächelte. „Wissen Sie, Kindchen, ich habe eine große Familie – Kinder, Enkel, Großnichten und -Neffen. Auf die ist Verlass.“ Sie stellte das Foto auf die Anrichte zurück und blieb neben der Tür zum Flur stehen. Angelika deutete dies als Zeichen, dass die Fragestunde beendet war, und verabschiedete sich. Ich trottete wie ein Depp hinterher.
„Kommen Sie ruhig mal wieder, Kindchen“, rief Frau Pötsch ihr im Treppenhaus nach. „Und passen Sie auf Ihre Freundin auf.“ Das klang wie: Aber bringen Sie die bloß nicht wieder mit.
„Das war nicht Frank!“ platzte ich heraus, kaum das wir um die nächste Häuserecke gebogen und somit außer Hörweite waren.
„Mein Frank ist schlank, hat schwarze Haare, arbeitet irgendwo in der IT. Und“, triumphierend sah ich meine Freundin an, „er ist sechsunddreißig.“
„Aber er heißt wohl nicht Frank. Du warst wirklich in seiner Wohnung? Hier in dem Haus?“
„Ja, ich könnte Dir genau beschreiben, wie es dort aussah. Alles ziemlich klein und praktisch eingerichtet.“
„Was ja auch einen Sinn ergibt, wenn es sich um eine Studentenbude handelt.“ Angelika ging langsam weiter und ich folgte ihr, wollte nur noch weg, fort aus Heidelberg.
„Hm, dann muss dein Prinz irgendwie an den Schlüssel von diesem Frank gekommen sein. Vielleicht ist er ja jemand aus der großen Verwandtschaft, von der sie sprach, der dir von Anfang an Theater vorgespielt hat. Bleibt immer noch die Frage nach dem Warum.“
Seltsamerweise war ich zunächst ruhiger nach dem Gespräch mit Frau Pötsch, bei dem ich nur Zuhörer gewesen war. Wollte ich wirklich noch wissen, was hinter dem ganzen Theater steckte oder wollte ich einfach in Ruhe gelassen werden? Angelika akzeptierte das und so drehte sich unser Gespräch während der Rückfahrt um sie, ihren Mann Martin, das Baby, die Schweiz …
Natürlich bestätigte sich meine Vermutung, dass Angelika gar nichts in Konstanz zu erledigen hatte und nur meinetwegen hergekommen war. So brachte ich sie am nächsten Morgen zum Zug, bevor ich zur Arbeit ins Büro fuhr. Der Alltag hatte mich wieder. Zwar versuchte ich, jeden Gedanken an Frank, wie ich ihn immer noch nannte, zu verdrängen, doch es gelang mir nicht. Tagsüber vergrub ich mich in Arbeit und lenkte mich damit ab. Spätestens abends im Bett kamen die Fragen, tanzten wie kleine böse Geister in meinem Kopf herum und hinderten mich am Einschlafen. Wenn ich dann irgendwann für kurze Zeit in einen unruhigen Schlaf fiel, erwachte ich wenig später wieder, nur um mich für den Rest der Nacht im Bett hin und her zu wälzen und kein Auge mehr zu zu tun.
Mit Angelika telefonierte ich regelmäßig, aber wir sprachen nie mehr über Frank. Ich vermied das Thema, da es nichts Neues zu berichten gab. Und sie? Glaubte sie mir wirklich? Immerhin hatte sie sich nach ihrem Besuch mit dem freundlichen Rat verabschiedet, ich sollte vielleicht einen Therapeuten aufzusuchen. Ich war wie besessen davon, ein winziges Zeichen dafür zu finden, dass Frank existierte, mir selbst zu beweisen, dass ich nicht verrückt war. Da ich aber nicht einmal seinen richtigen Namen wusste, machte es wenig Sinn, ihn per Google zu suchen oder Heidelberger Firmen nach ihren IT-Mitarbeitern zu fragen. Bei Frau Pötsch brauchte ich es schon gar nicht versuchen. Ihn bei der Polizei als vermisst melden? Lächerlich. Mister X war ja nicht wirklich verschwunden, sondern wollte nur von mir nicht gefunden werden. So blieb ich allein mit meiner Grübelei, die mich mehr und mehr gefangen nahm. Mir schmeckte kein Essen mehr, ich magerte ab, schminkte mich nur noch sehr nachlässig, wählte meine Kleidung lustlos aus, hatte an nichts mehr Freude.
Es kam die Weihnachtszeit. In den Jahren zuvor hatte ich nach der Arbeit gern den einen oder anderen Glühwein mit meinen Kollegen getrunken. Der Weihnachtsmarkt am See war für mich immer der schönste in ganz Deutschland gewesen. In diesem Jahr zog es mich nicht ein einziges Mal dorthin. Die Feiertage verbrachte ich bei meiner Mutter in Stuttgart, zusammen mit meiner Schwester, ihrem Mann und meinen beiden kleinen Nichten. Zum Glück beschäftigten die quirligen Kleinen die Familie so sehr, dass niemandem auffiel, wie wenig ich sagte. Erleichtert, dem heile-Welt-Gedudel entronnen zu sein, fuhr ich bereits am Morgen des zweiten Feiertages wieder nach Hause. Zu Silvester schlug ich alle Einladungen aus, wollte keine bunte Party, sondern vergrub mich in meiner Wohnung. Öffnete eine Flasche Rotwein, zündete eine Kerze an, legte klassische Musik auf und dachte über mein Leben nach. Was war nur schief gelaufen?
Die Sache mit Frank war ein Desaster, die größtmögliche Verarsche, die ich mir vorstellen konnte. Irgendwie hatte ich mit Männern kein Glück. Verliebte ich mich in die Falschen oder verliebten sich die Falschen in mich? Holger zum Beispiel. Wir waren uns vor einem Jahr beim Eislaufen auf dem See begegnet, wo ich ihn fast über den Haufen gefahren hatte. Statt sauer zu sein, hatte er sich für die stürmische Begrüßung bedankt und mich auf einen Glühwein am Ufer der Reichenau eingeladen. Danach hatten wir uns zum Kartfahren und Klettern verabredet, uns auf den Hegauvulkanen wilde Schneeballschlachten geliefert, waren gemeinsam durch Kneipen gezogen und hatten jede Menge Spaß gehabt. Bis er eines Tages von Heiraten sprach. Da wurde mir bewusst, dass er nicht der Richtige war, ich ihn nie lieben würde. Nachdem ich ihm das unmissverständlich gesagt hatte, hörte ich nie wieder von ihm. Ein bisschen schwermütig holte ich mein Fotoalbum hervor. Von Holger und mir besaß ich noch Bilder. Ich lächelte, als ich die Fotos nun wieder sah. Holger war wie ein Clown, der mich immer wieder zum Lachen gebracht hatte. Aber wer will schon einen Clown heiraten?
Angenehme Erinnerungen stiegen in mir auf, als ich die Bilder vom Hohentwiel betrachtete. Wir hätten von mir aus gerne Freunde bleiben können. Moment, was war das? Auf der nächsten Seite hatte ich Fotos eingeklebt, die Holger mir geschenkt hatte. Sie waren entstanden, bevor wir uns kennengelernt hatten, und zeigten alle sein typisches, lausbubenhaftes Lächeln. Er am Strand von Hurghada, mit einem süßen, streunenden Hund. Holger auf dem Empire State Building, im Hintergrund die Wolkenkratzer von New York. Er als Pirat geschminkt, wobei eine gewisse Ähnlichkeit zu Johnny Depp nicht zu leugnen war. Ein kahler Apfelbaum, an dem ein einziger roter Apfel hing. Das letzte Foto war definitiv nicht von Holger. Das hatte ich gemacht, im Herbst, kurz bevor ich Frank begegnet war. Es hatte, mit anderen Naturfotos zusammen, lose vorn im Album gelegen, da war ich mir sicher. Meine Gedanken tanzten Pirouetten, ich bekam sie nicht zu fassen. Welches Foto fehlte hier und war durch das Apfelbild ersetzt worden? Warum und vor allem, von wem?
Ich fröstelte, obwohl die Heizung voll aufgedreht war. Hatte dieser Fototausch etwa auch mit den Ereignissen um Frank zu tun? Seit dem folgenschweren Abend im Schwarzwald hatte ich keinen Alkohol mehr angerührt. Es mag an dem Glas Rotwein gelegen haben, dass ich nun plötzlich mutig wurde. Alles in mir drängte danach, Holger anzurufen. Unbedingt. Jetzt. Zwar hatte ich seine Nummer längst aus meinem Handy gelöscht, doch kannte ich seinen Namen und wusste von der Wohnung im Haus seiner Eltern in Ravensburg. Wobei Haus untertrieben war, Villa traf es eher. Einmal waren wir gemeinsam dort gewesen und Holger hatte von früheren Kindergeburtstagspartys im riesigen Garten der Villa geschwärmt. Er bewohnte das ehemalige Gärtnerhaus, einen Anbau mit eigenem Zugang. Unbemerkt von seiner Familie hatten wir uns spätabends hinein und am Morgen wieder hinausgeschlichen.
Der Computer blinkte einladend, ich rief das Onlinetelefonbuch auf, Ravensburg, Samson … Da, Federburgstraße, das waren sie. Automatisch griff ich zum Telefon und gab die Nummer ein. Während am anderen Ende der Wählton erklang, überlegte ich, was ich sagen sollte, wenn jemand von seiner Familie abhob. Es war Silvester, kurz nach 22 Uhr. Ich könnte mich damit herausreden, ihm alles Gute zum neuen Jahr wünschen zu wollen.
„Samson?“, eine fragende, schon etwas älter klingende Frauenstimme meldete sich, wahrscheinlich seine Mutter.
„Hallo, hier ist Nadine“, gab ich mich fröhlich. „Ich würde gern mit Holger sprechen.“
„Nadine ...“ wurde mein Name am anderen Ende wiederholt. Dann war es still. Ich wartete, doch nichts passierte. Gerade wollte ich mich wieder in Erinnerung bringen, aber das Hallo blieb ungesagt auf meinen Lippen kleben.
„Holger ist tot. Rufen Sie nie wieder hier an.“ Aufgelegt.
Ich war wie betäubt, hielt noch lange den Hörer ans Ohr, bis das Tuten des Besetztzeichens endlich bis in mein Hirn vordrang.
Holger war tot? Der fröhliche, lachende Holger? Das wollte ich einfach nicht glauben.
Was war passiert? Wie war es passiert? Nur zu gern hätte ich seine Mutter danach gefragt. Vielleicht war er erst vor Kurzem gestorben und der Schmerz saß noch so tief in ihr, dass sie deshalb nicht mit mir reden wollte? Während ich noch vor mich hin grübelte, flogen meine Finger wie von selbst über die Tastatur, tippten Holgers Namen ein. Google lieferte zehn Seiten voller Suchergebnisse. Ich reduzierte auf drei Seiten, indem ich Ravensburg hinzufügte. Aktuelle Beiträge zuerst. Da war etwas. Ein Nachruf seines Arbeitgebers, datiert auf Ende März, also kurz nach unserer Trennung. Von einem tragischen Unglücksfall war die Rede. Völlig aufgewühlt durchforstete ich die Polizeinachrichten und Unfallmeldungen der lokalen Presse aus dem fraglichen Zeitraum. Tränen schossen mir in die Augen, als ich Berichte über den Sturz von einer hohen Brücke lesen musste. Von Holger S., 32 Jahre, war die Rede und dass Selbstmord nicht ausgeschlossen sei. Um Himmelswillen, war das etwa meine Schuld? Weil ich ihn zurückgewiesen hatte, nicht heiraten wollte?
Während mir die Tränen nun in Strömen die Wangen hinab liefen, fingerte ich in meiner Bürotasche herum, die unter dem Schreibtisch stand. Dabei fand ich nicht nur die gesuchten Papiertaschentücher, sondern auch den Memorystick, auf dem ich mir manchmal Arbeit vom Büro mit nach Hause nahm. Nachdem ich mich kräftig geschnäuzt und die Tränen abgewischt hatte, wurde mein Blick wieder klar und ich überlegte. Hatte ich nicht damals die Fotos von Holger auf den Stick kopiert, um in der Mittagspause zum Fotoladen zu laufen und die Papierabzüge anfertigen zu lassen? Kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, steckte auch schon der Stick in meinem Computer. Tatsächlich, die Fotos waren noch da, unter Privat abgespeichert. Eine innere Stimme sagte mir, dass ich kurz vor der Lösung all der Rätsel des zu Ende gehenden Jahres stand. Während draußen Glockengeläut und das Knallen und Pfeifen der Silvesterraketen den Beginn des neuen Jahres verkündeten, klickte ich mich durch Holgers Fotos. Fand das eine, das in meinem Album ersetzt worden war. Es zeigte Holger im Garten der Villa mit seiner Familie. Hinter ihm, die etwas ältere Frau, musste seine Mutter sein. Sie lächelte stolz in die Kamera. Neben ihr vermutlich Holgers Vater. Er hatte den Arm liebevoll um die Schultern seiner Frau gelegt. Rechts von Holger erkannte ich Frank und Michi, links Beate.