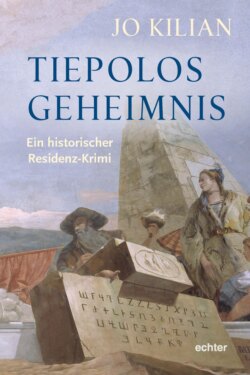Читать книгу Tiepolos Geheimnis - Jo Kilian - Страница 7
ОглавлениеKARNEVAL 1751
Venezianische Maskerade lautete das Motto des Abends. Es war ein Heidenspaß, der für zwei bedauernswerte Seelen bitter enden sollte.
Zwei Dutzend hochrangige Bedienstete seiner fürstlichen Gnaden Carl Philipp von Greiffenclau waren zu einem rauschenden Fest geladen. Darunter befanden sich auch die Neuankömmlinge aus Venedig – der hochverehrte Maestro Giambattista Tiepolo mit seinen Söhnen Domenico und Lorenzo.
Die Gäste waren angehalten eine Maske zu tragen, und nur zu gerne folgte man der Aufforderung. Ein einziges Mal im Jahr durfte man ungestraft seine Herkunft und Stellung unter den insgesamt vierhundert Bediensteten am Hof des Fürstbischofs verschleiern. Jeder war dem anderen gleichgestellt, keiner konnte wissen, wer sich hinter der Maske verbarg. Kammerdiener oder der Leibarzt des Fürsten? Küchenmeisterin oder die bevorzugte Muse eines Mächtigen?
Willkommen im Reich der Narren!
Das Speisezimmer war durch Hoffourier Spielberger, den fürstbischöflichen Quartiermeister, in flackerndes Kerzenlicht getaucht worden, die Luft stickig vom Dampf der Speisen und der Hitze der Gäste. Beschwingt klangen Weingläser aneinander, Gelächter hallte und da-Capo-Rufe überschlugen sich.
Auf der Bühne stand Signora Platti im Kreis der Musikanten, ausnahmsweise nicht im eleganten Kleid, sondern dem Kostüm einer Magd. An ihrer Seite kauerte ein Freiwilliger mit der Maske und in der Pose eines Adeligen, der dem Kommando seiner Dienerin Serpina nichts entgegenzusetzen hatte. Immer wieder setzte er zur Gegenrede an – erfolglos, Serpinas resoluter Sopran zwang ihn zum Schweigen.
„Still, still, Serpina regiert dies Haus!“
Keiner dachte sich etwas Böses dabei und aus über zwanzig Kehlen donnerte es zurück.
„Still, still, Serpina regiert dies Haus!“
Die Magd schwang sich zur Herrin auf, der Herr hatte zu gehorchen. So sah es die lustige Oper La serva padrona vor, in der ein reicher Tölpel von einer Dienerin zur Heirat überlistet wird.
Serpina: „Ihr handelt so, wie ich Euch lenke!“
Und alle wiederholten es lauthals, dass die Becher auf den Tischen tanzten und der rebellische Kanon durch die Hallen der weitläufigen Residenz schallte.
Nur einer schwieg, der Maestro Giambattista Tiepolo. Nachdenklich zog er an der Zigarre, in Gedanken ein paar Räume weiter, wo die Herrschaften dinierten. Keinesfalls würden ihnen diese aufmüpfigen Worte entgehen. Er schob die unleidige Maske eines Gondoliere beiseite, kratze sich an Nase und Stirn. Mochte das Schicksal gnädig sein. Es war Karneval, ein Scherz der betrunkenen Dienerschaft, nichts weiter. Morgen schon würde alles wieder in gewohnten Bahnen laufen.
„Was schaut Ihr so ernst, Vater?“, fragte Lorenzo, des Maestros jüngster Sohn von vierzehn Jahren. Seine Wangen waren erhitzt vom Singen und Tanzen, auf der Stirn perlte Schweiß. Schwarze Strähnen hingen in die goldfarbene Maske eines Falken.
Der Maestro fuhr ihm zärtlich übers Haupt. „Es ist nichts, mach dir keine Sorgen.“
„Aber, Vater, Ihr könnt mich nicht täuschen. Ich seh es genau: Etwas liegt Euch auf der Seele.“
Ein dankbares Lächeln. „Dem Himmel sei Dank für dein aufmerksames Auge. Es ist wirklich nichts, ich muss nur wieder an die Arbeit.“ Er wandte sich ab, bahnte sich einen Weg durch die Reihen der Maskierten und von der Realität Entrückten.
Lorenzo wollte ihm nachgehen, doch eine Hand auf der Schulter hielt ihn zurück.
„Er ist und bleibt ein alter Griesgram“, zürnte Domenico, des Maestros ältester Sohn von vierundzwanzig Jahren. Anders als der Vater verstand er die ihnen gewährte Ehre als Pflicht, es wäre ihm nicht im Traum eingefallen, das Fest frühzeitig zu verlassen.
„Sprich nicht so über ihn“, widersprach Lorenzo, „große Kunst wird von ihm erwartet.“
„Von uns!“, korrigierte Domenico und nahm seine schlichte, weiße Maske ab – er war kein Freund des närrischen Treibens und der Verkleidung, niemals gewesen, selbst in der Hochburg des Karnevals nicht, in ihrer Heimatstadt Venedig. „Ohne deine Zeichnungen und meinen wohlfeilen Pinsel ist all sein Ruhm vergebens.“
„Er ist der Maestro. Wir können nur tun, was er uns befiehlt.“
„Was ist ein Herr schon ohne seine Diener wert?“
Noch bevor Lorenzo den Einwand entkräften konnte, schnitt ihm die jubelnde Menge das Wort ab.
„Still, Widerspruch kann nichts gelten!“
Aus der tobenden Menge tauchte Cristina auf, des Maestros bevorzugtes Modell und nicht minder kreative Muse. Sie hielt geradewegs auf Domenico zu, der ahnte, was ihn erwartete. So wich er einen Schritt zurück, prallte aber gegen die breite Brust von Angelo, dem schwarzen Diener der Tiepolos.
„Tritt beiseite“, befahl Domenico, was dieser umgehend tat. Aber es war zu spät, aus den gierigen Fingern Cristinas gab es kein Entrinnen.
„Vieni, balla con me!“ Komm, tanz mit mir!
Zwischen ihren langen Strähnen, die noch eine Spur schwärzer waren als Lorenzos, funkelten zwei Augen, die ein Nein als Antwort nicht gelten ließen.
„Wir sind nicht in Venedig“, war die klägliche Antwort Domenicos, „was sollen die werten Herren von uns denken?“
Sie warf die Mähne in den Nacken und lachte. „Herr? Diener? Niemand kümmert es. Heute sind wir alle gleich.“
„Ihr solltet tun, was sie verlangt“, brummte Angelo, „allein, um ein größeres Aufsehen zu vermeiden.“
Recht hatte er, dachte sich Lorenzo. Cristina war in dieser Stimmung nicht zu bremsen. „Jetzt geh schon, wenn dir so viel an unserem Ruf liegt.“
„Soll ich etwa Angelo bitten“, giftete Cristina, „damit alle sehen, dass wir uns mit Wilden umgeben?“
Mit keiner Wimper zuckte der schwarze Diener, er blieb stoisch, den Blick nach vorne, über alle Köpfe hinweg gerichtet, obwohl Lorenzo wusste, dass die Beleidigung nicht ungesühnt bliebe. Irgendwann würde sich die Gelegenheit ergeben, Angelo vergaß nichts.
Notgedrungen lenkte Domenico ein und ließ sich von Cristina mitten unter die feine Hofdienerschaft ziehen.
„Meint Ihr, junger Herr“, fragte Angelo, „sie wird gnädig mit ihm sein?“ Ein Lächeln fiel auf seine wulstigen Lippen, darüber schloss sich eine nicht minder ausgeprägte Nase und breite Stirn an, die in langes, kupferfarbenes Haar überging – ein missglückter Versuch des Maestros, dem Hofvolk die Angst vor dem schwarzen Koloss zu nehmen.
„Ich fürchte, er bekommt, was er verdient.“
„Ich denke, sie auch.“
Es sollte keinen Atemzug länger dauern, als sich um die beiden Tänzer ein Kreis bildete. Anfeuerungsrufe gellten durch den Saal.
„Nimm mich hoch“, befahl Lorenzo, und Angelo setzte ihn auf die Schultern.
Hier oben hatte der junge Tiepolo freie Sicht. Welch wunderbar inspirierender Anblick! Masken, wohin Lorenzo schaute. Kleine, mit Pailletten besetzte Augenmasken konkurrierten mit üppig verzierten Gesichtern. Andere stellten Tiere dar – Katzen, Tiger oder Vögel, aus denen Federn sprossen. Einer ging mit der schwarzen Schnabelmaske des Pestdoktors umher – runder Hut und ein einfaches, wallendes Gewand, einen Stock in der Hand, um Kranke abzuhalten. Er jagte Lorenzo einen Schauer über den Rücken.
„Fürchtet Ihr Euch, junger Herr?“, fragte Angelo, dem nichts zu entgehen schien, obwohl ihm seine langen, kupferfarbenen Haare ins Gesicht hingen. Es war seine Art der Maskierung, wenngleich niemand diesen Koloss verwechseln konnte.
„Pah, niemals!“, log Lorenzo, wissend, dass er Angelo nicht belügen konnte. Der war von klein auf an seiner Seite gewesen, hatte mit ihm gespielt, ihn getröstet und beschützt. Er war sein eigentlicher großer Bruder gewesen, während Domenico schon damals in der Werkstatt des Vaters arbeitete.
„Ich spüre, wie Ihr zittert.“
„Du irrst. Es ist die Freude, nicht die Angst.“
„Vermisst Ihr die Heimat?“
Lorenzo seufzte. „Ich wünschte, Mutter wäre hier und könnte mit uns feiern. Es ist so ein prachtvolles Fest.“
„Ich bin sicher, sie ist mit jedem Gedanken bei Euch.“
„Und ich bei ihr“, sagte er leise und drückte eine Träne weg. „Genug, jetzt“, er holte tief Luft, „ich will Spaß haben. Sag, was wollen wir als Nächstes tun?“ Ihm stand der Sinn nach einem Abenteuer.
„Der Fasan könnte uns munden.“
Es verging keine Stunde, in der Angelo nicht ans Essen dachte. Kein Wunder. Sein muskulöser Körper wollte versorgt werden.
„Achtzehn Speisen und fünf Körbe mit feinstem Konfekt sind gereicht worden“, antwortete Lorenzo verblüfft, „dazu Wein, Bier und Geistiges. Hast du immer noch nicht genug?“
„Nicht einen Bissen habe ich bekommen.“
„Hat man dir etwa nichts in der Küche serviert?“
„Sie fürchten mich, junger Herr.“
„Unverschämtheit!“ Ein entschiedener Schenkeldruck und Angelo setzte ihn ab. „Warte hier. Ich werde dir etwas besorgen.“
„Wie Ihr befehlt.“
Wieder auf den Beinen drückte sich Lorenzo an den klatschenden, singenden und auch taumelnden Gestalten vorbei, jetzt nicht mehr vom Zauber eines Maskenballs durchdrungen, eher missmutig bis aufgebracht.
„Tretet zur Seite!“, blaffte er einen im Kostüm eines französischen Chevaliers an, nicht wissend, wer genau sich dahinter verbarg. Der Nächste stellte sich ihm geradewegs entgegen, ein beleibter Kerl mit verschwitzten, schwarzen Haaren, darunter die furchterregende Maske eines Drachen oder sonstigen Getiers mit Nüstern und klaffenden Zähnen.
„Wohin des Wegs, junger Tiepolo?“
Lorenzo stockte. „Woher wisst Ihr, wer ich bin?“, und im selben Moment ging die Hand zur Maske, die er aufs Haupt gerückt hatte. „Wer seid Ihr?“
Der Drache nahm die Maske ab. Es war der Meister des Stuckierens höchstselbst, der Lombarde Antonio Bossi, mit dem sein Vater in den vergangenen Wochen immer wieder zusammengesessen und die Ausgestaltung des Saales besprochen hatte. Ein wichtiger Mann, er sollte vorsichtig sein.
„Verzeiht, wenn ich Euch nicht gleich erkannt habe“, entschuldigte sich Lorenzo. „Der Appetit treibt mich zur Tafel.“
In Bossis Begleitung befand sich ein weiterer, etwas dicklicher Maskierter, dem der Hut eines türkischen Janitscharen nicht ganz passen, wie auch der angeklebte schwarze Bart nicht länger halten wollte. Es handelte sich unverkennbar um Balthasar Neumann, den Baumeister dieser fürstlichen Residenz zu Würzburg, und nach dem Hausherrn um den wichtigsten Befehlsgeber am Hof, auch und gerade für die Tiepolos.
Eine hastige, vielleicht übertriebene Verbeugung Lorenzos sollte die Unachtsamkeit wettmachen. „Seid gegrüßt, Meister Neumann.“
Der nahm den jungen Spross des großen Tiepolo kaum wahr, seine Aufmerksamkeit gehörte den Gästen. Disziplin und Ordnung standen für ihn an erster Stelle. Dass es ja niemand mit der Ausgelassenheit übertrieb. Der Fürst dinierte im Kreis seiner erlauchten Gäste nicht weit entfernt, und Neumann war selbstredend einer von ihnen. Wenngleich nicht von vornehmer Herkunft, so war er doch ein hochdekorierter Obrist im Kampf gegen das Türkenheer vor Belgrad und nicht weniger des Fürsten wichtigster Diener in diesem atemberaubenden Bauvorhaben.
„Wo ist Euer Vater?“, fragte Bossi mit schwerer Zunge. „Ich glaube, ihn noch vor einem Moment gesehen zu haben.“
„Er hat sich zurückgezogen. Die Entwürfe für den großen Saal beschäftigen ihn über alle Maßen.“
„Daran tut er wohl“, antwortete Neumann unerwartet und mit einer unverhohlenen Warnung, „nicht, dass wir erneut auf einen Betrüger hereinfallen.“
Damit war ein windiger Gauner namens Visconti gemeint, der vor den Tiepolos an den Hof berufen worden war. Statt die Räume und Decken kunstfertig auszumalen, versteckte dieser Filou sich hinter einem Gerüst und verprasste den üppigen Vorschuss für Wein, Weib und Gesang. Die Schmach war in Windeseile durch die Lande gegangen und hatte manch schadenfrohen Geist gefunden.
Lorenzo wusste von den hohen Erwartungen, die nun an die Tiepolos gestellt wurden. Er beschwichtigte: „Habt keine Sorge. Mein Vater wird Wunderbares, nie Dagewesenes vollbringen. Das kann ich Euch versprechen. Nun entschuldigt mich, mein Hunger lässt sich nicht länger bezähmen.“
Nur schnell weg, keinen Blick zurückwerfen und besser etwas vorsichtiger sein. Auf diesem Fest der Diener trieben sich maskierte Herren herum, selbst wenn sie eigentlich keine waren.
Die lange Tafel mit den vielen Speisen und Getränken lag verwaist da, während die Gäste von Cristinas Freizügigkeit berauscht wurden. Nur einer konnte dem Treiben nichts abgewinnen: Der alte Hofnarr in seinem lächerlich normalen Kostüm, grün-weiß gestreift, mit einem Sternenkranz von Glöckchen um Leib und Haupt. Seiner Arbeit beraubt, kümmerte er betrunken in einer Ecke. Lorenzo fühlte mit ihm. Wozu war ein Narr unter lauter Narren noch nützlich?
Da packte ihn jemand am Arm. „Komm mit!“, befahl Domenico außer Atem und schweißgebadet. „Cristina wird uns noch alle ins Verderben stoßen.“
„Lass mich los!“, widersetzte sich Lorenzo, „Angelo hat noch nichts …“ Doch es war vergebens, schließlich überflüssig. Angelo tauchte hinter Domenico auf. Er ließ seine Schutzbefohlenen nie aus den Augen.
„Das wird nicht gut enden.“
„Soll sie sehen, wie sie das Vater erklärt. In ihr steckt der Teufel.“
Weiterer Widerspruch war zwecklos, Gegenwehr vergebens. Domenico zog seinen Bruder aus dem Saal, hinaus in den weiten, leeren Gang, wo sich die Stimmen brachen und in den Schatten verloren.
„Wir können sie doch nicht einfach zurücklassen“, protestierte Lorenzo.
Domenico wollte nichts davon wissen. „Doch, können wir.“
Ein flehender Blick zurück. „Angelo …“
Der klang gelassen. „Das Schicksal nimmt sich ihrer an.“
Der Lärm verebbte, je weiter sie sich in den dunklen Gängen des Schlosses verloren. Die vielen Baustellen dort änderten sich täglich und damit auch die Orientierungspunkte. Schließlich wussten sie gar nicht mehr, wo sie sich befanden.
„Porco Giuda!“, fluchte Domenico – zum Teufel nochmal. „Wo sind nur unsere Gemächer?“
„Wir hätten die andere Abzweigung nehmen müssen“, erwiderte Angelo.
„Wieso hast du das nicht früher gesagt?“
„Ihr habt die Führung übernommen.“
„Hüte deine Zunge!“
Das ungewöhnlich scharfe Wortgefecht zwischen Diener und Herr ging an Lorenzo vorüber, seine Gedanken verloren sich in der mondbeschienenen Nacht jenseits der Fenster, wo Schneeflocken taumelten und die Welt in Zuckerguss tauchten. Friedlich und einladend lag sie da, dieses Gegenstück zum Lärm und der stickigen Luft des Ballsaals.
„Lasst uns eine Schneeballschlacht machen.“
„Red keinen Unsinn!“, beschied Domenico. „Vater erwartet uns.“
„Vater ist in seine Pläne vertieft“, konterte Lorenzo.
„Oder er muss Cristina einfangen“, fügte Angelo hinzu.
„Ihr seid Langweiler“, und kaum gesagt, lief Lorenzo auch schon los. Mitten hinein in den nächsten dunklen Gang, um die Ecke und um eine weitere. Einzig gelenkt vom Mondlicht, das durch die Fenster hereinfiel und dem drängenden Wunsch, diese Nacht tobend im Schneegestöber zu verbringen. Die mahnenden Rufe Domenicos verblassten, die schweren Schritte Angelos blieben ihm aber auf den Fersen.
Dann endlich, nach einer engen Treppe hinunter ins Erdgeschoss, fiel kalte Luft herein, eine Tür stand offen. Diener eilten hindurch, in den Händen Decken und Mäntel, einer jonglierte gar mit heißen Steinen. Und als Lorenzo endlich in diese wunderbare Nacht trat, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen.
Im Fackelschein des Hofes standen etliche Pferdeschlitten aufgereiht. Auf einem hatten sich Musiker eingefunden, sechs an der Zahl, warm angezogen und die empfindlichen Instrumente gegen die Schneeflocken schützend, was ein aussichtsloses Unterfangen war. Binnen kurzem legte sich erneut eine weiße Schicht auf Geigen, Oboen und Hörner, wie auch auf die vielen Häupter dieser unerwarteten Festgesellschaft. Und dass es eine vornehme, herrschaftliche war, daran bestand kein Zweifel.
Prächtig glitzernde Gewänder waren mit goldenen und silbernen Brustpanzern besetzt, sie schillerten im Schein der Fackeln als exotisch anmutende Uniformen eines türkischen Paschas, eines römischen Feldherrn oder eines griechischen Eroberers. Die Gesichter waren maskiert, Lorenzo glaubte in einem dieser Kriegsherren Alexander den Großen zu erkennen, in einem anderen Cäsar und in einem dritten gar die Verkörperung der Pallas Athene – die griechische Göttin der Weisheit, des Kampfes und der Kunst.
Doch am meisten wurde Lorenzos Erstaunen von diesen prachtvollen, wunderbar gestalteten Schlitten gespeist. Das waren keine einfachen Gefährte mit einer groben, unbequemen Holzauflage, das waren wahre Meisterwerke der Schnitz- und Schmiedekunst. Der Körper eines angriffslustigen Widders mit geschwungenen Hörnern schützte seinen Herrn gegen jegliche Attacke, desgleichen ein wuchtiges Wildschwein mit gefletschten Hauern oder ein Hirsch mit mächtigem Geweih. Nur ein Tier schien der Attacke erlegen – ein braun gefleckter, auf dem Rücken liegender und vor Schmerz gekrümmter Jaguar, in dessen Seite sich ein Pfeil gebohrt hatte. Aus dem Maul schwang sich eine Zunge und stachen Zähne hinaus, die Tatze war mit scharfen Krallen zur letzten Gegenwehr erhoben. Welch ein Meisterwerk!
„Bist du nicht ein Tiepolo, des Maestros jüngster Sohn?“
Die ihn da unvermittelt ansprach, war Pallas Athene. In der Hand einen Speer, auf dem Haupt den nach vorne geschwungenen Streithelm, und die Brust schützte ein goldener Panzer mit dem gewundenen Schlangenhaar einer Gorgonin.
Verblüfft fiel Lorenzo im ersten Moment nichts anderes ein als eine Verbeugung, darauf folgte ein Stottern. „Ja, Eure Hoheit, ich bin Lorenzo …“
Die Göttin lachte. „Ich bin keine Hoheit, nur eine Comtesse, eine Gräfin. Habe ich dich so sehr verwirrt?“
Ja, das hatte sie, und sie legte nach.
„Hübsch bist du, fast schon sündhaft.“ Ihre Hand hob sein Kinn an, der stechende Blick der Medusa ließ ihn schaudern.
„Es schickt sich nicht mir derart zu schmeicheln“, erwiderte er mit unsicherer Stimme. „Ich bin nur ein bescheidener Diener unseres hochfürstlichen Herrn, Ihr aber seid eine Göttin.“
Sie lachte herzerfrischend. „Comme c‘est merveilleux! Ich wünschte, mein abtrünniger Gatte fände deine Worte und hätte deinen unwiderstehlichen Charme.“ Sie streichelte ihm übers Haar. „Oh, du mein junger, wunderschöner Chevalier. Ich bin sicher, die Frauen verzehren sich nach dir.“
Jetzt wurde er rot und das mitten im Schneegestöber. Die Kehle war trocken, unmöglich auch nur einen Ton hervorzubringen.
Und sie? Sie lachte erneut, nein, nicht boshaft oder höhnisch, es hörte sich mehr nach einem wohligen Gurren an, so als träfe sich ihre Vorhersage mit einer bislang unerfüllten Leidenschaft.
Zu Lorenzos Rettung schallte ein Ruf über den Hof, genauer: ein Befehl.
„En selle!“ Aufgesessen!
Eine Peitsche knallte und die Schlittenführer nahmen ihre Plätze am hinteren Ende der Schlitten ein – junge, adelige Studenten oder Offiziere, die für die Herrschaften mit Peitsche, Bremse und Füßen lenkten.
Lorenzo trat einen Schritt zurück, räusperte und verneigte sich. „Ich wünsche Euch eine angenehme Ausfahrt.“
„Du siehst mir ein wenig traurig aus“, sagte die Comtesse. „Was hältst du davon, wenn du mich begleitest?“
Er glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. „Verzeiht, Comtesse, was habt Ihr da gesagt?“
„Es ist genügend Platz für uns beide und es ist kuschelig warm.“
Lorenzo zögerte. Durfte er auf das Angebot eingehen? Es war gegen jede Regel am Hof des Fürsten, wo großer Wert auf die Etikette und das Zeremoniell gelegt wurde.
Wieder knallte die Peitsche.
„Allez! On y va!“ Los geht’s!
„Jetzt! Bevor es zu spät ist.“
Der Schlitten zog an. Lorenzo blickte sich um, noch immer zweifelnd, aber mit wachsender Abenteuerlust. Schließlich kamen Angelo und Domenico durch die Tür auf den Hof gelaufen. Damit war die Entscheidung gefallen. Er sprang auf den Schlitten auf, landete zwischen den Schenkeln der Comtesse und achtete nicht weiter auf die Rufe seines Bruders und des Dieners.
Was soll‘s?! Zum Teufel mit der Etikette!
Die Fahrt ging durchs Tor hinaus auf den weiten Platz vor der Residenz. Das Mondlicht glitzerte im frischen Schnee. Niemand traute sich in der Nacht so nah an das Schloss heran, die Wachen hätten ihm Beine gemacht. Jetzt erst recht, da die Ausfahrt einem Ausfall glich, von dem keiner wissen konnte, wem er galt. Fackelfeuer flackerte an und zwischen den Schlitten, Peitschen knallten wie Gewehrfeuer, Kommandos gellten und die Insassen der Streitwägen waren unverkennbar gefürchtete Eroberer. Nur eins wollte nicht auf einen Handstreich schließen lassen – die Musik. Statt martialischer Töne, die die Krieger in die Schlacht begleiteten, spielte das kleine Orchester zu Tanz, Jubel und Heiterkeit auf.
„Heyja! Lauf!“, skandierte es hinter Lorenzo und der Comtesse, gefolgt vom hellen Surren der Peitsche und dem Schnauben des Pferdes. Der Schlittenführer musste ein Soldat sein, gemessen an der resoluten Stimme.
„Gefällt es dir?“, hörte Lorenzo an seinem Ohr.
Ein entschiedenes Nicken, nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. War das ein Abenteuer! Er befand sich mit einer leibhaften Comtesse in einem Schlitten, ach, in einem wunderbaren Streitwagen. Davor und dahinter weitere, furchteinflößende Pferdegespanne, denen man besser nicht in die Quere kam. Denn selbst die Pferde waren nicht einfach nur harmlose Rösser, sie waren mit Büschen, Bändern und anderem Zierrat geschmückt, sodass man sie als Bären, Löwen, Adler und Schwäne deuten konnte. Welch eine Pracht! Er hatte nichts Vergleichbares je erlebt – selbst in der Hochburg des Karnevals nicht, in Venedig. Denn dort war er nur der Sohn eines Handwerkers, hier aber der Protegé einer wahrhaften Comtesse.
Vorbei am Residenzgarten und einer Kirche tauchten kleine Lichter aus dem Dunkeln auf, die neugierige Bürger erwartungsvoll vor sich hielten.
„Greif nach vorne in den Korb“, drang es an Lorenzos Ohr, und er folgte widerspruchslos. Als Erstes fand er den heißen Stein, der die Füße wärmte, dann den Korb, darin Konfekt und Obst.
„Was soll ich damit?“, fragte er.
„Werfen natürlich.“
„Werfen? Warum?“
Die Comtesse nahm es ihm aus der Hand, gab dem Lenker ein Zeichen, die Peitsche surrte und der Schlitten schloss zum vorderen auf. Dann geschah Undenkbares. Die Comtesse bewarf den türkischen Pascha mit süßem Konfekt.
„Graf Falkenberg, was seid Ihr nur für eine lahme Ente“, nicht bösartig, nein, sie lachte und machte ungebührliche Gesten, dass man meinen konnte, eine liederliche Dirne habe sich unter die hohen Herrschaften geschlichen. Und der Pascha quittierte die Unverschämtheit nicht etwa mit dem krummen Türkensäbel, er tat das Gleiche. Konfekt und Obst waren auch seine Munition, es flog Lorenzo um die Ohren wie Kanonenkugeln.
„Schneller!“ Die Peitsche gehorchte und der nächste Schlitten wurde ihr Ziel. „Mehr!“, ermutigte sie Lorenzo, „gib mir mehr“, und er reichte ihr Konfekt und Obst wie zuvor.
Nun hatten sie es mit einem anderen Gegner zu tun. Die Comtesse grüßte nicht mit Schmähungen, sondern mit fragwürdigen Liebkosungen.
„Liebster Gatte“, schnurrte sie, „wollt Ihr den Kampf mit mir wagen?“
Der Comte, im Kostüm eines römischen Feldherrn, war nicht gewillt. Lustlos winkte er ab, nahm stattdessen einen Schluck Wein, was die Comtesse anstachelte.
„Fehlt Euch etwa der Mut? Hier, nehmt das!“, und eine Handvoll Konfekt flog ihm um die Ohren.
„Ihr macht Euch lächerlich“, kam es indigniert zurück.
Sie stichelte weiter. „Verlogener Schlappschwanz!“
Er quittierte es mit einem höhnischen Lächeln. „Liebreiz ist nicht Eure erste Tugend.“
„Wenn Ihr ein richtiger Mann sein wollt“, keifte sie, „dann stellt Euch endlich! Oder habt Ihr Eure hochwohlgeborenen Hosen voll?“
Jetzt lachte sie, so laut und entrückt, dass es Lorenzo ganz anders wurde. „Comtesse, wollt Ihr nicht jemand anderen wählen?“, er zeigte auf die Schlitten vor und hinter ihnen, aber auch die vielen am Wegesrand Stehenden, die das Konfekt und das Obst auflasen und in mitgebrachte Beutel steckten.
Darunter befanden sich Kinder, die sich mit Schneebällen bewarfen. Und just einer dieser Schneebälle verirrte sich aus dem Getümmel in den festlichen Zug.
War es Schicksal? Sicher ein verhängnisvolles Unglück, dass das Geschoss mitten im Gesicht des Comtes landete. Der ließ den Schlitten umgehend anhalten.
„Bravo!“, applaudierte die Comtesse, „welch vorzüglicher Treffer.“ Auch sie ließ den Schlitten stoppen. Lorenzo sprang heraus, bot ihr die Hand an.
Der Comte hielt sich das schmerzende Auge und forderte vom Schlittenführer die Peitsche. Dann stapfte er durch den Schnee auf die Unglücklichen zu. „Wer war das?!“
Die Kinder wichen zurück, keines antwortete.
„Ich frage nochmals: Wer von euch hat mich angegriffen?“ Die Comtesse schritt ein, versuchte ihn zu beruhigen. „Es war ein dummer Zufall, werter Gatte. Nichts weiter. Kommt, bevor wir die anderen verlieren.“
Rückzug war für den Comte indiskutabel, Vergeltung für die erlittene Schmach erste Pflicht. „Ein letztes Mal!“, schrie er sie an, „komm hervor und ich will es bei einem Dutzend Peitschenhiebe belassen.“
Das waren schlechte Aussichten für ein Geständnis, die ersten retteten sich in die Nacht. Einzig ein Junge und ein Mädchen schienen den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Sie bewarfen sich weiterhin mit Schnee, tollten herum wie junge Hunde.
„Ihr da!“, befahl der Comte, „kommt her“, was die Ahnungslosen sofort taten. Vielleicht gab es eine extra Portion vom leckeren Konfekt.
Lorenzo sah ihre freudestrahlenden Gesichter, die ein Stück dunkler und asketischer waren als die örtlichen. Ihre Kleidung passte ebenso wenig in diese Stadt, eher südländisch, es mussten Reisende sein, Händler oder …
„Respektlose, gottlose Brut!“, schimpfte sie der Comte und deckte sie mit wuchtigen Peitschenhieben ein, auf dass sie zu Boden gingen und heulend um Gnade flehten.
„Haltet ein“, ging ihm die Comtesse in den Arm, „Ihr züchtigt unschuldige Kinder.“
„Niemand ist unschuldig“. Ein Stoß beförderte sie in den Schnee und weitere Hiebe fanden ihr Ziel auf den blutigen Rücken der Kinder. „Ich will euch lehren, einen Vornehmen von Stand und Ehre zu beleidigen.“
Graf Falkenberg, der türkische Pascha, dessen Schlitten ebenfalls angehalten hatte, redete auf ihn ein. „Comte, genug, Ihr bringt sie noch um.“
Eine dritte Vornehme kam hinzu, eine Aphrodite oder Helena in einem prächtigen Pelz. „Comte, beherrscht Euch“, aber es war vergebens.
„Baronesse, bleibt Ihr bei Euren Liebschaften, ich aber will Gerechtigkeit walten lassen.“
Lorenzo nahm all seinen Mut zusammen und warf sich dem Comte vor die Füße. „Gnädigster Herr und Fürst, zeigt Erbarmen. Sie wussten nicht, was sie taten.“
„Das schützt sie vor Strafe nicht“, erwiderte der Comte. „Geh zur Seite, bevor auch du meine Peitsche zu spüren bekommst.“
„Herr, ich flehe Euch an …“
„Wie du willst.“ Die Peitsche erhob sich, da stachen eine Frau und ein Mann aus dem Dunkel hervor, sie nahm die Kinder schützend in die Arme, während der Mann zu begreifen versuchte, was hier vor sich ging.
„Per amor del cielo! Che cosa è successo?“ Um Himmels Willen! Was ist geschehen?
Also hatte Lorenzo recht behalten: Es waren Landsleute von ihm, allerdings sprach der Mann einen seltsamen Dialekt. Genuesisch? Neapolitanisch? Diese Kerle verstanden keinen Spaß, wenn es um Ehre und Familie ging. Vorsicht war geboten.
Mit blutzornigem Gesicht ging er auf den Comte los, in der Hand eine kurze Klinge. „Che cosa hai fatto?!“ Was hast Du getan?!
Der Comte war von der Ungeheuerlichkeit überrascht, er wich einen Schritt zurück, bis er sich seiner Stellung besann und wieder zum Angriff überging. Die Peitsche flirrte durch die winterliche Luft – drei, vier, ein ganzes Dutzend Mal. Der Schlittenführer sprang seinem Herrn bei und schlug gleichsam auf die Unglückseligen ein.
Lorenzo atmete schwer, nicht vor Schmerz, sondern von der Last der Körper, die auf ihm lagen. Warmes Blut tropfte auf die Wangen und in die Augen, das Weinen und Wimmern der Kinder drang an sein Ohr. Dann endlich, als er es nicht mehr für möglich gehalten hatte, hörte er eine vertraute Stimme.
„Lorenzo! Wo bist du?!“ Es war Angelo, sein Schutzengel und treuester Freund.
Darauf in gebrochenem Deutsch: „Dein Tod, meine Ehre.“