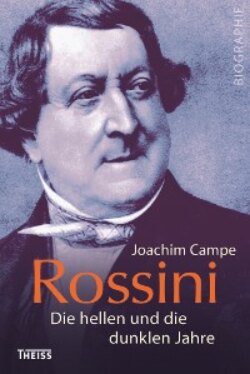Читать книгу Rossini - Joachim Campe - Страница 7
ROSSINI ERFINDET SICH SELBST
ОглавлениеVivazza
Giuseppe Rossini war ein unruhiger Mann. Ende 1788 verließ er seine Heimatstadt Lugo, einen kleinen Ort östlich von Ravenna, wo er Stadttrompeter war – also Fanfare blies und die Verlautbarungen der Obrigkeit vorlas. Einen trombetta gab es in jeder Stadt, denn lesen konnten nur wenige. Giuseppe Rossini verdiente in Lugo nur mäßig, und er dachte daran, sich zu verbessern. Ihn lockte Pesaro. Die Hafenstadt südlich von Rimini war reicher als das verschlafene Lugo, sie konnte sich sogar eine eigene Oper leisten, das Teatro del Sole; dort wollte Giuseppe Rossini das Horn spielen, sein eigentliches Instrument. Und er machte Eindruck bei den Aufführungen. Als er sich nach dem Ende der Saison um die Stelle eines Stadttrompeters bewarb, hielt ihn der Rat freilich hin. Enttäuscht zog Giuseppe Rossini weiter nach Ferrara, wo er in der Militärkapelle das Jagdhorn blies. Doch in Pesaro entwickelten sich die Dinge schneller als gedacht – Luigi Ricci, der zweite Stadttrompeter, bot Rossini an, seine Stelle zu verkaufen. Der neue Verwaltungschef reagierte allerdings empört auf solche Machenschaften und ernannte Rossini am 29. April 1790 zum neuen trombetta von Pesaro. Er war ein Hitzkopf, das trug ihm seinen Spitznamen ein: Vivazza. Den Frauen gefiel das – zumindest einer, der Bäckerstochter Anna Guidarini, die im selben Haus wohnte wie er. Auch sie war musikalisch. Obwohl sie keinen professionellen Gesangsunterricht genossen hatte, trat sie hin und wieder in der Oper auf. Die beiden wurden rasch ein Paar, und schon bald wurde Anna schwanger. Ehe es zu spät war, heirateten Giuseppe und Anna, und im Februar 1792 wurde das erste Kind geboren. Die schmerzhaften Wehen seiner Frau sollen Vivazza in solche Unruhe versetzt haben, dass er ins Nebenzimmer flüchtete und bei jedem Schrei seiner Frau die Statue eines Apostels köpfte. Dann, am 29. Februar 1792, war Gioachino endlich da.
Die Rossinis wohnten im zweiten Stock eines schmalen Hauses in der Via del Duomo, und Gioachino wuchs auf engstem Raum auf. Gleichwohl war seine frühe Kindheit glücklich, denn die Unruhe des Vaters war verflogen, und die kleine Familie hing in großer, ja überschwänglicher Liebe aneinander. Die zahlreichen Briefe an die Mutter, die Rossini als Erwachsener schrieb, sind ein Beleg dafür.
*
Die Zeit war freilich unruhig geblieben. Mit einer zahlenmäßig unterlegenen Armee stieß Napoleon im April 1796 in Richtung Genua vor. Er schlug die piemontesisch-österreichische Armee, worauf Vittorio Amadeo III. von Sardinien einen Waffenstillstand schließen musste. Napoleon rückte weiter vor, südlich von Mailand traf er auf die Österreicher. Der bravouröse Angriff auf der Brücke von Lodi erzwang den Übergang über die Adda und drängte die Österreicher nach Süden ab. Napoleon sorgte dafür, dass zahlreiche Stiche von dem Heldenstück in Umlauf kamen – er selbst, die Trikolore in der Faust, der Truppe über die noch von Österreichern gehaltene Brücke voranstürmend, Ikone einer ganzen Epoche. Am 15. Mai zog er in Mailand ein und versprach den versammelten Honoratioren eine Neuordnung Norditaliens: Die Lombardei werde Republik werden und Teile der päpstlichen Romagna erhalten. Das hörte man natürlich gern. Tatsächlich ermunterte Napoleon den Magistrat in Bologna und Ferrara, sich vom Kirchenstaat loszusagen und der Cisalpinischen Republik beizutreten. Dafür musste die Lombardei indessen zahlen. Napoleon erlegte ihr hohe Kontributionen auf, denn die Pariser Kriegskassen waren leer. Räuberei und Willkür stießen viele Italiener ab, und der Historiker Johannes Willms urteilt, aus dem zuerst „bejubelten Befreier“ sei in wenigen Tagen ein „Prokurator des Schreckens“7 geworden. Dazu kam die Feindschaft des Klerus gegen das gottlose neue System. Das veränderte das Land, und im vorher so friedlichen Italien standen sich Republikaner und Klerikale feindselig gegenüber. Auf welcher Seite Giuseppe Rossini stand, versteht sich.
Auch in Pesaro, das zum Kirchenstaat gehörte, marschierten die Franzosen am 5. Februar 1797 ein. Es gab keinen Widerstand – vielmehr beeilte sich die Verwaltung, dem neuen Mann zu huldigen. Napoleon kam schließlich auch selbst. Er wollte die päpstlichen Städte nicht völkerrechtswidrig annektieren, und sein Gastgeber, der einflussreiche Graf Mosca, half ihm bei seinem Plan, die Stadt wie Bologna und Ferrara auf dem Vertragsweg der neuen Cisalpinischen Republik einzugliedern. Giuseppe Rossini war begeistert – er hing ein neues Namensschild an seine Tür: „Wohnung des Bürgers Vivazza, eines wahren Republikaners“, und als auf der Piazza unter schmissigen Klängen ein Freiheitsbaum errichtet wurde, dirigierte er das Orchester. Die „Patrioten“ gingen einen Schritt weiter: Sie bewaffneten sich, vertrieben die päpstlichen Soldaten und setzten einen neuen Rat ein, der für die Vereinigung Pesaros mit der Cisalpinischen Republik stimmen sollte. Am Beitrittstag übte Giuseppe Rossini sein Amt mit besonders patriotischem Eifer aus. Die Gazetta di Pesaro meldete, dass die Einwohner schon in der Frühe von „den Tönen der Trompete geweckt worden [seien, d. Verf.], die der hervorragende Patriot Rossini vor ihren Häusern blies“8. Eigentlich hätte Giuseppe Rossini zufrieden gewesen sein müssen. Trotzdem beschloss er 1798, sein Amt aufzugeben und zusammen mit seiner Frau auf Operntournee zu gehen. Es war wohl nicht die wieder aufkommende Unruhe, die ihn trieb, sondern auch die Furcht vor den instabilen Verhältnissen. Wenn die Klerikalen wieder an die Macht kamen, würden sie sich für sein patriotisches Trompeten rächen.
1799 wurde er tatsächlich ein Opfer der Politik. Da Napoleon und seine Armee in Ägypten waren, ließen sich die Österreicher auf ein Bündnis mit England und Neapel ein und riskierten einen Angriff in Italien. Außerdem drang eine russische Armee vor und sorgte dafür, dass die päpstliche Herrschaft wiederhergestellt wurde. Giuseppe Rossini wurde in Bologna verhaftet und wanderte durch die Gefängnisse von Imola, Cesena und Rimini, ehe er nach Pesaro gebracht wurde, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Doch sein Idol rettete ihn. Ende 1799 war Napoleon zurück in Paris, überquerte mit seiner Armee zur allgemeinen Verblüffung die Alpen und stellte durch den Sieg bei Marengo in Norditalien die alten Verhältnisse wieder her. Darauf dachte man auch in Pesaro um und ließ den inzwischen gar nicht mehr so feurigen Vivazza frei. Patriotismus hin, Patriotismus her – Giuseppe Rossini war endgültig von der Politik kuriert, und mit seiner Frau nahm er das Wanderleben von Bühne zu Bühne wieder auf.
Finstere Jahre allerdings für Gioachino, der sich nach dem festen Zusammenhalt der kleinen Familie in der Via del Duomo sehnte. Sie schien aber nicht mehr zu existieren, jedenfalls ließen die Eltern ihn nun oft wochenlang allein, nur eine Großmutter sah nach ihm. Auch seine Ausbildung litt – die Schreib- und Leseübungen, die ihm ein Franziskaner erteilte, fesselten ihn ganz und gar nicht, lieber zog er mit Freunden umher und machte die Stadt unsicher. Wie es dabei zuging, hat Francesco Genaro, einer seiner kindlichen Spießgesellen, 1865 bezeugt; er schrieb ihm: „Im Nacken habe ich noch die verheilte Wunde, die durch einen von Ihrer erlauchten Exzellenz nach mir geworfenen Stein verursacht wurde. Dies geschah zu der Zeit, als es dir Spaß machte, in die Sakristeien einzubrechen, um die Meßkännchen zu leeren, und als du eher ein Problem als ein Vergnügen für die Welt warst.“9 So konnte das nicht weitergehen, und um Gioachino zur Raison zu bringen, verdonnerten ihn die Eltern, beim Schmied den Blasebalg zu treten. Doch das beeindruckte Gioachino nicht. Er wurde nicht fleißiger und ließ auch nicht von seinen Dummjungenstreichen. Darauf probierten die Eltern ein stärkeres Mittel und gaben ihn zu einem Schweineschlachter nach Bologna, der dafür sorgen sollte, dass der Priester ihn Rechtschreibung lehrte und der Cembalist des Teatro Communale ihm ersten Musikunterricht gab. 1801 nahmen die Kindheitswirren aber dann doch ein glückliches Ende. Der Vater erhielt eine Professur für Jagdhorn am Konservatorium von Bologna und konnte sich nun selbst um seinen Sohn kümmern. Vor allem unterrichtete er ihn auf seinem Instrument, dem Horn, und diesmal reagierte Gioachino anders als auf all die früheren pädagogischen Experimente: Er übte fleißig, und wenn das Horn eine auffällige Rolle in seinen Partituren spielt, von der Italiana in Algeri bis zum Tell, mögen Jugenderinnerungen mitgespielt haben.
1802 gaben die Rossinis ihr Wanderleben auf. Den Anstoß gab ein bizarrer Theaterskandal im Teatro Nuovo10 in Triest. Auf dem Spielplan stand die Semiramis von Sebastiano Nasolini; der Stoff war beliebt bei den Komponisten, die Geschichte ist schaurig-schön. Auf dem Höhepunkt des ersten Aktes, als Semiramis vom Geist ihres ersten Mannes verfolgt wird, den sie gemeinsam mit ihrem Liebhaber ermordet hat, geschah es – als die Grassini, die die Semiramis sang, zu ihrer großen Arie ansetzen wollte, „konnte man zwischen dem lauten Beifall ein Zeichen der Mißbilligung hören“, wie es in einem anonymen Bericht heißt.11 Die Grassini wurde ohnmächtig, der Vorhang fiel, und vergebens versuchte man, das Publikum mit einem Ballett zu beruhigen. Aller Ärger kehrte sich nun gegen Anna Rossini, der die Fans der Grassini die Schuld gaben. Im zweiten Akt empfing Anna Rossini sogar ein Pfeifkonzert, woraufhin sie sich ebenfalls zu Boden fallen ließ. Damit war die Opernkarriere der Rossinis beendet. Sie gaben ihre Wohnung in Pesaro auf und zogen zurück nach Lugo, wo der Vater ein kleines Haus geerbt hatte. Gioachino dürfte das gefallen haben. Lugo mochte langweilig sein, aber der Familienfrieden war wiederhergestellt.
Ein Wunderkind
Ausgerechnet in Lugo bekam Gioachino zwei Lehrer, die ihn tiefer in die Musik einführten, als es der Vater gekonnt hätte: Don Giuseppe Malerbi und seinen Bruder Luigi, die das Civico Liceo musicale leiteten. Gioachino besuchte es seit 1802; außerdem unterrichteten die Malerbi ihn auch privat.12 Sie standen weit außerhalb der Welt Giuseppe Rossinis, denn sie waren schwerreiche Domherren und damit Stützen des Ancien Régime. Man weiß nicht, was er dazu sagte, dass sein Sohn immer mehr Zeit im Palazzo Malerbi verbrachte, schließlich war er einmal geschworener Feind der alten Gesellschaft gewesen. Freilich ließ sich viel zugunsten der Malerbi sagen: Sie hatten die Musikschule gegründet, die jedermann besuchen konnte, und vor allem kümmerten sie sich nun um seinen Sohn. Giuseppe Malerbi gab Gioachino hauptsächlich Gesangsunterricht, der rasch anschlug: Sein brillanter Knabensopran erlaubte ihm schon bald, öffentlich aufzutreten. Man darf nie vergessen, dass Rossini als Kind ein Star war („Ich kann nur sagen, daß ich sehr stolz auf meine schöne Stimme war“13, hat er selbst gesagt) und auch als Mann noch beachtlich sang.
Giuseppe Malerbis Gesangsunterricht machte Rossini mit der großen italienischen Tradition des bel canto vertraut. Gewiss klingt dieser für Hörer von heute schwierig, aber Kenner versichern, dass er den Sänger nie überfordert – immer bleibt genug Zeit zum Atemholen, und Rossini vermied bei „heiklen virtuosen Ausbrüchen die für die Stimme unbequemen Bereiche“14. Dass das Wort niemals Vorrang vor der Musik haben durfte, verstand sich in der Tradition, die Gioachino durch die Malerbi kennenlernte, von selbst – was aber nicht heißt, dass die Musik, und wenn es die gewagteste Koloratur ist, nicht ausdrückt, was die Figuren empfinden.
Die Malerbi gingen noch einen Schritt weiter. Sie erlaubten Gioachino, auf dem Spinett in ihrem Palazzo zu üben, und öffneten ihm auch ihre berühmte Musikalienbibliothek, die viele Partituren Mozarts und Haydns enthielt. Der junge Gioachino wird darin herumgelesen haben. Dazu kam offenbar Kompositionsunterricht. Jedenfalls schrieb der Zwölfjährige 1804 sein erstes Werk, die sechs Sonate a quattro. Den Auftrag hatte ihm der Gutsbesitzer Agostino Triossi aus Ravenna erteilt; Gioachino komponierte die Quartette in nur drei Tagen – auch das weist auf Späteres voraus.
Ein paar Takte aus dem Finale der sechsten Sonate kennt jeder Opernhörer, denn Rossini hat sie als reifer Komponist wieder verwendet. Das Motiv, das die Gewittermusik im Barbier einleitet, ist schon dem Zwölfjährigen eingefallen. Tempestà ist denn auch das folgende Quartett-Finale überschrieben, das freilich weit weniger eindrucksvoll ist als das temporale in der Oper – die erste, kindliche Vorwegnahme des Barbier. Gewiss klingt vieles noch nach Haydn, aber immer wieder meint man, für ein paar Takte den reifen Rossini zu hören – schon in den Sonate a quattro regt sich kompositorische Kraft, für die es kein Vorbild gibt. Durch Temperament und Elan hebt sie sich deutlich von der gelegentlich steifen Gediegenheit Haydns ab. Merkwürdig auch die Besetzung: Es gibt keine Viola, dafür aber neben dem Cello einen Kontrabass. Melodien und Läufe vertraut Gioachino meist der Violine an, wenn sie ernst gemeint sind. Wenn der Kontrabass Melodien oder gar Läufe spielt (wie im Finale der ersten Sonate), entsteht ein komischer Effekt, der schon an den Bass der Buffoopern denken lässt.
1805 ging die Zeit bei den Malerbi zu Ende, denn die Rossinis zogen nach Bologna. Gioachinos Karriere als jugendlicher Bühnenstar unterbrach das nicht. Die Familie dürfte dankbar für seine Honorare gewesen sein, denn Vater und Mutter bekamen nur noch wenig Engagements – Familie bedeutete auch ökonomische Gemeinschaft, daran hielt Rossini stets fest. In Bologna lernte Gioachino die Mombelli kennen, eine andere Künstlerfamilie: Der Vater gesuchter Tenor, die Frau sang Sopran, und die beiden Töchter machten das Gesangsquartett voll. Er führte sich bei den Mombelli ein, indem er eine Oper, in der der Vater auftrat, in der Aufführung nach dem Gehör mitschrieb – jedenfalls hat er es Hiller so erzählt. Vincenza Mombelli, eine Nichte Boccherinis, sang aber nicht nur. Sie dichtete auch und schrieb dem Wunderkind, das bei ihrer ersten Begegnung gerade dreizehn Jahre alt war, sein erstes Opernlibretto: Demetrio e Polibio. Ihre Verse weckten ein lyrisch-vokales Talent, von dem Rossini selbst nicht allzu viel gewusst haben dürfte. Wann die Partitur vollendet war, weiß man nicht, da Demetrio e Polibio erst 1812 Premiere hatte. Stendhal liebte die Jugendoper mehr als jedes andere Werk Rossinis. „Ich glaube, ich habe nie so lebhaft empfunden, daß Rossini ein großer Künstler ist“, schrieb er beim ersten Hören. „Jedes neue Stück bot uns die reinsten Gesänge, die lieblichsten Melodien … Was den Reiz dieser erhabenen Kantilenen steigerte, waren die Anmut und Bescheidenheit der Begleitung.“15 Rossini folgte in seiner ersten Oper den Meistern des 18. Jahrhunderts, sodass Stendhal finden konnte, was er in der italienischen Oper suchte: Schlichtheit, Lieblichkeit und Reinheit. Man fühle sich wie in den „verborgenen Winkeln“ eines „herrlichen Parks“, schwärmt er – der ganz junge Rossini verstand sich auf das, wonach die Romantik sich so sehnte: Natur. Auch Rossini selbst, das zeigt ein Brief von 1866 an Tito Ricordi, hat das Jugendwerk niemals vergessen, das etwas bietet, was in den späteren Werken immer nur aufblitzt: die pure Schönheit des Gesangs.16
*
1806, nach dem Stimmbruch, trat Gioachino in das Liceo von Bologna ein. Das Liceo hatte europäischen Ruf – schon Mozart hatte hier 1777 Unterricht im Kontrapunkt genommen. Es erinnert äußerlich an die Welt von gestern, denn es gleicht einem Kloster. Um einen Innenhof laufen, im Rechteck aneinanderstoßend, vier langgestreckte Gebäude, deren Straßenfronten nichtssagend-nüchtern sind. Nur auf einer Seite ein hohes schmales Portal, durch das die Schüler eintraten – so, als wollte sich das Liceo bewusst von der Welt draußen abgrenzen. Die Säle, etwa die Musikalienbibliothek oder die Übungs- und Konzerträume, haben freilich nichts von dieser Kargheit: überall Stuck und Gold, die hochgewölbten Decken barock heiter ausgemalt. Direktor des Liceo war zu Rossinis Zeiten Padre Stanislao Mattei, der Papst der Polyphonie, die jeder italienische Komponist genauso beherrschen musste wie den bel canto, denn geistliche Musik war ohne Kontrapunkt nicht denkbar. Nach den Geniestreichen Sonate a quattro und Demetrio e Polibio begann nun die Disziplin; sie ist Rossini nicht leichtgefallen.
Er drang nicht gleich zu Mattei selbst vor, sondern musste vorher etliche vorgeschriebene Kurse absolvieren. 1806 erhielt er zunächst Unterricht auf dem Cello, 1807 kamen Klavierunterricht und Einführung in den Kontrapunkt hinzu. 1809 und 1810 war es dann so weit, Gioachino wurde Schüler Matteis. Gioachino machte der unnahbare Mann Angst. Azevedo berichtet: „Nachdem Rossini sechs Monate in der Kontrapunktklasse gearbeitet hatte, konnte er nicht eine einzige Note schreiben, ohne zu zittern.“17 Mit Mattei konnte man nicht reden, und diese Erfahrung beklemmte Gioachino. Einmal wagte er, ihn zu fragen, warum man Fugen so und nicht anders schreibe, und bekam die lakonische Antwort, die nur einem Traditionalisten einfallen kann: „Es ist üblich, sie so zu schreiben.“ Die Autorität Padre Matteis, die sein Wunderkind-Bewusstsein kränkte, forderte Gioachino heraus, aber nach einigen Monaten ängstlicher Abwehr fügte er sich und verinnerlichte, was der Lehrer ihm auferlegte: die Last der Tradition, des So-und-nicht-anders. Er wurde sogar ein guter Schüler. Tatsächlich verdankte Rossini Padre Mattei, dass er eine neue Seite seiner musikalischen Fantasie entdeckte – die Polyphonie gehört zu Rossini wie der bel canto, die großen Doppelfugen der geistlichen Werke sind nicht weniger inspiriert als die Opernfinali. Mit zunehmendem Alter veränderten sich Rossinis Gefühle für Mattei. Er begann, ihn zu bewundern. In der Villa, die er sich in Passy baute, gibt es ein Zimmer mit Deckenfresken bedeutender Komponisten, und in seinem Tempel der Musik ließ Rossini neben Mozart und Palestrina auch seinen Lehrer verewigen.
Padre Stanislao Mattei.
Padre Mattei sorgte zudem dafür, dass Gioachino eine literarische Ausbildung erhielt. Er engagierte zwei Literaten, die ihm das Nötige beibrachten. Da war einmal Jacopo Landoni, der ihn in die italienische Klassik einführte, in Dante und Tasso, und Giambattista Giusti, ein poetisch begabter Ingenieur, der ein „glühender Patriot“18 war und Rossini mit dem Denken des Risorgimento, der Freiheits- und Einigungsbewegung, vertraut machte. Damit glaubte Gioachino, alles gelernt zu haben, was er lernen musste. Als ihm Mattei 1810 sagte, er müsse noch zwei Jahre bleiben, um gregorianischen Gesang zu studieren, wehrte Gioachino ab: Das könnten er und seine Eltern sich nicht leisten. Das Ausscheiden aus dem Liceo war aber nur der erste Schritt in die Freiheit; der endgültige folgte durch einen glücklichen Zufall dann aber sehr rasch. Im August 1810 erhielten die Eltern Besuch von den Morandi, einem befreundeten Künstlerehepaar, das am Teatro San Moisè in Venedig engagiert war. Gioachino erzählte von seinem Wunsch, für die Bühne zu komponieren. Die Morandi versprachen bei ihrer Abreise, in Venedig etwas für ihn zu tun. Tatsächlich ergab sich eine Gelegenheit. Intendant des San Moisè war ausgerechnet jener Marchese Cavalli, mit dem Rossini in Senegallia aneinandergeraten war. Doch Cavalli war froh, dass die Morandi Ersatz wussten, denn ein anderer Komponist hatte ihn versetzt, und so erhielt der Achtzehnjährige, der frisch vom Konservatorium kam, seinen ersten Opernauftrag: die Musik zu dem Einakter La cambiale di matrimonio zu schreiben.
Das Regno d’Italia
Am 8. Mai 1805 zog Napoleon in Mailand ein, und Tausende säumten die Straßen, um ihn zu sehen. Dass er sich nach der Kaiserkrönung in Paris nun auch zum König von Italien krönen wollte, begeisterte die Stadt, und nur eingefleischte Republikaner bedauerten, dass aus der Cisalpinischen Republik das Regno d’Italia wurde, während die Mailänder Geschäftsleute zufrieden gewesen sein dürften, dass endlich ein moderner Staat nach französischem Muster aufgebaut wurde. Am 26. Mai war es dann so weit. Napoleon und sein Gefolge betraten in feierlicher Prozession den Dom, und auch wenn der Erzbischof bei der Zeremonie mitwirkte, setzte Napoleon sich die eiserne Langobardenkrone selbst auf. Dabei sagte er: „Gott hat sie mir gegeben, und ich nehme sie an.“ Dann riefen die Herolde: „Napoleon I., Kaiser von Frankreich und König von Italien ist gekrönt, geweiht und inthronisiert; es lebe der Kaiser und König.“19 Der gotische Dom lieh der grandiosen Zeremonie seine Magie. Regiert hat Napoleon freilich niemals selbst. Er ernannte seinen Stiefsohn Eugène de Beauharnais zum Vizekönig, unter all seinen Statthaltern vielleicht der solideste.
Freilich war der neue Staat Napoleons Feinden ein Dorn im Auge. Im November 1805 schickten Engländer und Russen eine Flotte nach Neapel, die Landungstruppen an Bord hatte. Sie sollten das Regno d’Italia von Süden angreifen. Die Schlacht von Austerlitz, in der Napoleon im Dezember Russen und Österreicher besiegte, entschied auch die italienische Episode – die englische Flotte verschwand aus Neapel, und im Frieden von Pressburg musste Österreich das Veneto, Istrien und Dalmatien an das Regno d’Italia abtreten. Und auch im Süden änderten sich die Dinge. König Ferdinand von Neapel verlor seinen Thron an Joseph Bonaparte. In Italien hatte das napoleonische Jahrzehnt begonnen.
Napoleon ermahnte Eugène de Beauharnais strikt, sich mit Italienern zu umgeben und auf italienisches Empfinden Rücksicht zu nehmen; nichts dürfe an Fremdherrschaft erinnern. Beauharnais hat sich daran gehalten. Aber die italienische Freiheit, wie sein Premierminister Francesco Melzi sie wollte, blieb eine Illusion – als Beauharnais einen ersten Schritt tat und Napoleon auf die Ablehnung hinwies, die dessen Kriegspolitik in Mailand weckte, antwortete der Kaiser gereizt: „Es wäre schlecht, wenn man vergäße, daß Italien von Frankreich abhängig ist.“20 Außenpolitische Bewegungsfreiheit erhielt Eugène de Beauharnais nie, und am Ende der napoleonischen Ära bekam er den Groll der Mailänder auf die französische Kriegspolitik zu spüren. Doch erst einmal genoss die neue Hauptstadt ihre große Zeit, in der sich das Leben grundlegend änderte. Es wurde moderner und freier. Die Privilegien des Adels wurden abgeschafft. Nach und nach wurde der Code Napoleon, dessen juristisches Grundprinzip das Privateigentum ist, auch in Italien eingeführt. Aber eine ebenso gefährliche Gegnerin des neuen Systems war die Kirche, denn sie besaß nicht nur viele Anhänger, sondern auch eine eigene Lehre. Darum suchte man ihr so viel zu nehmen wie möglich. In Norditalien wurden die Kirchengüter enteignet, und gegen die Kirche ging es auch bei der Bildungsreform. Volksschulen nach französischem Vorbild wurden eingeführt und die Gymnasien weltlicher Leitung unterstellt. Wenn alles neu wurde, musste sich auch das Stadtbild verändern – Mailand musste zeigen, dass es eine Hauptstadt war. Die Fassade des Doms wurde vollendet, und eines der Stadttore, die Porta Ticinese, repräsentativ neu gestaltet. Die monumentalsten Bauten des Regimes befinden sich im Parco Sempione hinter der mittelalterlichen Festung der Sforza – die Arena Civica, ein von römischen Vorbildern inspiriertes Stadion für sportliche Wettkämpfe, das 30000 Zuschauer fasst. Am Ende des Parks, die Zentralachse abschließend, der Arco della Pace, ein Triumphbogen, der eine genaue Kopie seines Pariser Urbildes ist: Allegorie des modernen Systems, das die Massen mobilisiert und leitet.
Napoleon I. Bonaparte als König von Italien.
Trotz aller kollektiven Disziplin, ohne die der bonapartistische Staat nicht zu denken ist, brachte die neue Zeit aber auch mehr individuelle Freiheit – die kirchliche Moral verlor ihre Macht; der Mensch des napoleonischen Zeitalters war emanzipierter als der des Ancien Régime. Das brachte die Klerikalen besonders auf. Indigniert beschrieb ein Geistlicher in seinem Tagebuch die neue Freizügigkeit: „Heute kann man die Jugend beiderlei Geschlechts ungeniert auf öffentlichen Plätzen flirten sehen, und die Frauen kokettieren mit einer höchst bescheidenen und zugleich verführerischen Aufmachung, von der die Mode nie etwas zu wissen glaubte. Arme, Busen, Achseln, alles ist vollkommen entblößt; die Hüte wechseln täglich; alles ist bedeckt mit Blumen, Federn, unechtem Gold …“21 Eine Zeitenwende also, die auch die beliebteste Abendunterhaltung Italiens verändern musste: die Oper.
Erfolg
Das Teatro San Moisè, für das Rossini seine erste Oper komponierte, hatte eine ruhmvolle Vergangenheit. Im 18. Jahrhundert hatte hier Goldoni gewirkt und zusammen mit Baldassare Galuppi erstmals eine buffa auf eine venezianische Bühne gebracht, die europaweit Erfolg hatte: Eine neue Gattung war geboren. Doch von dieser großen Zeit war nichts mehr zu spüren – über einaktige Farcen und Rührstücke wagte sich die Direktion nicht mehr hinaus, und wer hier Erfolg hatte, gehörte keineswegs zu den maestri di cartello, die für die großen Bühnen schrieben. Zweitklassig auch die Libretti. Auch das zu La cambiale di matrimonio ist nicht besonders gut – eine Kaufmannssatire, die von fern gewiss an Goldoni erinnert, aber volksstückhaft grobschlächtig ist.22 Der Geschäftsmann Sir Mill erhält einen Brief seines kanadischen Geschäftspartners Slook, der nach Europa kommt, um sich eine Frau zu suchen. Schon gefunden, antwortet Mill und bietet seine Tochter Fannì an. Wenn Slook sie will, soll er endlich seine Schulden bezahlen – so sind die Kapitalisten, besonders die englischen, wie man im Zeitalter der Kontinentalsperre auch im Regno d’Italia wusste. Aber die Geschichte geht gut aus, denn Slook, der als Mann aus der neuen Welt natürliches Gefühl besitzt, durchkreuzt Sir Mills Pläne. Er zahlt seine Schulden, überlässt Fannì aber ihrem Liebhaber Edoardo, und Liebe und Geld finden so zusammen, wie es sich das Publikum des San Moisè wünschte.
Das klingt nach platter Unterhaltung. Und doch hat Rossini in La cambiale di matrimonio eine neue Tonsprache gefunden, die er im Laufe der Jahre immer weiter verfeinerte, um am Ende jenen „mythischen Rausch“ zu erzeugen, der ganz Europa ansteckte. Drei Grundelemente fallen auf. Da ist einmal das Brio, das durch straff akzentuierte Rhythmen entsteht, meist durch repetierte Akkorde. Nach wenigen Takten weiß man: Das ist Rossini. Diese rhythmische Grundfigur wirkt ähnlich wie der beat und dürfte nicht wenig zu dem „mythischen Rausch“ beigetragen haben, auch wenn es einen wichtigen Unterschied gibt: Rossinis stereotype Rhythmen laufen nie durch, es gibt Stauungen. Ein Beispiel liefert gleich das Eröffnungsduett zwischen Mills Buchhalter Norton und seiner Dienerin Clarina, das durch ein pfiffiges Motiv der Violinen eingeleitet wird, zu dem die restlichen Streicher stereotyp wiederholte Achtelakkorde spielen. Das treibt. Allerdings ist es mit dem Brio in der Mitte des Duetts vorbei – Norton und Clarina hören Mill kommen, gute Laune und Elan schlagen um in Panik, und nun dominieren die dramatisch expressiv geführten Stimmen. Nicht lange freilich. Sobald Mill aufgetreten ist und seine Weltkarte entfaltet hat, auf der er die Entfernung zwischen Venedig und Kanada berechnen will, setzen wieder die rasch repetierten Akkorde ein. Und dann, auf der Mitte, wieder eine Stauung. Mill befallen Zweifel, dass er richtig rechnet, und er singt einige langausgehaltene und mit ausgefallenen Harmonien unterlegte Töne. Aber der Zweifel geht rasch vorüber, und der straffe Rhythmus setzt wieder ein. Elan, Stauung, Elan – Rossinis rhythmische Konzeption erfasst den Pulsschlag des Alltagslebens. Das ist nur scheinbar simpel.
Zweites Markenzeichen von Rossinis Stil ist die Melodie. Die schönste in La cambiale di matrimonio ist sicher die des Liebesduetts zwischen Fannì und Edoardo (Tornami a dir che m’ami), die sich rein aus dem Vokalen entfaltet. Die Begleitung ist auf ruhig dahinfließende, noch dazu pizzicato gespielte Dreiklänge reduziert. Das verleiht dem Gefühl etwas Ungemeines – für einen Augenblick scheint es aus der Zeit herauszuführen. Freilich ist dieses schwelgerische Innehalten nur eine Seite der Liebe, denn gerade sie ist Drang und élan vital – deshalb kehrt im zweiten Teil des Duetts die rhythmische Straffheit wieder. Er wird eingeleitet von einer rhythmisch stereotypen Bläserfigur, die unermüdlich wiederholt wird: Propizio accolga amore/il nostro giuramento: Die Liebe hat Teil am élan vital, wenn sie auch auf etwas zielt, das jenseits der allgemeinen Geschäftigkeit liegt: auf Bindung.
Das dritte Markenzeichen von Rossinis Stil ist die Koloratur. In La cambiale di matrimonio ist sie vorerst nur einer Figur zugeordnet: Fannì, die von Rosa Morandi gesungen wurde. Ihr Liebesschwur im Duett mit Edoardo ist virtuos ausgeziert, und auch der Überschwang fehlt nicht – die Stretta von Fannìs Arie kurz vor dem glücklichen Schluss (nel sen di chi s’adora) nimmt fast notengetreu vorweg, was Rosina im Barbier singt, wenn sie Almaviva im Arm hält. Das machte aus der farsa eine Oper, die weit vorausweist. Gerade das befremdete die Besetzung. Die Sänger, die sich der ungewohnten Partitur nicht gewachsen fühlten, rebellierten – sie weigerten sich aufzutreten, wenn Rossini nicht ihren Part und vor allem die irritierend reiche Begleitung vereinfache. Rossini war tief verletzt, und wäre nicht Giovanni Morandi gewesen, wäre es wohl nach der ersten Probe zum Eklat gekommen. Er sorgte dafür, dass man sich auf Änderungen einigte, und nahm den verstörten jungen Komponisten mit nach Hause. Als Rossini sich in sein Zimmer einschloss, gab Morandi so lange keine Ruhe, bis er aufmachte. Er war immer noch den Tränen nahe, doch Morandi konnte ihn beruhigen und ging mit ihm die Änderungen durch. Rossini hat ihm das nie vergessen. Als er 1818 Rosa Morandi schrieb, bat er sie, ihren Mann zu grüßen, und fügte hinzu, sie solle ihm ausrichten, dass er sich noch genau an die „Freundschaftsdienste“ erinnere, die er ihm „einst in Venedig“23 erwiesen habe. Morandis Korrekturen sorgten für Beruhigung, und am 3. November 1810 war es endlich so weit: Rossini hatte seine erste Premiere. Sie war ein respektabler, aber kein ganz großer Erfolg. Herbert Weinstock hat vielleicht recht, wenn er vermutet, dass Rossinis Musik viele Hörer irritierte – man war von seinen Vorgängern Lieblicheres gewohnt, und manche Zuschauer mögen La cambiale di matrimonio geradezu als lärmig empfunden haben.24
Vollauf zufrieden war Rossini nur mit seinem Honorar: Zweihundert Francs seien für ihn damals viel Geld gewesen, sagte er Ferdinand Hiller 1855. Dann war er erst einmal fertig mit Venedig und fuhr Anfang Dezember zurück nach Bologna.
*
Ein ganzes Jahr blieb Rossini. Die ersten Monate musste er freilich mit Warten verbringen. Am Teatro Moisè hätte er sofort einen Vertrag bekommen, aber er setzte auf das neugegründete Teatro del Corso in Bologna, das ihm einen Auftrag für eine zweiaktige buffa in Aussicht gestellt hatte – die einaktige farsa war nicht seine Form. Zwar bot sie die Chance, einen modernen Stil zu entwickeln, aber die hohe Kunst der buffa ist doch das Finale am Ende des ersten Aktes, wenn die dramatische Welt nach und nach aus den Fugen gerät und die Unordnung sich immer weiter steigert. Rossini wartete nicht vergeblich. Im Sommer erhielt er den Auftrag, L’equivoco stravagante (die verrückte Verwechslung), nach einem Libretto Gaetano Gasbarris, zu komponieren. Nach heutigem Geschmack ist die dramatische Pointe mehr als sonderbar: Ernestina, eine gelehrte Frau, die nur an den Büchern interessiert ist, weist ihren Verehrer Ermanno ab, was diesen so verzweifelt stimmt, dass er Selbstmord begehen will. Doch das Beste kommt noch. Der Diener Frontino, dem der Gedanke an die scompigli e precipizi, das bisher angerichtete Durcheinander, äußerste Genugtuung bereitet, will im zweiten Akt (Ermanno und Ernestina zuliebe) noch eins draufsetzen: Er kommt auf den Einfall, Ernestinas offiziellen Verlobten damit zu vertreiben, dass er ihm einzureden versucht, sie sei ein verkleideter Junge und obendrein kastriert, da der Vater sie/ihn vor dem Militärdienst habe schützen und einen Gesangsstar aus ihr/ihm habe machen wollen. Doch die Intrige geht nach hinten los. Denn nun interessiert sich das Militär für die angeblich Verkleidete und führt sie ab. Sie kommt in einen Kerker, in dem sie vor allem eines vermisst: Bücher. Aber Ermanno zeigt, wer er ist. Er steigt durch eine Luke ein und bringt ihr das Ersehnte. Wie Ernestina aus der Situation herauskommt, kann man sich denken. Als sie gerettet ist, öffnet sie endlich Ermanno ihr Herz, und alles kommt in Ordnung, wie es sich für den zweiten Akt einer buffa gehört. Eine wilde Geschichte, über die man heute lächelt. Aber frühere Zeiten nahmen moralischen Anstoß, die Oper wurde nie gespielt und gehört zu den wenigen ganz vergessenen Werken aus Rossinis Œuvre. Trotzdem setzte er 1811 seine Hoffnungen auf das Werk – die Musik ist einfallsreich, flüssig und (in den Arien des selbstmordgefährdeten Ermanno) auch empfindsam. Vor allem aber präsentierte er seine erste buffa. Wenn Ermanno im ersten Finale damit droht, er werde sich das Leben nehmen, steigt die Verwirrung aufs Höchste. Rossini erreicht in L’’equivoco stravagante noch nicht das Niveau späterer, noch weiter gespannter Finale, aber ein Anfang ist gemacht. Der zweite Akt kann es mit dem ersten durchaus aufnehmen. Rossini hat ein doppeltes Finali geschrieben – da ist einmal die virtuose Arie der Ernestina, in der sie ihren Sinneswandel vollzieht und neben den Büchern auch Ermanno Platz in ihrem Leben einräumt. Aus dramaturgischen Gründen musste Rossini noch einen konventionellen Schluss anfügen, an dem auch alle versichern, jetzt könne der Frieden zurückkehren: Ritorni la calma.
Verwirrungen waren seit jeher Thema der buffa. Doch Verwirrspiele, wie sie Rossini im zweiten Akt inszeniert, setzten Fantasien frei, die der bonapartistischen Ordnung gründlich widersprachen – auf einer Bühne des Regno d’Italia sollte nicht einmal andeutungsweise die Rede von Dingen wie Kastration sein. Jedenfalls schritt der Präfekt ein und verbot die Oper nach der dritten Aufführung, und auch die Presse schrieb, es sei unverständlich, wie ein Komponist zu einem solchen Libretto mitreißende Musik schreiben könne. Rossini scheint das sonderbare Libretto freilich fasziniert zu haben. Zwar gab es keine Verwirrspiele in seinem Leben, dafür aber sexuelle Obsessionen, die so heftig waren, dass sie das Fundament seines Lebens erschütterten. 1842 gestand er seinem Arzt in der andeutenden Sprache des 19. Jahrhunderts, „der Göttin Venus seit seiner frühesten Jugend gehuldigt“25 zu haben. Wahrscheinlich befriedigte er seine Bedürfnisse im Bordell – eine Gewohnheit, die blieb und ihn seine erste große Liebe und seine Gesundheit kosten sollte. Auch in diesem Punkt war Rossini Kind seiner Zeit.26 Solch heikle Dinge werden in L’equivoco stravagante gewiss nicht verhandelt, aber das Libretto öffnet der Fantasie einen Weg in die Unter- und Hintergründe der Gesellschaft, von denen man lieber nicht redete. Gewiss eine Enttäuschung für Rossini; dennoch war die Oper nicht nur ein Fehlschlag, denn er war nicht der Einzige, den die anzügliche Geschichte reizte – das Publikum applaudierte, und auch die Mezzosopranistin Marietta Marcolini, die die Ernestina sang, hat die Glanzrolle genossen, die Rossini ihr geschrieben hatte. Und wohl auch die transvestitische Verwirrung; jedenfalls sagte man ihr nach, dass sie gern Männerkleider trug. Luigi Romanelli, der Librettist der Scala, nahm in La pietra di paragone (der nächsten Gemeinschaftsarbeit Rossinis und der Marcolini) Rücksicht auf ihre Vorlieben: Er verschaffte ihr einen Auftritt in Uniform, der glücklicher ausgeht.
*
Im Dezember 1811, einen guten Monat nach dem Skandal, fuhr Rossini zurück nach Venedig. Er bekam am ungeliebten Teatro San Moisè sofort einen Auftrag – die farsa, die er über Weihnachten vertonen sollte, ist das genaue Gegenteil von L’equivoco stravagante, denn sie ist ungewöhnlich rührselig. Sie handelt von einer Herzogin, die vor den Nachstellungen eines Günstlings geflohen ist, eines Tages aber durch Zufall von ihrem Mann wiederentdeckt wird – ausgerechnet in einem Bergwerk, wo sie sich verborgen hat. In der Ouvertüre zu L’inganno felice (so der Titel der neuen farsa) wartet Rossini mit einer weiteren Neuerung auf, die ein Markenzeichen seines Stils werden sollte: das nach ihm benannte Crescendo. Nach dem zweiten Thema der Ouvertüre hat er eine harmonisch zwischen Tonika und Dominante pendelnde Schlussfigur geschrieben, die mit steigender Lautstärke wiederholt wird und auf dem Höhepunkt auch die Bläser einbezieht.27 Rossini hat die Innovation, die so gut zu seinem neuen Stil passt, von nun an in all seine Ouvertüren eingefügt. Zur rührenden Geschichte, die L’inganno felice inszeniert, passt die Neuerfindung nicht recht. Aber das Publikum störte sich nicht daran. Es goutierte die Aufregung am Ende der Ouvertüre und die sentimentale Geschichte, die danach kommt. Diesmal war Rossinis Erfolg eindeutig. Die empfindsam verschleierten Melodien, die er für L’inganno felice schrieb, kamen sehr viel besser an als die kühle Ironie von La cambiale di matrimonio. Jedenfalls wurde die Premiere am 8. Januar bejubelt; ausverkauft waren auch die folgenden Vorstellungen, und die letzte Aufführung am 11. Februar, die die Presse mit überschwänglichen Worten ankündigte, schloss mit einem ungewöhnlichen Happening: In den Logen wurden Vögel freigelassen, Tauben und Kanarienvögel.
Natürlich wurde in Theaterkreisen darüber geredet. Seit L’inganno felice war Rossini kein Unbekannter mehr. Zunächst erteilte ihm Graf Aventi, der die Oper in Ferrara leitete, den Auftrag für die sogenannte Fastenoper, die zwischen Karneval und Ostern gespielt wurde. Der Stoff war selbstverständlich biblisch: Ciro in Babilonia führt die Geschichte von Belsazars Festmahl vor. Die geistliche Oper, zu der Rossini eine ziemlich langweilige Musik schrieb, wurde freilich ein Fiasko, das Rossini mit Selbstironie nahm. Er erzählte Hiller: „Als ich von der unglückseligen Aufführung nach Bologna zurückkehrte, fand ich eine Einladung zum Essen vor. Ich ging zu einer Zuckerbäckerei und bestellte ein Schiff aus Marzipan. An seinem Wimpel trug es den Namen Ciro, sein Mast war gebrochen, seine Segel waren in Fetzen, und es lag seitlich auf einem Ozean von Creme. Unter großer Heiterkeit verschlang die Gesellschaft mein gestrandetes Schiff.“28 Und doch brachte seltsamerweise die Unglücksoper die große Wende. Rossini war in Ferrara nämlich erneut Marietta Marcolini begegnet; sie sang den Ciro, eine Hosenrolle wie so viele Heldenrollen der zeitgenössischen seria, denn da es zu Rossinis Zeiten kaum noch Kastraten gab, begnügte man sich mit einem Mezzo. Marietta Marcolini hatte beste Beziehungen zur Scala, die sie für ihren Freund spielen ließ. Seit L’equivoco stravagante kannte sie nicht nur sein Talent, sondern wusste, dass er für sie große Rollen schreiben konnte. Und so erhielt der erst Zwanzigjährige für den Herbst einen Auftrag aus Mailand für eine zweiaktige buffa. Das war mehr, als sich ein Anfänger wie er erträumen durfte. Erfolg ist immer auch Zufall. Rossini erfuhr von dem Angebot der Scala nicht sofort. Vorerst kehrte er nach Venedig zurück, wo er eine neue farsa komponierte, La scala di seta, die am 9. Mai uraufgeführt wurde. Für eine Überraschung hatten überdies die Mombelli gesorgt, denn es war ihnen gelungen, in Rom Demetrio e Polibio auf die Bühne zu bringen. Schließlich erhielt er aber doch Kenntnis davon, was ihm die Scala anbot, und so kehrte er Ende Juni erhobenen Hauptes zurück nach Bologna. Er blieb diesmal allerdings nicht lange, denn er konnte seine erste buffa, die zählte, nur dort vollenden, wo sie auch gespielt wurde: in Mailand.
*
Titel von Rossinis erster wirklich erfolgreicher buffa ist La pietra di paragone – also: der Prüfstein, und der Titel Die Liebesprobe, unter dem Günter Rennert die Oper 1962 erstmals auf die deutsche Bühne brachte, sagt, was da geprüft wird. Das Libretto ist vorzüglich, was Rossini genossen haben dürfte nach all dem, was er bisher hatte vertonen müssen. Stendhal rühmt den „entzückend raschen Wechsel“29 der Situationen – durch das Gegeneinander der Egoismen, durch Täuschung und Intrige entsteht eine halb imaginäre Welt. Musikalisch hat Rossini an die kompositorischen Grundelemente angeknüpft, die er in La cambiale di matrimonio und L’equivoco stravagante entwickelt hatte, aber der Ton ist raffinierter und geistreicher – die Welt des Conte Asdrubale, in der die Oper spielt, ist sehr verschieden von der der hemdsärmeligen Kaufleute des ersten Einakters und der des Krautjunkers seiner ersten buffa. Romanellis Grundeinfall dreht das gewohnte Komödienschema um – in La pietra di paragone sind es nicht die Männer, die die Frauen umwerben, vielmehr machen drei Frauen Asdrubale Avancen. Der freilich traut keiner; alle drei, so argwöhnt er, seien nur an seinem Geld interessiert. So hat er sich eine höchst sonderbare Inszenierung einfallen lassen – eine Liebesprobe, mit der er seine Verehrerinnen testen will. Und schon Rossinis Ouvertüre signalisiert Esprit: Das Hauptthema ist spritzig, in punktierten Achteln gehalten. Dann geschieht freilich etwas Merkwürdiges. Das Thema gerät in die parallele Molltonart – Nachdenken, Stauung, vielleicht ein romantischer Akzent, dann kehrt der Beginn noch einmal wieder. Noch bevor der Vorhang sich gehoben hat, weiß man: Die Welt, die Rossini diesmal vorführt, ist doppelbödig, vielleicht macht das den größten Reiz von Pietra del paragone aus. Das Finale des ersten Aktes ist weiter gespannt als das jeder anderen buffa. Es beginnt damit, dass Asdrubale, verkleidet als Türke, einen Wechsel über einen riesigen Betrag präsentiert, den angeblich Asdrubales Vater unterzeichnet hat. Janitscharenklänge, große Trommel und Piccoloflöte kündigen den vermeintlichen Türken an, der dann mit quäkender Stimme und in grausiger Aussprache sein Geld fordert und auf Pfändung besteht. Sein gebrüllter Befehl, Sigillara! – alles versiegeln, komisch und brutal zugleich, ist die erste große Steigerung des Finales. Aber auch eine erste Probe, nach der zwei Liebeswerberinnen ausscheiden, und nur Clarice, die von Marietta Marcolini gesungen wurde, noch im Rennen bleibt. Das Finale ist nach dem Sigillara keineswegs zu Ende. In einem anderen Raum seiner Villa tritt Asdrubale in üblicher Kleidung auf, präsentiert einen Gegenwechsel und sucht die verstörten Gemüter zu beruhigen. Doch so schnell geht das nicht. Die Musik nimmt einen neuen Anlauf zum abschließenden Tutti, das die Grundformel aller ersten Finale von Rossinis Buffoopern verkündet:
Qual chi dorme e in sogno crede
Di vedere quel che non vede.
Se uno strepito improvviso
Tronca il sonno, egli è indeciso
Nel contrasto delle vero
Colle immagini premieri.30
Alle sind aus der Realität gefallen wie der Schlafende aus einem jäh unterbrochenen Traum. Nur eine anarchische Un-Welt bleibt übrig. Das gibt es im zweiten Akt nicht, er bringt nur noch Verzögerungen vor dem alles ordnenden Schluss. Nun kommt auch die Romantik zu ihrem Recht. Der angebliche Frauenverächter Asdrubale hat Clarice stets geliebt, und als sie ihn zu verlassen droht, findet er mit einem Mal empfindsame, ja pathetische Töne: Più bramar no so che morte, singt der bekehrte Zyniker, und im kurz gehaltenen zweiten Finale bekennt er, von nun an werde er die Frauen stets respektieren – und stets zu dem stehen, was er in Wirklichkeit fühlt. Eine künstliche und schwierige Welt, in der man sich mit den eindeutigen Emotionen von L’inganno felice kaum zurechtfinden würde. Am 26. September war Premiere. Das Publikum war begeistert, und Marietta Marcolini und Rossini genossen ihren Triumph. La pietra di paragone brachte es auf 53 Vorstellungen, mehr als Bellinis Norma zwei Jahrzehnte später, sodass auch Hof und Militärbehörden den Erfolg zur Kenntnis nehmen mussten. Eugène de Beauharnais war nicht in der Stadt, da er Napoleon auf seinem Russlandfeldzug begleitete, aber es fand sich doch ein Minister, der Rossini vom Militärdienst befreite, was der (nach dem Bericht Azevedos) mit den Worten kommentierte: „Der Militärdienst gewann dabei, denn ich wäre ein schrecklicher Soldat geworden.“31 Und auch die Frauen belohnten ihn. So erzählt es jedenfalls Stendhal: „Beim Anblick von Rossinis Ruhm vergaßen die hübschesten der hübschen Frauen der Lombardei, … was sie ihrem Ruf, ihrem Schloß, ihrem Ehemann schuldig waren … Rossini machte aus seiner Geliebten die beste Musikerin Italiens; an ihrer Seite, an ihrem Klavier und in ihrem Landhaus hat er die meisten Arien und Kantilenen komponiert, die später seinen dreißig Meisterwerken zum Erfolg verhalfen.“32 So war es nicht. Die Mailänderinnen mögen beeindruckt gewesen sein, aber es gab noch kein Landgut und keine Geliebte, vielmehr kehrte Rossini im Herbst 1812 erst einmal wieder nach Venedig an das ungeliebte San Moisè zurück. Man kennt die Gründe nicht, Rossini hat seine Entscheidung nicht kommentiert. Eine Wahrheit steckt aber in Stendhals Erfindung, nur dauerte es noch zwei Jahre bis zur Geliebten und dem Landgut.
*
In Venedig entstanden noch zwei Einakter für das San Moisè – L’occassione fa il ladro, uraufgeführt am 24. November, und Il signor Bruschino, der am 27. Januar 1813 Premiere hatte. Harmlose Unterhaltung in einer Zeit, die keineswegs harmlos war. Stendhal schreibt: „Während des tollen Erfolgs von La pietra di paragone flohen unsere Armeen über den Dnjepr, und das (…) Debakel näherte sich mit großen Schritten.“33 Napoleons Ende war nicht mehr fern und damit das des Regno d’Italia. Rossini muss etwas gewusst haben, aber leider bleibt sein Briefwechsel stumm, auch politische Großereignisse kommentiert er nie. Doch ist offensichtlich, dass er sich im Tancredi, einer opera seria, die am 6. Februar im Fenice, dem größten Theater Venedigs, aufgeführt wurde, an einer Zeitdeutung versuchte. In der Oper geht es um einen Weltenretter, der Napoleon einst für Norditalien gewesen war. 1813 zündete der Tancredi noch nicht recht, vielleicht weil die Nachricht von den Ereignissen in Russland noch nicht herum war, aber als die Oper nach Napoleons endgültigem Sturz 1815 aufs Neue gespielt wurde, war der Erfolg gewaltig, und er wiederholte sich auch außerhalb Italiens. Das heute vergessene Werk wurde in alle Sprachen übersetzt – ins Deutsche, Englische, Französische, Spanische und Russische, und sogar ins Schwedische, Polnische und Tschechische.
Die Oper erinnert in vielen Details an Wagners Lohengrin. Tancredi kommt wie Lohengrin von weit her – zwar nicht von der Gralsburg, aber doch aus Byzanz, und nicht mit einem Schwan, aber auf einer Barke, mit der die Theatertechniker der Zeit nach Stendhals Zeugnis schon Mühe genug hatten. Er schlichtet die Zwietracht in seiner Heimatstadt Syrakus, ficht ein Gottesurteil aus und wäscht eine „hart Beklagte“, wie es bei Wagner heißt, vom Vorwurf des Verrats rein. Merkwürdige Berührungspunkte. Der Tancredi ist anders als Wagners Lohengrin kein musikalisches Meisterwerk, obwohl die Oper, auf Secco-Rezitative verzichtend, den unkonventionellen seria-Stil vorwegnimmt, den Rossini in Neapel pflegte. Das kann den gesamteuropäischen Erfolg freilich nicht erklären – fasziniert hat die Oper einst wohl durch Rettungsmythos, mit dem Rossini auf den drohenden Untergang der napoleonischen Welt reagierte.
Von heute aus gesehen ist Rossinis nächstes Werk, L’italiana in Algeri, weitaus bedeutsamer. Die buffa, die am 22. Mai am Teatro San Benedetto Premiere hatte, hat sich bis heute im Programm gehalten. Vielleicht kein Zufall, dass sich darin die Zusammenarbeit mit Marietta Marcolini fortsetzt, der Sängerin des jungen Rossini – er hat ihr die größte Rolle geschrieben, die er bis dahin für eine weibliche Stimme überhaupt komponiert hatte. Auch das ist ein Grund für den Erfolg, den das Werk bis heute hat. Das Libretto von Angelo Anelli, das zuvor schon von Luigi Mosca vertont worden war, ist bunt, leicht skurril, aber höchst wirkungsvoll. Rossini gelang es erstmals, Charaktere zu zeichnen, die sich einprägen – L’italiana in Algeri war lange Zeit sein beliebtestes Werk überhaupt. Anellis Geschichte ist abenteuerlich. Das Schiff Isabellas, die von der Marcolini gesungen wurde, wird von Seeräubern gekapert und sie selbst an den Bey von Algier verkauft – die nordafrikanischen Piratenstaaten waren damals eine Plage der Seefahrt. Die Oper beginnt im Serail von Algier, denn die Piratenstaaten wurden beherrscht von einem osmanisch geprägten Hof. Der Bey Mustafà, der sich als Held im Geschlechterkampf fühlt, will seine Frau Elvira verstoßen – ihn locken die Italienerinnen, die sehr viel ernster zu nehmende Gegner sind. Der Piratenkapitän Haly soll ihm eine fangen. Lindoro, der Liebhaber Isabellas, ist ebenfalls in Algier; er hat es zum Lieblingssklaven des Beys gebracht. Er tritt auf, als sich der Hofstaat zurückgezogen hat, und singt seine Arie Languir per una bella, für die Rossini eine sehnsuchtsvolle Melodie gefunden hat, die er im Vorspiel dem Horn anvertraut – man kann das symbolisch nehmen: Das Jagd- und Signalinstrument, also das Instrument des Mannes, kann auch weich und melodisch sein. Die nächste Szene spielt am Strand, Isabella ist umringt von den Piraten, die ihr Schiff aufgebracht haben, doch sie lässt sich nicht niederdrücken, sie ist überzeugt, dass ihr nichts geschehen kann – denn sie weiß, wie man mit den Männern umgehen muss.
Tutti la bramano
Tutti la chiedono
Da vaga femmina:
Felicità.34
Die Sehnsucht nach dem Glück zieht die beiden Geschlechter zueinander, alles andere ist eine Erfindung des großmäuligen Beys. Die virtuosen Sprünge und Koloraturen, mit der die cabaletta von Isabellas Auftrittsarie schließt, hat Rossini mit Pizzicatoakkorden der Streicher unterlegt, die regelmäßig repetiert werden – ein schon in La cambiale di matrimonio erprobtes Stilmittel. Nur sind in L’italiana in Algeri die Koloraturen, die weibliche Souveränität ausdrücken, weit virtuoser. Der Aktschluss spielt wieder in Mustafàs Palast, wohin die Piraten ihre Gefangenen gebracht haben. Als Isabella auftritt, ist Mustafà begeistert, denn er glaubt, endlich seine kapriziöse Italienerin gefunden zu haben, mit der er sich messen kann. Der Chor der Eunuchen seufzt: Oh! Che rara beltà!, und dann beginnt auch schon das Finale des ersten Akts, dessen Tempo Rossini langsam steigert, bis es in einer tumultuarischen Stretta endet. Auch in L’italiana in Algeri haben die Figuren das Gefühl, aus der Realität zu fallen – die entsprechenden Verse, die sich in der Vertonung Moscas noch nicht finden, hat Anelli offenbar auf Bitten Rossinis eingefügt.35 Sie sind drastisch formuliert. Die Frauen glauben, im Kopf ein Glockengeläut zu haben, der Bey meint, eine große Kanone zu hören, und Lindoro glaubt, im Kopf einen Hammer zu haben – mi percuote e fa din-din. Rossini hat den Zustand des Nicht-mehr-klar-denken-Könnens präzis komponiert. Die Melodie, mit der die Stretta beginnt, beißt sich auf der Quint fest, und das ganze Ensemble fällt mit Sprüngen von der Tonika zur Quint ein. Erst der Chor löst die Stauung auf. Er spielt dem Ensemble eine Metapher zu, die das große Durcheinander deutet: den Schiffbruch. Alle fühlen sich presso a naufragar – frei übersetzt, als gingen sie bald baden. Aufgeputscht schließt das erste Finale; es ist noch wirkungsvoller als das in Pietra di paragone, denn L’italiana in Algeri führt keine Welt der doppelten Böden vor, vielmehr glaubt jeder Spieler an seine Rolle.
Der zweite Akt besitzt nicht dieselbe Spannung, aber er zeigt die andere Seite der Hauptfiguren. Isabella ist nicht nur eine wehrhaft kokette Schönheit, sondern auch eine Frau von Gefühl – ihre Arie Per lui che adoro drückt zärtliche Süße aus, und der Geschlechterkämpfer Mustafà beweist, dass er im Grunde ein Kind ist. Und er bekommt die Quittung. Da er zu Beginn Isabellas Reisegefährten Taddeo den Titel eines Kaimakan verliehen hat, revanchieren sich seine Gäste, indem sie ihm den eines Pappataci verleihen – drastisch übersetzt: Papa, halt den Mund. Lindoro erklärt ihm, die Pflicht eines Pappataci bestehe darin, zu essen, zu trinken und zu schlafen. Das gefällt Mustafà. Und als Lindoro und Isabella ein Schiff besteigen, das sie nach Italien zurückbringen soll, beruhigt Mustafà Taddeo, der bei ihm bleiben soll, mit seinem neuen Credo: Mangi e taci, das gesungen von seinem mächtigen Bass hinreißend komisch klingt. Anders als die schlimmen Väter in Rossinis späteren Buffoopern gewinnt der verwandelte Mustafà im letzten Augenblick die Sympathien der Zuschauer. Auch Isabella zeigt noch eine zweite Seite. Sie singt die patriotische Arie Pensa all’ patria, in dem von Pflicht und Vaterland die Rede ist – bisher ein exklusiv männliches Thema, darum dürfte die Arie Marietta Marcolini besonders gelegen haben. Vielleicht war die Zeit der Weltenretter abgelaufen, auf jeden Fall zeigt Isabellas Abschiedsarie Rossinis eigentliches Credo, das der erwachenden Nation galt. Vedi per tutta Italia/Rinascere gli esempi/D’ardire e di valor, singt Isabella. Am Ende ist sie Italia, die Verkörperung der Nation – jedenfalls für die Zuschauer des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Premiere war ein großer Erfolg, und Marietta Marcolini und Rossini konnten den Triumph, den sie an der Scala erlebt hatten, noch einmal wiederholen. Die Oper wurde auch auf anderen Bühnen unzählige Male nachgespielt; lange Zeit war sie der Inbegriff der italienischen buffa überhaupt.
Danach legte Rossini eine mehrmonatige Arbeits- und Schaffenspause ein. Wo er sich im Juli aufhielt, weiß man nicht – vielleicht besuchte er die Familie in Bologna. Im August, das geht aus dem Briefwechsel hervor, war er wieder in Venedig und blieb wahrscheinlich bis in den September. Im Oktober 1813 fuhr er dann nach Mailand – er sollte eine seria für die Scala schreiben. Diesmal empfing ihn die Stadt anders als vor einem Jahr, denn inzwischen war er ein Star. „Ich bin das Idol von Mailand“, schrieb er seiner Mutter selbstgefällig.36
Amelia Belgiojoso
Alles schien wie immer, als Rossini im Oktober 1813 nach Mailand kam. Aber das täuschte. Am 16. Oktober wurde Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig von Russen, Preußen und Österreichern vernichtend geschlagen – der Anfang vom Ende seines Imperiums und natürlich auch des Regno d’Italia. Nach der Schlacht bei Leipzig begannen die Österreicher sofort, Dalmatien, Istrien und Triest zu bedrohen. Trotzdem nahmen die Mailänder die Nachricht von Napoleons Niederlage gelassen, jedenfalls wollten sie sich ihre Opernsaison nicht verleiden lassen. Mit gewohntem Glanz eröffnete die Scala am 26. Dezember die Karnevalssaison mit Rossinis Aureliano in Palmira. Es gibt darin dramatisch eindrucksvolle Szenen, die Bühnenbilder waren opulent, und noch wichtiger für das zeitgenössische Publikum dürfte gewesen sein, dass die Hauptrolle von einem Star gesungen wurde, dem vielbewunderten Velluti, einem der letzten Kastraten. Die Scala hatte alles aufgeboten – nur Rossinis Musik ist seltsam leer, vielleicht wäre ihm eine buffa lieber gewesen. Jedenfalls ist die Ouvertüre zum Aureliano dieselbe, die er später dem Barbier voranstellte, und die Melodie eines einleitenden Priesterchors nimmt die Cavatine der Rosina vorweg.
Freilich begann sich der Mensch Rossini, der lange zurückgestanden hatte, in den letzten Tagen des Regno d’Italia zu entwickeln. Er lernte Amelia Belgiojoso kennen. Genaues weiß man darüber nicht. Die beiden waren ein seltsames Paar. Er war einundzwanzig und jugendlich schön, sie war fast zehn Jahre älter, verwitwet, aber immer noch anziehend. Ein Porträt zeigt sie mit schwarzen Locken und schmalem, feinem Gesicht – ein Zeichen aristokratischer Noblesse vielleicht, jedenfalls gehörte sie dem schwerreichen Mailänder Hochadel an. Leider ist ein Briefwechsel nicht erhalten, und alles, was man über Rossini und Amelia Belgiojoso weiß, liest man aus Rossinis Briefen an seine Mutter. Am 8. Januar 1814 versuchte er, ihr die Neuigkeit beiläufig beizubringen, und schrieb: „Es geht mir gesundheitlich sehr gut, ich habe genug Geld, und meine Schöne ist äußerst liebenswert.“37 Die Reaktion war offenbar kühl, denn im nächsten Brief fühlte er sich bemüßigt, seine Verbundenheit mit den Eltern feierlich zu beschwören: „Seid überzeugt, daß ich euch beide liebe und es kein Übel geben wird, das mich meine lieben Eltern vergessen lassen könnte.“38 Der Brief tat seine Wirkung, und fortan konnte er der Mutter offen von seinem Verhältnis zu Amelia berichten.
Dass die politische Welt sich dramatisch veränderte, hat in Rossinis Briefwechsel keine Spur hinterlassen. Kein Kommentar zum Rücktritt Napoleons am 6. April 1814, nicht einmal eine Bemerkung zum Ende des Regno d’Italia, das höchst dramatisch verlief. Nach dem Umsturz in Paris stand Eugène de Beauharnais ganz allein, denn nicht einmal Joachim Murat, der 1806 als Nachfolger von Napoleons Bruder Joseph König von Neapel geworden war, unterstützte ihn – er hatte sich, um seinen Thron zu retten, mit Österreich verbündet, und Eugène de Beauharnais blieb nur die Kapitulation. Freilich hoffte sein Premierminister Melzi bis zum letzten Augenblick. Er schlug dem Mailänder Senat vor, Eugène zum König eines unabhängigen Italien auszurufen, doch er überzeugte die Ratsherren nicht. Mitten in die Beratungen stürmte eine wütende Volksmenge, die Eugène de Beauharnais zur Verantwortung für die in Russland gefallenen Italiener ziehen wollte. Die erregte Masse schlug alles kurz und klein und stürmte dann fort zum Haus des verhassten Finanzministers Giuseppe Prina, den sie mit Stöcken und Regenschirmen umbrachte. Mailand wollte Eugène de Beauharnais nicht mehr. Er verließ Italien und floh nach Frankreich.
Rossini flüchtete sich in die Liebe. Anfang Juni schrieb er seiner Mutter, dass er mit Amelia Belgiojoso nach Merate nicht weit von Mailand übersiedelt sei. Dort besaß sie ein Landhaus. „Nun bin ich also auf dem Land“, schrieb er, „bei bester Gesundheit und ganz nah bei meiner Geliebten … [Ich, d. Verf.] schreibe Musik für Genua und führe ein wahrhaft glückliches Leben.“39 Am Ende erhielt er also doch noch den Lohn, von dem Stendhal schrieb – die Liebe einer vornehmen Frau und ein Landhaus. Hat Rossini in Merate überhaupt etwas komponiert? Er spricht von „Musik für Genua“, aber vielleicht erwähnte er das nur, um die Eltern zu beruhigen – jedenfalls weiß man nichts von dem, was in Merate entstanden sein könnte. Angestrengt gearbeitet hat Rossini erst wieder, als er im Juli nach Mailand zurückkehrte, das inzwischen wieder österreichisch war. Felice Romani, der neue Librettist der Scala, hatte ein pfiffiges Opernbuch aus dem 18. Jahrhundert entdeckt, Il Turco in Italia, das schon Mozarts Schüler Süßmayr vertont hatte – eine buffa, wie Rossini sich gewünscht hatte. Sie bietet neben dem illusionslosen Blick auf Männer und Frauen ein Spiel mit der Gattung, das Experimente des 20. Jahrhunderts vorwegnimmt. Der Dichter Prosdocimo gerät in eine einsame Gegend weit außerhalb von Neapel – dorthin, wo die Zigeuner hausen. Dort stößt er auf eine Geschichte, die auf die Bühne drängt. Da ist zunächst der Ehemann Geronimo, der zu den Zigeunern gegangen ist, um sich weissagen zu lassen, ob seine Fiorilla ihm auch treu bleiben werde. Und es kommt noch besser. Fiorilla, die ihrem Mann nachgegangen ist, kommt zum Strand, wenn das Schiff des türkischen Prinzen Selim anlegt, der seine große Liebe sucht, sich aber sofort in Fiorilla verliebt. Sie nimmt ihn mit nach Hause, das Spiel der Verführung geht weiter und beide beschließen, gemeinsam durchzubrennen. Als Selim sie nun mitnimmt, taucht plötzlich Zaida auf, die er eigentlich suchte – Gelegenheit für die habituelle Verwirrung am Ende des ersten Akts: Quando il vento improvviso sbuffando/Scuote i boschi, e gli spoglia di fronde/Quando il mare in tempesta mugghiando … Meno strepito fan di due femmine/Quando sono rivali in amor.40 Im zweiten Akt kommen die Dinge nach einigem Hin und Her schließlich doch wieder in Ordnung. Fiorilla schließt Frieden mit Geronimo, Zaida mit Selim, dessen Schiff nun die richtige Partnerin an Bord hat. Il Turco in Italia ist vielleicht Rossinis kälteste und brillanteste buffa. Seltsam, dass Rossini während des Liebesidylls von 1814 ausgerechnet die Oper komponierte, die einen so illusionslosen Blick auf die Geschlechter wirft. Das Mailänder Publikum von 1814 (die Premiere war am 14. August) mochte die Oper nicht – die Zuschauer meinten, eine Kopie der Italiana in Algeri zu sehen, und erst Maria Callas, die die Rolle der rücksichtslosen, ja grausamen Fiorilla liebte, hat dem Werk noch zu einem posthumen Erfolg verholfen.
Ende des Jahres fuhr Rossini wieder nach Venedig. Am 26. Dezember sollte zur Eröffnung der Karnevalssaison seine neue seria aufgeführt werden, der Sigismondo. Es wurde ein Fiasko. Azevedo berichtet: „Sigismondo produzierte allgemeine Langeweile und wurde mit einstimmigem Gähnen begrüßt. Rossini, der die Aufführung leitete, wurde von dieser Langeweile angesteckt … und einigen Freunden, die nahe beim Orchester saßen, sagte er: Pfeift lieber.“41 Das konnte seine Laune nicht trüben, denn er stand noch unter dem Eindruck von Amelias Besuch. Am 2. Dezember 1814 hatte er der Mutter geschrieben: „Die Belgiojoso ist für vier Tage nach Venedig gekommen, um ihren Kleinen zu sehen.“42 Das wirft Licht auf die Beziehung zwischen der Aristokratin und dem jugendlichen Komponisten, der sie nicht nur, aber auch wie eine Mutter liebte. Amelia hat offenbar die Kindlichkeit in ihm neu geweckt, und immer wird er fortan das beste Verhältnis zu den Frauen finden, wenn er sich darauf verlässt. Nach der Begegnung in Venedig gingen sie auseinander – sie nach Mailand, er würde zuerst nach Bologna gehen, dann vielleicht in den Süden, nach Neapel, das bei der anstehenden politischen Neuordnung wieder aufsteigen würde.
Die ersten Meisterwerke
1863 kritzelte Rossini an den Schluss seiner Petite Messe solennelle, er wisse nicht, ob er sich an ernste geistliche Musik habe wagen dürfen, denn eigentlich habe ihm Gott nur ein wenig Talent für die buffa verliehen. Und auch die Nachwelt schätzt besonders den Rossini der buffa. Merkwürdigerweise pflegte er die Gattung nicht während seines ganzen Lebens an der Oper, vielmehr nahm er schon früh Abschied – mit dem Barbier, der 1816 Premiere hatte, und der Cenerentola von 1817, und es bedurfte eines offiziellen Anlasses, der Krönung Karls X. von Frankreich, dass er 1824 mit Il viaggio a Reims noch einmal zur buffa zurückkehrte. Das Frühwerk als Gipfel also? Offenbar sah es Rossini selbst so. Immerhin sind auch der Barbier und die Cenerentola Nachzügler, die Rossini für Rom schrieb, als er das für ihn und für Italien so schwierige Jahr 1815 hinter sich gebracht und den Weg in den Süden gefunden hatte. Beide Werke sind Vollendung eines früheren – das legt einen Sprung über die Epochengrenze nahe.43
Das Rom von 1816 war so verschlafen wie der Kirchenstaat, dessen Hauptstadt es war. Stendhal schrieb in seinem italienischen Reisebuch von 1817 sogar, Rom lasse Gedanken an „Verfall, Erinnerung, Tod“44 aufkommen. Auch die Theater waren schlecht, wenn man ihm glauben will – ein großes Opernhaus wie die Scala besaß Rom jedenfalls nicht. Aber Rossini hatte Glück. Im Dezember 1815 lernte er den Eigentümer des Teatro Argentino kennen, den Herzog Sforza-Cesarini. Er plante, an Rossinis Erfolge mit der buffa anzuknüpfen und brachte am 13. Januar 1816 L’italiana in Algeri neu heraus. Die Aufführung wurde ein großer Erfolg. Sforza-Cesarini wollte auch einen Barbier – ein Barbier würde die frühen Buffo-Opern vielleicht noch übertreffen, denn Beaumarchais’ dramaturgische Formel des tollen Tags entsprach Rossinis Konzept womöglich noch genauer als das, was seine bisherigen Librettisten ihm geboten hatten. Es gab nur ein Hindernis. Giovanni Paisiello hatte den Stoff bereits 1786 vertont, und auch wenn seine Musik längst aus der Mode war, hatte er noch seine Anhänger. Deshalb ging man diplomatisch vor. Rossini hat später erzählt, er habe den greisen Paisiello in Neapel aufgesucht und ihn gebeten, den Stoff neu vertonen zu dürfen, und seine Zustimmung erhalten. Cesare Sterbini, der lediglich Beaumarchais’ Stück in Verse bringen musste, schrieb Rossini ein überraschend gutes Libretto. In aller Eile komponierte Rossini seine Partitur, von zwanzig Tagen hat er später gesprochen.
Aschenputtel.
Die Premiere am 20. Februar 1816 fiel der Schlamperei der römischen Theater zum Opfer. Das Unheil begann damit, dass der Sänger des Don Basilio über eine Falltür stolperte und die Verleumdungsarie mit blutender Nase singen musste. Das Publikum, das darin einen besonderen Gag der Regie sah, war begeistert. Und dann, „als Höhepunkt der Katastrophe“ (so erzählt Azevedo) „erschien eine Katze während des herrlichen Finales und lief zwischen den Sängern herum … Zamboni [= der Tenor, d. Verf.] jagte sie auf der einen Seite heraus, worauf sie auf der andern wieder erschien … [die Sänger, d. Verf.] wichen mit den lebhaftesten Bewegungen den großen Sprüngen des tollgewordenen Tiers aus … Die Zuhörerschaft rief ihm zu, ahmte das Miauen nach und ermutigte es mit Wort und Geste, seine Rolle weiterzuspielen.“45 Rossini, der am Cembalo die Rezitative begleitete, schimpfte lauthals auf das Publikum und feierte am nächsten Tag sicherheitshalber krank. Aber diesmal klappte alles, und die Oper wurde doch noch ein leidlicher Erfolg. Aber die ganze Bedeutung des Werkes erschloss sich erst dem Publikum der kommenden Jahrzehnte. Rossini selbst wusste schon, dass er eines seiner Hauptwerk komponierte, als er die Musik niederschrieb – un capo d’opera46 nennt er den Barbier in einem Brief an seine Mutter.
Er ist das Zentrum seines Frühwerks, in das manche Einfälle strömen, die er zunächst anderswo untergebracht hatte. Das Augenfälligste ist die Ouvertüre, die er zuerst dem Aureliano, später der 1815 in Neapel entstandenen Elisabetta vorangestellt hatte, die aber erst hier ihren richtigen Platz hat: als Lustspielouvertüre par excellence. Auch die Gewittermusik und die Cavatine der Rosina klingen schon in Früherem an. Aber nicht nur der Zustrom von Früherem macht den Barbier zum Zentrum und Hauptwerk. Er setzte nun auch seine Mittel bewusster ein als früher. Seine Musik, so schrieb er der Mutter, sei spuntanea (lebendig) und imitativa al excesso – was den Herausgebern des Briefwechsels zufolge sagen will, die Musik folge genau dem Text und der Handlung.47 In keiner anderen Oper ist Rossini so nah an den Sprachgesten wie im Barbier. Ein drastisches Beispiel: Wenn im ersten Finale der verliebte Almaviva (auf Figaros Rat hat er sich als Offizier verkleidet) in Dottor Bartolos Haus eindringt und von seinem fingierten Einquartierungsbescheid den Namen des Doktors absichtsvoll mehrfach falsch abliest, wiederholt der Hausherr zornig dreimal: Dottor Bartolo – Oktavsprünge abwärts, begleitet von Trompeten. So klingt Autorität. Aber Rossini hat nicht nur einzelne Sprachgesten verdeutlicht, er trifft auch genau den Tonfall seiner Figuren. Etwa den süßlicher Heuchelei, mit dem der Kirchenmann Don Basilio, Ratgeber des Doktors, den meschino caloniato bedauert, den seine Gerüchte zur Strecke gebracht haben. Die Beispiele ließen sich häufen. Die imitative Ästhetik erklärt auch die Veränderungen, die das zentrale Liebespaar der Komödie durchgemacht hat – die Melodie des Ständchens, das Almaviva Rosina im ersten Akt bringt, kann es an tenoraler Emphase mit Lindoros Languir per una bella aufnehmen, doch die folgende Cabaletta ist nicht nur männlich-triumphaler, ja frecher als alles, was Lindoro singt. Gewiss ist Almaviva nicht unsympathisch, aber doch ein gewöhnlicher Mann. Ähnlich Rosina. Im langsamen Teil ihrer Cavatine legt sie ein ähnlich emphatisches Liebesbekenntnis ab wie Almaviva, aber musikalischen Schwung gewinnt erst die Cabaletta, in der sie singt: Ma se mi tocca, dov’è il mio debole, sarò una vipera – wenn man meinen schwachen Punkt trifft, kann ich eine Viper sein. Das klingt bei aller Eleganz spitz und drohend: Ein Kampf der Geschlechter ist nicht ausgeschlossen – wie er ja auch in der Fortsetzung der Komödie ausbricht, die Beaumarchais geschrieben hat. So weit ist es in Rossinis Barbier aber noch nicht. Einen Kampf führt das Stück freilich doch vor: den der Jungen gegen die Alten – ein Kampf, der zu einem tollen Ende des Tages führt und Rossinis Final-Kunst ganz entfaltet. Almaviva, der sich auf Figaros Rat betrunken stellt, hämmert gegen die Tür von Bartolos Haus und fängt einen so gewaltigen Streit an, dass die Polizei kommen muss. Dann geschieht – nichts. Denn Almaviva, der verkleidete Graf, zeigt dem Polizeioffizier seinen Ausweis, und die Nacht auf der Wache bleibt ihm erspart. Umso größer die allgemeine Verwirrung. Sie beginnt mit Erstarrung, die Rossini als stockendes Andante komponiert hat: Das Finale endet wieder mit dem Gefühl des Realitätsverlustes, dem Rossini eine weitausgesponnene stretta gewidmet hat – er bestreitet sie mit einer Melodie, die alle Dreiklangstöne auf- und abwärts reiht, was ein Gefühl des Kreisenden, Wirbelnden erzeugt. Schließlich geht sie dann in vokales Plappern über. Alle spielen verrückt, und die beiden letzten Zeilen lauten denn auch: E il cervello, poverello/Gia stordito, sbalordtio/Non ragiona. Si confonde/Si riduce ad impazzar.48
Aber im Barbier gibt es nicht nur den élan vital, der sich im Konflikt der Geschlechter und der Generationen äußert, sondern auch élan vital, der solistisch um sich selbst kreist. Sein Exponent ist Figaro. Rossini hat seine Auftrittsarie mit Geträller beginnen lassen, zu dem er ein rhythmisch straffes Begleitmotiv im 6/8-Takt geschrieben hat. Der lebensfrohe Held ist alles andere als bescheiden. Largo al factotum della città – also Platz für das Faktotum der Stadt, lautet der erste Vers, den er singt, und das Selbstlob, mit dem er sich bedenkt (ah, bravo Figaro! Bravo, bravissimo), mündet wieder in selbstverliebtes Geträller. Der Erste, der Beste sein ist die Devise der neuen bürgerlichen Gesellschaft, deren Herold Figaro ist. In der weitausgesponnenen stretta kehrt das Einleitungsmotiv wieder – diesmal trällert Figaro nicht dazu, sondern stellt sich vor, wie man in der Stadt überall nach ihm ruft: Figaro sù, Figaro giù, Figaro qua, Figaro là. Figaro ist von sich selbst geradezu besoffen, die Steigerung ist rauschhaft. Und dieser egozentrische élan vital hat Affinität zum Geld, wie das folgende Duett mit Almaviva zeigt. Geld bedeutet Allmacht, sagen die beiden ersten Verse (all’idea di metallo/portentoso, omnipotente) – allerdings nicht ordnende, sondern eher verwirrende. Rossini hat das im Sinn der imitativen Ästhetik komponiert: Zu Beginn des zweiten, dritten und vierten Taktes verlangt er unmelodisch bizarre Sprünge von der Singstimme: vom e abwärts zum fis, vom d eine None zum c in der Oktave darunter und vom c abwärts zum d. Das Geld macht freilich erfinderisch. Figaro bringt in einer rasanten Melodie das Credo der Moderne auf eine komödiantische Formel: Che invenzione! Che invenzione! Gleichwohl darf der Zuschauer beruhigt sein. Die autoritäre Ordnung Bartolos und die hemmungslose Neuerungslust Figaros sind Extreme – dazwischen steht das Paar, Rosina und Almaviva. Die Welt bewegt sich, aber sie gerät nicht außer Rand und Band.
*
Rossini ließ es bei der realistischen Schilderung der neuen bürgerlichen Welt nicht bewenden. Er komponierte auch den Traum, der einer ganz anderen Logik folgt, La bontà in trionfo lautet der Untertitel der Cenerentola, die am 29. Januar 1817 in Rom aufgeführt wurde. So realistisch der Barbier ist, so traum- und märchenhaft ist die Cenerentola.
Im Dezember 1816 war Rossini wieder in Rom. Diesmal kam er bei Cartoni unter, dem Impresario des Teatro Valle, für den er die zweite Karnevalsoper komponieren sollte. Der Stoff stand noch nicht fest, und so lud Cartoni zwei Tage vor Weihnachten Rossini und den Librettisten Feretti zum Abendessen ein – man diskutierte bis in die Nacht, ohne eine Lösung zu finden. Feretti hat in seinen Memoiren anekdotisch farbig erzählt, wie es weiterging. Man sei zu Bett gegangen, auch er habe bei Cartoni übernachtet, und zwar im selben Zimmer wie Rossini. Halb schon im Schlaf habe er gemurmelt: „Aschenputtel.“ Rossini sei aus seinem Bett emporgefahren und habe gefragt: „Würden Sie den Mut haben, mir ein Aschenputtel zu schreiben?“49 Feretti sagte zu, aber er konnte sein Versprechen nur halten, indem er das Libretto einer Aschenputtel-Oper kopierte, die Felice Romani 1814 für Mailand geschrieben hatte. Rossini störte das nicht, denn er erhielt so einen vorzüglichen Text. Der dramaturgische Grundeinfall, den Feretti übernahm, ist die Ersetzung von Fee und Zauber durch den Prinzenerzieher Alidoro, der die unwahrscheinliche Heirat arrangiert. Ihm ist im Haus Don Magnificos (einem Geistesverwandten Dottor Bartolos) ein schönes und sanftes Mädchen aufgefallen und er erzählt Prinz Ramiro von ihr. Der sucht verkleidet als Diener das Haus Don Magnificos auf und ist sofort entzückt von Cenerentola, wie Feretti seine Heldin genannt hat50. Er gewinnt ihr Herz und sorgt dafür, dass sie zum nächsten Hofball eingeladen wird. Ihr Glück beginnt.
Die Güte, deren Triumph Rossinis Märchenoper inszeniert, ist Unfähigkeit zur Aggression. Cenerentola kann nicht zur Viper werden wie Rosina, und so nimmt sie hin, dass Don Magnifico sie unter dem Einfluss der bösen Stiefschwestern, seiner Töchter aus zweiter Ehe, wie ein Dienstmädchen behandelt. Ihren Traum hat sie sich freilich bewahrt. Zu Beginn des ersten Aktes singt sie ihr Lied vom Märchenprinzen, der von den Schönen nichts wissen will und innocenza e bontà wählt; es schließt traurig mit einem Lilili und lalala – ein Refrain, der in den Ohren der Stiefschwestern leiernd klingt und den sie spöttisch nachäffen. Das Publikum dürfte freilich anders reagieren auf die knapp dreißig schwermütig-süßen Takte, die Rossini in d-Moll und wiegendem 6/8-Takt geschrieben hat: Aber die Melancholie ist nur eine Seite ihres Charakters. Mitten im ersten Finale tritt sie überraschend in reicher und eleganter Kleidung auf (dafür hat Prinzenerzieher Alidoro gesorgt, damit sie auch beim Hofball bestehen kann). Elegant wie ihr Kleid ist ihr Solo Sprezzo quel don che versa fortuna capricciosa. Zunächst ein fast majestätischer Abstieg über die Töne des Es-Dur-Dreiklangs, dann eine weitgespannte Koloratur, die hinaufführt zum d eine Oktave höher, und schließlich, nach einem Sprung zurück aufs tiefe b, gleich zwei Oktaven höher zum b. Die Leichtigkeit, mit der sie die halsbrecherische Koloratur meistert, steht in scharfem Kontrast zu ihrem schlichten Auftrittslied. Man könnte die ganze Oper als allmähliche Entwicklung einer verborgenen Souveränität verstehen. Den Hofball, auf dem alle ihre Rollen spielen, hat Feretti ausgespart. Im zweiten Akt wird dann jeder wieder, was er eigentlich ist. Zu Beginn kehrt Cenerentola in das Haus Don Magnificos und in ihr altes Leben zurück – noch einmal erklingt ihr schwermütiges Lied. Dann zieht ein Gewitter herauf, vor Don Magnificos Haus bricht die Achse von Prinz Ramiros Wagen, und er und sein Gefolge suchen Zuflucht im Haus. Nun erst sieht Ramiro, dass das Dienstmädchen und die elegante Dame ein und dieselbe Person sind, und noch mehr Mühe hat Cenerentola, zu begreifen, dass der Diener, in den sie sich verliebt hat, in Wirklichkeit der Fürst ist. Dabei ist doch nur ihr Traum in Erfüllung gegangen. Ehe sie triumphiert, stellt sie in einem melodiösen Andante fest, dass geschehen ist, was eigentlich immer geschehen müsste: trionfi la bontà. In der Schlussszene reißt sie die vokale Linie an sich – ihre gewagten Koloraturen51 drücken ihre ganze Erleichterung aus, und sie findet kurz vor Ende, was man ihr nie zugetraut hätte: eine kecke Melodie.
Rossini schrieb der Mutter, mit der neuen Partitur werde er bestimmt den Geschmack der Stadt treffen – und tatsächlich ist sie so delikat wie keine andere, die Rossini komponiert hat; alles Lärmige oder Groteske bleibt ausgespart (sogar die berühmten Crescendi vertraut er in der Märchenoper gern den sordinierten Streichern an). Doch die Römer hatten kein Einsehen. Die Premiere am 29. Januar 1817 war ein Fiasko, und auch wenn die folgenden Aufführungen erfolgreicher waren, so gilt für die Cenerentola dasselbe wie für den Barbier: Auch sie brauchte Zeit, um ihr Publikum zu erreichen.
Das Teatro San Carlo.