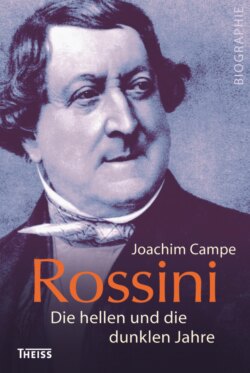Читать книгу Rossini - Joachim Campe - Страница 6
EINLEITUNG
ОглавлениеRossini war ein großer Anekdotenerzähler, wie viele Zeitgenossen berichten – er war gesellig, plauderte gern und wusste immer eine neue Geschichte zu erzählen. Nicht erst als er 1858 in Paris seinen musikalischen Salon eröffnete, schon der junge Rossini liebte die Anekdoten, und so sind von ihm mehr als von jedem anderen Komponisten überliefert. Viele sind verbürgt. So die Geschichte von dem Sechzehnjährigen, der mit dem venezianischen Marchese Cavalli aneinandergeriet. Cavalli hielt eine Sängerin in Senigallia aus, das südlich von Rossinis Geburtsstadt Pesaro liegt. Der halbwüchsige Komponist, der als maestro al cembalo die Oper dort begleitete, erdreistete sich, die Sängerin wegen ihrer falschen Töne herunterzuputzen. Cavalli zitierte den jungen Musiker zu sich und wurde ausfallend, aber Rossini ließ sich nichts bieten – Musik war immer noch Musik. Die Auseinandersetzung hatte ein seltsames Nachspiel. In Venedig leitete nämlich ausgerechnet Cavalli das Teatro San Moisè, an dem Rossini später seine erste Premiere hatte. Cavalli wird sich gut erinnert haben, aber er sagte nichts. Andere Geschichten sind so pikant, dass man den Verdacht hegen könnte, sie seien der gesalzenen Pointe zuliebe erdacht worden. So pflegte Rossini zu erzählen, einer seiner Onkel habe vorgeschlagen, ihn kastrieren zu lassen – die Familie hätte dann ein sicheres Einkommen gehabt, da er als Knabe wunderschön sang. Es gibt unter den Rossini-Anekdoten aber auch Geschichten, die nicht recht glaubhaft sind. Etwa dass er während eines Gesprächs mit dem Bankier Aguado über den spanischen Kapitalmarkt eine Komposition vollendet habe. Reiz haben aber alle Anekdoten, und der Komponist und Musikschriftsteller Ferdinand Hiller, der die Gespräche mit Rossini, die er 1855 in dem Seebad Trouville führte, zu seinen Plaudereien mit Rossini verarbeitete, gab ihm den Rat: „Sie müßten einmal jemandem ihre Biographie in die Feder diktieren, die Einzelheiten eines so reichen Lebens dürfen nicht verlorengehen.“1 Freilich hoffte Hiller darauf, dass es nicht bei Anekdoten bleiben werde, sondern dass Rossini einmal jemand finden werde, der ihn „aushorche“ wie eine „geheime Polizei“, also einen roten Faden finde in all den Geschichten.
Inzwischen weiß man sehr viel mehr. Zwischen 1927 und 1929 erschien der dreibändige Rossini von Arturo Radiciotti, und 1981, nicht ganz so monumental, aber genauso gehaltvoll, Herbert Weinstocks Biografie. 1992 kam der erste Band der kritischen Brief-Edition der Fondazione Rossini heraus – man kann nur bedauern, dass sie 1830, nach der ersten Lebenshälfte, abbricht. Doch trotz all dieses aufgespeicherten Wissens hat man den inneren Zusammenhang, den Hiller meinte, immer noch nicht gefunden, der Mensch Rossini ist nicht deutlicher geworden als damals.
*
Rossini, 1792 geboren, wuchs in einer Zeit der heroischen Großereignisse auf: der Napoleons. Sie war der Geschichtsphilosophie günstiger gesonnen als den Anekdoten, auf die Rossini so versessen war. Dabei war ihm das Neue nicht unsympathisch, denn es brachte frischen Wind nach Italien; der Vater war außerdem geschworener Anhänger Napoleons. Trotzdem haben die meisten Biografen die Zeit, die dem Werk das Thema stellt, nicht nachdrücklich genug behandelt: die französische Besetzung, die Norditalien veränderte. Eine neue Zeit brach an, und Rossini wurde ihr Komponist.
Rossini war gewiss kein bonapartistischer Ideologe, aber seine Opern verraten doch den neuen Geist. Das 19. Jahrhundert, dem die napoleonische Moderne näher war, scheint das halbwegs empfunden zu haben – es wusste zumindest, dass Rossini die Menschen begeisterte, weil er die Musik schrieb, die die Zeit wollte. Hiller schreibt in seinem Nachruf, Rossini habe „einen fast mythischen Rausch“2 über Europa gebracht. Diese Euphorie wurde gewiss von den Kunstwerken ausgelöst, aber das Publikum muss auch innerlich bereit gewesen sein. Das sagt viel über die Zeit. Rausch ist nicht gleich Rausch, jeder hat seine eigene Bedeutung – der, in den Rossinis Musik versetzt, glorifiziert die ungehemmte Lebenskraft, das bürgerliche Prinzip par excellence, das in krassem Widerspruch steht zu allen Herrschaftsideologien des Ancien Régime.
Dem Erschaffen des Rauschzustandes dienen viele kompositorische Mittel Rossinis, die nach ihm benannten Crescendi etwa, und ekstatisch gebraucht er gelegentlich auch die Kunst des bel canto. Wir verbinden den Zug zum Rauschhaften vor allem mit den Buffoopern. Zu Unrecht. Als Rossini 1826 in Paris seine erste Grand opéra Die Belagerung von Korinth auf die Bühne brachte, ging es auch um Rausch – man hört denn auch immer wieder Anklänge an die buffa von einst. Allerdings ist der Rausch, den er in der Belagerung von Korinth schildert, furchtbar, denn es ist der der Gewalt: des Tötens und Niederbrennens. Doch das Hochgefühl Figaros, der das Faktotum seiner Stadt sein will, also derjenige, der alles regelt und zur geheimen Nummer eins wird, und das von Mahomets Soldateska, die Korinth erobert und niederbrennt, sind nicht völlig verschieden – um den Beweis von Kraft geht es Figaro und den Osmanen. Rossini hatte ein illusionsloses Bild vom Menschen. Ob er zerstört oder aufbaut, ist ihm gleichgültig, die Hauptsache ist, er beweist seine Kraft.
*
Kraft ist freilich nur die eine Hälfte der menschlichen Realität. Dass Rossini auch das Leid sah, widerspricht dem Klischee vom kühlen Weltmann – aber er war nicht nur das, er verstand es auch, zu „predigen“3, wie Mendelssohn in einem Brief an seine Mutter schrieb. Seine Zeit, das 19. Jahrhundert, sprach gern von den Erniedrigten und Beleidigten, und auch Rossini tat das gelegentlich. Überraschend beredt verleiht er schon im Mosè von 1818 dem Gefühl der Unterdrückten Ausdruck – es sind allerdings Unterdrückte, wie auch die Bibel sie kennt: die Kinder Israels, die Pharao versklavt. Das mochte auch der König von Neapel durchgehen lassen, für dessen Opernhaus Rossini damals komponierte. Fast klingt es nach depressiver Verstimmung, was der Chor in der Eingangsszene singt. Jedenfalls schreit es nach Entbürdung und Erlösung, die Rossini noch hinreißender komponiert hat als den dumpfen Schmerz des Beginns: Wenn das Rote Meer zurückweicht und die Israeliten hindurchlässt, singt Mosè eine schlichte und eingängige preghiera. Alles Leid hat ein Ende, alle Wunden sind geheilt. Ähnlich – nur politischer – der Tell von 1829, dessen Schlussapotheose um das Wort liberté kreist. Der liberale Freiheits- ist eigentlich ein Erlösungstraum.
Doch es gibt auch unheilbares Leid, Rossini wusste das aus eigener Erfahrung. Er litt an Urethritis, die er sich bei seinen Bordellbesuchen zugezogen hatte, und – was schlimmer war – auch an Depression, die man damals noch nicht behandeln konnte; die Psychiatrie hatte noch nicht einmal einen Begriff dafür. Die Berichte der Zeitgenossen sind vage. 1831 scheint sich das Leiden freilich so zugespitzt zu haben, dass er sich von der Opernbühne zurückziehen musste; schließlich hätte er feste Termine nicht mehr einhalten können. Die Verarbeitung des unheilbaren Leidens erforderte andere gedankliche und musikalische Mittel als die von der Oper gewohnten – begreifen ließ es sich nur religiös und künstlerisch gestalten nur in geistlicher Musik, deren strikte Regeln Rossini in seiner Studienzeit in Bologna gelernt hatte. Vielgespielt bis heute das Stabat mater, das er 1841 vollendete, und die Petite Messe solennelle von 1864, die leider immer noch ein Stiefkind des Musikbetriebs ist. Darin bedient er sich auch traditionell konstruierender Techniken wie der Polyphonie, die dem „mythischen Rausch“ strikt zuwiderlaufen. Die höhere Ordnung, die Rossini in seinen geistlichen Werken beschwört, lässt keine menschliche Kraftbekundung zu, und sie kennt nur die Erlösung im ursprünglichen Sinn.
Rossinis Werk ergibt so wenig eine bruchlose Einheit wie seine Biografie. Er war ein weltlicher, ja höchst weltlicher Mensch, aber je älter er wurde, auch ein entschiedener Christ. Er war kein Frömmler, das ist bei einem Plauderer und Anekdotenerzähler auch gar nicht vorstellbar, aber es gibt doch einige (und gern übersehene) Briefe Rossinis zu religiösen Themen. Und es ist nicht nur eine Schrulle des Alternden, dass er viele Briefe mit einem Laus deo zu beenden pflegte, also: Gelobt sei Gott.
*
Eine weitgespannte Konzeption, die freilich ausklammert, was seit jeher im Zentrum der Oper gestanden hatte: die Liebe. Gewiss, da ist Lindoros schwärmerisches Languir per una bella aus der Italiana in Algeri, das bis heute alle Tenöre lockt, und im Mosè hören wir die erotische Zwiesprache zwischen Osiride und Elcia. Doch das alles bleibt Oberfläche. Die Liebe kann in Rossinis Opern die Alltagsrealität unterbrechen und für einen unvergesslichen Moment sorgen, aber die Tiefen, die Verdi im Don Carlos oder im Otello erreicht, gibt es nirgends. Es ist, als habe Rossini die Verstrickung ineinander nicht interessiert – die erlösende Macht der Liebe, an der sich die anderen Komponisten des 19. Jahrhunderts abarbeiteten. Rossini musste sich wegen seines offensichtlichen Desinteresses schon von den Zeitgenossen Kritik anhören. Sinnenzauber und mythischer Rausch reichten nicht allen. So befand etwa Giuseppina Strepponi, Verdis Lebensgefährtin, Rossini sei kalt und gefühllos4, und Nikolaus Harnoncourt hat diese Kritik 2007 im SPIEGEL wiederholt: Er bewundere den Könner Rossini, doch es sei schon erstaunlich, dass dieser Mann während seines langen Lebens keinen einzigen „Herzenston“ zustande gebracht habe. Und das Werk scheint zu beweisen, was Harnoncourt ihm vorhält: Rossini war kein Gefühlsmensch, obwohl er zweimal verheiratet war und den Schutz, den die Ehe bieten kann, sehr wohl erfuhr. Emphatischen Ausdruck haben aber selbst die Gefühle für seine zweite Frau Olympe, an der er sehr hing, nicht gefunden. Die Musique anodyne, sechs Lieder, die er ihr 1857 widmete, sind, wie der Titel sagt: belanglos.
Männer und Frauen hat Rossini scharf umrissen auf die Bühne gebracht, Rosina und Almaviva aus dem Barbiere di Siviglia sind wohl die bekanntesten Beispiele. Aber die Liebe war nicht Rossinis Thema. Seine Themen waren Krankheit und Gesundheit, die individuelle wie die kollektive.
*
Mit Veränderungen in der Kunst konnte Rossini nichts anfangen. Scheinbar jedenfalls. Er brachte 1868, kurz vor seinem Tod, in einem Brief an Filippo Filippi, den Redakteur einer Mailänder Musikzeitschrift, seinen Horror vor allem Modernen zum Ausdruck: Die Zukunftsmusik, um die sich Berlioz und Wagner mühten, sei nichts für ihn – ihm drehe sich der Magen um, wenn er von „Fortschritt, Dekadenz, Zukunft, Gegenwart, Konventionen“5 lese, schrieb er. Innerer Fortschritt sei Unsinn und Kunst etwas Überzeitliches. Musik sei Melodie und Rhythmus, im Fall der Oper komme noch die declamazione hinzu, die psychologisch stimmige und sinngenaue Artikulation der Texte – verboten sei nur, was langweile. Das sei alles, und damit Punktum.
Aber Veränderung gab es dennoch, nur musste der Anstoß von außen kommen. Er musste historisch sein. Der Bürger des napoleonischen Norditalien wollte eine andere buffa hören als Jahrzehnte zuvor der Untertan des Königs von Neapel; was man um 1780 spritzig fand, langweilte dreißig Jahre später – jedenfalls schien Rossini die Musik Paisiellos, der 1786 einen ersten Barbier komponiert hatte, antiquiert und banal.6 Gar so überzeitlich war auch die Sprache der Oper nicht. Rossini wusste das.
Freilich kam alle Veränderung von außen, und auch in Rossinis Leben griff dieses Äußere immer wieder ein. Man findet seine Spur in den Werken, hin und wieder auch in den Briefen und in zuweilen überraschenden Lebensentscheidungen. Es gibt Anhaltspunkte genug. Folgt man ihnen, ordnen sich die Widersprüche in Leben und Werk wie von selbst. Dem Ideal einer „geheimen Polizei“, wie Hiller formuliert, kommt man als Biograf gewiss nicht nahe, da sie auch Dokumente über das Innere braucht, die verborgenen Gefühle dessen, hinter dem sie her ist. Hillers Wunsch, Rossini möge irgendwann seinen Lebensdetektiv finden, hat sich bis heute nicht erfüllt, und da er ein mehr als diskreter Briefschreiber war, wird es wohl auch nie jemanden geben, der ihn von innen heraus verstünde. Man muss versuchen, ihn vom Äußeren her zu verstehen: der historischen Realität, in die der leidenschaftliche Zeitgenosse immer wieder verstrickt wurde. Immerhin gewinnt man durch den Weg über das Außen, die dauernd eingreifende Geschichte, Raum für den Versuch, Rossinis Leben neu zu erzählen.
Anna und Giuseppe Rossini.